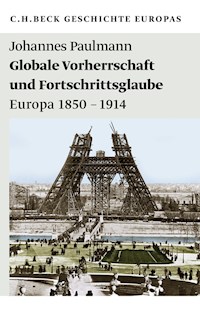
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner souveränen Synthese zeigt Johannes Paulmann, wie sehr sich die Lebenswelt der Europäer zwischen 1850 und 1914 wandelte. In dieser Epoche wurden materielle und geistige Grundlagen gelegt, die bis in unsere Gegenwart hinein aktuell sind. Gleichzeitig erlebte Europa den Höhepunkt seiner imperialen Machtentfaltung - nie wieder erreichte der Kontinent ein vergleichbares Maß an globaler Vorherrschaft wie in den Jahren vor 1914.
Selten veränderte sich so vieles so schnell wie in der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts. In seiner souveränen Synthese zeigt Johannes Paulmann wie sehr sich die Lebenswelt der Europäer zwischen 1850 und 1914 wandelte. In dieser Epoche wurden materielle und geistige Grundlagen gelegt, die bis in unsere Gegenwart hinein aktuell sind.
Die Zukunft schien offen und dynamisch. Die Nutzung fossiler Energieträger ermöglichte enorme Produktivitätsgewinne. Die industrielle Gesellschaft setzte sich in den europäischen Zentren durch. Menschen, Güter und Ideen waren europaweit und global mobil, die Kommunikation beschleunigte sich rapide. Gleichzeitig erlebte Europa den Höhepunkt seiner imperialen Machtentfaltung – nie wieder erreichte der Kontinent ein vergleichbares Maß an globaler Vorherrschaft wie in den Jahren vor 1914. Doch die umfassenden Veränderungen weckten auch Zweifel. Kritik am Materialismus und der Naturzerstörung, an Ungleichheit und Unterdrückung, an Kolonialismus und Gewalt gingen Hand in Hand mit dem Fortschritt und dem verbreiteten Glauben an ihn. Konkurrenz und nationale Abgrenzungsbemühungen prägten daher gleichzeitig mit vielfältigen grenzüberschreitenden Kooperationen die europäischen Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg. Teil der Reihe "C.H.BECK Geschichte Europas".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Johannes Paulmann
Globale Vorherrschaft und Fortschrittsglaube
Europa 1850–1914
C.H.BECK GESCHICHTE EUROPAS
Zum Buch
C.H.Beck Geschichte Europas – die zehnbändige Reihe vereint herausragende Vertreter der deutschen Geschichtswissenschaft, die auf dem neuesten Stand der Forschung eine zugängliche und zeitgemäße europäische Geschichte vorlegen. Ihr Blickwinkel ist europäisch, nicht nationalstaatlich. Sie konzentrieren sich auf zentrale Entwicklungen, die ein ganzes Zeitalter prägten, und vermitteln zugleich das wichtigste Wissen über den behandelten Zeitraum. So wird deutlich, was «Europa» in den unterschiedlichen Epochen seiner langen Geschichte ausmachte und was für Vorstellungen jeweils mit dem Begriff verbunden wurden.
Selten veränderte sich in Europa so vieles so schnell wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Nutzung fossiler Energieträger ermöglichte enorme Produktivitätsgewinne. Menschen, Güter und Ideen waren europaweit und global mobil, die Kommunikation beschleunigte sich rapide. Die Zukunft schien offen und dynamisch. Doch die umfassenden Veränderungen weckten auch Zweifel. Kritik am Materialismus und der Naturzerstörung, an Ungleichheit und Unterdrückung, an Kolonialismus und Gewalt gingen Hand in Hand mit dem Fortschritt und dem verbreiteten Glauben an ihn. Konkurrenz und nationale Abgrenzungsbemühungen prägten daher gleichzeitig mit vielfältigen grenzüberschreitenden Kooperationen die europäischen Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg.
Über den Autor
Johannes Paulmann ist Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz.
Inhalt
I. Grenzen und Entgrenzungen: Wie weit reicht Europa im 19. Jahrhundert?
Europäische Meerengen im 19. Jahrhundert
Globale Vorherrschaft und Fortschrittsglaube
II. Gesellschaft in Bewegung: Soziale und wirtschaftliche Transformation in Europa
1. Bevölkerungsbewegungen: Demographische Übergänge und Freizügigkeit
Große Zahlenordnungen
Geburten und Todesfälle
Szenarien des Niedergangs und progressive Interventionen
Europäische und globale Wanderungsbewegungen
Regulierte Freizügigkeit
Kolonial-imperiale Migrationen
Mobilität und Fortschrittsbewusstsein
2. Markt, Macht und Umwelt: Europäische Wirtschaftsbeziehungen
Ökonomisches Wachstum und ökologischer Wandel
Europäische Verkehrs- und Kommunikationsnetze
Welthandel im Zeichen Europas
Industriekapitalismus, Arbeit und Konsum
3. Veränderte Verhältnisse: Land und Stadt
Landbevölkerung
Ländliches Beharrungsvermögen und Anpassungsfähigkeit
Vergroßstädterung
Städtische Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung
Urbanisierung der Lebensweisen
4. Neuordnung der Gesellschaft: Stand, Klasse, Familie und Volk
Bürgerliche Gesellschaft
Arbeiterklasse und Unterschichten
Adel und Adeligkeit
Familienordnungen
Ethnizität und «Rasse»
III. Gewissheiten und Ungewissheiten: Europäische Kultur zwischen Heroentum, Institutionen und Massenmarkt
1. Heroen und Heroinnen: Kultur als öffentliches Ereignis
Intellektuelle Streitkultur
Schriftsteller auf sozial-moralischer Sinnsuche
Spektakuläre Kultur und nationale Mythenbildung
Ikone der kulturellen Grenzüberschreitung
2. Wissenschaftsglaube: Institutionen und geschichtlicher Wandel
Wissenschaftsinstitutionen und Ausbildungsstätten
Wandel als Gewissheit: Historismus und Evolutionstheorie
3. Religion im Konflikt: Säkularisierung und Religiosität
Säkularisierung und Verkirchlichung
Revitalisierte Religiosität, Weltreligionen und Mission
4. Ungewissheiten: Avantgarde und Massenkultur
Kritik und Zweifel in der bürgerlichen Kultur
Populäre Massenkultur im imperialen Zeitalter
IV. Partizipation und Herrschaft: Staatlichkeit im Wandel
1. Monarchischer Konstitutionalismus: Kämpfe um politische Partizipation
Konstitutionalismus in post-revolutionärer Zeit
Verfassungstransfer in der südosteuropäischen Nationalstaatsbildung
Herausforderungen der Massenpolitik
2. Ressourcen der Ordnung: Verwaltung, Finanzen und Staatsgewalt
Muster europäischer Staatsverwaltung
Staatseinnahmen und Steuerpolitik
Koloniale Verwaltungsherrschaft und Gewalt
3. Mobilisierung und Zugehörigkeit: Staatsbürgerschaft, Nation und Empire
Staatsbürgerschaft
Nationalismus und Empire
V. Frieden und Krieg:Europäisches Staatensystem, Internationalismus und imperiale Expansion
1. Auflösung der Ordnung und Suche nach Stabilität: Kriege und Allianzen 1850–1890
Systemischer Wandel vom Krimkrieg bis zu den Nationalstaatsgründungen
Die Erfindung der Realpolitik
Europäische Allianzen als Aushilfen
2. Ökonomie, Öffentlichkeit und Diplomatie: Mechanismen zwischenstaatlicher Politik
Ökonomie und Kommunikationsrevolution
Diplomatie in der Massenöffentlichkeit
Exklusivität des diplomatischen Dienstes
3. Reformer und Experten: Zeitalter des Internationalismus
Internationale Organisationen
Internationalismen
Grenzen der Verflechtungen
4. Expansion, Blockbildung und Krisenmanagement: Europäische Weltpolitik 1890–1914
Weltpolitisches Denken im Imperialismus
Aneignung der Welt
Fragile Blockbildung 1890 bis 1914
Krisenmanagement und Scheitern in Europa
VI. Rückblick
Literaturhinweise
Zeitleiste
Danksagung
Register
I. Grenzen und Entgrenzungen: Wie weit reicht Europa im 19. Jahrhundert?
/i/m 19. Jahrhundert herrschte unter Geographen weder Einigkeit darüber, ob Europa ein eigenständiger Kontinent sei, noch darüber, wo denn seine Grenzen verliefen. Europa ist «nichts als ein westlicher Vorsprung, ein Endland Asiens», schrieb etwa der Geograph Alfred Hettner 1907, auch wenn mancher «ein gehobenes Gefühl» habe, «wenn er von Gibraltar nach Afrika oder von Konstantinopel nach Asien» hinüberblicke. Andere Fachkollegen, wie Alfred Kirchhoff, sprachen Europa selbstbewusst die «volle Erdteilberechtigung» zu. Sie beriefen sich dabei auf einen engen Zusammenhang zwischen Land und Leuten, wonach feste Naturräume mit einem physischen Relief existierten, die gleichsam das Material für je besondere Kulturen ihrer Bewohner boten.
Die Frage der Selbständigkeit des Kontinents fand Widerhall in den Diskussionen, wo denn genau die Grenzen Europas verliefen. Eine Karte des Cambridge Modern History Atlas von 1912 ließ Europas Grenzen in mehrfacher Hinsicht unscharf erscheinen. Im Westen, Norden und Süden war Europa durch Meere zwar relativ klar umrissen. Der Osten und Südosten schienen hingegen weniger eindeutig. Südöstlich ragte das Osmanische Reich noch auf die Balkanhalbinsel. Das Zentrum seiner Herrschaft lag mit Konstantinopel geographisch in Europa. Die Masse seines Territoriums befand sich zu einem größeren Teil in Asien, während seine Ränder bis Tripolis an der nordafrikanischen Küste reichten. Ganz selbstverständlich war in der Einleitung zu dem Kartenwerk aber von der Türkei in Europa die Rede. Im Osten verhielt es sich mit Russland ähnlich. Die meisten Zeitgenossen begriffen das Zarenreich als eine europäische Macht, die mit Asien ein ausgedehntes Feld zur Kolonisation vor der Haustür liegen hatte. Einige Geographen wollten allerdings den Ural nicht als scharfe geographische Grenze sehen. Sie beschrieben Russland westlich wie östlich des Gebirgszugs als einen einheitlichen Raum, der sich durch Weiträumigkeit und Eintönigkeit auszeichne und so dem stark gegliederten Europa entgegengesetzt sei. Die physische Landschaft schlage sich im Charakter der Menschen und im politischen System nieder: Die passiven und despotischen halbasiatischen Menschen unterschieden sich von den aktiven, fortschrittlichen und freiheitlich denkenden Europäern. Auf russischer Seite sahen – positiv wertend – Naturwissenschaftler und Panslawisten wie Nikolaj Danilevskij ebenfalls im Ural keine eindeutige Grenze, sondern glaubten von den westlichen Grenzen Russlands bis über das Gebirge hinaus nach Sibirien eine eigene geographische Welt zu erkennen – eine Vorstellung, die später zur Idee eines dritten Kontinents «Eurasien» zwischen Europa und Asien weiterentwickelt wurde.
Der Atlas aus Cambridge ließ die räumliche Ausdehnung Europas auf eine weitere Art unbestimmt. Er kennzeichnete nicht nur Sibirien und Kleinasien als Gebiete, die zwar geographisch außerhalb Europas lagen, aber politisch zu ihm gehörten. Auch Zypern, Ägypten, Tunis und Algerien wurden in derselben Weise als Teile Großbritanniens oder Frankreichs markiert. Im Begleittext schrieben die Herausgeber sogar von einem «Greater Europe», das sich über den Globus erstrecke. Dabei hoben sie die institutionelle und sogenannte blutsmäßige Ausbreitung hervor. Nord- und teilweise auch Südamerika war ihnen ein «zweites Europa», zu dem sie Australien und Neuseeland hinzuzählten. «Groß-Europa» bezeichnete nicht eine politische Vorherrschaft, sondern eine Art Verpflanzung von Europäern, die sich wesentlich auch in der ökologischen Umwälzung der besiedelten Gebiete bemerkbar machte: Europäische Menschen, Tiere, Pflanzen wurden importiert und heimische – im Gegenzug – oft ausgerottet, während die «weißen» Siedler die Agrarwirtschaft nach europäischen Mustern ausbauten und nun verstärkt in Weltmärkte einbanden.
Das siedlungsgeographische «Groß-Europa» besaß eine Entsprechung in den Darstellungen der Wirtschaftsgeographie. Ein Handbook of Commercial Geography von George G. Chisholm aus dem Jahr 1889 erläuterte die sich herausbildende Arbeitsteilung zwischen dem industrialisierten Teil Europas und den Ländern, Kolonien und Siedlungsgebieten, die Rohstoffe und Nahrungsmittel lieferten und im Gegenzug Fertigprodukte abnahmen. Der Autor hing nicht dem zeitgenössischen Determinismus an, dem zufolge die natürlichen Umweltbedingungen die wirtschaftlichen Fähigkeiten bestimmten, mithin der Kolonialismus dadurch zu rechtfertigen sei, dass die einheimische Bevölkerung physisch und mental nicht in der Lage wäre, die vorhandenen Ressourcen voll auszuschöpfen. Er erkannte vielmehr in den verbesserten Transport- und Kommunikationsbedingungen des 19. Jahrhunderts eine wesentliche Voraussetzung. Die technischen Errungenschaften – Eisenbahn, Dampfschiffe und Telegrafen – ermöglichten es, naturräumliche Ordnungen umzugestalten, sie anders als bisher zu nutzen und physische Beschränkungen, wenngleich nur teilweise, zu überwinden.
Eine europäische Geschichte kann nicht alleine von der physischen Geographie ausgehen, wenn sie den Ort ihres Gegenstandes bestimmt, sondern sollte Europa als eine historisch gewordene, kulturell konstruierte Vorstellung begreifen. Die Geographen, die sich universitär gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablierten und disziplinär ausdifferenzierten, legten, wie die Beispiele zeigen, verschiedene Kriterien für eine Verortung Europas an. Fast alle waren sich aber einig, dass seine Geographie eine besondere sei, die erkläre, warum Europa zum «Herd der Zivilisation» geworden sei – wie es Vidal de la Blache 1891 formulierte –, und die seine herausragende Stellung in der Welt begründe. In jeder Hinsicht reichte Europa über den «Kontinent» hinaus, was immer genau darunter verstanden wurde.
Europäische Meerengen im 19. Jahrhundert
Emil Deckert, der in Frankfurt am Main lehrte, machte für die Besonderheiten Europas die «zahlreichen, tief in seine Rumpfmasse einschneidenden Rand- und Binnenmeere und Golfe» sowie die «Menge von Halbinseln und Küsteninseln» verantwortlich. Er zog 1883 die Schlussfolgerung, dass der Atlantische Ozean «in seinen Meerengen und Teilmeeren eine so prächtige Stufenleiter nautischer Schwierigkeiten [bietet], dass es nicht sehr zu verwundern ist, wenn an seiner ausgedehnten europäischen Küste das unternehmungslustigste und tüchtigste Seefahrergeschlecht der Erde erwuchs» und sich dort die «Kultur- und Handelsmacht des europäischen Weltteils» entfaltete. Nehmen wir einmal seine Perspektive ein, so fällt der Blick auf die Meerengen, die Europa umgeben. Sie bildeten in ökologischer, ökonomischer, politischer, sozialer und kultureller Hinsicht Kreuzungen und Schnittstellen, die Europäer untereinander und mit nichteuropäischen Gesellschaften verbanden, sie aber auch voneinander trennten. Je nach Umständen und Bereich resultierten daraus Kooperation, Konkurrenz oder Abwehr. Diese «marginalen» Orte zeigen, welche enormen Anstrengungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unternommen und welche komplexen Wissens- und Organisationssysteme entwickelt wurden, um wirtschaftliche Ressourcen zu erschließen, politische und militärische Macht auszuüben, Gesellschaften zu ordnen und sie zu verstehen. Wir wollen den Gegenstand des Buchs im Folgenden genauer bestimmen, indem wir uns ihm über die Meerengen gleichsam vom Rande her nähern. Damit kann nicht nur der wandelbare Zusammenhang von Geographie und Geschichte beschrieben werden, denn dort kristallisierten sich, wie wir sehen werden, zugleich zentrale historische Momente der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg heraus.
Kara-Straße: Beginnen wir mit der Kara-Straße im äußersten Nordosten Europas. Sie führt von der Barentssee in die Karasee, ein Randmeer des Polarmeers, an deren Südküste der Ural beginnt und die heute dafür bekannt ist, dass dort Nuklearreaktoren sowjetischer U-Boote verklappt wurden. Die Meerenge ist 56 Kilometer breit und trennt die Inselgruppe Nowaja Semlja von der Insel Waigatsch im Süden. Die Wasserstraße erlangte ab den 1850er Jahren für die Schiffsverbindung zwischen den europäischen Häfen und Sibirien zunehmend an Bedeutung. Es waren zunächst sibirische Kaufleute und Goldminenbesitzer, die nach Möglichkeiten suchten, den langen und teuren Transport über Land durch eine direkte Seeverbindung von den beiden in die Karasee mündenden sibirischen Flüssen Ob und Jenissej nach Westen abzukürzen. Die Transsibirische Eisenbahn wurde erst ab 1891 gebaut und war ab 1904 durchgängig, aber in weiten Teilen nur einspurig befahrbar. Mit der Bauernbefreiung, die im Rahmen der Reformanstrengungen nach der russischen Niederlage im Krimkrieg durchgeführt wurde, nahmen die Zahl der Siedler und die Getreideproduktion in Westsibirien zu. Auch diese Kolonisten hofften, ihre Erzeugnisse per Schiff auf den Markt zu bringen. Hinzu kamen norwegische Walfänger, die nach der Überfischung der Barentssee vor Spitzbergen nun in die Karasee vorstießen, um dort Robben, Walrosse und Wale zu jagen. Die mit Gold reich gewordenen sibirischen Kaufleute bemühten sich mit mäßigem Erfolg, die Kaiserlich-Russische Geographische Gesellschaft, die Royal Geographical Society und die norwegischen Kapitäne für die Kartierung der Polarroute und die Beobachtung der Wind- und Wetterbedingungen zu gewinnen. Schließlich trafen sie beim Verein für die deutsche Nordpolarfahrt (ab 1877 Geographische Gesellschaft in Bremen) auf Interesse. Die dort versammelten Kaufleute und Reeder waren auch aus kommerziellen Überlegungen bereit, die Polarforschung zu unterstützen. Ab 1877 finanzierten der Goldminenbesitzer Michail K. Sidorow und dann der Bremer Großkaufmann und Unternehmer Ludwig Baron Knoop eine Reihe von Fahrten des Kapitäns Eduard Dallmann durch die Kara-Straße zur Mündung des Jenissej. Die Eisverhältnisse auf der Karasee sowie die nicht gesicherte Schiffbarkeit der sibirischen Flüsse – erste Kanalbauprojekte wurden 1893 eingestellt – ließen allerdings bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg keine dauerhafte Handelsschifffahrt zwischen den europäischen Häfen und dem Innern Sibiriens zustande kommen.
Von Erfolg gekrönt war hingegen die Expedition des schwedisch-finnischen Geologen und Polarforschers Adolf Erick Nordenskiöld (1832–1901), dem es auf einer fast zweijährigen Reise gelang, erstmals die Nordostpassage vom Atlantik entlang der sibirischen Küste in den Pazifik zu befahren. Finanziert wurde er von dem Göteborger Magnaten Oscar Dickson und dem sibirischen Goldminenbesitzer Alexander Sibirjakow. Nordenskiöld brach im Juli 1878 von Göteborg aus auf, fuhr am 1. August zwischen dem russischen Festland und der Insel Waigatsch hindurch in die Karasee und umrundete am 20. August Kap Tscheljuskin, die nördlichste Landspitze Eurasiens. Sein Schiff, die in Bremerhaven für Eismeerfahrten als Walfänger gebaute Vega, fror allerdings im September kurz vor der Beringstraße ein und musste dort 294 Tage lang bis Juli 1879 überwintern. Die Weiterfahrt führte über Japan durch die Straße von Malakka bei Singapur, den Suezkanal und das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar und den Ärmelkanal schließlich durch den Öresund zurück in die Ostsee, wo die Vega im April 1880 in den Hafen des festlich beleuchteten Stockholm einlief. Nordenskiöld veröffentlichte 1882 einen ausführlichen Bericht über Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega in mehreren Sprachen und verbreitete seine geographischen und naturkundlichen Erkenntnisse sowohl in wissenschaftlichen als auch populären Publikationen. Seine Reise war Teil der aufstrebenden Polarforschung im späteren 19. Jahrhundert, ihre wissenschaftliche Auswertung setzte Maßstäbe und definierte dabei auch, was als europäisch galt: zum einen die Zivilisation in Abgrenzung zu den eisigen Naturlandschaften des Polarmeers und dem unterentwickelten Sibirien, zum anderen das heldenmütige Bewältigen widrigster Umstände und das Fakten sammelnde «Erobern» ganzer Meere und Kontinente. Die Erkundung des Eismeers war ein Unternehmen, das von wirtschaftlichen Interessen und von Wissenschaftlern verschiedener Länder betrieben wurde – die Besatzung der Vega beispielsweise setzte sich aus schwedischen, finnischen, dänischen und italienischen Offizieren und einer schwedisch-norwegischen Mannschaft zusammen. Die Kara-Straße bildete so in vieler Hinsicht eine europäische Meerenge am Übergang nach Asien. Ihre ökonomische Bedeutung blieb allerdings in der Zeit vor 1914 trotz der russischen Kolonisation Sibiriens aufgrund der eisigen Verhältnisse beschränkt. Erst in der Zwischenkriegszeit schafften sowjetische Eisbrecher die Nordostpassage in den Pazifik, ohne zu überwintern. Der nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtete Regelbetrieb verursachte hohe Kosten, die seit 1990 kaum noch aufgebracht werden können. Die klimatischen Veränderungen der globalen Erwärmung könnten die Route allerdings künftig wieder so attraktiv erscheinen lassen wie in den 1850er Jahren.
Öresund und Kaiser-Wilhelm-Kanal: Wirtschaftlich profitabel war über lange Zeit der Öresund, und zwar für den dänischen Staat. Die Wasserstraße bildet einen Teil der Verbindung zwischen Nord- und Ostsee. Die flache See zwischen Dänemark und Schweden ist mit Hunderten von kleineren und größeren Inseln durchsetzt. Drei Hauptwege ermöglichen die Durchfahrt: westlich der Kleine und der Große Belt – beide mit zahlreichen Untiefen und einer verschlungenen Fahrstraße recht unsicher – und östlich zwischen der dänischen Insel Seeland und der südschwedischen Provinz Schonen der Öresund, eine 67 Kilometer lange Meerenge. An ihrer schmalsten Stelle zwischen Helsingör und Helsingborg ist sie etwa vier Kilometer breit und wird von der dänischen Festung Kronborg beherrscht. Der Öresund, an dem die Städte Kopenhagen und Malmö liegen, ist im Winter in der Regel befahrbar, und durch ihn lief im 19. Jahrhundert der Export der skandinavischen Getreideproduktion. Die dänische Krone erhob seit 1429 eine Schiffs- und Warenabgabe, den sogenannten Sundzoll, von fremden Schiffen. Die Einnahmen ermöglichten dem König eine bestimmte Unabhängigkeit von ständischer Mitsprache und bildeten bis in das 19. Jahrhundert hinein eine bedeutende Einnahmequelle des Reiches. 1853 passierten knapp 25.000 zollpflichtige Schiffe die Zollstation bei Helsingör und erbrachten Einnahmen in Höhe von 2,5 Millionen dänischen Reichstalern. Handelsgüter der Ostseeanrainer (aus Russland etwa Leder, Segeltuch, Teer, Hanf, Seile für Takelage und Mastholz) und Einfuhren (Luxuswaren, Wein, Früchte, hochwertige Textilien und auch Kolonialwaren wie Gewürze, Kaffee, Rohrzucker, Tabak, Reis und Rohbaumwolle – die letztgenannten Produkte aus den USA) wurden durch die Meerenge transportiert.
Die Zollerhebung beruhte auf bilateralen Verträgen mit anderen Seemächten, die immer wieder zu diplomatischen und kriegerischen Spannungen Anlass gegeben hatten. Als die Vertragserneuerung mit den USA 1856 anstand, insistierte deren Regierung auf der Abschaffung der Zölle, weil sie den Handel behinderten und in ihren Augen eine unrechtmäßige Einschränkung der Freiheit der Meere bedeuteten. Die amerikanischen Diplomaten drohten mit Maßnahmen gegen die Westindischen Inseln Dänemarks. Dänemark zog es vor, seinen Kolonialbesitz auf den Kleinen Antillen noch bis 1917, als die USA die Virgin Islands schließlich kauften, zu behalten, und gab daher 1857 in der Konvention von Kopenhagen lieber dem internationalen Druck auf Abschaffung des Sundzolls nach. Gegen eine einmalige Entschädigung von 30,5 Millionen dänischen Reichstalern verzichtete Dänemark damit nach mehr als 400 Jahren auf die Zollerhebung. Seine Wasserstraßen, die Nord- und Ostsee miteinander verbinden, wurden zu internationalen Gewässern. Die Ablösesumme brachten diejenigen Staaten auf, deren Reeder und Händler an der freien Durchfahrt am meisten interessiert waren: Jeweils ein Drittel zahlten Großbritannien und Russland, auch die Vereinigten Staaten als Initiator der Reform beteiligten sich mit einer beträchtlichen Summe. Die Abschaffung des Sundzolls zeigt zum einen, dass Dänemark in der Mitte des 19. Jahrhunderts seine frühere nordeuropäische Großmachtstellung eingebüßt hatte und ein Kleinstaat geworden war. Schon 1814 hatte die dänische Krone Norwegen an Schweden abtreten müssen, 1864 bis 1866 sollte es dann die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen verlieren. Zum anderen ist die Abschaffung des Zolls ein Beispiel für die internationale Liberalisierung des Handels im 19. Jahrhundert und verdeutlicht neben den europäischen die weltweiten, auch kolonialen Verflechtungen, die sich am Öresund manifestierten.
Die Meerenge zwischen Ost- und Nordsee hatte im Übrigen nicht trennend gewirkt, sondern verbindend. Als 1892 die erste Eisenbahnfähre über den Öresund in Betrieb genommen wurde und damit zwei der Motoren des Fortschritts im 19. Jahrhundert, Dampfschiff und Lokomotive, einander nahtlos ergänzten, verstärkte dies eigentlich nur die geographische Brückenfunktion der Inseln und Wasserstraßen zwischen Dänemark und Schweden. Einschneidender wirkte hingegen der Kaiser-Wilhelm-Kanal, heute Nord-Ostsee-Kanal, der zwischen 1887 und 1895 vom Deutschen Reich gebaut wurde. Er ersetzte den 1784 in Betrieb genommenen Schleswig-Holsteinischen Canal, den der dänische König hatte graben lassen. Dieser mündete bei Rendsburg in die Eider und damit letztendlich an der Westküste ins Wattenmeer und nahm eine Durchfahrtzeit von drei bis vier Tagen in Anspruch. Im Wesentlichen aus marinestrategischen Gesichtspunkten wurden von Bismarck dann seit den 1860er Jahren, auch gegen militärischen Widerstand und mit Unterstützung eines Hamburger Reeders, die Planungen für einen von Kiel-Holtenau nach Brunsbüttel in die Elbe verlaufenden Kanal vorangetrieben. Während der achtjährigen Bauzeit von 1887 bis 1895 wurden fast 9000 Arbeiter beschäftigt, viele aus Dänemark, Polen, Russland, Österreich und Italien. Der neue Kaiser-Wilhelm-Kanal besaß eine Länge von knapp hundert Kilometern; er war für den Nachtbetrieb elektrisch beleuchtet, und eine Durchfahrt dauerte 13 Stunden. Die Tiefe von ursprünglich neun Metern und die Breite von 67 Metern mussten bereits ab 1907 auf elf bzw. 102 Meter erweitert werden. Auslöser hierfür waren die neuen Großkampfschiffe der Dreadnought-Klasse, die für die kaiserliche Flotte angeschafft wurden.
Anders als bei der natürlichen Meerenge des Öresunds ging es bei der künstlichen Wasserstraße nicht um die internationale Freiheit der Seefahrt. Im Gegenteil: Nationalstaatliche Flottenkonkurrenz mit Großbritannien und Weltpolitik bildeten die Raison d’être für den ingenieurstechnischen Einschnitt in die Geographie. Letztlich erwies sich der Kanal allerdings strategisch als wenig nützlich: Die Idee, Kriegsschiffe jederzeit von der Ost- in die Nordsee verschieben zu können, mündete während des Ersten Weltkriegs nach der Skagerrak-Schlacht 1916 in die fortgesetzte Blockade der deutschen Hochseeflotte in Kiel und anderen Häfen. Immerhin fuhren im Jahr 1904/05 gut 23.000 Handelsschiffe durch den Kanal, doch sicherten die Gebühren Bau- und Betriebskosten nur unzureichend. Teile der seit 1902 erhobenen Schaumweinsteuer, die zweckgebunden für den Flottenbau eingeführt worden war, subventionierten den Kaiser-Wilhelm-Kanal. 1919 internationalisierten die Alliierten dann die Wasserstraße im Versailler Vertrag. Der Kanal ist heute die meistbefahrene künstliche Wasserstraße, noch vor dem Suezkanal von 1869 und dem Panamakanal von 1914.
Ärmelkanal: Während die organisatorischen, technischen und finanziellen Mittel des Deutschen Reichs die geographischen Bedingungen zwischen Ost- und Nordsee einschneidend veränderten, blieb der Ärmelkanal, die nordwestliche Meerenge Europas, weitgehend unverändert. Der Ärmelkanal ist circa 350 Kilometer lang, seine Breite beträgt an der westlichen Einfahrt zwischen dem bretonischen Ouessant und den britischen Scilly-Inseln 160 Kilometer und östlich zwischen Dover und Cap Gris-Nez, der sogenannten Straße von Dover bzw. dem Pas de Calais, nur 34 Kilometer. Er war damals und ist bis heute einer der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Welt. Er verbindet die Nordsee und damit auch den Zugang zur Ostsee am Öresund mit dem Atlantik und leitet den Verkehr von Nordwesteuropa über die Straße von Gibraltar zum Mittelmeer und ab 1869 von dort weiter durch den Suezkanal bis nach Indien. Seine Küstengeographie bewirkt im östlichen Teil unregelmäßige Gezeiten und an manchen Orten eine doppelte Flut. Die Klimaverhältnisse führen ganzjährig zu häufiger Nebelbildung und trübem Wetter. Die Seine auf der französischen Seite ist der größte Fluss, der den Kanal mit Süßwasser speist. An der Küste des Ärmelkanals liegen unter anderem die Städte Le Havre (der bedeutendste europäische Kaffeeimporthafen am Vorabend des Ersten Weltkrieges), Portsmouth (der Kriegshafen der Royal Navy) und Southampton, von wo 1912 die Titanic zu ihrer einzigen Fahrt in Richtung New York ablegte. Die international übliche englische Bezeichnung «English Channel» drückt aus, wer die Wasserstraße beherrschte. In Portsmouth, 1859 mit einem aufwendigen Ring von Festungen gegen mögliche französische Angriffe geschützt, lief 1906 das Schlachtschiff Dreadnought der britischen Marine, das seiner Klasse den Namen gab, vom Stapel.
Der Ärmelkanal war mithin eine ganz zentrale Seebrücke, die verschiedene Teile Europas und der Welt miteinander verband, Aus- und Einfuhrhäfen für den globalen Warenverkehr besaß und zugleich die Marinebasis eines Weltreichs sowie dessen stark geschützte nationale Sicherheitszone bildete. Es gab im 19. Jahrhundert verschiedene Pläne, die verbindende Funktion zwischen den Britischen Inseln und dem Kontinent zu verstärken. Ab den 1850er Jahren häuften sich die Vorschläge, die Meerenge zu überbrücken, zu untertunneln oder mit einer Eisenbahnfähre auszustatten. Interessenten gab es auf beiden Seiten des Kanals, die französische Seite befürwortete die Vorhaben kontinuierlich, die britische Regierung und das Parlament blockierten die Umsetzung aber immer wieder in entscheidenden Momenten. In den Jahren 1875 und 1876 tagte bereits eine gemeinsame Kommission, die einen zwischenstaatlichen Vertrag zur Regelung von Zugangs- und Zugriffsrechten sowie die internationale Grenzziehung in einem Tunnel unter dem Kanal vorbereitete. Bau- und Betreibergesellschaften wurden gegründet, die 1881/82 Probebohrungen an den Shakespeare-Klippen bei Dover und in Sangatte unweit von Calais ausführten. Sie drangen auf beiden Seiten jeweils eine gute Meile vor. Der gesetzlichen Genehmigung für den eigentlichen Bau sollte dann eine große Anhörung beider Häuser des Parlaments in London vorausgehen: Ingenieure, Handels- und Industrievertreter, Eisenbahnunternehmer, Marineoffiziere und die Armeeführung wurden 1883 über zwei Monate befragt. Der Parlamentsausschuss konnte sich anschließend nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen. Die Befürworter des Tunnelprojekts bildeten knapp die Minderheit, die Zahl der Gegner überwog gerade eben.
Das Hauptargument gegen eine Tunnelverbindung kam aus dem Kriegsministerium. In schon damaligen Zeitgenossen irreal anmutenden Szenarien befürchtete die Armeeführung, dass die unterirdische Röhre einer fremden Macht, gemeint war bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg immer Frankreich, dazu dienen könnte, die Britischen Inseln mit Truppen zu besetzen. Die Insellage wurde gegen alle Argumente, welche die faktische enge Anbindung Großbritanniens an den Kontinent betonten, als die eigentliche Stärke des Landes stilisiert. Damit war der Fortgang des Projekts zwar aufgehalten, doch brach die Diskussion um einen Tunnelbau unter dem Ärmelkanal bis zum Weltkrieg trotz des Rückschlags nicht ab. Die Befürworter brachten wiederholt Gesetzesvorlagen ein. 1913/14 befasste sich der Ausschuss für Imperiale Verteidigung der britischen Regierung erneut mit der Frage. Die seit der Entente cordiale von 1904 verbesserten Beziehungen zu Frankreich sowie die Möglichkeit, in einem europäischen Krieg ein Expeditionskorps auf den Kontinent schicken zu können und die Versorgung der Inseln mit Nahrung und Material zu sichern, ließen nun auch manche Militärs Vorteile in einem Tunnel erkennen. Doch die Meinungen in der britischen Regierung blieben gespalten, und letztlich überwog der Gedanke, dass die Insellage ein wesentlicher Faktor für die Errichtung und den Erhalt des Empires gewesen sei sowie einen Teil des nationalen Charakters ausmache. Ein Tunnel käme einer Landgrenze gleich, hieß es, und würde daher zu seinem Schutz die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht erfordern – das wiederum war ein innenpolitisches Tabu, an das die britische Regierung 1914 noch nicht rühren wollte.
Großbritannien wollte den Ärmelkanal mehrheitlich als trennendes Wasser bewahrt wissen, obgleich die Insel in verschiedener Hinsicht im 19. Jahrhundert immer enger mit dem Kontinent verbunden worden war. So versprachen sich französische Befürworter 1913 eine weitere Verbesserung der Handelsbeziehungen mit Großbritannien, weil empfindliche und verderbliche Produkte aus Frankreich (Milchprodukte, Früchte und Luxusgüter) schneller und ohne Umladen transportiert werden könnten und weil Firmenvertreter leichter reisen und so mehr Geschäftsbeziehungen knüpfen würden. Vor allem aber setzten die Fürsprecher auf den Tourismus. Hinter der öffentlichen Kampagne für den Tunnelbau am Vorabend des Weltkriegs standen im Wesentlichen die gleichen Interessen wie schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts: Eisenbahngesellschaften und ihre Finanziers, Freihändler und bestimmte Exportbranchen. Sie konnten sich gegenüber den Gegnern, die auf der englischen Seite des Kanals zentrale Regierungspositionen und damit die Blockademacht innehatten, jedoch nicht durchsetzen. Dennoch: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts intensivierte die von französischen und britischen Unternehmen gemeinsam betriebene, regelmäßige Dampfschifffahrt den Verkehr über den Kanal wesentlich. Und 1909 überflog der französische Flugingenieur Louis Blériot (1872–1936) in 37 Minuten erstmals den Kanal von Calais nach Dover: Die Wasserstraße schien jetzt weniger breit geworden zu sein, auch wenn aus der verminderten militärischen Schutzfunktion des Ärmelkanals gegenüber Flugzeugen erst nach dem Ersten Weltkrieg Konsequenzen gezogen wurden und ein Tunnel überhaupt erst 1994 eröffnet werden sollte.
Die Geschichte der Tunnelprojekte sollte allerdings nicht nur als eine Geschichte des Scheiterns betrachtet werden, belegt sie doch die zentrale Rolle der nordwestlichen Meerenge. Neben der machtpolitischen Funktion und den vielfältigen Verbindungslinien, die aus Europa und der weiteren Welt hier zusammenliefen, offenbarten die Projekte auch den selbstbewussten Willen der zeitgenössischen Ingenieure, die physische Geographie umzugestalten. Die Techniker erreichten andernorts durchaus ihr Ziel: Seit 1906 war zum Beispiel der fast 20 Kilometer lange Simplon-Tunnel durch die Schweizer und italienischen Alpen für Züge befahrbar. An der Finanzierung dieses Bergtunnels war unter anderem Emile Baron d’Erlanger (1832–1911) beteiligt, ein in Frankfurt am Main geborener bedeutender Pariser Bankier, der 1901 Vorstandsvorsitzender der Channel Tunnel Company wurde und die gleiche Funktion bei der am Kanaltunnel interessierten Chemin de Fer du Nord ausübte. Das Bankhaus d’Erlanger investierte Gelder nicht nur in europäische Eisenbahnen, sondern auch in Schienenverkehr im kolonialen Afrika, in Nord- und Südamerika sowie (gemeinsam mit Julius Reuter) in transatlantische Telefonkabel. Das nicht ausgeführte Projekt am Ärmelkanal war also nur eines von vielen landschaftsumgestaltenden Großvorhaben im 19. Jahrhundert. Diejenigen Projekte, die tatsächlich verwirklicht wurden, sind eindrucksvolle Belege für die Kapazität und den Willen, die physische Natur durch Technik zu überwinden. Sie veränderten die Geographie und trieben die infrastrukturelle Verflechtung Europas, auch mit anderen Weltregionen, entscheidend voran.
Gibraltar: Die Straße von Gibraltar ist ebenfalls ein strategischer Ort für Europa. Sie verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik und Europa mit Nordafrika. Dabei konnte sie sowohl als vermittelnde Brücke wie als trennender Graben wirken. Der westliche Eingang der Meerenge ist 44 Kilometer breit und liegt zwischen Kap Trafalgar südöstlich von Cádiz und Kap Spartel, der Nordwestspitze Afrikas bei Tanger. Im Osten der Meerenge beträgt die Entfernung zwischen der Südspitze von Gibraltar, der Punta de Europa, und dem Felsen von Ceuta auf afrikanischer Seite ungefähr 20 Kilometer. Die Meeresströmung sorgt für schwierige Schifffahrtsverhältnisse, weil eine sehr starke Oberflächenströmung vom Atlantik ins Mittelmeer fließt. Starke Winde machen die Fahrt nicht leichter, doch gibt es im südlichen, durch das Rif-Gebirge geformten Teil des Mittelmeers auch anhaltende Windstillen, so dass Segelschiffe früher häufig länger unbeweglich auf See liegen mussten. Mit der Bucht von Algeciras und Gibraltar existiert im nördlichen Teil der eigentlichen Meerenge einer der sichersten Häfen der Welt.
Gibraltar ist seit 1704 in britischer Hand. Auf dem Felsen, der durch eine sandige Landzunge mit der Iberischen Halbinsel verbunden ist, befinden sich eine britische Festung und Stadt. Sie bildeten im 19. Jahrhundert keineswegs, wie später seit dem spanischen Diktator Franco und dem Zweiten Weltkrieg, eine Art Enklave, denn die Festungskolonie war damals nur teilweise geschlossen und besaß durchlässige Grenzen. Trennlinien wurden hingegen vor allem intern gezogen. Aus der Perspektive der britischen Regierung in London war die Hauptfunktion Gibraltars eine militärische: sicherer Hafen und Werft für die Königliche Marine, dominierende Festung an einer bedeutenden, durch den Suezkanal ab 1869 noch wichtiger gewordenen Wasserstraße und zentraler Punkt für die Dampfschiffe im weltweiten Netz von Kohlestationen. Die ursprüngliche Festung nahm jedoch im Laufe der Zeit immer mehr den Charakter einer Kolonialsiedlung an. Die Garnison beherbergte zwischen 3000 und 5000 Soldaten. Die Zivilbevölkerung lag um 1800 bei etwa 5000, umfasste 1831 gut 17.000 Menschen, 1871 waren es schon über 18.500 und 1901 mehr als 20.000. Nur ein Teil davon waren britische Untertanen, der andere Teil wurde als «Aliens» bezeichnet. Schon die Herkunft der «Briten» war allerdings sehr unterschiedlich. Sie kamen nur zu einem kleinen Teil von den Britischen Inseln, die Mehrheit stammte ursprünglich aus Spanien, Portugal, Genua, Malta und Nordafrika und war der religiösen Zugehörigkeit nach überwiegend katholisch und zu einem kleinen Teil jüdisch. 1816 wurde, wer seit mindestens zehn Jahren in Gibraltar lebte, zum Einheimischen und damit zum britischen Untertan erklärt. Dieser Personenkreis besaß ein dauerhaftes Residenzrecht. Die zahlreichen «Fremden» (1831 waren es knapp 7000) hingegen durften sich nur mit einer amtlichen Erlaubnis («permit») auf dem Felsen aufhalten. Die Aufenthaltsbewilligung wurde ein- und mehrtagesweise oder länger vergeben. Zahlreiche Kaufleute nutzten den Freihafen für ihre Geschäfte, Arbeitskräfte erbrachten verschiedenste Dienstleistungen, denn Festung und Stadt waren auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser angewiesen, so dass außer denjenigen, die sich hier niederließen, ohne je britische Untertanen zu werden, täglich viele Spanier und andere «Fremde» durch die Tore ein- und ausgingen.
Das System, nach dem eine Aufenthaltserlaubnis gewährt wurde, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrfach reformiert. Die Behörden mussten dabei eine Balance finden zwischen notwendiger Offenheit und erwünschter Kontrolle, ohne dass sie die militärische Sicherheit oder die Handelswirtschaft schädigten. Vordringliches Ziel war nicht, die Bevölkerung in der Festungsstadt zu überwachen, sondern ihr Wachstum einzuschränken. Anlass gaben verschiedene Seuchen, deren Ursache zeitgenössisch in der Übervölkerung gesehen wurde und als deren Träger häufig die «Fremden» galten. Gelbfieber tötete 1804, 1813/14 und 1828 mehrere tausend Menschen, 1860 und 1864 brach die Cholera aus. Neben der Einführung von Hygienemaßnahmen suchten Gouverneur und Polizei das Bevölkerungswachstum zu unterbinden, indem sie zum einen die Vergabe von Aufenthaltserlaubnissen beschränkten und diese verkürzten. Zum anderen erschwerten sie über Gesetze und Verordnungen den Erwerb der Staatsangehörigkeit. Wer in Gibraltar geboren wurde, erhielt aufgrund des ius soli die britische Staatsangehörigkeit. Ab 1822 konnte nun für nichtbritische Männer die Heiratserlaubnis an die Bedingung geknüpft werden, dass sie binnen drei Monaten Gibraltar verließen – in der Annahme, dass sie ihre Frauen mitnähmen und Kinder daher andernorts geboren würden und somit keine britische Staatsangehörigkeit erhielten. In den 1830er Jahren wurde die Regelung eingeführt, dass nichtbritische Frauen und britische Frauen, die mit fremden Männern verheiratet waren, bei Schwangerschaft das Territorium für die Niederkunft verlassen mussten. Das britische Einbürgerungsgesetz von 1844, dem zufolge Frauen mit der Heirat die eigene Staatsbürgerschaft verloren und diejenige ihres Mannes annehmen mussten (diese einseitige Bestimmung blieb bis 1948 gültig), galt in Gibraltar und anderen Kolonien nur bis 1847, weil man dort den Erwerb der britischen Staatsangehörigkeit durch «fremde» Frauen, die Briten ehelichten, verhindern wollte. Gedacht wurde hier vornehmlich an Prostituierte, die durchreisende Briten zur Heirat «verführten». Ab 1889 besaßen nur noch Personen, die in Gibraltar geboren worden waren, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, selbst andere britische Staatsangehörige wurden seither nur temporär geduldet. So entstand durch verschiedene gesetzliche Bestimmungen und amtliche Praktiken zwischen 1816 und 1889 die besondere Identität der «Gibraltarianer».
Die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik in der Kronkolonie ist ein Beispiel, wie in Europa durch interne Grenzziehung auf der Grundlage von ethnischen, sozialen und genderspezifischen In- und Exklusionen ein Identitätsbewusstsein geschaffen wurde. Ökonomische und sicherheitspolitische Interessen mischten sich mit moralischen Urteilen, insbesondere «fremde» Frauen wurden leichthin als Prostituierte eingeordnet. Die notwendige Mitwirkung der Bevölkerung an Gesundheits- und Hygienemaßnahmen führte langfristig allerdings auch zur politischen Partizipation männlicher Honoratioren an der Regierung der Kronkolonie. Zunächst wurde 1865 eine Sanitary Commission vom Gouverneur ernannt, die dann 1921 in einen teilweise gewählten Stadtrat überging. Kaufleute hatten bereits kurz nach 1800 ein «Exchange Committee» gegründet und 1817 eine Bibliothek ins Leben gerufen, später folgte eine Handelskammer. Vertreter der katholischen Kirche und der jüdischen Gemeinde, Pfadfinder und – in den 1920er Jahren – Gewerkschaften organisierten sich. In diesen Formen entwickelte die besser gestellte Zivilgesellschaft Gibraltars im Laufe der Jahrzehnte vor dem Weltkrieg eine besondere Loyalität gegenüber der britischen Krone. Bei gelegentlichen Besuchen von Angehörigen des Königshauses und bei den Jubiläen Königin Victorias 1887 und 1897 demonstrierten ihre Vertreter dies öffentlich. Sie untermauerten damit ihren Anspruch auf Teilhabe zusammen mit dem Gouverneur oder über ihn hinweg. Bis 1937 waren bei festlichen Angelegenheiten im Übrigen immer auch amtliche Vertreter aus Spanien anwesend. Die Grenzziehungen erfolgten im 19. Jahrhundert stärker innergesellschaftlich als zwischen den Nationalstaaten. Gibraltar lag zwar geographisch am Rande Europas, kann in vielerlei Hinsicht aber als exemplarisch gelten für europäische Probleme und Lösungsmöglichkeiten von Sanitäts- und Bevölkerungspolitik, Staatsbürgerrecht und Fremdenpolitik, für soziale, ethnische und genderspezifische Grenzziehungen, vermehrte, aber nicht umfassende, sondern immer wieder unterlaufene Staatskontrolle und für Identitätskonstruktionen und politische Partizipation. Die Festungsstadt auf dem Felsen an der Meerenge zwischen Mittelmeer und Atlantik war mehr als ein militärstrategischer Punkt Europas.
Werfen wir einen Blick auf die gegenüberliegende Seite. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in dem Golf, der an der afrikanischen Nordküste des Mittelmeers vom Rif-Gebirge gebildet wurde, mehrere spanische Stützpunkte von Ceuta im Westen bis Melilla im Osten. Sie waren im Laufe der Reconquista erobert und zuletzt 1848 durch die Einnahme der Islas Chafarinas ergänzt worden. In der Folge der europäischen Besatzung hatte sich der marokkanische Handel von der Mittelmeerküste an den Atlantik verlagert. Der Sultan übte keine wirksame Kontrolle mehr über die Rif-Küste aus, die zu einer ärmlichen Randzone am Mittelmeer geworden war. Die lokalen Bedingungen erlaubten nur karge Landwirtschaft, Fischerei – und Piraterie. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die Seemächte die muslimische und christliche Piraterie mit großen Schiffen im Mittelmeer zwar erfolgreich unterdrückt, doch bekamen sie die von kleinen Gruppen der Rif-Bevölkerung betriebene Seeräuberei nie vollständig in den Griff. Die einheimischen Piraten benutzten Boote, um die durch die Windstille im Golf festgehaltenen Schiffe zu kapern und auszurauben. Die Küstennatur mit zahlreichen kleinen Buchten und Felsunterschlüpfen sowie die Siedlungsformen ohne Städte und erkennbare Dörfer, die von der europäischen Marine hätten beschossen werden können, verhinderten eine wirksame Bekämpfung der beteiligten Gruppen.
Die wirtschaftlichen Lebensbedingungen in der Region waren schlecht. Die spanischen Festungen erschwerten sie noch, weil sie seit den 1830er Jahren den Handel mit der französischen Kolonie in Algerien störten. Die Spanier betrachteten den Warenaustausch als Schmuggel oder hielten die Händler für Piraten, ohne zwischen den tatsächlich wohl unterschiedlichen Berber-Stämmen zu unterscheiden. Indirekt erhöhten sie damit die Attraktivität oder Notwendigkeit, Piraterie zum Lebensunterhalt zu machen. Die Regierungen Spaniens, Frankreichs und Großbritanniens beklagten zwar die Zustände, konnten sich aber zu keinem gemeinsamen Vorgehen durchringen, weil keine die strategischen Interessen der anderen befördern wollte. Schließlich übte die britische Regierung ab 1855 starken Druck auf den Sultan von Marokko aus, dieses Gebiet, an dem der Herrscher auch wegen dessen Ärmlichkeit bislang kein Interesse gezeigt hatte, effektiv zu kontrollieren. Mit mehreren Militärexpeditionen gelang es Mulai Abd ar-Rahman, die Rif-Bevölkerung so weit zu disziplinieren, dass die Piraterie zunächst aufhörte. Als jedoch die marokkanische Regierung am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund innerer Krisen und konkurrierender europäischer Interventionen zusehends geschwächt wurde, flammte die Piraterie an der peripheren Rif-Küste wieder auf. 1893/94 führte Spanien einen Krieg gegen zahlreiche Berber-Stämme, später folgten 1909 auch militärische Auseinandersetzungen mit dem Sultan um die Festungsstadt Melilla. Die imperialistische Konkurrenz der europäischen Mächte mündete nach der Jahrhundertwende in zwei diplomatische Krisen um Marokko 1905/06 und 1911. In deren Folge errichteten Frankreich und Spanien dann 1912 im Vertrag von Fes ein Protektorat über das Land, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1956 wieder aufgehoben wurde. Während Frankreich den größeren Teil im Süden übernahm, erhielt Spanien die nördliche Mittelmeerküste einschließlich des Rif-Gebirges sowie ein Stück am Atlantik. Tanger, das hier am südlichen, atlantischen Teil der Straße von Gibraltar lag, wurde – offiziell 1923 – zur Internationalen Zone. Von Spanisch-Marokko aus begann später General Franco, der dort im langwierigen Rif-Krieg gegen die Berber 1921 bis 1926 als stellvertretender Kommandeur der spanischen Fremdenlegion gedient hatte, mit Unterstützung der Kolonialarmee im Juli 1936 seine Revolte gegen die republikanische Regierung Spaniens und eröffnete den bis 1939 anhaltenden Bürgerkrieg.
Die Straße von Gibraltar war im 19. Jahrhundert eine Zone mit unscharfen Grenzziehungen zwischen Europa und Afrika. Auf beiden Seiten bildeten sich unterschiedliche, von lokalen wie überregionalen Kräften bestimmte, aber nur partiell abgeschlossene Lokalitäten aus: Gibraltar, Tanger, Ceuta und weitere Orte. Die staatliche Kontrolle über sie und die umliegenden Gebiete nahm spürbar zu, war aber weder hinsichtlich der Bevölkerungspolitik in Gibraltar noch hinsichtlich der räuberischen Rif-Bewohner umfassend. Identitätsbildungen und gesellschaftliche Grenzziehungen erfolgten an der Meerenge anhand verschiedener Kriterien: Europäisch-orientalisch war nur eines von mehreren, hinzu kamen religiöse, ethnische, soziale und genderspezifische Inklusion und Exklusion. Generell machten sich der europäische Kolonialismus und die imperiale Konkurrenz insbesondere auf der südlichen Seite der Meerenge, wo ein relatives Defizit an Staatlichkeit existierte, verstärkt bemerkbar und prägten langfristig die politischen und ökonomischen Bedingungen bis in die Zeit der Dekolonisation. Das Rif ist heute das weltweit größte Anbaugebiet für Cannabis, von dort stammt die Hälfte der Weltproduktion von Haschisch. Die Straße von Gibraltar war eine machtpolitische Kreuzung, eine Kontakt- und Austauschzone für Europäer untereinander und mit anderen. Mit der Eröffnung des Suezkanals am anderen Ende des Mittelmeers wurde sie 1869 dann auch zu einer globalen Wasserstraße.
Dardanellen und Bosporus: Am anderen Ende des Mittelmeers waren die Meerengen der Dardanellen und des Bosporus für das 19. Jahrhundert zentrale Orte europäischer Diplomatie und kriegerischer Auseinandersetzungen. An ihnen manifestierte sich Europa als Staatensystem. Sie bildeten zugleich eine Schnittstelle für das Osmanische Reich und seine europäischen und kleinasiatisch-nahöstlichen Territorien. Geographisch verbinden die Wasserstraßen das Mittelmeer mit dem Schwarzen Meer. Die Dardanellen sind 65 Kilometer lang und zwei bis sechs Kilometer breit. Auf das in der Mitte gelegene Marmarameer folgt der Bosporus, der nach 31 Kilometern ins Schwarze Meer übergeht. Er ist an der schmalsten Stelle knapp 700 Meter breit. Auf seinen beiden Seiten liegt Istanbul mit 1897 über einer Million Einwohnern – einer Gesamtbevölkerungszahl, die mit dem Ersten Weltkrieg deutlich sank und erst in den 1950er Jahren wieder erreicht wurde. Etwa 15 Prozent der Bevölkerung waren laut einer Zählung von 1885 keine türkischen Untertanen; von den osmanischen Staatsbürgern stellten die Muslime mit 44 Prozent weniger als die Hälfte der Einwohner, Griechisch-Orthodoxe über 17 Prozent und armenische Christen ebenfalls über 17 Prozent sowie Juden 5 Prozent. Hinzu kamen kleine Gruppen von Katholiken, Bulgarisch-Orthodoxen und Protestanten. Die staatliche Statistik kategorisierte vornehmlich nach religiöser Zugehörigkeit, weil darauf Militärdienst- und Steuerpflicht beruhten. Sie lässt erkennen, dass die Stadt ein bemerkenswertes Konglomerat von Religionen, Ethnien, Nationen, Sprachen und Sitten beherbergte und, wie die Encyclopaedia Britannica 1911 zitierte, «nicht aus einer Nation [bestand], sondern aus vielen und kaum mehr aus einer als aus einer anderen». Über Konstantinopel als Hafenstadt und als Zentrum des osmanischen Staates, über die Brückenfunktion für das europäisches und nichteuropäisches Gebiet umfassende Imperium müsste ein eigenes Kapitel verfasst werden. Hier sollen die eigentlichen Meerengen lediglich als Gegenstand der europäischen und der Weltpolitik vorgestellt werden.
Die Meerengen waren sowohl Anlass für diplomatische Konflikte als auch Gradmesser für europäische Beziehungen, und sie wurden mehrfach Gegenstand internationaler Übereinkünfte. Die Kontrolle über sie lag grundsätzlich zunächst einmal in der Hand der osmanischen Herrscher. Doch versuchte vor allem Russland seit dem 18. Jahrhundert, für sich günstige Regelungen herbeizuführen. Dabei stieß es jedoch nicht nur auf türkischen Widerstand, sondern auch auf den der übrigen europäischen Großmächte. Russlands Interesse bestand zum einen darin, dass seine Handelsschiffe die Meerengen durchfahren durften. Dies wurde bereits 1774 im Frieden von Küçük Kaynarca mit dem Osmanischen Reich vereinbart. Noch im 19. Jahrhundert waren es vor allem Getreideschiffe mit ukrainischen Erzeugnissen, die passierten; später suchte auch die Industrie in den Kohle- und Erzgebieten am Don den Anschluss an den Mittelmeer- und Welthandel. Zum anderen spielten militärisch-strategische Interessen eine entscheidende Rolle. Im Zuge der territorialen Expansion Russlands, die Ende des 18. Jahrhunderts bis an das Schwarze Meer reichte und nach verschiedenen Kriegen bis 1864 schließlich die Kaukasus-Region umschloss, schienen der gesicherte Ausgang für die russische Kriegsmarine durch die Meerengen ins Mittelmeer und damit ein ganzjähriger Zugang zu den Ozeanen erreichbar. Die russischen Regierungen ergriffen im Laufe des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Mittel, um an ihr Ziel zu gelangen: Kriege und Drohungen gegen das Osmanische Reich, aber auch Bündnisse mit dem Sultan, um sich möglichst großen Einfluss zu sichern; ferner führten sie Kriege mit den anderen europäischen Mächten oder versuchten Kriege der anderen Staaten untereinander für sich auszunutzen. Alle Bemühungen waren erfolglos: Die türkischen Meerengen blieben im 19. Jahrhundert in Friedenszeiten weiterhin durchgängig für fremde Kriegsschiffe gesperrt.
1833 gelang es der russischen Regierung im Vertrag von Hünkâr İskelesi immerhin zu vereinbaren, dass die Meerengen im Konfliktfall für ihre eigene Kriegsmarine geöffnet werden, für andere aber geschlossen bleiben sollten. Zuvor hatte der Zar 1828/29 zunächst einen Krieg gegen den Sultan geführt, ihn dann aber 1831 bis 1833 gegen dessen aufständischen Vasallen, den Vizekönig von Ägypten Muhammad Ali (1769–1849), unterstützt. Doch im Gefolge der nächsten Auseinandersetzungen Muhammad Alis mit dem osmanischen Oberherrn intervenierten die europäischen Mächte 1840 gemeinsam zugunsten von Sultan Abdülmecid (1823–1861) und regelten anschließend den Durchgang durch Bosporus und Dardanellen in den beiden Londoner Konventionen von 1840 und 1841. Diese blieben grundsätzlich bis zum Ersten Weltkrieg in Kraft. Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland sowie in der zweiten Konvention auch Frankreich bestimmten darin zusammen mit dem Osmanischen Reich, dass die Meerengen für alle Kriegsschiffe fremder Mächte gesperrt sein sollten, solange die Türkei sich im Frieden befand. Im Kriegszustand konnte der Sultan entscheiden, wem er Durchfahrtsrechte gewähren wollte. Damit blieb der russischen Kriegsmarine der Zugang ins Mittelmeer verschlossen, gleichzeitig erhielt Russland aber auch grundsätzlich Sicherheit gegen einen Angriff anderer Seemächte auf seine Schwarzmeerküste, solange es sich mit Konstantinopel im Frieden befand. Die Londoner Konventionen unterschieden sich von vorhergehenden Verträgen, weil sie die Regelungen unter die Garantie der europäischen Mächte stellten, die Kontrolle über die Schließung der Meerengen in Friedenszeiten also gleichsam internationalisierten.
In den Londoner Konventionen manifestierte sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts Europa als Staatensystem. Allerdings kam es 1853 erneut zu einem türkisch-russischen Krieg, der sich vordergründig an den Forderungen des Zaren nach einem Protektorat über die Christen an den Heiligen Stätten in Jerusalem entzündete. Die russische Armee besetzte im Juni die Donaufürstentürmer Moldau und Walachei, die Schwarzmeerflotte zerstörte im November bei Sinope die dort vor Anker liegenden osmanischen Kriegsschiffe. Daraufhin entsandten Frankreich und Großbritannien ihre Marine in das Schwarze Meer und erklärten im März 1854 Russland den Krieg. Sardinien und Österreich folgten später. Die Kämpfe wurden im Wesentlichen auf der Krim ausgetragen, aber auch im Kaukasus und auf der Ostsee. Der Friede von Paris, an dem schließlich auch das neutral gebliebene Preußen beteiligt und mit dem das Osmanische Reich völkerrechtlich in das «Europäische Konzert» aufgenommen wurde, beendete 1856 den Krimkrieg. Er bestätigte erneut die Regelungen von 1841 über die Meerengen. Zugleich verschärfte er aber die Einschränkungen: In der sogenannten Pontus-Klausel wurde das Schwarze Meer entmilitarisiert, d.h., Russland durfte dort auch keine Kriegsflotte mehr stationieren. 1870 nutzte die russische Regierung die europäische Krise des Deutsch-Französischen Krieges, um diese Klausel einseitig zu kündigen. Die Regelungen über die Sperrung der Meerengen für Kriegsschiffe von 1841 wurden grundsätzlich nochmals nach der Orientkrise von 1875 bis 1878 und dem erneuten russisch-türkischen Krieg, in dem russische Truppen bis ans Marmarameer vordrangen, auf dem Berliner Kongress als ein «europäisches Prinzip» bezeichnet und in der Kongressakte von 1878 bestätigt.
Die Frage, wer die Meerengen mit Kriegsschiffen befahren durfte, sorgte auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder für Spannungen zwischen den europäischen Mächten. 1895 wurden in Konstantinopel christliche Armenier in großer Zahl umgebracht, nachdem sie gegen Pogrome, die mit Duldung des Sultans Abdülhamid II. (im Amt 1876–1909) in Ostanatolien stattfanden, protestiert hatten. Das britische Kabinett debattierte daraufhin, ob man nicht die Mittelmeerflotte in die Dardanellen schicken sollte. Die russische Regierung hegte ähnliche Pläne und wollte auf jeden Fall gleichzeitig mit den englischen Schiffen ankommen. Trotz humanitärer Kampagnen in Europa und den Vereinigten Staaten – der evangelische Missionspfarrer Johannes Lepsius begann damals sein publizistisches Engagement und seine Hilfstätigkeit für die Armenier – blockierte aber die misstrauische Konkurrenz der Großmächte eine Intervention.
1905 verhinderten dann die bestehenden internationalen Vereinbarungen, dass die russische Schwarzmeerflotte über das Mittelmeer und den Suezkanal nach Ostasien auslaufen konnte, wo sie die russische Pazifikflotte im Krieg mit Japan hätte verstärken können. Im Hinblick auf die strategischen Gegensätze des Zarenreiches und des britischen Empires hatten die Meerengen also eine geradezu weltpolitische Dimension. Die russische Expansion in Zentralasien stieß in Afghanistan unmittelbar an das Prunkstück des britischen Imperialismus, den indischen Subkontinent. Da die Seeverbindung nach Indien über Gibraltar, Malta und Zypern und den Suezkanal lief, wollte die britische Politik auf keinen Fall, dass eine russische Flotte im Mittelmeer frei agieren könnte. Es war daher ihr zentrales Anliegen, die türkischen Meerengen für Kriegsschiffe dauerhaft geschlossen zu halten.
Die innere und äußere Schwäche des Osmanischen Reiches, die sich – trotz der Reformbemühungen ab 1908 – erneut in den beiden Balkankriegen 1912/13 und 1913 zeigte, erschwerte zunehmend die Bemühungen um den Erhalt des 1840/41 fixierten «europäischen Prinzips». Im Ersten Weltkrieg fand 1915/16 auf der Halbinsel Gallipoli, welche die europäische Seite des Eingangs in die Dardanellen bildete, eine der verlustreichsten Schlachten des Krieges statt. Britische und französische Truppen versuchten, dort zu landen, um nach Konstantinopel zu gelangen und die Meerengen für Transporte von Süden her an die russische Front zu öffnen, denn das Weiße Meer im Norden des Kontinents war nicht eisfrei und die Ostsee von der deutschen Flotte blockiert. Auf britischer Seite kamen an den Dardanellen unter anderem das Australian and New Zealand Army Corps und weitere koloniale Hilfstruppen wie ein Gurkha-Regiment zum Einsatz; das französische Armeekorps umfasste mehrere Bataillone aus dem Senegal. Auf türkischer Seite diente Mustafa Kemal (1881–1938), der spätere türkische Staatspräsident, als Divisionskommandeur. Die Gallipoli-, Dardanellen-, Çanakkale-Schlacht wurde für die Truppen aus den Kolonien und den Dominions sowie für die türkischen Soldaten zu einem identitätsstiftenden, sie von Europa mehr und mehr trennenden Ereignis. Insgesamt starben weit über 200.000 Soldaten bei dem vergeblichen Versuch, die Meerengen zu erobern. Diese kamen erst im Waffenstillstand von 1918 unter alliierte Kontrolle und 1923 dann im Abkommen von Lausanne in die Hände einer internationalen Meerengen-Kommission, bevor die Durchführung der Bestimmungen 1936 durch das Abkommen von Montreux wieder der Türkei übertragen wurde. Der Historiker Egmont Zechlin hat die Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer zu Recht als einen «Brennpunkt der Weltgeschichte» bezeichnet.
Suezkanal: Schließen wir die Umschreibung Europas mit einer letzten Wasserstraße ab, die vor der Mitte des 19. Jahrhunderts noch gar nicht existierte. Sie wurde erst zwischen 1859 und 1869 künstlich geschaffen und war aus ähnlichen Gründen wie die türkischen Meerengen ein welthistorischer und insbesondere imperialer Brennpunkt. Die Rede ist vom Suezkanal, dem großen europäischen Bauprojekt der Epoche und im strengen Sinne keine Meerenge, sondern der Durchstich einer Landenge. Der schleusenfreie Kanal besitzt ein leichtes Gefälle vom Roten Meer ins Mittelmeer. Er verbindet die beiden Meereswelten, wobei die im südlichen Teil gelegenen Bitterseen, ehemals trockene Salzseen, zunächst die Wanderung von Meereswesen nach dem Zusammenfluss unterbanden. Bis in die späten 1920er Jahren ist der Salzgehalt dort aber durch die Wasserströmung so stark verringert worden, dass seither eine merkliche Migration ins Mittelmeer stattfindet. Sie heißt nach dem Erbauer des Kanals Lessepsian migration. Einige Fischarten aus dem Roten Meer sind heute im östlichen Mittelmeer keine Exoten mehr, sondern zählen zur heimischen Fauna und breiten sich aufgrund der biologischen Veränderungen, die der Bau des Assuan-Staudamms im Delta des Nils seit den 1960er Jahren bewirkte, noch weiter aus. Die Wanderung von Menschen ist eine langfristige Folge der technischen Umwälzung. Im 19. Jahrhundert beschäftigte die medizinischen Experten vornehmlich die Ausbreitung von Krankheitserregern, die mit den Schiffen und Passagieren durch den Kanal nach Europa gelangen könnten. Internationale Konventionen regelten 1892 und 1897 die Quarantänebestimmungen für Suez, die Cholera und Pest aus dem Osten fernhalten sollten.
Die menschliche Geschichte des Kanalbaus ist voller Ironie: Angestoßen von französischen Diplomaten und Ingenieuren und finanziert mit französischem Kapital, wurde er zunächst von ägyptischen Fronarbeitern ohne den Einsatz moderner Maschinen gegraben. Der Bau wurde gegen den Widerstand der britischen Regierung verwirklicht, erwies sich nach der Fertigstellung jedoch in vielerlei Hinsicht als gerade für britische Interessen förderlich. Gedacht als Instrument, um die Unabhängigkeit der ägyptischen Vizekönige von Konstantinopel zu stützen, trug er zum Bankrott der ägyptischen Staatsfinanzen und damit 1882 zum britischen Protektorat über Ägypten bei. Und knapp 90 Jahre nach seiner Eröffnung kündete er dann 1956 in der Suezkrise vom Ende des britischen Weltreichs.
Der Suezkanal führt ohne den «Umweg» über das südliche Afrika direkt in den Indischen Ozean. Seine Länge zwischen Port Said im Norden und Suez im Süden betrug bei der Eröffnung 164 Kilometer, er war am Grund 22 Meter breit und besaß eine Tiefe von acht Metern. Schon bald nach der Inbetriebnahme wurden Erweiterungsbauten in Angriff genommen, denn nur an wenigen Stellen konnten Schiffe einander in beide Richtungen passieren. 1911 war dies dann fast durchgängig möglich, so dass sich die Fahrzeit von anfangs 36 auf nur noch 18 Stunden reduzierte. Ab 1887 durften die Schiffe, die mit elektrischem Licht ausgestattet wurden, sich auch nachts fortbewegen. Der Kanal verkürzte die Wegstrecke von Europa nach Asien erheblich: Im Vergleich zur Route um das Kap der Guten Hoffnung war sie von London nach Bombay um mehr als 40 Prozent kürzer, nach Kalkutta noch um fast ein Drittel und nach Hongkong um ein gutes Viertel. Aufgrund der unbeständigen Windverhältnisse im Roten Meer und der hohen Schleppkosten benutzten Segelschiffe den Kanal kaum, während er die Verwendung von Dampfschiffen und ihren Bau anregte und so wesentlich das Ende der Segelschifffahrt im Welthandel vorantrieb. Die Tonnage, die auf dem Weg nach und von Asien oder Ostafrika durch Suez kam, übertraf rasch die Erwartungen. In den ersten zehn Jahren versiebenfachte sie sich, stieg zwischen 1880 und 1900 um das Dreifache, um bis 1910 nochmals um 70 Prozent auf über 16 Millionen Registertonnen zu wachsen. Verkürzung der Seeroute, wachsende Produktionszahlen von Dampfschiffen und Zunahme des Schiffraums: All dies gereichte Großbritannien zum Vorteil. Die Verbindung zu den asiatischen Teilen seines Empires wurde gestärkt. Die eigene Schiffbauindustrie profitierte, denn zwei Drittel aller weltweit von 1890 bis 1914 gebauten Dampfschiffe stammten von britischen Werften. Der britische Anteil an der Tonnage im Suezkanal stieg von 66 Prozent im Jahr 1870 auf fast 80 Prozent im Jahr 1880 und hielt sich bis zum Ersten Weltkrieg bei über 60 Prozent.
Der Kanal erwies sich zugleich als Indikator und Instrument britischer Weltmacht. Der Anstoß für seinen Bau war allerdings von anderer Seite gegeben worden. Seitdem Napoleon 1798 während des ägyptischen Feldzugs eine Landvermessung hatte durchführen lassen, wurden den Khediven verschiedene, zumeist französische Vorschläge für einen Kanalbau unterbreitet. Erst ein Nachfolger Muhammad Alis, des aus Albanien stammenden Begründers der selbsternannten vizeköniglichen Herrscherdynastie in Ägypten, erteilte 1854 eine Vorkonzession an den ehemaligen französischen Diplomaten Ferdinand de Lesseps (1805–1894). Dieser gründete 1855 die Compagnie Universelle du Canal de Suez, die den Bau des Kanals und der Häfen von Port Said und Suez in Angriff nahm. Einige Hürden waren bis zur Eröffnung allerdings zu nehmen, und die zehn Jahre dauernden Bauarbeiten hatten, wie Nathalie Montel gezeigt hat, enorme Schwierigkeiten zu bewältigen. Ein Hauptproblem waren die Arbeitskräfte. Die Konzession von 1856 sah vor, dass vier Fünftel der Arbeiter Ägypter sein sollten. Es gelang nicht, genügend Freiwillige anzuwerben – die Arbeitsbedingungen waren äußerst hart, die Firma hielt sich nicht an die vereinbarten Lohnsätze, und bei einer Gelegenheit brach die Cholera aus. Der Khedive stellte schließlich unbezahlte Zwangsarbeiter bereit. Gegen diese Fronarbeit protestierten Teile der britischen Öffentlichkeit, und die Londoner Regierung erreichte, dass der Sultan aus Konstantinopel den Arbeitsdienst der Fellachen 1864 untersagte. Seither wurden verstärkt Maschinen eingesetzt, vor allem dampfgetriebene Bagger, welche die französischen Ingenieure vor Ort anpassten und mechanisch verbesserten. Die Großbaustelle brachte auf diesem Weg auch technischen Fortschritt. Sie erforderte außerdem einen außergewöhnlich hohen logistischen Aufwand bei bis zu 20.000 Arbeitern, die gleichzeitig Hand anlegten, um sie mit Trinkwasser zu versorgen und den Nachschub an Kohle für die Maschinen zu gewährleisten.
Außer den physischen und organisatorischen mussten finanzielle und politische Hindernisse bewältigt werden. Die Aktien der Baugesellschaft wurden zu einem großen Teil von Franzosen gezeichnet, den Rest übernahm die ägyptische Regierung, denn die Analysten erwarteten nicht, dass die Firma gewinnbringend arbeiten werde. Lord Palmerston, der englische Außen- und anschließende Premierminister, lehnte das Vorhaben zunächst ab, weil er die strategische Bedeutung des Kanals erkannte, aber negativ bewertete. Die erwartete Stärkung des Khediven gegenüber dem Sultan und damit die mögliche Unabhängigkeit Ägyptens von Konstantinopel würden zum einen das Osmanische Reich schwächen und damit ein russisches Vordringen ins Mittelmeer erleichtern. Zum anderen gerate eine strategische Verbindung nach Indien unter den Einfluss Frankreichs und damit eines Landes, dem die britische Führung wie die meisten anderen europäischen Regierungen gründlich misstraute. Die Lobbyarbeit britischer Firmen für ihre kommerziellen Interessen milderte den Widerstand allmählich ab, ebenso die Erfahrung des Großen Aufstandes von 1857, als man rasch Truppen nach Indien hatte schicken müssen. Nach der Eröffnung erwarb dann die britische Regierung 1875 unter Premierminister Benjamin Disraeli fast die Hälfte der Anteile an der Kanalgesellschaft vom hoch verschuldeten Vizekönig Ismail (1830–1895), der 1879 auf britisch-französischen Druck vom Sultan seines Amtes enthoben wurde und den Rest seines Lebens in einem Palast am Bosporus verbrachte. Die Frage, wer den Kanal benutzen durfte, war in den ursprünglichen Konzessionen 1854 und 1856 dahingehend geregelt, dass er für Schiffe aller Nationen offen sein sollte. 1888 sicherte eine diplomatische Konferenz der Großmächte in Konstantinopel die Neutralität völkerrechtlich ab. Für den Suezkanal galt damit die Freiheit der Schifffahrt, die in mehreren Verträgen 1831/1868 auch für den Rhein und 1838/1856 für die Donau international geregelt worden war.
Die faktische Kontrolle über Suez befand sich jedoch seit 1882 bei Großbritannien, dessen Truppen Ägypten in diesem Jahr besetzten. Die britische Übernahme der Herrschaft in Ägypten gilt als eines der Schlüsselereignisse für den Imperialismus im späten 19. Jahrhundert und die folgende Aufteilung Afrikas. Die Beweggründe und Ursachen sind in der Forschung lange kontrovers diskutiert worden. Dem Historiker A. G. Hopkins zufolge standen 1882 weniger die Sicherung des Suezkanals und die Wahrung der Ordnung in Ägypten angesichts eines Militärputsches gegen den Khediven im Vordergrund der englischen Entscheidung als vielmehr die Wahrung von britischen Finanz- und Dienstleistungsinteressen. Britische und andere europäische Investoren engagierten sich seit gut drei Jahrzehnten in dem nordafrikanischen Land. Die drohende Zahlungsunfähigkeit des Vizekönigtums, zu der das Kanalvorhaben und andere durch Schuldverschreibungen finanzierte Modernisierungsprojekte wesentlich beigetragen hatten, löste schrittweise Interventionen aus: erst 1876 in Form der gemeinsamen französisch-britischen Finanzkontrolle, der 1879 die Amtsenthebung Ismails und schließlich 1882 die militärische Intervention folgte. Das Protektorat dauerte bis zur Unabhängigkeit Ägyptens 1922 an, die letzten Truppen wurden erst 1956 aus Suez zurückgezogen. Die Besetzung Ägyptens war nicht der Auslöser des neuen Imperialismus im 19. Jahrhundert, sondern ein bedeutsamer Schritt im Rahmen des bereits früher einsetzenden, vielfältigen europäischen Engagements außerhalb seiner politischen Grenzen.
Der Suezkanal gehörte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgrund des europäischen Engagements im südöstlichen Mittelmeer in politischer, wirtschaftlicher und technologischer, bald auch in ökologischer Hinsicht zu den europäischen Meerengen. Er war ein «Kristallisationspunkt imperialer Geographien» (Valeska Huber), an dem Verbindungen hergestellt wurden, aber gleichzeitig auch eine neue, gefühlsmäßige Grenze Europas entstand. Europäische Händler, Soldaten, Kolonialbeamte und ihre Familien, Missionare, Arbeitskräfte und Touristen passierten sie. Spätestens in Port Said erwarb man die passende Kleidung für die «Tropen»; man wechselte dort auf der Rückreise wieder in europäische Gewänder und legte damit auch koloniale Rollen und Status ab. Viele Reisende hielten die Grenzüberschreitung von und nach Europa in Briefen, Postkarten und Tagebüchern fest. Schriftsteller bezogen sich gerne auf Suez. Der in Indien geborene britische Autor Rudyard Kipling (1865–1936) beschrieb die Grenze zwischen verschiedenen Welten, in denen unterschiedliche Regeln galten, in mehreren seiner Werke. Im Gedicht «Mandalay» fasste er 1890 die Sehnsucht eines Rückkehrers nach dem «Osten» in die Worte: «Ship me somewhere east of Suez, where the best is like the worst,/ Where there aren’t no Ten Commandments an’ a man can raise a thirst;/ For the temple-bells are callin’, an’ it’s there that I would be —/ By the old Moulmein Pagoda, looking lazy at the sea.» Östlich von Suez schienen ihm andere Kräfte als die christliche Vorsehung zu herrschen: «East of Suez, some hold, the direct control of Providence ceases; Man being there handed over to the power of the Gods and Devils of Asia», hieß es im gleichen Jahr in seiner Kurzgeschichte «The Mark of the Beast». Obwohl geographisch außerhalb Europas gelegen, markierte auch der Suezkanal eine europäische Grenze.
Globale Vorherrschaft und Fortschrittsglaube
An den Meerengen zeigt sich, wie unscharf und zugleich durchlässig die Grenzen Europas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren. Sie bildeten in ökologischer, ökonomischer, politischer, sozialer und kultureller Hinsicht Kontaktzonen und Schnittstellen. Hier trafen verschiedene Interessen, Ideen und Vorstellungen, Menschen, Güter, Tiere und Pflanzen aus Europa und anderen Erdteilen aufeinander. Die Geschichte an diesen vermeintlichen Rändern verdeutlicht, anders als das lange übliche Bild von den abgeschlossenen Nationalstaaten, in welch großem Maße vielfältige Beziehungen und Interaktionen Europa prägten. Der Kontinent war weltweit dichter eingebunden als je zuvor. Er reichte weit über die Grenzen hinaus, deren Ausdehnung und Charakter die zeitgenössischen Geographen damals gerade in ihren globalen Relationen zu bestimmen suchten. Die Meerengen entwickelten sich zu imperialen Kreuzungen: Händler, Missionare und Missionsschwestern, Naturwissenschaftler, Menschen, die in Übersee siedeln und Familien gründen wollten, sowie Soldaten und Beamte, die politische Herrschaft sicherten und verwalteten, gelangten über sie nach Sibirien, Nordafrika, in die Schwarzmeerregion, nach Ostafrika, Südasien und in den Fernen Osten sowie nach Süd- und Nordamerika. Der Blick von den Rändern dezentriert unsere Perspektive und lässt erkennen, dass für die historische Entwicklung zentrale Orte an der geographischen Peripherie und sogar jenseits des Kontinents lagen.
Die vielfältigen Beziehungen zur weiteren Welt bildeten ein wesentliches Moment der europäischen Geschichte in dieser Zeit. An den Meerengen manifestierte sich die globale Vorherrschaft Europas. Im Unterschied zur frühneuzeitlichen Expansion kennzeichnete eine imperialistische Dynamik das Verhältnis zu den angrenzenden und den entfernteren Weltregionen. Fremdherrschaft über Kolonialgebiete bildete dabei nur einen Teil der globalen Vorherrschaft. Der europäische Kolonialismus erfuhr in der Epoche zwar seine größte Ausdehnung, hinzu kam jetzt jedoch das Streben der verschiedenen imperialen Zentren, Weltreiche aufzubauen, welche die einzelnen Kolonien übergreifend miteinander verknüpften. Die europäischen Mächte betrieben Weltpolitik, wobei sie im sich ausbildenden Weltstaatensystem nicht nur konkurrierten, sondern auch widerstreitende Ansprüche auszugleichen suchten, in internationalen Vereinbarungen Regeln des friedlichen Umgangs entwickelten und vor allem vor Ort eng miteinander kooperierten. Ihre alleinige Vorherrschaft dauerte nur kurz, denn schon um die Jahrhundertwende traten mit den USA und Japan außereuropäische Imperialisten auf die Bühne. Die globale Vorherrschaft zeitigte jedoch langfristig Folgen, denn sie beruhte auf der Mobilisierung von Ressourcen durch und für den Industriekapitalismus. Sie legte damit den Grund für Strukturen ökonomischer Ungleichheit zwischen den Regionen der Welt, die bis in die Gegenwart wirken. Die Europäer entwickelten außerdem eine Form der Rechtfertigung für ihre Vorherrschaft, die weit bis in das 20. Jahrhundert und untergründig bis heute virulent geblieben ist. Basierend auf sozialdarwinistischen, scheinbar wissenschaftlichen Vorstellungen, erhielt die koloniale und imperiale Herrschaft eine rassistische Begründung, die auch die anders gelagerten Legitimationsmuster wie die christliche Rettung von Seelen durch Missionierung oder die Zivilisierung durch säkulare Ordnungskräfte einfärbte. Der Imperialismus, die ihn stützenden Ideologien und der intensive weltweite Austausch wirkten auf europäische Gesellschaften, Kultur und Politik zurück. Auch wenn Europa zu den maßgeblichen Akteuren in der Welt gehörte, war es doch selbst auch Kräften und Entwicklungen ausgesetzt, die jenseits seiner Grenzen ihren Ursprung hatten. Die Machtausübung an den kolonialen Rändern blieb trotz militärischer Präsenz immer prekär. Die Zukunft wurde um 1900 in den europäischen Außenbeziehungen offen gedacht: als weltpolitische Rivalität der Nationalstaaten und Imperien, als anzustrebende Zivilisierung der Welt und andernorts gerade als Emanzipation von der europäischen Vorherrschaft.
An den Meerengen und künstlichen Wasserstraßen zeigte sich auch der Glaube an den Fortschritt, der in dieser Zeit europaweit fast alle Lebensbereiche durchzog. Konkret veranschaulichen ihn etwa die Umgestaltung der Landschaft an der Suezhalbinsel oder die wissenschaftlich-ökonomische Exploration des arktischen Seewegs. Er wird in den bevölkerungs- und gesundheitspolitischen Maßnahmen deutlich, mit denen in Gibraltar gesellschaftliche Entwicklungen gesteuert werden sollten. Derartige technische oder gesellschaftspolitische Anstrengungen, die überall in Europa unternommen wurden, basierten auf der Erschließung wirtschaftlicher Ressourcen, der Ausübung politischer, administrativer und militärischer Macht sowie der Entwicklung von komplexen Wissens- und Organisationssystemen. Allgemein verband sich damit eine optimistische Sicht des Machbaren, welche die durchaus spürbaren Kosten des Fortschritts als unvermeidlich, aber letztlich lohnenswert ansah. Zu den Akteuren des Wandels gehörten auch diejenigen, die ihm eigentlich widerstehen wollten und nur unfreiwillig an ihm teilhatten. Selbst diejenigen, die – wie das Bürgertum – zahlreiche Veränderungen vorantrieben, wollten den Wandel partiell begrenzt sehen, etwa hinsichtlich der politischen Partizipation von Frauen. Der Fortschritt schien aber trotz und unter Mitwirkung der beharrenden Kräfte, die dem konkreten Wandel in Gesellschaft und Staat auch ihren Stempel aufdrückten, unaufhaltsam und stetig voranzuschreiten. Die Transformation, die stattfand, kann also im doppelten Sinne als beharrlich bezeichnet werden.





























