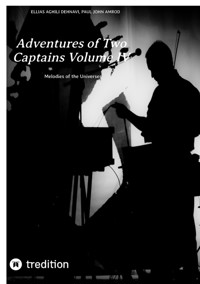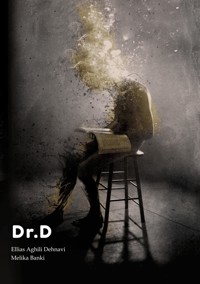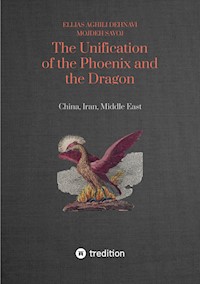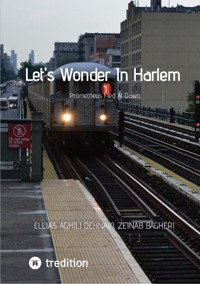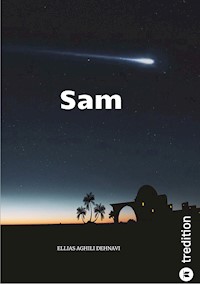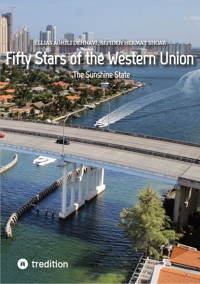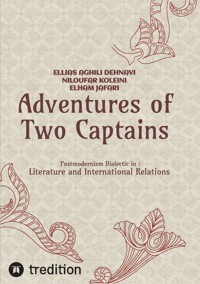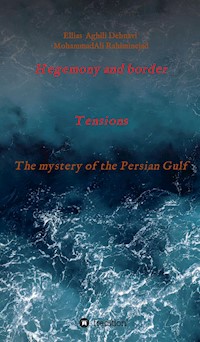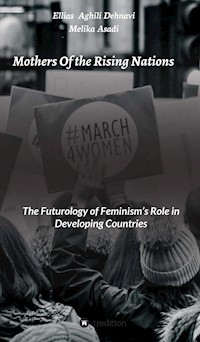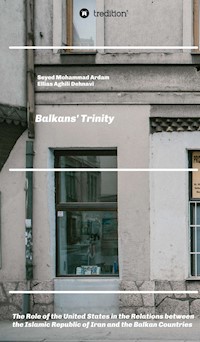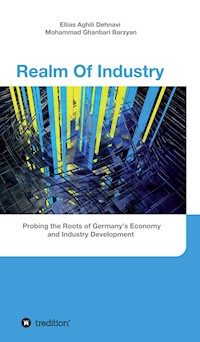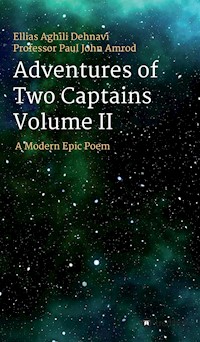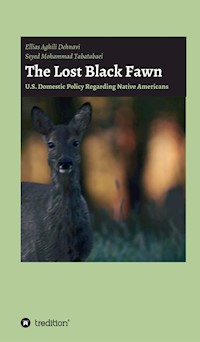19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Globalization effects on health nutrition trends and flows ...
Das E-Book Globalisierung, Gesundheit und Ernährungswissenschaft wird angeboten von tredition GmbH und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Globalization,health,nutrition,international relation,politics
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Globalisierung, Gesundheit und Ernährungswissenschaft
Globalisierung, Gesundheit und Ernährungswissenschaft
Dr. Ellias Aghili Dehnavi, Sepideh Barati Chamgordani
© 2022 Dr. Ellias Aghili Dehnavi, Sepideh Barati Chamgordani
ISBN Softcover: 978-3-347-69433-0
ISBN Hardback: 978-3-347-69434-7
ISBN E-Book: 978-3-347-69435-4
Printing and distribution on behalf of the author: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
The work, including its parts, is protected by copyright. The author is responsible for the contents. Any exploitation is prohibited without his approval. Publication and distribution are carried out on behalf of of the author, to be reached at: tredition GmbH, department "Imprint service", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany.
Ich möchte mich bei meinen Eltern und Freunden bedanken, die mir sehr geholfen haben, dieses Projekt in der begrenzten Zeit fertigzustellen. Ich mache dieses Projekt nicht nur wegen des akademischen Prestiges, sondern auch, um mein Wissen zu erweitern. Nochmals DANKE an alle, die mir geholfen haben, besonders an Paul John Amrod, der mich immer wieder über die Politik der Postmoderne und die Brücken, die wir zwischen den Disziplinen schlagen können, unterrichtet hat!
EINFÜHRUNG
Globalisierung, Gesundheit und Ernährungswissenschaft
An seine Exzellenz, Dr. Johannes Schmitt, den auserwählten Geist
Die Globalisierung löst Kontroversen aus. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft provoziert sie lautstarke Debatten und widersprüchliche Antworten. Innerhalb der Wissenschaft scheiden sich die Geister über die Realität und die Bedeutung der gegenwärtigen Globalisierung, vor allem aber über ihre angeblich revolutionären Auswirkungen auf die klassischen Paradigmen der Humanwissenschaften. In der breiten Öffentlichkeit ruft die Globalisierung sehr unterschiedliche Reaktionen hervor und nährt radikal unterschiedliche politische Projekte, von der Globaphobie der extremen Rechten bis zur Globaphilie der Neoliberalen. Bei näherer Betrachtung löst sich diese scheinbare Polarisierung der Ansichten jedoch in eine weitaus komplexere und nuanciertere Reihe von Argumenten auf, die orthodoxe ideologische und disziplinäre Bruchlinien überschreiten. Die Globalisierung hat weder der Wissenschaft noch dem sozialen Aktivismus eine "goldene Zwangsjacke" auferlegt, um es mit Friedmans Worten zu sagen. Im Gegenteil, sie hat ein radikales Wiederaufleben, wenn nicht gar eine Renaissance, der sozialen und politischen Theorie ausgelöst, ganz zu schweigen von der Mobilisierung und dem Dissens in der Bevölkerung. In diesem Kapitel wird versucht, die intellektuelle und politische Kontroverse um die Idee der Globalisierung nachzuzeichnen und zu erklären, warum sie sowohl unter Akademikern als auch unter Aktivisten zu einer so heftig umstrittenen und verhassten Idee geworden ist.
Im ersten Teil des Kapitels wird erörtert, worum es in der Die große Globalisierungskontroverse und damit auch die Frage, warum sie sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik von so großer Bedeutung ist. Dies bildet die Grundlage für die anschließende Ausarbeitung eines heuristischen Rahmens zur Erfassung dieser Vielfalt und zur Identifizierung der wichtigsten kontroversen Denkschulen. In den verbleibenden Abschnitten wird jede dieser breit gefächerten Schulen diskutiert und kritisch bewertet, wobei diese mit der umstrittenen Politik der Globalisierung in Verbindung gebracht werden. In der Schlussfolgerung wird über die aktuelle Kontroverse über die Globalisierung nachgedacht und darüber, warum sie für Sozialwissenschaftler und soziale Aktivisten bis weit ins einundzwanzigste Jahrhundert hinein von zentraler Bedeutung sein wird.
JENSEITS DER ANTIMONIEN DER GLOBALISIERUNG
Der Satz "Globalisierung ist das, was wir aus ihr machen" hat eine gewisse Gültigkeit. Die Art und Weise, wie die Globalisierung in den Medien und in akademischen Diskursen sozial konstruiert wird, prägt, wenn nicht beschränkt, ihre Bedeutung sowohl für Akademiker als auch für Aktivisten. Zeitgenössische Diskurse über die Globalisierung neigen allzu leicht dazu, ihre Bedeutung im Sinne eines titanischen Kampfes zwischen ihren Befürwortern und ihren Gegnern, zwischen den Kräften der Globalisierung und denen der Globalisierungsgegner, zwischen Globalisten und Skeptikern, zwischen Kosmopol iten und Kommunitaristen oder zwischen dem Globalen und dem Partikularen zu konstruieren. Solche Antimonien haben sicherlich einen heuristischen Wert, da sie helfen zu definieren, was auf dem Spiel steht - im intellektuellen und sozialen Bereich - wenn die Globalisierung ernst genommen werden soll. Allzu oft jedoch vereinfachen solche Gegensätze die Komplexität der akademischen und politischen Auseinandersetzungen über das Wesen und die Bedeutung der Globalisierung zu sehr. Wenn sie zu wörtlich genommen werden, können sie leicht dazu führen, dass Rhetorik an die Stelle einer gründlichen Analyse tritt. Die Überwindung solcher Antinomien ist die Hauptaufgabe dieses Kapitels. Bevor wir uns dieser Aufgabe stellen, wird es jedoch nützlich sein, einige der Gründe zu wiederholen, warum die Globalisierung zu einer so umstrittenen und verabscheuten Idee innerhalb und außerhalb der Wissenschaft geworden ist.
In der Eröffnungsausgabe der Zeitschrift Globalizations argumentiert V. Spike Petersen dass "wir die Globalisierung nicht in den herkömmlichen analytischen und disziplinären Rahmen einordnen können" (Petersen 2004: 50). Jim Rosenau stellt in derselben Ausgabe fest, dass "Sozialwissenschaftler, wie die Menschen, die sie studieren, zu gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen neigen und daher eher dazu neigen, ihre Untersuchungen in gewohnte und als selbstverständlich angesehene Rahmen einzubetten, als ihre Organisationsprinzipien als problematisch zu betrachten" (Rosenau 2004: 12), während Martin Shaw eine "globale Transformation der Sozialwissenschaften" fordert (Shaw 2003: 35). Was die Globalisierung in Frage stellt, sind die zentralen Organisationsprinzipien der modernen Sozialwissenschaft - nämlich Staat, Gesellschaft, politisches Gemeinwesen, Wirtschaft - und das klassische Erbe der modernen Sozialtheorie, die sie als selbstverständliche Einheiten oder Fokus der sozialen Erklärung ansieht - manchmal auch als methodologischer Nationalismus bezeichnet. Rekursive Muster weltweiter Verflechtung stellen das Prinzip der begrenzten Gesellschaft und die Annahme in Frage, dass ihre Dynamik und Entwicklung in erster Linie durch den Bezug auf endogene soziale Kräfte erklärt werden kann. Indem die Idee der Globalisierung die Unterscheidungen zwischen dem In- und dem Ausland, dem Endogenen und dem Exogenen, dem Internen und dem Externen aufhebt, stellt sie direkt den "methodologischen Nationalismus" in Frage, der in der modernen Gesellschaftstheorie seinen stärksten Ausdruck findet. Sie impliziert, wie Scholte und andere schlussfolgern, die Notwendigkeit eines "Paradigmenwechsels in der Sozialanalyse", damit die entstehende Bedingung der Globalität in ihrer ganzen Komplexität erklärt und verstanden werden kann (Scholte 2000: 18).
Solche revolutionären Behauptungen sind nicht unumstritten. Viele lehnen eine solche voreilige Ablehnung der klassischen Sozialtheorie und betrachten die "Globalisierungstendenz" einfach als die Torheit vieler liberaler und radikaler Sozialwissenschaften, in denen Befürwortung an die Stelle von Skepsis oder "ausgewogener sozialwissenschaftlicher Reflexion" getreten ist (Rosenberg 2005: 66). Die Globalisierung stellt jedoch keine unüberwindbare intellektuelle Herausforderung für die orthodoxe Sozialwissenschaft dar, sondern wurde durch die Beschäftigung mit der Räumlichkeit und damit der Globalität in der Entwicklung und Funktionsweise moderner Gesellschaften weitgehend in die zeitgenössische Sozialanalyse integriert (Brenner 2004). Bestrebungen für
Eine wichtige Quelle der akademischen Kontroverse über die Globalisierung ist die Die konkurrierenden Einschätzungen ihres deskriptiven (ontologischen) und erklärenden (epistemo- logischen) Wertes sind eine zweite, aber nicht weniger wichtige Quelle, die sich aus unterschiedlichen normativen und ethischen Positionen ergibt. Diese sind insofern untrennbar mit Fragen der Empirie und Theorie verbunden, als Analysen der Globalisierung notwendigerweise von ethischen Urteilen über ihre Tendenzen und Folgen durchdrungen sind. Ob die Globalisierung gut für die Armen ist, um ein offensichtliches Beispiel zu nennen, beinhaltet nicht nur empirische Beurteilungen, sondern auch Urteile darüber, was gut für die Armen ist. Diskussionen über die Globalisierung, ob in der Wissenschaft oder darüber hinaus, sind unweigerlich - ob explizit oder implizit - von normativen Überlegungen geprägt. Um Sandel zu paraphrasieren: "Jeden Tag leben wir viele der Konzepte der normativen Theorie aus" (Sandel 1996). Ob sie als gutartig, bösartig oder beides angesehen wird, ist ein Urteil, das durch normative Überlegungen und ethische Bewertungen ihrer Folgen für die menschliche Existenz bedingt ist. Es gibt jedoch keine einfache Entsprechung zwischen bestimmten normativen Positionen - wie links oder rechts - und der Einstellung zur Globalisierung. Wie Tormey vorschlägt, liegt die wichtigere Unterscheidung vielmehr zwischen dem, was man allgemein als ideologische und postideologische Argumentation bezeichnen könnte, zwischen denjenigen, die die Globalisierung danach beurteilen, inwieweit sie den Fortschritt in Richtung eines bestimmten Ideals des "guten Lebens" fördert oder einschränkt, und denjenigen, die sie danach beurteilen, inwieweit sie unterschiedliche und vielfältige "Lebensweisen" erleichtert oder behindert oder was Haber als "radikalen Pluralismus" bezeichnet (Tormey 2004: 75; Haber in Noonan 2003: 92). In dieser Hinsicht spiegeln ethische Einschätzungen der Globalisierung nicht die traditionelle binäre Opposition von links und rechts wider, sondern lösen sie im Gegenteil auf. Ethische Kritik an der Globalisierung, sei es aus Gründen der Gerechtigkeit oder der Gemeinschaft, geht über das orthodoxe Links-Rechts-Denken hinaus, ebenso wie ethische Verteidigungen der Globalisierung, seien sie im Kosmopolitismus oder im Konservatismus verwurzelt. In Anlehnung an diese breiteren intellektuellen Strömungen innerhalb der Sozialwissenschaften wird die Kontroverse über die Globalisierung zunehmend von normativen und ethischen Überlegungen darüber geprägt, ob andere oder bessere Welten vorstellbar oder möglich sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in der akademischen Kontroverse über die Globalisierung um zwei zentrale Fragen geht. Die erste betrifft die umstrittene intellektuelle Hegemonie des Globalisierungskonzepts in den Sozialwissenschaften: seinen deskriptiven, analytischen und erklärenden Zweck. Der zweite betrifft die normative Ausrichtung der Globalisierung: ob sie aus ethischen Gründen zu verteidigen, zu transformieren, zu bekämpfen oder abzulehnen ist. Zusammengenommen bieten diese beiden Achsen einen konzeptionellen Raum, um darüber nachzudenken, was die vielen verschiedenen Stimmen und Beiträge zur Kontroverse über die Globalisierung auszeichnet. In Abbildung 1.1 wird der Versuch unternommen, diesen Raum zu kartieren. Die vertikale Achse stellt den Streit um die intellektuelle Hegemonie der Globalisierung dar, der durch eine Privilegierung entweder globalistischer Analyseformen (methodologischer Globalismus) oder alternativ statistischer oder gesellschaftlicher Analyseformen (methodologischer Territorialismus) gekennzeichnet ist. Die horizontale Achse stellt den normativen Bereich dar, der zwischen ideologischen und postideologischen Argumentationsformen unterscheidet, d.h. die Privilegierung einer Vision der "guten Gemeinschaft" gegenüber der Befürwortung vieler koexistierender "guter Gemeinschaften" (ideologische versus postideologische Argumentation). Diese Figur stellt ein heuristisches Instrument dar, um die Vielfältigkeit der Globalisierungsforschung zu identifizieren, zu kartieren und zu differenzieren. Sie bildet die Grundlage für die Konstruktion einer einfachen Typologie, die über die bestehenden binären Gegensätze - für und gegen die Globalisierung, Globalisierer gegen Globalisierungsgegner oder Globalisten gegen Globalisierungsskeptiker - hinausgeht und den nuancierten Charakter der aktuellen Kontroversen anerkennt.
Wie Holton und andere vorgeschlagen haben, gibt es drei Formen der Globalisierungsforschung sich überschneidende, aber unterschiedliche Wellen: die hyper-globalistischen, die skeptischen und die post-skeptischen (Holton 2005: 5; Bruff 2005). Die Wellenanalogie ist insofern nützlich, als sie auf die sukzessive Verbreitung und das Auf und Ab verschiedener Forschungsprogramme im Laufe der Zeit anspielt, bei denen zentrale Forschungsproblematiken angeeignet werden und durch neue Forschungsagenden neu definiert werden. Bezeichnenderweise impliziert sie auch nicht die Vorstellung von kumulativem Wissen oder epistemischem Fortschritt. Aufbauend auf Holtons Schema, das jedoch zwangsläufig modifiziert werden muss, lassen sich vier aufeinander folgende Wellen der Globalisierungsforschung ausmachen: die Theoretiker, die Historiker, die Institutionalisten und die Dekonstruktivisten. Wie bei allen derartigen Schemata ist es weder endgültig noch erschöpfend, sondern eher eine partielle Möglichkeit, ein hochkomplexes Forschungsgebiet zu organisieren.
Wie in den Arbeiten von u.a. Giddens, Robertson, Rosenau, Albrow, Ohmae, Harvey und Lawrence zum Ausdruck kommt, befasste sich die erste theoretische Welle im Allgemeinen mit Debatten über die Konzeptualisierung der Globalisierung, ihre Hauptdynamik und ihre systemischen und strukturellen Folgen als säkularer Prozess des weltweiten sozialen Wandels (Albrow 1996; Giddens 1990; Robertson 1992; Rosenau 1990; Ohmae 1990; Harvey 1989; Lawrence 1996). Im Gegensatz dazu ging es der historisierenden Welle, die sich auf die historische Soziologie der globalen Entwicklung stützte, vor allem darum zu untersuchen, ob und in welcher Weise die gegenwärtige Globalisierung als neu oder einzigartig angesehen werden kann, ob sie eine neue Epoche oder Transformation in der sozioökonomischen und politischen Organisation menschlicher Angelegenheiten definiert und, wenn ja, welche Auswirkungen sie auf die Verwirklichung fortschrittlicher Werte und Projekte menschlicher Emanzipation hat (siehe unter anderem Held et al. 1999; Hirst und Thompson 1999; Frank 1998; Castells 1996; Bordo et al. 2003; Dicken 1998; Baldwin und Martin 1999; Gilpin
2001; Gill 2003; Scholte 2000; Mann 1997; Hopkins 2002; Sassen 1996; Hardt und Negri 2000; Hoogvelt 1997; O'Rourke und Williamson 2000; Boyer und Drache 1996; Appadurai 1998; Amin 1997; Tomlinson 1994; Taylor 1995). In Anbetracht dieser Argumente über den Strukturwandel versuchte die dritte (institutionalistische) Welle, die Behauptungen über die globale Konvergenz (und Divergenz) zu bewerten, indem sie sich auf Fragen des institutionellen Wandels und der Widerstandsfähigkeit konzentrierte, sei es in nationalen Kapitalismusmodellen, staatlichen Umstrukturierungen oder im kulturellen Leben (siehe u. a. Garrett 1998, 2000; Swank 2002; Held 2004; Keohane und Milner 1996; Campbell
2004; Mosley 2003; Cowen 2004; Hay und Watson 2000; Pogge 2001). Die vierte und jüngste Welle schließlich spiegelt den Einfluss des poststrukturalistischen und konstruktivistischen Denkens in den Sozialwissenschaften wider, vom offenen Marxismus bis zur Postmoderne. Infolgedessen wird die Bedeutung von Ideen, Handlungsfähigkeit, Kommunikation, Kontingenz und normativem Wandel für eine überzeugende Analyse des Entstehens, des Vergehens und der Neugestaltung der Globalisierung betont, die sowohl als historischer Prozess als auch als hegemonialer Diskurs verstanden wird. Im Mittelpunkt dieser Welle steht die Debatte darüber, ob die gegenwärtige historische Konjunktion am besten als post-globales Zeitalter zu verstehen ist, in dem die Globalisierung (als Bestreben, Diskurs, materieller Prozess und erklärende Kategorie) auf dem Rückzug ist (oder sein sollte), oder im Gegenteil als eine Epoche von manchmal konkurrierenden und alternativen Globalisierungen (im Plural), was Hoffman als "Kampf der Globalisierungen" bezeichnet hat (Hoffman 2002; Rosenberg 2005; Hay 2004; Urry 2003; Bello 2002; Held und McGrew 2002; Callinicos 2003; Keohane und Nye 2000; Rosamond 2003; Wolf 2004; Saul 2005; Eschele 2005; Beck 2004; Harvey 2003).
Diese vier Analysewellen bestimmen die gegenwärtigen akademischen Überlegungen zur Globalisierung. Wie im Folgenden erörtert wird, haben sie auch einen erheblichen Einfluss darauf, wie die breitere öffentliche Debatte gestaltet wird. Da sie sich auf unterschiedliche epistemische Traditionen in den Humanwissenschaften stützen, wird der Streit um die Globalisierung sowohl durch inhaltliche Auseinandersetzungen als auch durch konkurrierende, wenn auch nicht unbedingt eine Globalisierungstheorie haben einer Vielzahl von Globalisierungstheorien Platz gemacht, da verschiedene Traditionen und Disziplinen, von der Anthropologie bis zur Weltgeschichte, versuchen, die Dynamik der Globalisierung in ihre Erklärungsschemata einzubeziehen. Obwohl diese "globale Wende" die klassische Sozialtheorie nicht verdrängt hat, hat die Idee der Globalisierung nun auch die Geisteswissenschaften erfasst. Skeptiker sehen in diesem "Kolonisierungsprozess" weniger die Verdrängung der Sozialtheorie als vielmehr den deskriptiven und erklärenden Wert des Globalisierungskonzepts selbst. Damit wird die Daseinsberechtigung der Globalisierungsforschung in Frage gestellt, denn wenn das Konzept keine überzeugenden "Anhaltspunkte für die Interpretation empirischer Ereignisse" liefert, muss es in einem sinnvollen Sinne analytisch redundant sein (Rosenberg 2005: 1; Hay 2004). Sowohl für Rosenau als auch für Rosenberg als Vertreter gegensätzlicher Argumente geht es in diesen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um nichts Geringeres als um die Seele der Sozialwissenschaften als einem reflexiven und kritischen Unterfangen, das die wichtigsten Kräfte, die die gegenwärtige Situation des Menschen prägen, zu erklären und zu verstehen sucht. Kurz gesagt, die Globalisierung ist entweder das neue "soziale Imaginäre" der Humanwissenschaften - als explanans oder explanan- dum - oder aber eine subversive konzeptionelle "Torheit" (Taylor 2004; Rosenberg 2000).
Inkommensurable, soziale Untersuchungsmethoden. Doch selbst innerhalb ähnlicher Untersuchungsmethoden sind widersprüchliche Ansichten über die Globalisierung zu beobachten. Dies deutet, wie bereits erwähnt, darauf hin, dass einfache binäre Gegensätze oder Antinomien der Komplexität der Kontroversen über die Globalisierung kaum gerecht werden.
Um auf die Aufgabe der Kartierung zurückzukommen, besteht das allgemeine Untersuchungsfeld zunächst darin, diese Diskussion über die Quellen oder Dimensionen der Aufmerksamkeit und die vier Wellen der Wissenschaft zusammenzuführen. Abbildung 1.1 zeigt mindestens vier verschiedene Analysemodi auf: Diejenige, die die Globalisierung als real existierenden Zustand ansieht und sie entweder im Großen und Ganzen für gut befindet oder, vorbehaltlich einer stärkeren politischen Lenkung, für fortschrittliche Ideale und die Schaffung einer "besseren Welt" nutzbar macht; diejenige, die sie ernst nimmt, wenn auch als neue Form der Herrschaft, gegen die man sich ebenso wehren muss wie gegen alle großartigen Projekte zur Umgestaltung der Welt nach abstrakten universellen Prinzipien; diejenige, die der Idee der Globalisierung oder ihrer vermeintlichen Gutartigkeit zutiefst skeptisch gegenübersteht und stattdessen die anhaltende Bedeutung des "methodologischen Territorialismus" für die Sozialtheorie und die zentrale Bedeutung der Staatsmacht für die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen betont; und diejenige, die ebenfalls die Privilegierung des Globalen in der Sozialtheorie ablehnt und die Verflechtung von Globalisierungs- und Lokalisierungsprozessen betont, jedoch mit einer normativen Bindung an Gemeinschaft, Autonomie, Nachhaltigkeit und Differenz. Diese vier Analysemodi werden hier als defensiver Globalismus, kritischer Globalismus, Postglobalismus bzw. Glokalismus bezeichnet (siehe Abbildung 1.2). Natürlich handelt es sich dabei um allgemeine Bezeichnungen, hinter denen sich ein Spektrum von Argumenten verbirgt, das von eher orthodoxen bis hin zu radikalen Positionen reicht. Dies entkräftet jedoch nicht den heuristischen Wert der Typologie als Instrument für eine systematischere Analyse und vergleichende Untersuchung der Frage, warum die Globalisierung als Konzept und/oder real existierende Bedingung die Quelle so vieler Kontroversen innerhalb und außerhalb der akademischen Welt ist.
Ethische Konsequenzen der Globalisierung von Lebensmitteln, Ernährung und Gesundheit für Fachleute
Globalisierung ist der Prozess zunehmender Verflechtungen und Verbindungen innerhalb von Gesellschaften und über geografische Grenzen hinweg, der auf verbesserte Kommunikation und erweiterten Welthandel zurückzuführen ist. Sie schränkt die durch die menschliche kulturelle Entwicklung hervorgerufene Differenzierung ein und homogenisiert Gesundheitspraktiken, Ernährung und Lebensstil. Der Globalisierungsprozess hat sowohl positive als auch negative Folgen. Die Globalisierung stellt auch eine Herausforderung für die Entwicklung einer Ethik für die Praxis und das Eintreten der Fachleute für Lebensmittel und Ernährung dar. Unter den verwandten Begriffen "Moral", "Werte" und "Ethik" bezeichnet letzterer die grundlegenden Verhaltensregeln für Interaktionen innerhalb der Gesellschaft und mit der unbelebten Umwelt; Regeln, die auf anerkannten Prinzipien (ethischen Grundsätzen) beruhen. Die Anwendung dieser Grundsätze dient der Lösung ethischer Dilemmata, die entstehen, wenn mehr als ein Interesse im Spiel ist. Zu den anerkannten ethischen Grundsätzen gehören Autonomie, Wohltätigkeit, Nicht-Malefiz, Gerechtigkeit, Nützlichkeit und Verantwortlichkeit. Diese können in den Kontext von Fragen gestellt werden, die sich ergeben, wenn man sich für materielle und verhaltensbezogene Veränderungen einsetzt, um die Ernährungsgesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Auf globaler Ebene können Verhaltenskodizes und der Aufbau einer guten Lebensmittelpolitik bei der Institutionalisierung ethischer Grundsätze in Bezug auf die menschliche Ernährung und Essgewohnheiten hilfreich sein. Ethische Dilemmata ergeben sich im Zusammenhang mit der angeborenen Vielfalt von Bevölkerungsgruppen (einige Menschen profitieren, während andere unter den gleichen Belastungen leiden) und aufgrund der Polarität der menschlichen Physiologie und des Stoffwechsels (Praktiken, die bestimmte Krankheiten verhindern, können andere Krankheiten hervorrufen). Darüber hinaus kann die Autonomie eines Einzelnen, seinen eigenen Willen in Bezug auf die persönliche Gesundheit oder die Behandlung der Umwelt auszuüben, die Gesundheit seiner Nachbarn gefährden. Die Herausforderungen für den Berufsstand, der sich in einer globalisierten Welt für ethische Belange einsetzt, bestehen darin, die Grundlagen der ethischen Prinzipien zu erlernen, den Respekt vor den Unterschieden und der Differenzierung zu bewahren, die zwischen Individuen und Gesellschaften weiterhin bestehen und bestehen sollten, und eine totale Homogenisierung der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung zu vermeiden.
Die Grundsätze
Globalisierung