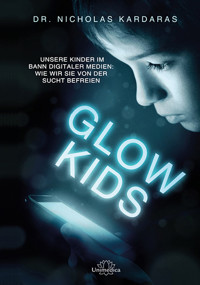
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unimedica, ein Imprint des Narayana Verlags
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie die digitale Welt uns unsere Kinder stiehlt und wie wir sie zurückgewinnen können
Wir alle kennen den Anblick: Kinder wirken wie hypnotisiert, wenn sie auf ihre leuchtenden Bildschirme starren. Mit Glow-Kids vermittelt uns der renommierte Psychotherapeut und Suchtexperte Dr. Nicolas Kardaras eine alarmierende Sichtweise auf die versteckten Gefahren unserer technologiegetriebenen Welt.
Bewaffnet mit neuen Erkenntnissen aus der Hirnforschung und beängstigenden Realitäten aus seiner Praxis zeichnet Dr. Kardaras das verstörende Bild einer Generation, die in der virtuellen Realität verloren geht. In packender Weise wird der Einfluss von Bildschirmmedien auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns, auf Kreativität, soziale Fähigkeiten und psychische Gesundheit beleuchtet.
Doch Glow-Kids ist mehr als nur eine düstere Prognose. Es ist auch ein Lichtblick und ein Leitfaden mit praktischen Lösungen für besorgte Eltern und Erzieher. Dr. Kardaras liefert Tipps und Strategien, wie wir unsere Kinder aus der Falle der Bildschirmabhängigkeit befreien und sie wieder mit der realen Welt – und vor allem mit sich selbst – verbinden können.
„Dr. Kardaras ruft uns ins Bewusstsein, dass Technologien sich auf tückische, unvorhersehbare Weise gegen uns wenden können. Glow-Kids ist ein Paradigmenwechsel, eine unfassbare Erzählung von Maßlosigkeit und Tragik – und ein Weckruf, unsere immer enger werdende Beziehung mit der sich stetig fortentwickelnden Technik zu überdenken.“ - Prof. Dr. Howard Shaffer, Universität Harvard
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Nicholas Kardaras
GLOW-KIDS
Unsere Kinder im Bann digitaler Medien: wie wir sie von der Sucht befreien
Impressum
Dr. Nicholas Kardaras
GLOW-KIDS
Unsere Kinder im Bann digitaler Medien: wie wir sie von der Sucht befreien
1. deutsche Auflage 2023
ISBN: 978-3-96257-303-4
2023 Narayana Verlag GmbH
Titel der Originalausgabe:
GLOW KIDS
HOW SCREEN ADDICTION IS HIJACKING OUR KIDS – AND HOW TO BREAK THE TRANCE
Copyright © 2016 by Nicholas Kardaras
Published by arrangement with St. Martin’s Publishing Group. All rights reserved.
„Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin´s Publishing Group durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.“
Übersetzung aus dem Englischen: Alice von Canstein
Layout und Satz: Eva Artinger
Coverlayout: Narayana Verlag
Coverdesign: David Curtis
Cover Abbildung: Junge: © Ashkey Carlon, Offset; Handy: © ImYanis, Shutterstock 593312897
Herausgeber:
Unimedica im Narayana Verlag GmbH,
Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974 970-0
E-Mail: [email protected]
www.unimedica.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen in diesem Buch wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Der Verlag schließt im Rahmen des rechtlich Zulässigen jede Haftung für die Inhalte externer Links aus. Für Inhalte, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Qualität und/oder Verwendbarkeit der dargestellten Informationen auf den verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Erkenntnisse in der Medizin unterliegen einem laufenden Wandel durch Forschung und klinische Erfahrungen. Autor und Übersetzer dieses Werkes haben große Sorgfalt darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten therapeutischen Angaben (insbesondere hinsichtlich Indikation, Dosierung und unerwünschten Wirkungen) dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Das entbindet den Nutzer dieses Werkes jedoch nicht von der Verpflichtung, anhand einschlägiger Fachliteratur und weiterer schriftlicher Informationsquellen zu überprüfen, ob die dort gemachten Angaben von denen in diesem Werk abweichen und seine Verordnung in eigener Verantwortung zu treffen.
Für die Vollständigkeit und Auswahl der aufgeführten Medikamente übernimmt der Verlag keine Gewähr. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden in der Regel besonders kenntlich gemacht (*). Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann jedoch nicht automatisch geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Der halbe Tag, die halbe Nacht
wird vor dem Bildschirm zugebracht.
Natürlich zieht es Kinder immer
zu jeder Art von Bildgeflimmer.
. . .
Es staunt das Kind, es starrt und stiert
und ist schon ganz hypnotisiert.
. . .
Doch habt ihr niemals recht bedacht,
was das aus euren Kindern macht?
Die Sinne nehmen schweren Schaden,
und der Verstand wird überladen.
Die Phantasie wird nicht geübt,
die Kraft zu denken wird getrübt,
und schließlich wird der Kinderkopf
mit lauter Plunder vollgestopft!
Roald Dahl
Auszug aus dem von den Umpa-Lumpas gesungenen Gedicht für Mickie Glotze in Charlie und die Schokoladenfabrik
(Übersetzung der deutschen Verse von Hans Georg Lenzen)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Das Problem mit der Technik
Kapitel 1: Invasion der Bildschirm-Kids
Kapitel 2: Schöne neue E-Welt
Kapitel 3: Digitale Drogen und das Gehirn
Kapitel 4: Interview mit Dr. Doan*
Kapitel 5: Die große Entfremdung
Kapitel 6: Klinische Störungen und der Bildschirm-Kids-Effekt
Kapitel 7: Was der Affe sieht, äfft er nach
Kapitel 8: Videospiele und Aggressionen
Kapitel 9: Aus den Schlagzeilen
Kapitel 10: Das Newtown-Massaker
Kapitel 11: Etan Patz und das Ende der Unschuld – und des Spiels im Freien
Kapitel 12: Immer dem Geld hinterher
Kapitel 13: Es ist eine E-Welt
Kapitel 14: Die Lösung
Anhang: Leidet mein Kind an einer Bildschirm- oder Techniksucht?
Anmerkungen
Quellen
Stichwortverzeichnis
Über den Autor
Danksagung
Einleitung
Das Problem mit der Technik
Captain Kirk war der Held
Zumindest dachte ich das 1974, als ich noch ein leicht zu beeindruckender Fünftklässler war. Ich schaute Star-Trek-Wiederholungen und träumte davon, mit dem knallharten Captain Kirk und dem coolen Spock auf der Brücke zu stehen und in Welten zu reisen, die noch nie zuvor ein Mensch betreten hatte. Mit Warpgeschwindigkeit zu exotischen Planeten zu fliegen und selbstbewusst grüne Frauen zu verführen – was mehr konnte sich ein Menschenjunge schon wünschen?
Und dann gab es noch all die coole Technik! Oh, der Kommunikator, den er so lässig aufklappte, und dann sagte: „Beam mich hoch, Scotty!“ Weil ich so gerne zu seiner Crew gehören wollte, bastelte ich Hunderte Papier-Kommunikatoren, während ich eigentlich meiner Lehrerin Mrs. Legheart zuhören sollte, die langatmig über die Pilgerväter oder Bruchrechnung oder Sonstiges dozierte … aber sicherlich über nichts, was nur annähernd so spannend war wie meine von Star-Trek inspirierten Tagträume.
Ich träumte davon, dass eines Tages die Realität auf dem gleichen Stand sei wie meine Science-Fiction-Fantasien, und war mir nicht darüber im Klaren, welche Weisheit in dem Spruch „Sei vorsichtig, was du dir wünschst!“ steckt. Denn mittlerweile verfügen wir über Kirks Technik – allerdings zu einem sehr hohen Preis.
Glauben Sie mir, das ist nicht das, was ich wollte; ich wollte und sehnte mich nach Technik, bei der man kein schlechtes Gewissen haben musste. Leider scheinen wir als Gesellschaft aber einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Ja, wir halten diese erstaunlichen Wunder des digitalen Zeitalters in der Hand – Tablets und Smartphones –, diese übernatürlichen, leuchtenden Geräte, die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden, und können mit nur einem Fingerdruck buchstäblich auf das gesamte Wissen der Menschheit zugreifen.
Aber was ist der Preis für all diese futuristische Technik? Die Psyche und Seele einer ganzen Generation. Die traurige Wahrheit lautet, dass wir für diese ach-so-befriedigende Einfachheit, für die Bequemlichkeit und den Reiz dieser modernen Schmuckstücke eine ganze Generation unwissentlich vor den virtuellen Bus gestoßen haben.
„Also ehrlich, dramatisieren Sie da nicht ein bisschen?“, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Aber schauen Sie sich um. Blicken Sie sich in einem Restaurant um, in dem Familien mit ihren Kindern sitzen; schauen Sie sich Orte an, an denen Kinder und Teenager rumhängen – Pizzerien, Schulhöfe, die Wohnungen der Freunde –, was sehen Sie?
Kinder und Jugendliche, die mit gesenkten Köpfen und glasigen Augen wie Zombies auf Bildschirme starren und deren Gesichter von den Displays angestrahlt werden. Wie die seelen- und ausdruckslosen Personen in Die Körperfresser kommen oder die Zombies in The Walking Dead sind unsere jungen Menschen nach und nach Opfer dieser digitalen Plage geworden.
Einen ersten, flüchtigen Eindruck dieser aufkommenden globalen Epidemie bekam ich im Sommer 2002 auf der Insel Kreta. Meine frisch angetraute Ehefrau und ich hatten eine Reise nach Griechenland, dem Land meiner Eltern und Vorfahren, geplant, um dem hektischen Leben in New York zu entfliehen.
Nach den üblichen Zwischenstopps auf Mykonos und Santorini wollten wir mit der Fähre zur schrofferen Insel Kreta fahren und dort in der Samaria-Schlucht bis zum entlegenen Küstenort Loutro wandern. Das Dorf ist einfach magisch: ein atemberaubender, sonnendurchfluteter griechischer Strand mit lachenden Badenden, die im klaren, blauen Wasser herumplantschen; ein wunderbarer, friedlicher Ort, den die Zeit vergessen zu haben scheint … es gibt keine Autos, keine Minimärkte, kein Fernsehen, keine blinkenden Lichter – nur traditionelle, weiß getünchte Häuser und eine Handvoll kleiner Tavernen am Meer.
Loutro gilt auch als perfekter Ort für Familien. Durch die Abgeschiedenheit des verkehrsfreien Dorfes ist es der ideale Kinderspielplatz: Kajak fahren, schwimmen, auf Felsen klettern, Fangen spielen, ins Wasser springen – ein Paradies für Kinder.
An unserem ersten Tag gingen wir, nachdem wir den ganzen Vormittag am Strand verbracht hatten, in eins der Cafés, um einen Frappé zu trinken. Dort fragte ich den Kellner nach den Toiletten und er zeigte auf eine steile Treppe, die hinab in einen schwach beleuchteten, niedrigen Kellerraum führte. Unten sah ich ein merkwürdiges Licht in einer Ecke, das sich von der Dunkelheit abhob. Ich kniff die Augen zu, um mich in dem dunklen Raum orientieren zu können, und erkannte dann den Ursprung der Lichtquelle: Ich stand in Loutros blutleerer Version eines Internetcafés – zwei alte Apple-Computer auf einem winzigen Tisch in einer Ecke des deprimierenden Kellers. Als ich genauer hinschaute, erkannte ich die dunklen Silhouetten zweier pummeliger amerikanischer Teenager, die Videospiele zockten und deren rundliche Gesichter von den nur wenige Zentimeter entfernten Bildschirmen hell erleuchtet wurden.
Wie merkwürdig, dachte ich; einer der weltweit schönsten Strandabschnitte, wo die ortsansässigen griechischen Kinder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang spielten, lag nur wenige Schritte entfernt, doch diese beiden hier verschanzten sich an einem sonnigen Nachmittag in der Dunkelheit.
Im Laufe der Woche führte mich mein Weg noch mehrfach in dieses Café und immer saßen die beiden Kinder dort im Keller und ihre Gesichter wurden von den Bildschirmen angestrahlt. Damals war ich noch kein Vater und dachte nicht groß über die pummeligen Kinder mit den leuchtenden Gesichtern nach, sondern tat sie – vorschnell urteilend, das muss ich zugeben – als ungesunde Kinder schlechter Eltern ab.
Trotzdem vergaß ich niemals den hypnotisierten Gesichtsausdruck dieser Jungen, die in dem furchtbaren Keller Computer spielten, während das Paradies direkt über ihren Köpfen lag. Doch langsam, wie ein stetig tropfender Wasserhahn, machte sich in mir die Erkenntnis breit, dass sich die hypnotisierten, glasigen Blicke verbreiteten; wie eine virtuelle Plage multiplizierten sich die Bildschirm-Kids und Jugendlichen.
Handelt es sich dabei nur um ein harmloses Vergnügen oder eine Modeerscheinung in der Art eines digitalen Hula-Hoop-Reifens? Manche meinen, leuchtende Bildschirme könnten sogar gut für die Kinder sein – ein interaktives Bildungswerkzeug.
Aber die Forschung kann diese Behauptung nicht bestätigen. Es gibt nicht einmal eine einzige glaubwürdige Forschungsarbeit, die zeigen würde, dass ein Kind, das in jungen Jahren der Technik ausgesetzt wurde, bessere Bildungsergebnisse erzielen würde als ein Kind, das ohne technische Geräte aufgewachsen ist. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass Kinder, die Zeit vor Bildschirmen verbringen dürfen, über etwas bessere Fähigkeiten zur Mustererkennung verfügen, aber keine Forschungsarbeit weist darauf hin, dass sie auch besser in der Schule sind oder besser lernen können.
Stattdessen stehen wir vor einem wachsenden Berg an Beweisen für erhebliche negative klinische und neurologische Auswirkungen bei Bildschirm-Kids. Bildgebende Verfahren in der Hirnforschung zeigen, dass die leuchtenden Bildschirme – wie zum Beispiel die von iPads – das Belohnungszentrum im Gehirn genauso stimulieren und den Dopaminspiegel (das sogenannte Wohlfühl-Hormon) genauso ansteigen lassen wie Sex. Dieser Hirnorgasmus-Effekt macht die Bildschirme so reizvoll für Erwachsene, aber noch viel stärker für Kinder, deren Gehirne sich noch in der Entwicklung befinden und die mit einer so starken Stimulation noch nicht umgehen können.
Darüber hinaus gibt es immer mehr klinische Forschungsarbeiten, die einen Zusammenhang zwischen Bildschirmtechnologien und psychiatrischen Erkrankungen wie ADHS, Sucht, Ängsten, Depressionen, gesteigerter Aggression und sogar Psychosen herstellen. Neueste Studien unter Nutzung bildgebender Verfahren zeigen sogar eindeutig, dass eine exzessive Bildschirmnutzung die gleichen neurologischen Schäden in einem sich noch entwickelnden Gehirn eines jungen Menschen hervorrufen kann wie eine Kokainsucht.
Sie haben richtig gelesen: Das Gehirn eines Kindes, das zu stark der Technologie ausgesetzt ist, sieht genauso aus wie ein Gehirn auf Drogen.
Leuchtende Bildschirme sind sogar eine so mächtige Droge, dass die University of Washington ein Virtual-Reality-Videospiel bei Verbrennungsopfern zur Schmerztherapie während der Behandlung nutzt. Erstaunlicherweise stellt sich bei diesen Patienten, während sie in das Spiel eingetaucht sind, ein schmerzreduzierender, morphinartiger analgetischer Effekt ein, sodass sie keine Betäubungsmittel benötigen. Natürlich ist das ein wünschenswerter Einsatz für die Bildschirmtechnologie, allerdings verabreichen wir dieses digitale Morphin auch unbeabsichtigterweise unseren Kindern.
Während wir den Drogen den Kampf angesagt haben, haben wir zugelassen, dass sich eine virtuelle Droge in unsere Wohnungen, Häuser und die Klassenzimmer unserer jüngsten und verletzbarsten Mitglieder unserer Gesellschaft schleicht – und dabei alle negativen Auswirkungen außer Acht gelassen. Eine virtuelle Droge, die Dr. Peter Whybrow, Leiter der Abteilung für Neurowissenschaften an der UCLA, der University of California, als „elektronisches Kokain“ bezeichnet und die Commander Dr. Andrew Doan, Dr. der Neurowissenschaften und Leiter für Suchtforschung bei der US-Navy, als digitale „pharmakeia“ (griechisch für ‚Droge‘) betitelt sowie chinesische Forscher als „elektronisches Kokain“ ansehen.
Mittlerweile nennt China die Internetabhängigkeit als seine Gesundheitskrise Nummer Eins und verzeichnet mehr als 20 Millionen internetsüchtige Teenager. Südkorea hat 400 Suchtzentren für Mediensucht eröffnet und verteilt an alle Schüler und Schülerinnen, Lehrkörper und Eltern ein Handbuch, das sie vor den möglichen Gefahren durch Bildschirme und Technologien warnt. Doch in den USA drücken ahnungslose und manchmal korrupte Schulbürokraten leuchtende Tablets – ja, elektronisches Kokain – allen Kindergärtnerinnen in die Hand. Warum nicht? Schließlich ist technische Ausstattung in Klassenräumen ein lukratives Geschäft, das sich 2018 schätzungsweise auf mehr als 60 Milliarden Dollar belaufen hat. Was ich bei der Recherche zu diesem Buch ebenfalls entdeckte, ist, dass Technologie im Klassenraum auch eine Geschichte der Habgier, Skandale und FBI-Ermittlungen ist.
Aber wenn schon unsere Schulen uns im Stich lassen, indem sie unsere Kinder nicht vor den Gefahren der nicht altersgemäßen Technologien schützen, dann erkennen doch wohl die Eltern die Probleme, die durch die Bildschirmzeit entstehen, oder? Leider verhält es sich aber so, dass viele Eltern, die sich Gedanken machen und es gut meinen, gar nicht wissen, wie schädlich die Bildschirmnutzung ist, oder dass diejenigen, die sich darüber im Klaren sind, dass es ein Problem gibt, dieses der Bequemlichkeit halber einfach verneinen.
Schließlich fällt es schwer zu akzeptieren, dass etwas, was so viele von uns mittlerweile selbst so gern mögen, in irgendeiner Form schlecht für uns und noch viel schädlicher für unsere Kinder sein kann. Wir sind inzwischen so abhängig vom digitalen Babysitter oder der sogenannten virtuellen Lernhilfe, dass wir eigentlich nicht hören wollen, dass unsere praktischen, schmucken Smartphones und unsere wunderbaren, allwissenden iPads tatsächlich dem Gehirn unserer Kinder schaden können – bitte sag, dass das nicht wahr ist!
Aber ob Sie es hören wollen oder nicht, es ist wahr.
Als einer der führenden Suchtexperten unseres Landes erkenne ich Sucht, sobald ich sie sehe. Und ich sehe sie in epidemischem Ausmaß beim obsessiven Videospiel, dem zwanghaften Texten und den hypnotisierten Blicken der Kinder und Jugendlichen, die ich behandle. In den letzten zehn Jahren habe ich mit mehr als tausend Teenagern klinisch gearbeitet und die schleichenden, süchtig machenden Auswirkungen der Bildschirmzeit beobachtet, die zu einer ganzen Reihe von klinischen Störungen und einem digital hervorgerufenen Unwohlsein bei Heranwachsenden führen.
Doch während überall auf der Welt Bildschirme unsere Kinder hypnotisieren, ignorieren Eltern entweder das Problem oder schlagen nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagen seufzend: „So sind Kinder heutzutage nun einmal.“ Aber Kinder waren nicht immer so; es ist erst dreizehn Jahre her, dass das iPad erfunden wurde – und innerhalb kürzester Zeit wurde eine ganze Generation an Kindern und Jugendlichen psychisch beeinflusst und neurologisch neu verdrahtet.
Ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass ich bei Technikfans und Videospielenden auf Widerstand oder sogar Verärgerung stoßen werde. Aber weder dieses Buch noch ich sind gegen die Technik. Dieses Buch möchte Erwachsene, die sich Gedanken über die Gesellschaft, in der sie leben, machen, informieren und gleichzeitig Eltern über die klinischen und neurologischen Gefahren exzessiver Bildschirmzeit ihrer Kinder in Kenntnis setzen und vor diesen warnen.
Ich mag meine technischen Geräte. Ich fahre auch gern Auto; ich bin nur der Meinung, meine achtjährigen Zwillinge sollten noch nicht Auto fahren. Also, keine Bange, ihr Videospielkrieger, mein Fokus liegt auf den Folgen der Technik für Kinder. Ich werde denjenigen, die schon mündig sind, nicht raten, den Stecker zu ziehen. Auch wenn Sie nach dem Lesen möglicherweise häufiger vor die Tür gehen werden. Um den großartigen William Shatner in seiner berühmten Star-Trek-Convention-Parodie in Saturday Night Live vor ein paar Jahren zu zitieren: „Get a life!“ (‚Führt ein Leben!‘) Und damit meine ich kein nicht-reales, künstliches Leben und erst recht kein Second Life. Ich meine ein waschechtes Leben, bei dem man nach draußen geht, an Rosen riecht, eine Freundin hat, das Gras unter seinen Füßen spürt.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich kann den Reiz der Technik absolut nachvollziehen, denn ich bin nicht nur ein Suchtexperte, ich bin sogar ein ehemaliger Süchtiger – ein wahrer Meister in der Realitätsflucht. Hand aufs Herz, obwohl ich schon seit vielen Jahren von meinen Suchtproblemen genesen bin, ist es für mich immer noch eine große Herausforderung, eine gesunde Beziehung zu meinem verführerischen, kleinen Smartphone zu haben.
Als Leiter einer führenden Reha-Einrichtung und Behandler vieler Patienten rede ich mir ein, ich müsse ständig verfügbar sein, falls es bei einem Patienten zu einem Notfall kommt. Aber die Wahrheit lautet, dass es mir schwerfällt, den Stecker zu ziehen – sogar im Urlaub. So wie ein Kardiologe, der raucht, merke ich, dass ich nicht dagegen immun bin, dass sich bei mir wieder Sucht erzeugende Tendenzen einschleichen. Und ich frage mich: Wenn es mir mit einem vollständig entwickelten Gehirn eines Erwachsenen und mit all meinem Wissen und der geleisteten Arbeit gegen die Sucht so schwerfällt, meinen Gebrauch technischer Geräte einzuschränken, welche Chance hat dann ein impulsiver Achtjähriger?
Egal was wir über den Gebrauch technischer Geräte bei Erwachsenen denken, man muss kein Suchtexperte oder Neurowissenschaftler sein – und auch kein Technikfeind –, um die nicht zu leugnenden Auswirkungen nicht altersgemäßer Technik zu sehen, sowohl in den neuesten Forschungsergebnissen als auch in der alltäglichen Realität eingestöpselter und ausgeschalteter Kinder.
Doch auch wenn kluge Schreibende und scharfsinnige Blogger über die Vor- und Nachteile der Technologie diskutieren, fügt die steigende Allgegenwart der Technik jetzt unseren Kindern erheblichen Schaden zu.
Wie der verstorbene, großartige Yogi Berra sagen würde: „Es wird verdammt früh spät.“
Kapitel 1
Invasion der Bildschirm-Kids
Verloren in der Matrix
Vor fast zehn Jahren hatte ich einen „Houston, wir haben ein Problem“-Moment. Natürlich hatte ich schon Jahre zuvor ein paar beunruhigende Warnhinweise in Griechenland gesehen, aber bis 2007 war ich mir glückseligerweise nicht darüber im Klaren, wie gravierend das Problem ist; ich hatte noch nicht vollständig begriffen, wie neurologisch schädlich und süchtig machend die hypnotisierend-leuchtenden Bildschirme für Kinder sein können.
All das änderte sich an einem kühlen Oktobernachmittag in besagtem Jahr. Ich dachte, ich wüsste genug über Sucht – schließlich unterrichtete ich dieses Fach an einer großen Universität, war Professor für Neurowissenschaft und auf die Suchtbehandlung in meiner Praxis spezialisiert; ich kannte also jegliche Geschmacksrichtungen der Sucht – so dachte ich zumindest.
Ebenso dachte ich, ich hätte schon alles gesehen, wenn es um die Arbeit mit jungen Menschen ging. Als Berater für psychische Gesundheit an einer örtlichen Highschool hatte ich Hunderte Teenager unterstützt; ich hatte Kinder gesehen, die sexuell missbraucht worden waren, drogensüchtige Schüler, asoziale Teenager, Gangmitglieder, Anarchisten, Pädophile, Schizophrene, amokbereite Außenseiter, Ritzende, obsessiv-kompulsive Schüler und Brandstifter.* Auf all das traf ich in meinem Alltag.
Aber ich war überhaupt nicht auf Dan vorbereitet, einen Jungen, der an jenem schicksalsträchtigen Tag im Jahre 2007 zu mir geschickt wurde.
Als er mein Büro betrat, wirkte er wie betäubt und desorientiert … und verängstigt. Er setzte sich langsam auf den Stuhl gegenüber meinem Schreibtisch, zappelte nervös herum und zuckte ständig mit dem Kopf, während er sich ängstlich in meinem Büro umschaute.
Ich fragte ihn, ob er wüsste, wo er war; er antwortete nicht, sondern blinzelte und schaute sich die ganze Zeit nervös um, wobei sein Kopf in ständiger Bewegung war.
„Dan, weißt du, wo du bist?“, fragte ich erneut. Wiederum keine Antwort.
Nach einer langen, ungemütlichen Zeit der Stille schaute er plötzlich zur Deckenlampe und kniff die Augen zusammen, als ob er sich zu orientieren versuchte. Noch immer blinzelnd ließ er seinen Blick senken, sodass er mich mit seinen dunkelbraunen Augen anstarrte. Auf seinem Gesicht zeigte sich die Angst und Verwirrung von Menschen, die Dinge sehen – manchmal furchtbare, manchmal profane –, die dem Rest von uns verborgen bleiben. Ich kannte diesen erschrockenen Blick; ich hatte ihn häufig bei meiner Arbeit mit Schizophrenen beobachtet.
Obwohl dieser blasse 16-jährige Schüler mit fettigen Haaren und einem abgewetzten Metallica-T-Shirt keine Krankengeschichte einer psychischen Erkrankung oder eines Substanzmissbrauchs vorzuweisen hatte, hatte man ihn zu mir geschickt, weil er sich sehr merkwürdig verhalten hatte.
Noch einmal, diesmal mit mehr Nachdruck, fragte ich ihn: „Weißt du, wo du bist?“
Abermals blinzelte er.
Dann schaute er mich schließlich direkt an und stammelte sichtlich verwirrt: „Sind … sind … wir noch im Spiel?“
Nein, das waren wir eindeutig nicht.
Dan war meine erste Begegnung – und es sollten noch viele weitere folgen – mit einer Psychose durch Videospiele (auch als „Game Transfer Phenomena“1 [GTP, ‚Spielübertragungsphänomen‘] oder „Tetris-Effekt“2 bekannt), eine Form des psychotischen Schubs, der auftreten kann, wenn man durch exzessives Videospielen, oftmals in Kombination mit Schlafmangel, nicht mehr unterscheiden kann, was real und was Fantasie ist. Und Dan hatte das Fantasy-Spiel World of Warcraft 10 bis 12 Stunden am Tag gespielt und sich in der Matrix verloren.
Ich erfuhr, dass World of Warcraft ein mythisches Rollenspiel (kurz: RPG für „Role-Playing-Game“) ist, das im Fantasy-Reich Azeroth spielt und die Geschichte eines Krieges zwischen zwei Fraktionen, der Allianz und der Horde, erzählt. Unglaublich detailliert, mit einer gut geschriebenen Story und von den Spielern gegründeten und verwalteten Gilden ist WoW ein sehr fantasievolles Spiel mit Möglichkeiten zur sozialen Interaktion mit anderen Spielern über eine sogenannte Voice-Interface – eine stimmliche Benutzerschnittstelle. Diese Spiele, bei denen sich mehrere Spieler miteinander verbinden können, heißen Massively Multiplayer Online Games bzw. MMOs, deutsch ‚Massen-Mehrspieler-Online-Spiel‘.
Durch ihre Erlebnisse in der Video-Welt werden die Spieler emotional involviert, interessieren sich stark für den Fortschritt ihres Charakters und für die Bindung zu ihren Mitspielern. Mit mehr als zehn Millionen Abonnenten ist World of Warcraft das beliebteste „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“ (abgekürzt MMORPG, deutsch übersetzt ‚Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel‘) weltweit.
Während ich dort saß und versuchte, einen Zugang zu Dan zu finden, wurde mir klar, dass Kinder und Jugendliche, die sich in der Fantasie eines Videospiels verloren hatten, Neuland für mich waren. Das Verschwimmen der Realität sollte schon lange durch psychedelische Drogen erzielt werden; Suchtpsychologen arbeiten mit der substanzinduzierten Psychose durch LSD, Meskalin und Angel Dust. Doch jetzt schien diese neue Bewusstseinsveränderung des 20. Jahrhunderts ein Nebenprodukt einer digitalen Droge zu sein.
Als Dan in meinem Büro saß, war er sichtlich ängstlich und verwirrt. Er litt unter den psychischen Symptomen sowohl einer Derealisation (man weiß nicht, was real ist) als auch einer Depersonalisation (dabei haben Menschen das Gefühl, selbst nicht real zu sein); sein Hirn war Matsch, weil er vollständig in seinem Fantasy-Spiel aufgegangen war.
Durch meine Arbeit mit psychiatrischen Patienten, die solche dissoziativen Störungen aufwiesen, wusste ich, dass Erdungstechniken hilfreich sein können. Im Grunde hilft man dem Patienten, seine bzw. ihre fünf Sinne zu nutzen, um die Unmittelbarkeit – die Körperlichkeit – des gegenwärtigen Moments zu spüren. Dan und ich stellten uns also voreinander hin und klatschten laut in die Hände; dadurch konnte er sich kurz aus seiner Wahnvorstellung befreien. Ich bat ihn, sich ein Blatt Papier zu schnappen und dieses zu zerknüllen, was er auch tat.
„Wo sind wir?“
„Du bist in meinem Büro und sprichst mit mir. Bist du noch im Spiel?“
„Nein, ich glaube nicht … aber ich fühle mich komisch … als ob ich noch nicht in meinem Körper wäre.“ Dann berichtete Dan von seinen Erfahrungen beim WoW-Spielen. Er war so WoW-süchtig, dass er die ganze Nacht durchspielte, nicht aß, nicht schlief und nicht ins Bad ging; er pinkelte einfach in ein Einmachglas, das neben seinem Computer stand. Irgendwann erfuhr ich, dass es für World of Warcraft-Enthusiasten nicht ungewöhnlich ist, in Einmachgläser zu pinkeln; die süchtig machende Anziehungskraft des Spiels ist so groß, dass manche sogar Windeln tragen wie Astronauten oder Fernfahrer, um bloß keinen Augenblick der Spielzeit zu verpassen.3
Dann begann er zu weinen. „Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was hier passiert … werde ich verrückt?“
Weil seine Symptome kurzfristig besser wurden, sich dann aber plötzlich verschlechterten und Bilder aus dem Spiel ihn wie Flashbacks völlig überwältigten, wurde er in die psychiatrische Notaufnahme gebracht. Der arme Junge blieb einen Monat lang im Krankenhaus in der Abteilung für Psychiatrie und wurde dort mit Antipsychotika und Psychotherapie stabilisiert, um irgendwann wieder in die Realität zurückzufinden.
Als er im Krankenhaus war, sprach ich mit seiner Mutter und befragte sie zu seinem exzessiven, die ganze Nacht dauernden Videospiel. Seine Mutter war alleinerziehend, hatte nur eine geringe Schulbildung genossen und arbeitete im örtlichen Walmart. Dass er wie ein Vampir die ganze Nacht aufblieb, machte ihr nur geringe Sorgen, war sie doch froh, dass er zumindest „sicher zu Hause war und nicht wie andere Jugendliche auf der Straße herumlungerte“, wenn er sich in seinem Zimmer verkroch und Videospiele spielte.
Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bat er mich um Hilfe, um von den Spielen die Finger zu lassen. Ich ermutigte ihn, all seine Videospiele in die Mülltonne zu werfen und wieder vermehrt Dinge zu tun, die er gern machte. Vor seiner Videospielzeit hatte er gern Basketball auf dem örtlichen Spielplatz gespielt – ich bestärkte ihn, nach draußen zu gehen und wieder Ball zu spielen.
Rund eine Woche später erhielt ich einen wütenden Anruf seiner Mutter.
„Wissen Sie, wie teuer diese Spiele und elektronischen Geräte sind, die er Ihrer Meinung nach wegwerfen soll? Wissen Sie das?!“
Verdutzt antwortete ich: „Ihr Sohn wurde gerade erst nach einem Monat aus der Psychiatrie entlassen, wo er aufgrund von Problemen war, die auf sein exzessives Videospiel zurückzuführen sind oder zumindest dadurch gefördert wurden. Möglicherweise hat er zugrunde liegende Probleme – das wissen wir noch nicht –, aber diese Spiele waren definitiv nicht hilfreich.“
Ich hielt inne und gab mein Bestes, ihr begreiflich zu machen, dass Dan von den Videospielen loskommen wollte. „Mrs. Smith, er hat mich um Unterstützung gebeten, damit er die Finger von den Spielen lässt. Er hat mich um Hilfe gebeten.“
Ich bin nicht leicht zu schockieren, doch bei ihrer Antwort war es der Fall: „Ja, aber jetzt möchte er nach draußen und dort spielen! Er möchte auf dem Spielplatz Basketball spielen! Wer weiß, was ihm da draußen alles passieren kann!“
Mit der Zeit begriff ich es: Beim Phänomen der Videospiele geht es darum, dass Kinder und Jugendliche etwas suchen und Eltern in falschem Glauben meinen, sie würden dafür sorgen, dass ihre Kinder drinnen in Sicherheit sind. Oder sie waren, wenn sie ein besseres Gefühl bezüglich des digitalen Babysitters haben wollten, davon überzeugt, dass die Kinder durch Videospiele und Bildschirme sogar etwas lernen oder sich besser fokussieren könnten und sich ihre Augen-Hand-Koordination verbessern würde – oder was auch immer die Verpackung des Spiels behauptete.
Leider haben sich seit 2007, als ich mit Dan arbeitete, die Bildschirmkultur und das Videospielen wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Heute spielen 97 Prozent der US-amerikanischen Kinder und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren Videospiele.4 Das sind 64 Millionen junge Menschen. Und die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr.*
Was treibt dieses Wachstum voran – was ist so verlockend an einem Videospiel?
Gewiss, Shooter-Spiele (deutsch Schießspiele) können einen Adrenalinschub hervorrufen, was Kindern und Jugendlichen sicherlich gefällt; und 3-gewinnt-Puzzlespiele wie Candy Crush und Aufbauspiele mit mehreren Leveln wie Minecraft haben bestimmt ihren eigenen stark süchtig machenden Reiz. Aber was machen wir mit der explosionsartigen Verbreitung von Fabel- und Fantasy-Spielen wie World of Warcraft, die mehrere zehn Millionen Kinder und Jugendliche in ihren Bann ziehen? Mittlerweile habe ich begriffen, dass für manche Spielende der Reiz viel tiefer und grundlegender ist als nur der Adrenalinschub. Möglicherweise sitzt das Bedürfnis nach mythischen Erlebnissen tief in unserer menschlichen Psyche.
Der legendäre Schweizer Psychologe Carl Jung und sein Anhänger, der Mythologe und Autor Joseph Campbell, schrieben beide umfassend über unser Bedürfnis nach Mythen und die Seelen nährende Rolle archetypischer Erfahrungen. Auf einer sehr tiefen, menschlichen Ebene brauchen wir unsere Mythen – unsere Schöpfungsgeschichten, unsere Heldenreisen, unsere Gleichnisse und unsere moralischen Lehrstücke.
Doch im Großen und Ganzen haben wir dies in unserem modernen Zeitalter verloren. Vor fast 100 Jahren schrieb Jung, dass die moderne Welt „entmystifiziert“ worden war und eine „Armut der Symbollosigkeit“ erführe;5 während sich unser Leben durch die Fortschritte der Wissenschaft – von medizinischen Behandlungen bis hin zu nützlichen Haushaltsgeräten – eindeutig stark verbessert hat, hat der Ikonoklasmus der Wissenschaft aber auch zu einer Bedeutungsleere geführt. Die Wissenschaft hat uns unsere Mythen genommen, uns gesagt, dass es keine Götter oder Dämonen, keinen Himmel und keine Hölle, keine Mysterien von Eleusis, keinen Weihnachtsmann und keine Zahnfee gibt. Stattdessen erzählt uns die Wissenschaft, dass die Welt ein eher kalter, mechanistischer Ort ohne Mythen oder Bedeutung – ohne das für die menschliche Psyche benötigte Lebenselixier – ist.
In dieser archetypischen Wüste werden mythenhungrige junge Menschen zu Fantasiewelten hingezogen, wo sie die Verkörperung des grundlegendsten aller Archetypen spielen können – die Heldenreise. In Der Heros in tausend Gestalten (1949)6 beschreibt Joseph Campbell diesen Archetypen, den man in den Mythen einer jeden Kultur finden kann: ein Held, der Hindernisse überwinden, Initiationsriten überstehen und zahlreiche Schwellen überschreiten muss, um das transformierende Ziel zu erreichen, das Inhalt seiner oder ihrer Reise ist. In diesem Sinne sind die heutigen mythischen Fantasy-Spiele wie World of Warcraft nichts anderes als digitale Versionen einer Heldenreise auf einem hypnotisch leuchtenden Bildschirm.
Bei meiner Arbeit mit Hunderten von Gamern merkte ich, dass viele dieser Kids auf der Suche nach einer tiefergehenden Verbindung und einer Sinnhaftigkeit sind. Entfremdet und haltlos in seelenlosen und institutionellen anstaltsmäßigen Oberschulen findet der nach einem Sinn lechzende Jugendliche seinen Zweck in einem Fantasy-Reich voller Abenteuer, wo Monster abzuschlachten, Konkurrenten auszuschalten und Preise zu holen sind; dort finden sie eine die Seele befriedigende Sinnhaftigkeit – und wenn das Spiel mit anderen zu spielen ist, eine gemeinsame Sinnhaftigkeit.
Als ich meine zahlreichen jungen Patienten behandelte und mit ihnen sprach, zeigte sich noch eine weitere Dynamik: Flucht. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Teenager, der nirgendwo so richtig hineinpasst. Oder Sie mögen Ihr Aussehen nicht oder leben in einer dysfunktionalen Familie; oder nehmen wir einmal an, Sie fühlen sich allein und leer und sind häufig niedergeschlagen. Sie hassen die Schule und haben keine richtigen Freunde. In der brutalen Dynamik der Hierarchie unter Heranwachsenden und deren Hackordnung stehen Sie draußen und schauen von dort hinein – und dort sitzen all die coolen Kids zusammen am coolen Tisch in der Schulcafeteria.
Würden Sie diesem Leben entfliehen, wenn Sie könnten? Für manche hat die Matrix ihren ganz besonderen Reiz.
Natürlich gibt es auch noch die alten Dauerbrenner Drogen und Alkohol, um dem Gefühl, nicht dazuzugehören oder sich in seiner eigenen Haut nicht wohlzufühlen, Abhilfe zu schaffen. Aber die Jugend von heute kann sich auch in magischen Fantasy-Welten verlieren und sich in diesen neu erfinden; Welten, wo sie starke und mächtige majestätische Charaktere schaffen können, die jeden in Vergessenheit geraten lassen, während sie auch noch irgendein nobles, gemeinsames Ziel verfolgen.
Was würden Sie wählen: Draußen stehen und nach drinnen auf den coolen Cafeteria-Tisch in der Schule blicken oder ein magischer Hexenmeister sein, der ganze Welten erobern kann?
Eine Zeit lang arbeitete ich mit einem spielsüchtigen 16-Jährigen namens Matthew, der nicht aufhören konnte, Final Fantasy zu spielen. Final Fantasy ist wie World of Warcraft ein Fantasy-RPG, in dem jeder von vier als „Kämpfer des Lichts“ bezeichneten Jugendlichen einen der verblassten Elementkristalle bei sich trägt, deren Macht durch den Einfluss der vier Elementargewalten erlosch. Zusammen machen sich die Kämpfer des Lichts auf eine Reise, um gegen böse Mächte zu kämpfen, die Macht der Elementkristalle wieder herzustellen und ihre Welt zu retten. Final Fantasy ist ein Paradebeispiel für eine Heldenreise.
Ich konnte nachvollziehen, warum Matthew so sehr in diesem Spiel aufging: Matthew war ein sehr lieber, sensibler und leise sprechender junger Mann, der in einer verdreckten, heruntergekommenen Wohnung bei seinen körperlich bzw. psychisch beeinträchtigten Eltern lebte. Sein Vater war ein verletzter Kriegsveteran, seine Mutter eine ans Haus gebundene, psychisch kranke, berufsunfähige Frau. Ihre Wohnung war ein solch unhygienischer Saustall, dass das Jugendamt häufig zu Besuch kam. In der Schule wurde Matthew mit dem Spitznamen „Kakerlakentyp“ gehänselt, weil mehrfach Küchenschaben aus seiner Kleidung und auf den Schreibtisch gefallen waren.
Es war mehr als verständlich, dass Matthew lieber den Großteil seines Tages als Krieger des Lichts in Final Fantasy verbrachte statt als „Kakerlakentyp“. Aber nicht alle Kinder und Jugendlichen, die videospielsüchtig werden, um der Realität zu entfliehen, kommen aus einem so dysfunktionalen Umfeld. Andere wohnen in hübschen Häusern mit liebevollen Eltern. In manchen Fällen entflieht der Jugendliche nicht unbedingt einer furchtbaren, externen Realität; manchmal flieht er oder sie vor intrapsychischen Dämonen oder Unbehagen. So ein junger Mann war Jonathan. Seine Mutter war eine sehr geschätzte Pädagogin an einer örtlichen Schule, sein Vater ein liebevoller und unterstützender Dad, der ein eigenes Geschäft führte. Jon, der introspektiv war, bekam immer düstere Gedanken und fing an, sich mit extremen Verschwörungstheorien zu beschäftigen: 9/11 Truthers, Illuminati, Neue Weltordnung. Eine Zeit lang hing er mit einer Gruppe Gothics rum, doch auch ihnen waren seine antisozialen Aussagen irgendwann zu viel. Er fühlte sich isoliert und sprach davon, in eine Hütte zu ziehen, um „aus dem Netz auszusteigen“. Doch stattdessen fiel er in die Matrix, als er sich zu sehr in World of Warcraft verlor.
Für die sozial besser integrierten Jugendlichen liegen die Fallen woanders. Wenn man das Glück hat, zu der Gruppe der coolen Kids am Cafeteria-Tisch zu gehören, hat die Flucht in ein Videospiel wahrscheinlich keinen so großen Reiz. Natürlich kann ein Shooter-Spiel aufgrund des Adrenalinschubs Spaß machen, aber man sitzt mit den Coolen an einem Tisch – wieso sollte man dann 7 Tage die Woche 24 Stunden lang der Realität entfliehen wollen? Ja, wenn man zu den Coolen gehört, sind Videospiele vielleicht nicht so attraktiv, aber wie sieht es mit Social Media aus? Die sind eine ganz andere Sache.
Gemeine Mädchen – und Jungs – sind nicht mehr auf den guten, alten Tratsch von Mund zu Mund und verbale Äußerungen beschränkt, um die soziale Hackordnung aufrechtzuerhalten; jetzt stehen ihnen Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Kik und alle anderen sozialen Medien zur Verfügung, um ihr Waffenarsenal zu erweitern.
Da liegt der Hase im Pfeffer: Videospiele machen einsame Kinder und Social Media die coolen Kids jeweils genauso süchtig wie Heroin einen Junkie.7 Mit jedem virtuellen Gewehrschuss, jeder Textnachricht und jedem Tweet wird Dopamin – ein winziger Spritzer – freigesetzt, genauso wie Kokain dafür sorgt, dass der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird.8 Und leider sind manche Kids aufgrund ihrer Genetik oder ihres psychologischen Temperaments anfällig für Suchtverhalten, wodurch sie eher dazu neigen, süchtig nach den verschiedenen digitalen Dopaminstimulanzien zu werden.
Doch bei meiner jahrelangen Arbeit mit Suchtfällen habe ich eine wichtige Lektion gelernt: Sogar ein „durchschnittlicher“ Erwachsener oder Jugendlicher kann abhängig werden – auch der Jugendliche ohne ein schlimmes häusliches Umfeld oder innere Dämonen kann in die Suchtfalle tappen. Egal warum Sie es tun, wenn Sie zu viel Alkohol trinken oder den ganzen Tag lang Dopamin aktivierende Videospiele zocken, können auch Sie in den Suchtsog gezogen werden.
Überraschenderweise sind digitale Drogen sogar noch heimtückischer und problematischer als unerlaubte Drogen, weil wir uns vor ihnen nicht so stark in Acht nehmen. Sie sind allgegenwärtig, werden von der Gesellschaft stärker akzeptiert und durch diese noch mehr verstärkt, als es bei ihren als schlecht angesehenen, pulverförmigen Pendants der Fall ist, wodurch sie so viel leichter zur Verfügung stehen. Höchstwahrscheinlich findet man in einem Klassenzimmer keine pulverförmigen Drogen, aber ganz bestimmt trifft man dort auf Tablets, Game Boys und Smartphones mit all ihren süchtig machenden und potenziell bewusstseinsverändernden Wirkungen. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Kinder, die diesen digitalen Drogen ausgesetzt werden, immer jünger werden.
Der Tetris-Effekt
Ein typisches Klassenzimmer einer dritten Klasse in einem Vorort: Kunstprojekte hängen an den Wänden, Achtjährige sitzen in kleinen Gruppen an ihren Schreibtischen, eine ernsthafte junge Lehrerin steht vorne im Klassenraum.
Die Kinder sind gerade aus der Pause gekommen und im Klassenzimmer ist ein aufgeregtes Murmeln zu vernehmen, weil jetzt die Lesezeit beginnt – und das bedeutet iPads! Die Lehrerin geht nach hinten, schließt den Technikschrank auf und bittet die Kinder, sich in einer Reihe aufzustellen, um sich ihre Tablets abzuholen. Als sie ihre Geräte erhalten, lächeln und kichern sie. Zurück auf ihren Sitzplätzen loggen sie sich bei Raz Kids ein und gehen dort zu Animals, Animals, dem E-Book, bei dem sie gestern aufgehört haben.
„Lest in eurem eigenen Tempo weiter – und meldet euch, wenn ihr Fragen habt“, sagt die Lehrerin mit sanfter Stimme zu ihren Schülern und Schülerinnen, die alle bereits nur noch Augen für ihre Tablets haben. Ein Mädchen mit Pferdeschwanz gebraucht ihren Finger, um über Kamelhöcker zu lesen; ein schlaksiger Junge, der ganz nah bei der Lehrerin sitzt, hält sich den Bildschirm direkt vor die Nase, um sich ein Foto von einem Nilpferd anzuschauen.
Engagierte und folgsame Schüler, eine hilfsbereite und achtsame Lehrerin – das Ideal einer Technik-Schüler-Lehrer-Synergie scheint hier gegeben zu sein.
Doch nach ein paar Minuten fangen ein paar Kinder zu zappeln an und wippen mit den Füßen; zwei Jungen in einer Sitzgruppe am hinteren Ende des Klassenraums haben Raz Kids weggeklickt und spielen nun Minecraft. Fünfzehn Minuten später, als die Lehrerin der Klasse sagt, sie sollen ihre iPads hinlegen, da die Lesezeit vorbei sei, sind die beiden Jungen sichtlich unruhig und trotzig, sodass die Lehrerin zu ihnen hinübergehen und ihre Aufforderung wiederholen muss. Während ein Junge sich fügt, ist der andere weiterhin aufsässig und brüllt: „Nein, ich will nicht!“
Später erzählt die Lehrerin mir: „Es ist meistens so, dass ein paar Schüler ziemlich aufgewühlt und eigensinnig reagieren, wenn ich ihnen sage, dass sie die Tablets weglegen sollen. Mich regt es auf, wie wütend sie werden können, wenn ich ihnen sage, dass sie aufhören sollen. Der eine Junge ist ja fast ausgerastet.“
Eine andere Lehrerin einer dritten Klasse hat die folgende beunruhigende Erfahrung gemacht: „Als wir einen Leseklub gründeten – also ein Buch außerhalb des normalen Rahmens gemeinsam lasen –, fragte ich Sam, einen lieben und nachdenklichen Jungen, was er über den Abschnitt dachte, den wir gerade lasen. Aber er schaute nur mit leerem Blick vor sich hin. Das machte mir wirklich Sorgen. Ich fragte ihn dann: ‚Sam, was denkst du gerade?‘ Und er sagte: ‚Ich kriege PlayStation 4 einfach nicht aus dem Kopf.‘“ Ein weiterer achtjähriger Strubbelkopf in einer anderen Klasse, der erzählt, dass er die würfelförmigen Blöcke von Minecraft nicht aus seinen Gedanken bekommt und sie vor seinem inneren Auge sieht, sobald er morgens aufwacht.
Wie mein World of Warcraft-besessener Patient Dan lag bei diesen Jungen eine mildere Form des Spielübertragungsphänomens (GTP) bzw. des Tetris-Effekts vor. Mit diesem Terminus wird ein Phänomen beschrieben, bei dem obsessive Gamer die Formen und Muster, die in ihren Spielen vorkommen, ständig in ihren Gedanken im Wachzustand und/oder ihren Träumen sehen.
Dieser Zustand ist nach dem Kultspiel aus den 1980ern benannt, bei dem man aus Quadraten zusammengesetzte Formen, die „Tetrominos“, zusammensetzen musste. Als das Spiel auf den Markt kam, berichteten Menschen davon, sie würden von den Quadraten halluzinieren oder, in anderen Fällen, sie hätten das Gefühl, die echte Welt bestünde aus ineinanderpassende Formen, die man miteinander verbinden müsse. Wieder andere erzählten, sie sähen hinabfallende Tetrominos am Rande ihres Gesichtsfeldes oder in ihren Träumen.
Aber diese elektronische Invasion in unsere Gedanken erstreckt sich mittlerweile auf weit mehr als Tetris und Quadrate. Professor Dr. Mark Griffiths und Dr. Angelica Ortiz de Gortari von der Nottingham Trent University in Großbritannien führten kürzlich drei Studien mit mehr als 1.600 Gamern durch und stellten fest, dass alle zu irgendeinem Zeitpunkt das Spielübertragungsphänomen erfahren hatten.9 Zu den Symptomen gehörten unwillkürliche Empfindungen, Handlungen und/oder Reflexe, die mit dem Videospiel im Zusammenhang standen – manchmal Stunden oder sogar Tage, nachdem sie zu spielen aufgehört hatten.
Manche berichteten, sie konnten Soundeffekte, Musik und die Stimmen der Charaktere hören; die Geräusche umfassten Explosionen, Schüsse, Schwerthiebe, Schreie und sogar Atemgeräusche aus dem Spiel. Ein Spieler erzählte, er hätte noch ein paar Tage nach dem Spiel ständig jemanden „Tod“ flüstern hören. Andere meinten, dass Bilder aus ihren Spielen plötzlich vor ihren Augen auftauchten.
Jetzt könnte man argumentieren, dass, wenn man ein Buch liest und einschläft, man ebenso von einer Hauptperson träumen könnte. Oder dass man Tagträume von einer TV-Sendung hat. Das mag alles zutreffen. Doch die intensive und übererregende Bildsprache unserer interaktiven Bildschirme scheint einen invasiveren und intrusiveren geistigen Angriff auf unsere Psyche zu verüben als Bücher und TV-Sendungen.
Teilnehmer der Studie10 berichteten über anschließende Ängste in der realen Welt – „Ich flippte aus, als ich draußen feststellte, dass die Bäume rund und nicht quadratisch wie in meinem Videospiel waren“ – oder dass sie von Gedanken an das Spiel überschwemmt wurden: „Ich kann nicht aufhören, an Minecraft zu denken. Das ruiniert mir mein Leben.“ Wieder andere sagten, sie hätten Angst, die Realität mit dem Spiel zu verwechseln: „Es war furchtbar, denn ich hatte immer Sorge, dass ich, wenn ich müde wurde oder nicht richtig aufpasste, versehentlich in den Grand Theft Auto IV-Modus switchen und gegen andere Autos oder über Menschen fahren würde.“
Das sind eindeutig extremere Erfahrungen als bloße Tagträume über das Buch, das man gerade liest. Laut Dr. Griffiths und Dr. de Gortari zeigen ihre Forschungsberichte, dass manche Gamer nicht aufhören können, an das Spiel zu denken, während andere Anzeichen darauf hinweisen, dass sie die Videospiele mit dem echten Leben verwechseln. Das sind genau die Symptome, die ich bei den Gamern, mit denen ich arbeitete, sah. Laut Dr. de Gortari kann diese Vermischung von Videospiel und realem Leben wie eine Psychose aussehen: „Diese Forschungsarbeit unterstützt die Ergebnisse früherer Studien zum Spielübertragungsphänomen, die zeigen, dass das Spielen von Videospielen pseudo-halluzinatorische Ereignisse hervorrufen kann.“ Auch wenn diese auditiven, visuellen und taktilen Halluzinationen meist vorübergehend sind, bleiben sie in manchen Fällen bestehen und treten immer wieder auf.
Außerdem verhält es sich wie bei jeder Droge so, dass die Resultate umso schlimmer sind, je mehr man konsumiert – und digitale Drogen sind da keine Ausnahme. Die Forschenden fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Spielübertragungsphänomens durch exzessives Videospielen gesteigert wurde, was wiederum häufig Schlafmangel mit sich brachte, sodass die negativen Auswirkungen eines Spielübertragungsphänomens noch gesteigert wurden. Zu beachten ist außerdem, dass das Alter der Studienteilnehmenden bei 12 bis 56 lag und sie somit entweder Teenager oder Erwachsene waren – keine Kinder. Mit unserem Wissen über das Gehirn und seine Entwicklung können wir also davon ausgehen, dass diese negativen Auswirkungen eines Spielübertragungsphänomens bei jungen Kindern noch verstärkt werden.
Zusätzlich zur Studie von Dr. Griffiths und Dr. de Gortari gibt es eine weitere klinische Forschungsarbeit, die andeutet, dass Bildschirmzeit und Videospiele zu psychischen Erkrankungen beitragen, die sich als Schizophrenie und/oder Psychose äußern. 2011 veröffentlichten Forschende der Universität von Tel Aviv die in ihren Augen ersten dokumentierten Fälle von „internetbezogener Psychose“. Sie wiesen darauf hin, dass die Technik „echte psychotische Phänomene“ hervorruft und dass die „Abwärtsspirale der Internetnutzung und ihr Potenzial in der Psychopathologie ganz neue Konsequenzen unserer heutigen Zeit“ sind.“11
Dr. Joel Gold, Psychiater an der New York University (NYU), und sein Bruder Ian, der an der McGill University als Professor im Bereich der Psychiatrie forscht, untersuchen, ob die realitätsverschwimmenden Aspekte der Technologie zu Halluzinationen, Wahnvorstellungen und echten Psychosen führen können.12 An der Stanford University untersucht der Psychiater und Autor Dr. Elias Aboujaoude, ob manche digitalen Avatare, die in Spielen wie Second Life gerne verwendet werden, sich klinisch als Formen eines Alter Egos qualifizieren; dies wird oftmals mit dem früher als multiple Persönlichkeitsstörung, jetzt im DSM (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders – auch bekannt als die „Bibel“ der Fachkräfte für psychische Gesundheit) als dissoziative Identitätsstörung bezeichneten Zustandsbild assoziiert.13 Die tiefgreifende Frage lautet: Leiden Kinder und Jugendliche, die Spiele-Avatare kreieren, an einer Form der multiplen Persönlichkeitsstörung? Werden sie zu digitalen Sibyllen?
Die übererregenden Bilder auf den Bildschirmen und in den Videospielen haben nicht nur eine tiefgreifende und eindringliche Wirkung auf die Psyche und geistige Gesundheit der jungen Menschen, sondern beeinträchtigen auch die Neurobiologie ihrer Gehirne.
Neben mehreren Neuroimaging-Studien, die Parallelen zwischen Bildschirm- und Substanzsucht aufzeigen, gibt es eine Neuroimaging-Studie aus dem Jahr 2016, die in der Fachzeitschrift Molecular Psychiatry veröffentlicht wurde. Sie fand heraus, dass Videospiele die Entwicklung mikrostruktureller Eigenschaften des Gehirns beeinträchtigen, die mit negativen psychischen Auswirkungen assoziiert werden.14
Bei der Studie wurden die Gehirne von 114 Videospiele spielenden Jungen und 126 Videospiele spielenden Mädchen untersucht. Anhand Diffusions-Tensor-Bildgebung, um die „mittlere Diffusivität“ (MD) bzw. die mikrostrukturellen Eigenschaften verschiedener Bereiche des Gehirns zu messen, ermittelten die Forschenden, dass „das Spielen von Videospielen direkt oder indirekt die Entwicklung von bestimmten Nervensystemen stört …, die mit der Entwicklung der verbalen Intelligenz zusammenhängen“; dazu gibt es einen Zusammenhang zwischen vermehrtem Spielen von Videospielen und der verzögerten Entwicklung von Mikrostrukturen in erheblichen Gehirnregionen und der verbalen Intelligenz.
Kurz gesagt haben die Forschenden herausgefunden, dass, je häufiger ein Kind Videospiele gespielt hatte, desto höher die MD in wichtigen Teilen des Gehirns lag – und eine höhere MD bedeutet eine geringere Gewebedichte und eine Abnahme der Zellstrukturen. Das verheißt nichts Gutes. Die evolutionäre neurobiologische Adaption braucht Zeit; im Grunde ist unser Gehirn noch immer auf Jagen und Sammeln ausgerichtet wie bei unseren Vorfahren. Unser Gehirn ist einfach nicht für die visuelle Überstimulierung gemacht, mit der wir von der in jüngster Zeit entwickelten digitalen Technologie bombardiert werden. Bei meiner Lehre der Neuropsychologie ist es allgemein bekannt, dass die Gehirnentwicklung ein fragiler Prozess ist, der schnell sowohl durch Unterstimulation als auch Überstimulation gestört werden kann – und zwar zum Beispiel durch genau die Art der Überstimulation, die man beim Zocken von Videospielen erfährt.
Wir haben nun gesehen, dass sich die überstimulierenden Bilder auf den technischen Geräten in das Bewusstsein der Kinder einbrennen und sie in ihren Gedanken und Träumen verfolgen können – und jetzt wissen wir auch noch, dass dies sogar ihre Gehirnentwicklung beeinträchtigt.
Und trotzdem nimmt alles seinen Lauf und immer jüngere Kinder halten immer mehr Bildschirmgeräte in den Händen.
Wie die Kids süchtig werden
Die digitalen Bildschirme der heutigen Zeit sind eindeutig nicht mehr die harmlosen, riesigen TV-Bildschirme von früher. Während man sich damals schon Gedanken über die Auswirkungen des Fernsehens machte, ist die hypnotisierende Macht immersiver und interaktiver digitaler Bildschirme auf Geist und Gehirn junger Menschen noch einmal eine ganz andere Sache. Zusätzlich zu den bislang zitierten Studien kommen andere Studien zu dem Schluss, dass sie sich noch stärker Dopamin aktivierend auswirken und somit potenziell stärker süchtig machen als Fernsehen; außerdem weisen sie auf einen Anstieg klinischer Erkrankungen wie ADHS,15 Aggression,16 Gemütsstörungen17 und, wie bereits besprochen, Psychosen hin. Eine junge Mutter erzählte mir, dass sie einmal mitten in der Nacht das Zimmer ihres Siebenjährigen betrat, um nach ihm zu sehen, und erschrocken feststellte, dass er Minecraft gespielt hatte und in einen Trancezustand verfallen war; er saß mit weit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen aufrecht im Bett und schaute in die Ferne, während sein leuchtendes iPad neben ihm lag. Sie geriet nicht nur selbst in Panik, sie musste ihren Sohn mehrmals schütteln, um ihn wieder zu sich zu bringen.
Die Mutter des Jungen war eine liebevolle, gut ausgebildete Berufstätige und hatte viel geopfert und darauf geachtet, alles richtig zu machen, um ihren Sohn die nötige Unterstützung und Hilfe zu geben, die er brauchte, um zu einem glücklichen, gesunden Erwachsenen heranzuwachsen. Sie war verzweifelt und konnte nicht begreifen, wie ihr einstmals gesunder und glücklicher kleiner Junge so süchtig nach dem Spiel hatte werden können, dass er in eine katatonische Starre hatte verfallen können.
Sehr zum Leidwesen vieler Kinder sind Minecraft und Kindheit zu Synonymen geworden. Mit mehr als 100 Millionen registrierten Nutzern ist Minecraft das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten.18 Das von der kleinen schwedischen Softwarefirma Mojang designte und kürzlich für 2,5 Mrd. $ an Microsoft verkaufte Spiel wird für seine kreativen, LEGO-ähnlichen Baumöglichkeiten hoch gelobt.
Der Spieler bzw. die Spielerin muss 3D-Würfel, die Materialien wie Erde, Stein und verschiedene wertvolle Erze darstellen, sammeln und aus diesen Materialblöcken einen Unterschlupf für die Nacht – wenn alle Monster herauskommen – bauen. Sobald ein Tag und eine Nacht vorbei sind (das sind 20 Minuten in Echtzeit), wiederholt sich der Kreislauf und der Spieler baut immer komplexere Unterschlüpfe und stockt überlebenswichtige Ressourcen auf.
Dennoch ist Minecraft in jeglicher Hinsicht – sowohl klinisch als auch neurologisch – eine süchtig machende Droge. Minecraft-Befürworter benutzen das magische Schlagwort „pädagogisch“, um jegliche Bedenken vom Tisch zu wischen, können aber keinerlei Forschungsarbeiten oder Beweise dafür liefern, dass das Videospiel das Lernen verbessert. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass Videospiele sich positiv auf die räumliche Wahrnehmung und die Mustererkennung auswirken, aber zu welchem Preis?
Die Geschichte ist voll von Beispielen für „wundersame“ Fehlerbehebungen, die das Problem, das sie eigentlich bereinigen sollten, nur verschlimmert haben. Im 19. Jahrhundert erfanden chinesische Alchimisten Schießpulver als medizinisches Elixier, mit dem man die Unsterblichkeit erreichen sollte; doch statt das Leben zu verlängern, hat Schießpulver, wie wir alle wissen, mehr Leben beendet als jede andere jemals erfundene Substanz. Sigmund Freud hielt Kokain für eine „magische“ Droge, die Depressionen und Morphinsucht heilen könnte – und nicht seine eigene epidemische Sucht hervorrufen könnte. Heroin galt anfangs, als es in den 1870ern von den Deutschen als „sichere und nicht süchtig machende“ Alternative zu Morphin erfunden wurde, auch als hochgelobte Wunderdroge. Und wir wissen ja, wie es weiterging.
Videospiele sind im Allgemeinen und insbesondere im Klassenzimmer ein Problem. Es gibt Forschungsarbeiten, auf die wir noch genauer eingehen werden, die zeigen, dass dieses „pädagogische“ Heilmittel in Wahrheit eine digitale Droge im Schafspelz ist; sie ist neurologisch und psychisch schädlich und hat nur geringfügigen potenziellen Nutzen, der seinen Preis nicht wert ist – auch wenn die Hersteller der Spiele natürlich etwas anderes behaupten. Das ist genauso wie in den 1950ern in den USA, als die großen Tabakkonzerne uns erzählten, Tabak sei gut für uns und Joe Camel den Heranwachsenden zum Paffen riet; denn Zigaretten seien cool und würden Spaß machen!
Und inwiefern ist Minecraft eine süchtig machende digitale Droge?
Die immer mehr werdenden und schier endlosen „grenzenlosen Möglichkeiten“ des Spiels ziehen die Kinder in einen hypnotischen Bann. Dieser hypnotische Sog hat zusammen mit dem stimulierenden, übererregenden Inhalt eine dopaminsteigernde Wirkung; dieser Dopaminanstieg wird die Hauptzutat für eine primordiale suchtbildende Dynamik.
Die primitivsten Bereiche unseres Gehirns – das Rückenmark und das Kleinhirn – beherbergen unsere uralten Dopamin-Belohnungswege. Und wenn eine Handlung zu einem Wohlfühlergebnis führt, wie zum Beispiel Nahrung finden oder etwas Neues im Internet oder bei einem Videospiel entdecken, wird Dopamin freigesetzt, was sich angenehm anfühlt und einen süchtig machenden Je mehr wir bekommen, desto mehr wollen wir-Kreislauf schafft.
Außerdem bietet das Spiel Gelegenheit für Neues und unser Gehirn ist so konzipiert, dass es das dann unbedingt genauer untersuchen möchte. Dr. Peter Whybrow, Leiter des Institute for Neuroscience and Human Behavior an der UCLA, bezeichnet Computer und Computerspiele als „elektronisches Kokain“ und beschreibt diese süchtig machende Dynamik des Strebens nach Neuem wie folgt: „Unser Gehirn ist so konzipiert, dass es nach sofortiger Belohnung sucht. Bei der Technologie ist das Neue die Belohnung. Im Grunde wird man süchtig nach Neuem.“19
Was also für die besonders süchtig machende Wirkung von Minecraft sorgt, geht über die zwanghafte Neuartigkeit beim LEGO-ähnlichen Blockbau und den Dopaminanstieg hinaus; indem er archetypisches Bildmaterial mit den Grundprinzipien der Verhaltenspsychologie kombiniert hat, schuf Mojang ein Spiel, das durch sein Belohnungssystem dafür sorgt, dass die Kinder immer weiterspielen. Da die Belohnungen (die Erze) willkürlich über die „Erde“ verteilt sind, weiß der Spieler nie, welcher Hieb mit der Spitzhacke dazu führt, dass er das gesuchte Gold oder die Diamanten findet. Genauso wie bei Spielautomaten im Casino ist dies ein variables Belohnungsschema, welches das am stärksten abhängig und süchtig machende Belohnungsschema ist – fragen Sie nur mal einen Rentner, der gerade einen gesamten Gehaltsscheck, Münze für Münze, in einen einarmigen Banditen gesteckt hat.
Und dann gibt es noch den Aspekt der hormonellen Erregung.
Commander Dr. Doan von der US-Navy meint dazu: „Jedes Mal, wenn es zu einer Erregung im Gehirn kommt, kann dies zur Sucht führen, weil es sich gut anfühlt. Forschungsarbeiten zeigen, dass, wenn das Gehirn stimuliert wird, dieser Erregungsmechanismus auch die Hypophyse durch den Hypothalamus stimuliert. Somit wird auch die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA) stimuliert; das ist der Adrenalinkick, der beim Spielen so entscheidend ist. Der Blutdruck der Heranwachsenden steigt, ihre Handflächen beginnen zu schwitzen, ihre Pupillen ziehen sich zusammen – sie befinden sich in einem Kampf-oder-Flucht-Modus. Und dann gibt es noch die Dopaminantwort in den Dopamin-Belohnungswegen, wodurch die Kinder und Jugendlichen diesen Adrenalinkick immer wieder haben wollen.“
Und wie jeder Neurowissenschaftler Ihnen sagen kann, bilden Adrenalin und Dopamin eine machtvolle und süchtig machende Kombination.
Beim Spielen von Videospielen wird ein altes neural-hormonelles Netzwerk verdreht. Unsere Vorfahren befanden sich nur kurz in Momenten der Gefahr, beispielsweise wenn sie von einem Löwen verfolgt wurden, im durch Adrenalin hervorgerufenen Kampf-oder-Flucht-Modus. Hingegen sorgt die heutige Technik dafür, dass der Adrenalinspiegel und die Kampf-oder-Flucht-Reaktion Stunden um Stunden während des Spielens auf einem anormal hohen Niveau und wir in ständiger Alarmbereitschaft sind. Dieser konstante Stresszustand durch das Adrenalin ist nicht gesund, denn das Immunsystem wird beeinträchtigt, Entzündungsreaktionen nehmen zu und Kortisol und Blutdruck schnellen in die Höhe. Außerdem gibt es auch verhaltensbezogene Folgen.
Dr. Whybrow meint: „Wenn die Stressreaktion ständig aktiviert ist, werden wir aggressiv, hypervigilant, hyperaktiv.“ Er zieht Parallelen zwischen den Symptomen der Techniksucht und denen klinischer Manie: Auf schnelle Sprache und Aufregung über den Erhalt neuer Dinge folgen Schlafverlust, Reizbarkeit und Depressionen.
Diese süchtig machende adrenale Erregung ist kein Zufall. Die Videospielbranche ist ein ausgeklügelter, viele Milliarden schwerer Industriezweig, der sich ausschließlich der Entwicklung süchtig machender Produkte für wehrlose Kinder und junge Menschen widmet; das ist so, als würde man auf Fische in einem Aquarium schießen. Laut Dr. Doan liegt der einzige Fokus der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Spieleindustrie darauf, die Spiele für Kinder so stimulierend und erregend wie möglich zu machen, denn das verstärkt die süchtig machende Wirkung und verkauft die meisten Spiele.
„Spieleunternehmen stellen die besten Neurobiologen und Neurowissenschaftler ein, damit sie Testspieler mit Elektroden verkabeln. Wenn diese nicht den gewünschten Blutdruckanstieg zeigen – meistens 180 zu 120 oder 140 innerhalb weniger Minuten des Spiels – und wenn sie nicht zu schwitzen beginnen und es zu keinem Anstieg der galvanischen Hautreaktionen kommt, optimieren sie das Spiel weiter, bis sie die maximale süchtig machende und erregende Reaktion erhalten, die sie haben wollen“, erklärt Dr. Doan.
Kann etwas, dass sich auf das Gehirn und Nervensystem eines Kindes so erregend auswirkt, in irgendeiner Weise lehrreich sein, wie die Minecraft-Verfechter uns zu überzeugen versuchen?
Lisa Guernsey, eine Bildungs- und Technikjournalistin, erzählte über ihre Beobachtungen bei ihren eigenen Töchtern: „Ich verspüre eine Hassliebe diesem Spiel [Minecraft] gegenüber. Im einen Moment bin ich davon fasziniert, wie es Kinder dazu bringt, kreativ zu werden … im nächsten schreie ich meine Kinder an und gebe lächerliche Drohungen von mir“, weil ihre Töchter wie besessen stundenlang spielen und ihre Achtjährige sagt: „Minecraft finde ich viel besser, als Hausaufgaben zu machen.“20
Andere Eltern sind zu „Minecraft-Witwen“ geworden und klagen, sie hätten ihre Kinder an das heimtückische Spiel verloren, sodass sie Unterstützungsgruppen mit anderen Eltern gebildet haben. Es gibt auch Minecraft Anonymous, ein 12-Schritte-Programm für diejenigen, deren Leben von den „lehrreichen“, aber süchtig machenden Würfeln im Spiel verschlungen wird. Guernsey warnt: „Wahrscheinlich verfluchen Sie schon bald den Tag, an dem Sie diesen Zeitfresser in Ihr Haus gelassen haben.“
Warum sich der kleine Paul nicht konzentrieren kann
Ob süchtig machend oder nicht, das Videospielklassenzimmer kommt schon bald in eine Schule in Ihrer Nähe. Die Geschichte, die die Technikunternehmen nutzen, ist ziemlich simpel: Kinder verfügen heutzutage einfach nicht über die notwendige Aufmerksamkeitsspanne für die traditionellen Bildungsmethoden, weswegen wir die Bildungserfahrung durch ein bisschen mehr Stimulation aufpeppen müssen – mehr Schnickschnack und blinkende Lichter, damit der kleine Johnny und die kleine Suzie aufmerksamer sind. Das ist der Beginn eines teuflischen und süchtig machenden ADHS-Kreislaufs: Je mehr ich ein Kind stimuliere, desto stärker muss ich es weiterhin stimulieren, damit es seine Aufmerksamkeit aufrechterhalten kann. Genau wie bei einer Drogensucht kommt es zu einer Toleranzerhöhung und einer Steigerung der Empfindlichkeitsschwelle, sodass das überstimulierte Kind eine immer stärkere visuelle Stimulation benötigt, um am Ball zu bleiben.
Wagen wir ein kleines Experiment. Ich bitte die erwachsenen Leser und Leserinnen dieses Buches, sich den schnellsten, intensivsten, zweistündigen Film anzuschauen, den sie sich vorstellen können – einen Film, bei dem der Adrenalinspiegel richtig in die Höhe schnellt. Beispielsweise einen aus der 96 Hours-Trilogie mit Liam Neeson. Oder einfach nur zwei Stunden lang im Internet zu surfen – schnell so viele Hyperlinks wie möglich zu überfliegen. Nach diesen zwei Stunden nehmen Sie sich eins Ihrer Lieblingsbücher und fangen zu lesen an. Achten Sie darauf, wie weit Sie kommen, ehe Ihre Aufmerksamkeit abschweift.
Wenn Sie wie die meisten von uns sind, werden Sie nicht sehr weit kommen. Es braucht Zeit, bis sich ein übererregtes Nervensystem wieder beruhigt; Sie können nicht einfach vom fünften in den ersten Gang herunterschalten. Und nicht zu vergessen ist, dass bei Ihnen als Erwachsenem Gehirn und Nervensystem vollständig entwickelt sind; Ihr Frontalkortex, der Ihre Exekutivfunktionen einschließlich der Impulsivität kontrolliert, ist voll ausgebildet. Ihr Nebennierenrinden- und Ihr Nervensystem sind ebenfalls vollständig entwickelt. Und Ihre Aufmerksamkeitsfähigkeiten sind seit Ihrer Kindheit fest verankert.
Und trotzdem fällt es Ihnen schwer, fokussiert zu bleiben, nachdem Sie nur ein paar Stunden lang dem intensiven, schnellen Szenenwechsel in einem Film oder dem schnellen Wechsel von Inhalten bei der Internetnutzung gefolgt sind. Stellen Sie sich vor, diese übererregende Bildschirmstimulation wäre der Zustand, in dem Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen würden – wie die mehr als sieben Stunden am Stück, in dem unsere Kinder sich in diesem Zustand befinden. Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zur ADHS-„Epidemie“ gibt und dem Anstieg dieser Erkrankung um 800 Prozent, den wir in den letzten 30 Jahren verzeichnen mussten?21 Tatsächlich bestätigen Forschungsarbeiten den Zusammenhang zwischen ADHS und gesteigerter Bildschirmzeit, was anfangs dem Fernsehen zugeschrieben wurde und in jüngster Zeit, wie die Forschung belegen konnte, den zahlreichen negativen Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit durch interaktive Bildschirme wie denen des iPads attestiert wird.22
Stellen Sie sich jetzt vor, dass nach Ihrem zweistündigen überstimulierenden Experiment aufgrund Ihrer abschweifenden Aufmerksamkeit nach der Stimulationszeit diagnostiziert würde, dass Sie mit bedächtigen, tiefergehenden Beschäftigungen wie Lesen einfach nicht zurechtkommen. Nein, Sie sind einfach jemand, der zum Lernen blinkende Lichter und all den Schnickschnack benötigt; es ist die Mühe nicht wert, Ihnen noch einmal ein Buch zu geben. Leider verfügen Sie einfach nicht über die Aufmerksamkeitsfähigkeiten für solche Dinge. Darum unterziehen wir Sie der strengen Diät von Michael-Actionfilmen, Grand Theft Auto-Videospielen und superschnellem Hyperlink-Surfen über die Kardashians.
Was meinen Sie, was mit Ihrer Aufmerksamkeitsfähigkeit passiert? Kleiner Hinweis: Sie würde verkümmern.
Leider geschieht genau dies in unserem Bildungssystem. Da Schulen von Bildungstechnologieunternehmen zwangsernährt werden, lautet die Geschichte, dass Kinder einfach nicht mehr über die nötige Aufmerksamkeitsspanne für traditionelle Lernmethoden verfügen. Man steigert die Anzahl der blinkenden, stimulierenden Lichter, mit denen man Schüler bombardiert, wodurch deren ohnehin schon beeinträchtigte Aufmerksamkeitsfähigkeiten weiter untergraben werden, indem man sie mit einer hoch stimulierenden Ernährung füttert.
Diese „Videospiele-im-Klassenzimmer“-Bewegung hat ein paar merkwürdige Verbündete hervorgebracht: Erzieher arbeiten nun mit Spieledesignern zusammen – Sie wissen schon, den Menschen, die uns die superbrutalen Spiele Grand Theft Auto und Call of Duty beschert haben –, die nun dafür verantwortlich sind, die Unterrichtserfahrungen unserer Kinder zu formen. Natürlich geht es dabei um viel Geld. Neben den zuvor erwähnten Minecraft und Microsoft haben die Bill & Melinda Gates Foundation zusammen mit der MacArthur Foundation Millionen in GlassLab investiert, ein Technologieunternehmen, das zu Videospielen in Klassenzimmern forscht. Und unübertroffen im Rennen um Videospiele in Klassenzimmern hat der Medienmogul Rupert Murdoch Hunderte Millionen in Amplify gepumpt, das Bildungstechnologieunternehmen unter der Leitung von Joel Klein, dem ehemaligen Schulkanzler von New York, bei dem 652 Personen in der „Spieleabteilung“ in Brooklyn arbeiten.23
Dort wurden Fortschritte wie „Eye-Tracking“ und Messung der Pupillenerweiterung entwickelt, um die kognitiven Reaktionen von klein Johnny und Suzie vor ihren Bildschirmen zu messen. Anschließend wird von jedem Kind ein Datenprofil erstellt, angeblich um die Lern-/Spielerfahrung jedes Kindes anzupassen und zu optimieren, allerdings mit dem Ergebnis, dass Big Data – und Rupert Murdoch – jede Augenbewegung Ihres Kindes ganz genau kennen.
Sesamstraße und Lassie sind es nicht gerade.
Zum Glück legte Amplify eine Bruchlandung hin. Murdoch verkaufte seine Anteile an Klein, dessen Unternehmen eine Massenentlassung vornahm.24 Die Bildungstechnologieprofiteure verkalkulierten sich eklatant bei ihrem strategischen Plan, dass in den Klassenzimmern nur noch mit Videospielen und Tablets gearbeitet werden sollte. Leider gibt es viele andere Edupreneure und Bildungsinnovatoren, die sabbernd Schlange stehen, um auf den Zug des Bildungstechnologie-Goldrauschs aufzuspringen.
Reale Erfahrungen vs. digitale Erfahrungen
Neben den unbegründeten Behauptungen, durch Technologie würden bessere Bildungsergebnisse erzielt, beharren manche Technologiebefürworter sogar darauf, dass immersive Spiele den Kindern bessere Natur-Erlebnisse bieten könnten. Laut Greg Toppo, Autor von





























