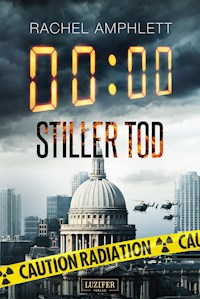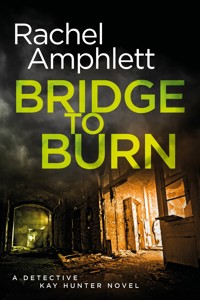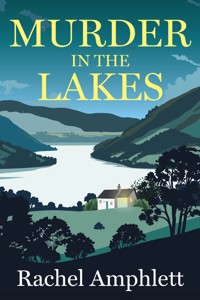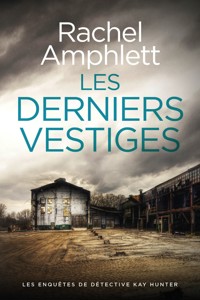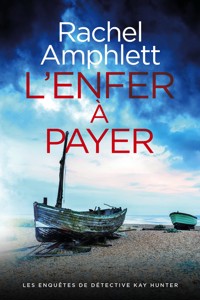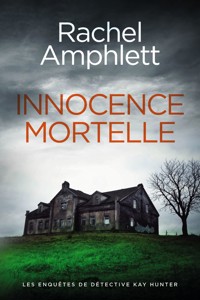Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dan Taylor
- Sprache: Deutsch
Dan Taylor versucht unterzutauchen, aber es gelingt ihm nicht: Ein alter Freund bittet ihn um Hilfe. Seine Tochter befindet sich in Afrika, und sie schwebt in höchster Gefahr … Sie ist einem Geheimnis auf der Spur. Einem tödlichen Geheimnis … Wieder im aktiven Dienst muss Dan Taylor schnell feststellen, dass die Sicherheit Annas nur eines seiner Probleme ist. Die Spezialistin ist im Besitz von Beweisen, die verhindern könnten, dass das Land im Chaos versinkt. Und sie kennt die Drahtzieher hinter einem Putsch. Im Kampf gegen militante Kräfte, die es auf die wertvollen Mineralien des Landes abgesehen haben und zu allem bereit sind, um ihn zu stoppen, muss Dan Taylor noch einmal auf seine Fähigkeiten und sein Glück vertrauen, um Anna und ihre Beweise in Sicherheit zu bringen … "Temporeich, voller Action und mit überraschenden Wendungen." - Amazon.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Glühender Sand
Dan Taylor – Band 4
Rachel Amphlett
übersetzt von Wolfgang Schroeder
© Copyright 2016 Rachel Amphlett
Keine Vervielfältigung oder Weitergabe ohne Genehmigung. Die Namen, Charaktere und Ereignisse in diesem Buch werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich lebenden oder toten Menschen, Ereignissen oder Orten ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: BEHIND THE WIRE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Wolfgang Schroeder Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-497-5
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
Essaouria, Marokko
Dan Taylor griff nach dem Motorsportmagazin und tippte sich damit als Gruß an den Cafébesitzer gegen die Stirn, dann trat er, ohne zu ahnen, dass er verfolgt wurde, in den heißen nordafrikanischen Sommer hinaus.
Ein kurzes Frösteln durchlief seinen Körper, als dieser sich nach der Kühle in dem klimatisierten Café auf die Hitze einstellte. Die Markise vor dem Café bot nur wenig Schutz, da die Sonne die schmale Straße über die gegenüberliegenden Dächer hinweg in gleißendes Licht tauchte.
Er trat zur Seite, um ein Touristenpaar vorbeizulassen. Beide trugen Surfbretter unterm Arm und ihre amerikanisch klingenden Stimmen wurden rasch leiser, als ihre sonnengebleichten Köpfe in der Menschenmenge, die auf dem Bürgersteig unterwegs war, aus seinem Blickfeld verschwanden.
Eine Frau blieb jetzt auf dem Bürgersteig stehen und öffnete die Tür zu der Bäckerei, die neben dem Café lag, woraufhin der angenehme Duft von frisch zubereiteten Backwaren und Brot die Luft erfüllte.
Dan ließ seine Sonnenbrille auf die Nase rutschen und lief schnell über die belebte Straße auf ein Lebensmittelgeschäft zu.
Er blickte kurz auf seine Uhr.
Er musste innerhalb einer Stunde zurück im Hafen sein, denn wenn er zu spät kam, würde der Mann wieder verschwinden, den er kontaktiert hatte, um ihm eine neue Kraftstoffpumpe für sein Boot zu liefern, und es würde einen weiteren Monat dauern, ihn zur Rückkehr zu überreden.
Er stieß die Ladentür auf und ging auf den einsamen Kühlschrank an der Rückwand des Geschäftes zu, dessen Motor ein Todesröcheln ausstieß, während er einen aussichtslosen Kampf gegen die Sommertemperaturen führte.
Er holte einen Zwei-Liter-Plastikbehälter mit Milch und eine Flasche Wasser heraus und schloss sich der kurzen Schlange am Tresen an.
Die Hafenstadt war zu einem beliebten Anlaufpunkt für ihn geworden; bis vor Kurzem hatte es hier nämlich viel weniger Touristen als in Casablanca oder Fes gegeben, sodass jeder, der nach ihm suchte, in der Menge sofort auffallen würde.
Dan war jedoch kein Glücksspieler, deshalb behielt er, auch während er in der Schlange wartete, die Straße hinter den schmutzigen Scheiben die ganze Zeit über im Blick.
Er hatte in den letzten sechs Monaten einen deutlichen Anstieg der Touristenzahlen festgestellt, was darauf hindeutete, dass mindestens zwei britische Billigfluggesellschaften das kleine marokkanische Hafenstädtchen in ihre regulären Flugpläne aufgenommen hatten, und daher hatte er entschieden, dass es bald an der Zeit war, weiterzuziehen.
Es wäre allerdings zu gefährlich, sich entlang der afrikanischen Küste weiter nach Süden vorzuwagen, vor allem für jemanden, der unter dem Radar zu bleiben versuchte. Stattdessen gefiel ihm die Idee, den Atlantik zu überqueren und während des Sommers die karibischen Inseln zu erkunden. Dan machte sich gedanklich eine Notiz, mit den anderen Bootseignern im Jachthafen darüber zu sprechen. Denn falls ein anderes Boot plante, bald in Richtung Westen zu fahren, würde er versuchen, sich dem Trip anzuschließen.
Ein Bus rumpelte vorbei und hielt mehrere Meter hinter dem Laden an. Während er die Straße mit seinen Dieseldämpfen vernebelte, warteten einige Passagiere mit gelangweilten Gesichtern, während sich andere aufrichteten und sich ihre Handys vors Gesicht hielten, in dem Versuch, die Monotonie ihrer Reise zu verdrängen.
Die Bremsen knarrten, der Motor wurde auf Touren gebracht und der Bus fuhr weiter, weshalb Dans Aufmerksamkeit zu dem Mann hinter dem Tresen zurückkehrte.
Er lächelte und hielt die Milch und das Wasser in die Höhe.
»Wie geht es Ihnen, Mr. Dan?« Der Ladenbesitzer grinste und enthüllte dabei einen Mund, in dem drei Vorderzähne fehlten und die restlichen gelb vom Nikotin waren.
»Gut, Farouk.« Dan deutete auf seinen mageren Einkauf. »Heute nur das hier.«
Dan bezahlte, nickte zum Dank kurz und trat dann wieder in die Morgenhitze hinaus.
Der Hafen war fünfzehn Gehminuten vom Lebensmittelgeschäft entfernt, und als er sein Ziel erreichte, floss bereits reichlich Schweiß zwischen seinen Schulterblättern und an seiner Brust hinunter.
Der Wind änderte nun die Richtung und brachte den penetranten Gestank der Fischerboote mit sich, die ein Stück weiter entlang der Sqalas im Fischereihafen lagen – befestigte Uferpromenaden, die zeigten, dass die marokkanischen Herrscher der Hafenstadt vor einigen Jahrzehnten die portugiesische Bauweise übernommen hatten.
Die Boote lagen bereits seit Stunden im Hafen und ihr Fang war schon längst auf den Märkten verkauft worden, doch die Möwen schwebten immer noch auf der Suche nach Fischresten über den Masten herum, während die Netze repariert und die Boote für den nächsten Morgen vorbereitet wurden.
Dan hatte gerade das Eingangstor des Jachthafens erreicht, als das Handy in seiner Tasche zu klingeln anfing.
Er fluchte verhalten und ging in Gedanken schnell alle Drohungen durch, die er dem Ersatzteillieferanten entgegenschleudern würde, falls sich die Lieferung der Kraftstoffpumpe erneut verzögern sollte. Er nahm die Einkaufstüte in die eine Hand und drückte mit der anderen gegen das Stahlgittertor, das zum Betonsteg führte, dann zog er das Handy schnell aus seiner Tasche.
»Hallo?«
Das metallische Scheppern des Tores, als es wieder ins Schloss zurückfiel, übertönte die Stimme des Anrufers, und Dan blickte neugierig auf das Display.
Anrufer unbekannt.
Er versuchte es erneut. »Hallo?«
»Lange nichts mehr von dir gehört, Dan.«
Geschockt ließ er fast das Handy und seinen Einkauf fallen.
Er drehte sich auf den Zehenspitzen einmal im Kreis und beobachtete aufmerksam die Boote, die sich am Steg auf und ab bewegten, bevor er mit zusammengekniffenen Augen das Büro des Hafenmeisters und die Gebäude dahinter überprüfte.
Der Platz war bis auf einen etwa zwölfjährigen Jungen, der am Ufer fischte, verlassen.
»David? Wie zur Hölle bist du an diese Nummer gekommen?«
Seine Gedanken überschlugen sich.
Er war so vorsichtig gewesen, hatte sein altes Leben komplett hinter sich gelassen und war sogar so weit gegangen, sein Boot in Marseille neu registrieren zu lassen, bevor er im Schutz der Dunkelheit über das Mittelmeer bis zur marokkanischen Küste gefahren war.
Danach hatte er den Kopf unten behalten und allen Einheimischen, mit denen er sich seit seiner Ankunft angefreundet hatte, erzählt, dass er ein ehemaliger Exekutivbeamter sei, der von der Hektik in der Stadt die Nase voll gehabt hätte. Jemand, der sich neu orientieren wollte und gerade herauszufinden versuchte, was er in Zukunft mit seinem Leben anstellen sollte.
Mit trockenem Mund umklammerte er das Handy fester.
»Wie zum Teufel hast du mich gefunden?«
»Das erkläre ich dir später. Wir haben ein Problem.«
»Kümmere dich selbst darum. Ich bin im Ruhestand.«
»Wohl eher gelangweilt, oder?«, meinte David Ludlow und in seinem ansonsten ruhigen Tonfall schwang eine Spur Verachtung mit.
Dan stellte die Tüte zwischen seinen Füßen ab, dann richtete er sich auf und kratzte über die Stoppeln auf seiner Wange, während er in seinem Kopf eine angemessene Antwort zu formulieren versuchte.
Doch sein ehemaliger Chef unterbrach seine Gedanken:
»Ich habe einen Job für dich, der umgehend erledigt werden muss und der dich unter Umständen beim neuen Premierminister sogar in einem guten Licht dastehen lassen könnte.«
»Welcher neue Premierminister?«
»Liest du in der Zeitung auch noch etwas anderes als den Sportteil?«
Dan schluckte seine bissige Antwort herunter und stellte stattdessen im Kopf einige Berechnungen an.
»Ich muss auf See gewesen sein, als es passiert ist.«
»Okay.« David klang allerdings nicht überzeugt. »Dann hast du also in den letzten zwei Wochen nur die Fußball-Ergebnisse überprüft?«
»Warte mal kurz.« Dan hielt seine Hand in die Höhe und seufzte dann. »Woher wusstest du, wo du mich finden kannst?«
»Hi, Dan.«
Er schloss die Augen und fluchte. »Mel?«
Die Analytikerin kicherte am anderen Ende der Leitung.
»Verdammter Mist«, rief Dan. »Du hast einen Peilsender an meinem Boot angebracht, nicht wahr?« Er runzelte die Stirn. »Warte mal. Wenn du die ganze Zeit über gewusst hast, wo ich bin, warum bin ich dann nicht längst zurückgeschleift und verhaftet worden?«
»Weil wir niemandem gesagt haben, wo du bist«, antwortete David. »Was mich zu meinem aktuellen Problem bringt.«
»David, ich stehe hier bei über dreißig Grad in der Sonne und die Milch für meinen Kaffee wird gleich zu Butter. Wie schon gesagt, ich bin nicht interessiert.«
Dan beendete den Anruf, griff nach seiner Tüte und ging heftig fluchend in Richtung seines Bootes.
Die gute Laune, die er seit seinem Aufwachen an diesem Morgen verspürt hatte, war schlagartig verschwunden und durch Frustration und eine brodelnde Wut ersetzt worden, weil es für David trotz allem vollkommen in Ordnung war, aus heiterem Himmel anzurufen und seine Hilfe zu verlangen.
»Vergiss es«, murmelte er aufgebracht.
Dan zwang sich zu einem Lächeln und hob zur Begrüßung seine Hand, als er an einer zweiunddreißig Fuß langen Ketch mit Holzrumpf vorbeikam, deren deutsche Besitzer gerade einen gemütlichen Brunch unter einem dunkelblauen Sonnensegel genossen.
Er schluckte mit trockener Kehle, als er sich die Tasse Kaffee vorstellte, die er sich gleich kochen würde, sobald er in die relative Kühle seines eigenen Bootes zurückgekehrt war.
Trotz der Hitze sorgte der Hafen abseits der sich aneinanderdrängenden Gebäude der Stadt nämlich dafür, dass seine Nutzer mehr von den kühlenden Winden des Atlantiks abbekamen.
Er trottete weiter den Steg entlang und versuchte dabei, die Schweißtropfen zu ignorieren, die trotz des Kurzarmhemdes aus Baumwolle zwischen seinen Schulterblättern hinunterliefen. Seine Sandalen bewahrten seine Füße zwar davor, von der heißen Betonoberfläche unter seinen Sohlen verbrannt zu werden, aber diese wurden immer dünner, je weiter der Sommer voranschritt.
Er hielt jetzt am Ende des Steges an, ging in die Hocke und begann das Seil zu lösen, das sein Dingi an Ort und Stelle hielt, während es auf den leichten Wellen schaukelte, die gegen den mit Gummi verkleideten Rumpf des Bootes schwappten.
Er richtete sich auf und zog sich die Baseballmütze tiefer ins Gesicht, während er seine Hand erneut senkte. Doch dann verharrte er plötzlich mitten in der Bewegung.
Sein Boot lag noch ungefähr fünfzig Meter von seinem jetzigen Standort entfernt, aber selbst auf diese Distanz hin, konnte er sehen, wie die Steuerhaustür mit der sanften Bewegung des Bootes im Wasser auf und zu schwang.
Instinktiv griff er in seine Hosentasche und im selben Moment, als seine Finger die Bootsschlüssel berührten, ließ seine andere Hand die Einkaufstüte zu Boden fallen und fasste nach der Pistole, die versteckt unter seinem T-Shirt im Hosenbund steckte.
»Scheiße«, murmelte er leise.
Zuerst ein Anruf von David aus heiterem Himmel, und jetzt das.
Er bewegte sich langsam vorwärts, während er prüfend seinen Blick über die Schiffe gleiten ließ, die diesen Teil des Hafens säumten. Er hatte sein Boot absichtlich an dieser Stelle festgemacht, weil es hier ruhiger lag und vor neugierigen Blicken geschützt war.
Er schaute über seine Schulter zurück.
Die Jacht des deutschen Pärchens lag zu weit entfernt, als dass er sie ansprechen und fragen könnte, ob sie irgendjemanden in der Nähe des Bootes bemerkt hatten, der ihnen verdächtig vorgekommen war.
Allerdings hätten sie ihm bestimmt sofort davon erzählt, als er an ihnen vorbeigegangen war. So etwas machten Bootsbesitzer nämlich. Man verbringt seine Zeit damit, sich von Hafen zu Hafen treiben zu lassen, von Marina zu Marina, und musste dabei oftmals gefährliche Gewässer durchfahren, weshalb passte man aufeinander auf.
Er hatte gerade damit begonnen, sein Dingi zum Einsteigen näher an den Steg heranzuziehen, als ein einzelner weißer Blitz quer durch das Steuerhaus seines Bootes schoss.
Dan warf sich sofort zu Boden, während die Luft um ihn herum in Richtung der Explosion gesaugt wurde, unmittelbar bevor die folgenden Flammen allen verfügbaren Sauerstoff verschlangen und einen tosenden Feuerball ausspien.
Er spürte, wie die Druckwelle über seinen Körper hinwegfegte, und schützte seinen Kopf hastig mit seinen Armen.
Als das Brüllen der Explosion langsam verklang, ging ein Regen aus Holzsplittern und Glasfiberbrocken auf den Steg nieder, der allerdings direkt danach vom tückischen Prasseln der Flammen abgelöst wurde.
Dan hob vorsichtig den Kopf, zog ihn aber sofort wieder ein, als eine zweite Explosion durch die Treibstofftanks fegte.
Scheiße!
Er ging in die Hocke und nachdem er befriedigt festgestellt hatte, dass er sich nichts gebrochen hatte, stand er mit zitternden Knien auf und sah sich den Schaden genauer an.
Es dauerte allerdings nicht lange.
Innerhalb einer Minute begannen die immer noch brennenden Überreste des Bootes, das er einst von seinem Vater geerbt hatte, unter der Wasseroberfläche zu verschwinden.
Als das Klingeln in seinen Ohren ein wenig abgeklungen war, nahm er das Geräusch rennender Füße wahr.
Kampfbereit drehte er sich blitzschnell um, doch dann bemerkte er, dass es lediglich die anderen Bootsbesitzer aus dem Hafen waren, die mit besorgten Gesichtern auf ihn zu gerannt kamen.
Er ließ seine Pistole unauffällig im Hosenbund verschwinden und zerrte sein T-Shirt darüber.
»Dan. Oh mein Gott.« Der Deutsche fuhr sich mit einem betroffenen Gesichtsausdruck durch die Haare, während er auf die qualmenden Überreste des Bootes im Wasser starrte. »Geht es dir gut?«
»Ich bin okay. Danke, Markus.«
»Du bist doch versichert, oder?«
»Ich denke schon«, antwortete Dan, runzelte dann aber die Stirn, als er nachzurechnen versuchte, ob seine Versicherungspolice während seiner Abwesenheit aus dem Vereinigten Königreich vielleicht erloschen sein könnte. »Vielleicht.«
Innerhalb weniger Augenblicke hatte sich eine kleine Menge um ihn herum versammelt, die trotz aller nachdrücklichen Versuche, sie wieder in die relative Sicherheit ihrer eigenen Boote zurückzutreiben, darauf bestand, ihm Ratschläge zu erteilen und ihm Trost zu spenden, sowie im Fall einer reichen amerikanischen Witwe, ihm ein Dach über dem Kopf anzubieten … sogar mit Zusatzleistungen.
Als sein Telefon klingelte, nahm er den Anruf deshalb beinahe erleichtert entgegen und entschuldigte sich bei der Menge.
Er ging ein paar Schritte in Richtung des Hafenmeisterbüros zurück.
»Hallo?«
»Bist du in Ordnung?«, fragte David mit besorgter Stimme.
Dan schluckte die erste Antwort, die ihm in den Sinn kam, herunter und nahm stattdessen einen beruhigenden Atemzug, bevor er sagte:
»Abgesehen davon, dass ich gerade den liebsten Teil meiner Erbschaft verloren habe? Ja, mir geht es gut. Woher wisst ihr überhaupt davon?«
»Feed via Satelliten«, antwortete Mel.
Dan drehte sich um und starrte auf das qualmende Durcheinander, das einmal sein Zuhause gewesen war. »Da gibt es wirklich nettere Arten, mich zur Heimkehr zu bewegen und dafür zu sorgen, dass ich wieder für dich arbeite, David.«
»Das waren wir nicht«, antwortete David. »Gibt es vielleicht sonst noch jemanden, den du verarscht hast? Mal abgesehen von der britischen Regierung?«
»Wo soll ich da nur anfangen?«, antwortete Dan, und wusste, dass der Sarkasmus in seiner Stimme David dort erreichen würde, wo auch immer er dieses Mal sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte.
»Okay«, sagte David, »da du ja jetzt obdachlos bist, möchtest du mein Angebot vielleicht noch einmal überdenken?«
»Du verschwendest wirklich keine Zeit, oder?« Dans Blick blieb an der reichen Amerikanerin hängen, die gerade mit dem Finger auf ihn zeigte, ihre Sonnenbrille herunterschob und dann eine Augenbraue hochzog.
Dan schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben, der gerade seinen gesunden Menschenverstand zu verwirren drohte, und begann mit staksenden Schritten den Steg entlangzugehen, weg von dem Desaster, das einmal sein Boot gewesen war. Er nahm seine Sonnenbrille ab und rieb sich die Augen, dann setzte er die Brille wieder auf, wechselte das Telefon in die andere Hand und fuhr sich mit den Fingern durch das Haar.
»Warum ich, David? Warum jetzt?«
Der andere Mann machte eine kurze Pause und die Stille schien sich über die ganzen Meilen auszudehnen, die zwischen ihnen lagen, bis er schließlich wieder sprach.
»General Collins’ Tochter wird in der von Marokko besetzten Westsahara vermisst.«
»Anna?«
Dan hatte Anna zuletzt vor einigen Jahren gesehen, als diese ihr Abschlussjahr an der Universität von Arizona begonnen hatte. Er erinnerte sich noch gut an die junge, langbeinige Blondine, der es praktisch vorherbestimmt gewesen war, die Herzen ihrer gesamten männlichen Kommilitonen zu brechen.
»Wie … wie geht es dem General?«, fragte er gepresst.
»Er ist mit seiner Weisheit am Ende«, antwortete David. »Angesichts der Art von Freunden, die er hat, und der Menge an Feuerkraft, die ihm zur Verfügung steht, kannst du dir wahrscheinlich selbst ausmalen, warum die Regierung Ihrer Majestät bestrebt ist, zu verhindern, dass er direkt an einer Such- und Rettungsaktion beteiligt ist.«
»Zur Hölle, ja.«
Der General leitete ein hervorragend organisiertes und äußerst leistungsfähiges Team von privaten militärischen Auftragnehmern. Dan hatte keine Ahnung, was David und seine Kollegen dem General versprochen haben könnten, um zu verhindern, dass dieser voller Angriffslust in Afrika auftauchte, aber lange würde es bestimmt nicht so bleiben.
»Weiß er, dass du mit mir redest?«, fragte Dan.
»Du warst sogar seine Idee«, antwortete David trocken. »Eigentlich warst du sogar mehr sein Ultimatum«, fügte er hinzu. »Schafft Dan Taylor dorthin oder ich gehe selbst – ich schätze mal, du verstehst.«
»In Ordnung«, sagte Dan. »Dann lass uns reden.«
»Triff uns in zwanzig Minuten im Argan Hotel«, erwiderte David.
»Ich werde da sein.«
»Großartig«, sagte Mel. »Soll ich schon mal den Wasserkocher anmachen?«
»Sehr komisch.« Dan beendete den Anruf und drängte sich an der kleinen Gruppe von Leuten vorbei, die noch immer auf den Liegeplatz seines Bootes zusteuerten.
Aus der Ferne erklang jetzt das verloren klingende Sirenengeheul des einzigen Feuerwehrfahrzeugs der Stadt.
Ein Mann, den seine Kleidung und die sonnenverbrannte faltige Haut als Einheimischen auswies, hielt seine Hand in die Höhe und stoppte Dan auf seinem Weg.
»Wo ist der Engländer?«
»Das bin ich«, antwortete Dan alarmiert.
Der Mann grinste und hielt ihm einen Karton entgegen.
»Neue Kraftstoffpumpe.« Er strahlte und hielt Dan ein Klemmbrett und einen Stift hin. »Einhundert Dollar, bei Lieferung. Unterschreiben Sie hier.«
Dan blinzelte den Kurier fassungslos an und blickte dann über seine Schulter zum anderen Ende des Steges, wo gerade der letzte Rest seines Bootes in den Wellen versank.
»Ich nehme mal nicht an, dass Sie eine Rückvergütung anbieten, oder?«
KAPITEL 2
Anna Collins öffnete die Schiebetür des Minibusses, noch bevor der Fahrer das Fahrzeug zum Stehen gebracht hatte, und sprang sofort heraus, wobei ihre Turnschuhe bei der Landung auf dem Boden eine kleine Staubwolke aufwirbelten.
Sie schob eine blonde Haarsträhne, die ihrem Pferdeschwanz entkommen war, zurück und schützte ihre Augen vor dem grellen Sonnenlicht, das von der weißen Lackierung des Fahrzeugs reflektiert wurde. Dann setzte sie ihre Sonnenbrille auf.
Anna schulterte ihren Rucksack und wartete ungeduldig darauf, dass ihr Kollege Benji aus dem Minibus kletterte, sich seinen Laptop an die Brust presste und die Tür zuschlug.
Sofort fuhr das Fahrzeug in so einem Tempo wieder los, als würde der Fahrer an der Rallye Dakar teilnehmen. Seine Hosentasche war prall gefüllt von der mehr als angemessenen Entschädigung, die sie mit ihm für seinen Umweg in letzter Minute ausgehandelt hatten.
Anna schluckte schwer, als sie die Panik in Benjis Augen entdeckte.
Seine Stirn war schweißüberströmt, und sie musste sich nicht länger fragen, ob er genauso verängstigt war wie sie.
Er tastete eine Sekunde lang in seiner Jeanstasche herum und zog dann sein Handy hervor.
»Immer noch nichts«, sagte er resignierend.
Anna trat von einem Fuß auf den anderen und versuchte ihren Herzschlag zu beruhigen. Sie hatte es geschafft, kurz mit ihrem Vater zu sprechen, bevor sie das Büro der Minengesellschaft verlassen hatten, und hatte ihm gesagt, dass sie sich große Sorgen um ihre und Benjis Sicherheit machte, und dass sie, bis sie ihm mitteilen konnte, dass sie in Sicherheit waren, bestimmt nicht mehr zur Ruhe kommen würde. Sie musste sie beide unbedingt aus dem Land schaffen … und zwar schnell.
»Okay«, presste sie hervor und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. »Lass uns in unsere Zimmer gehen, packen und dann direkt zum Flughafen fahren. Ich treffe dich in fünfzehn Minuten beim Auto, okay?«
Benji nickte und blickte über seine Schulter hinweg in Richtung der neuen Phosphat-Mine, von der sie gekommen waren und die gerade erst eröffnet worden war. »Bist du dir da wirklich sicher?«
»Absolut«, antwortete Anna. »Du hast doch dieselben Unterlagen wie ich gesehen. Wir stecken in echt großen Schwierigkeiten.«
Benji fluchte und stieß dabei ein leises Zischen zwischen den Zähnen aus. »Okay, dann lass uns packen.«
Sie schulterten gleichzeitig ihre Reisetaschen und liefen dann schnell zu den provisorischen Gebäuden hinüber, die auf dem Gelände des für die Bauphase der neuen Mine errichteten Camps standen.
Die Nachricht, dass ein neues Phosphat-Vorkommen entdeckt worden war, hatte Arbeiter von überall her angelockt, die allesamt zum Äußersten entschlossen waren, um in der Mine gutes Geld zu verdienen. Obwohl die Mine als eine Möglichkeit angepriesen wurde, die einheimische sahrauische Bevölkerung mit Arbeit zu versorgen und ihre Perspektiven zu verbessern, waren es in Wahrheit vor allem die im Ausland lebenden marokkanischen Arbeiter, die viele der angebotenen Stellen besetzt hatten und begierig darauf waren, mehr Geld über die Grenze nach Hause schicken zu können.
Die Arbeiter waren alle im Hauptbereich des Minenlagers untergebracht, einer weitläufigen Ansammlung von quadratischen Hütten, die wie drei übereinandergestapelte Schiffscontainer aussahen und hoch über ihren Bewohnern aufragten, wenn diese bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zur Arbeit gingen und wieder zurückkamen.
Die Westler, die bei der Minengesellschaft beschäftigt waren und auch ihre Gäste, waren allesamt in luxuriöseren Unterkünften im vorderen Bereich des Hauptlagers untergebracht worden.
Anna ging durch den kleinen, abwechslungsreich gestalteten Garten, der von einigen Arbeitern in der Nähe des Eingangs zum Empfangsgebäude angelegt worden war, während ihr Verstand bei dem Versuch, ihre Angst unter Kontrolle zu halten, auf Hochtouren arbeitete.
Rennen würde nur Aufmerksamkeit erregen, und das durften sie nicht riskieren, zumindest noch nicht.
Bevor sie die Kühle des Empfangsbereiches erreichten, bogen sie nach rechts ab und passierten dann einen Torbogen.
Dahinter umrahmten gelbes Gras und verkrüppelte Bäume eine Ansammlung von zwölf Bungalows. Beton- und Zinndachkonstruktionen, die fließendes Wasser und eine Klimaanlage boten, perfekt für die Nutzung durch die höheren Angestellten des Bauherrn und Gäste wie Anna und Benji, die nur kurzzeitig in der Mine zu tun hatten.
»Warte«, sagte Benji und ergriff Annas Arm. »Bevor wir uns trennen …«
»Was?« Sie runzelte die Stirn, als er in der Seite seiner Laptoptasche herumkramte.
Er zog einen USB-Stick heraus. »Nimm du ihn, er enthält alles, was wir herausgefunden haben. Du kennst zwar die wichtigen Dinge, die Codes und alles, aber hiermit können wir die Beweise dokumentieren.«
Annas Hand zitterte, als sie den Stick entgegennahm. »Was soll ich denn damit? Du hast doch auch alle Beweise auf deinem Laptop, oder?«
»Ja, als Back-up. Ich hatte vor Ort keine Zeit, die Unterlagen auf deinen Laptop zu kopieren. Lade sie also sofort herunter, sobald du in deinem Zimmer bist …«, trug er ihr auf. Benji schluckte. »… falls du recht hast, und es passiert irgendetwas, wodurch wir getrennt werden.«
»Hast du das auch als E-Mail an unsere Zentrale geschickt?«
»Die Verbindung war schrecklich. Ich glaube aber, einiges davon ist trotzdem durchgekommen.« Er machte ein langes Gesicht. »Doch angesichts dessen, was wir wissen, kann ich nicht garantieren, dass die E-Mail sie erreicht und nicht vorher abgefangen wird. Ich habe den Verschlüsselungscode verwendet, von dem ich dir erzählt habe, aber …«
Anna nickte. Keiner von ihnen war erpicht darauf, seine Ängste auszusprechen. »Bis gleich.« Sie steckte den USB-Stick in ihre Hosentasche und ging schnell auf den Bungalow am anderen Ende zu.
Weil sich direkt neben der Rezeption die Bar befand und die marokkanischen Arbeiter die Tendenz hatten, nach einem Arbeitstag die Sau rauszulassen, hatte sie sich bewusst für eine Unterkunft entschieden, die so weit wie möglich vom Hauptgebäude entfernt lag.
Die Bäume über ihr linderten die Hitze des Tages etwas, und nachdem sie die Stufen zu der hölzernen Veranda hinaufgestiegen war und ihren Schlüssel in das Türschloss gesteckt hatte, atmete sie erleichtert auf, als sie die Kühle der Klimaanlage umfing.
Sie schloss die Tür hinter sich sorgfältig ab, schob den Sicherheitsriegel vor und ließ ihren Rucksack auf das Bett fallen, dann zog sie ihren Laptop aus dem Rucksack, meldete sich hastig an und steckte den USB-Stick ein.
Während die Dateien hochgeladen wurden, blickte sie sehnsüchtig in Richtung Badezimmer, aber ihr war klar, dass sie sich den Luxus einer Dusche momentan nicht leisten konnte. Sie ließ das auffällige orangefarbene Hemd von den Schultern gleiten, ersetzte es durch ein einfaches schwarzes T-Shirt und band sich ein Sweatshirt um die Taille. Als Nächstes packte sie den Rest ihrer Kleidung ein, ohne sich Gedanken übers Zusammenlegen zu machen, und warf Shampoo und Sonnencreme in ihren Koffer.
Es dauerte nicht lange, denn sie und Benji hatten nur drei Wochen im Land bleiben sollen, um eine Bilanzprüfung abzuschließen, die sie im relativen Luxus ihrer Rotterdamer Büros begonnen hatten.
Ihr Blick schweifte nun zum Laptop-Bildschirm. Als der Download fertig war, schloss sie den Computer, zog den USB-Stick heraus und steckte den Laptop wieder in ihre Tasche zurück. Dann legte sie den Stick auf den Boden und zermalmte ihn unter ihrem Schuhabsatz.
Sie sammelte die Einzelteile sorgfältig ein, ging dann schnell zum Badezimmer, wickelte sie in Toilettenpapier und spülte sie hinunter.
Anna dachte an das Telefonat zurück, das sie vor zwei Stunden mit ihrem Vater geführt hatte. Als Benji an die Tür ihres zeitweiligen Büros geklopft und ihr die Daten auf seinem Laptop-Bildschirm gezeigt hatte, war sie von tiefer Panik erfasst worden, denn sie hatte sofort erkannt, dass sie viel mehr als nur einen einfachen Hackerdiebstahl aufgedeckt hatten.
Sie war von ihrem Schreibtisch aufgesprungen und hatte die Tür zugeworfen, bevor sie und Benji eine hitzige Diskussion darüber geführt hatten, was sie als Nächstes tun sollten. Sie wusste, dass wer auch immer den Diebstahl durchgeführt hatte, wahrscheinlich auch einen Alarm ins System eingebaut hatte, der denjenigen bei unerwünschter Aufmerksamkeit warnen würde, und der angesichts der Komplexität des Datendiebstahls bestimmt auch in der Lage sein würde, ihren genauen Standort herausfinden zu können.
Nach zehn Minuten hatte Benji ihrem Plan zugestimmt.
Die Telefonverbindungen in der Westsahara waren leider notorisch schlecht, doch nachdem sie ihr Büro nicht hatten erreichen können, war es Anna wenigstens gelungen, ihren Vater in Arizona anzurufen. Als sie seine Stimme gehört hatte, waren ihr vor lauter Erleichterung die Tränen gekommen.
Er hatte ihren Vermutungen zugestimmt und ihnen befohlen, so schnell wie möglich zu packen und zu verschwinden. Annas Vater hatte Verbindungen, und er würde alles in seiner Macht Stehende tun, damit sie jemand am Flughafen abholen und in Sicherheit bringen würde.
Alles, was sie jetzt tun mussten, war, den Flughafen von Laâyoune zu erreichen.
Seitdem hatte Anna versucht, ihn noch einmal anzurufen, um ihn auf den aktuellen Stand zu bringen, doch ihre Anrufe landeten immer direkt auf der Mailbox.
Anna kehrte ins Schlafzimmer zurück, packte ihren Koffer zu Ende und schloss den Reißverschluss. Anschließend zog sie die Bettwäsche glatt und überprüfte das Zimmer noch einmal gründlich.
Nichts wies mehr auf ihre Anwesenheit hin.
Sie warf erneut einen Blick auf ihre Armbanduhr. Noch fünf Minuten, bis sie Benji treffen sollte.
Nachdem sie vor drei Wochen auf dem einzigen internationalen Flughafen des besetzten Landes angekommen waren, hatten sie eine kleine Limousine gemietet, die seit ihrer Ankunft auf dem Parkplatz des Minenlagers stand. Anna wurde vor Angst schlecht, als sie daran dachte, dass der Motor eventuell nicht anspringen könnte; sie wusste schließlich, wie launisch Fahrzeuge in einem so rauen Klima sein konnten und verfluchte jetzt ihr Versäumnis, nicht regelmäßig den Öl- und Kühlmittelstand kontrolliert zu haben.
Ein lauter Schrei unterbrach jetzt ihre Gedanken und sie huschte hastig zum Fenster und spähte durch die Gardinen.
Dann musste sie einen Aufschrei unterdrücken.
Eine Gruppe von Männern stand am Eingang des Hains, der seine Schatten auf die Bungalows warf. Sie alle hielten Sturmgewehre in den Händen und ihre Tarnanzüge ließen keinen Zweifel am Grund ihrer Anwesenheit. Alle zielten jetzt gleichzeitig auf eine Gruppe von Arbeitern, die mit weit aufgerissenen Augen aus dem Hauptlager herausrannten und versuchten, den bewaffneten Männern zwischen den Gebäuden zu entkommen.
Die panischen Schreie der Bauarbeiter wurden immer lauter, als Schüsse die Luft durchdrangen. Die Flüchtenden am Ende der Menge stürzten in den Dreck, als sie hinter ihren stolpernden Kollegen niedergemäht wurden.
Annas Fingerknöchel wurden weiß, als sie den Fensterrahmen umklammerte, dann wich sie in die Dunkelheit des Raumes zurück, ohne ihren Blick von dem Blutbad abwenden zu können.
Als die Männer mit den Waffen näherkamen, hörten sie auf zu schießen und die Flüchtenden brachen durch die Sträucher, die den Hain vom Parkplatz hinter dem Haupteingang trennten, dann verschwanden sie außer Sicht; nur ihre geschockten Stimmen waren weiterhin zu hören.
Anna fluchte unterdrückt.
Ihre Verfolger hatten wesentlich schneller reagiert, als sie es ihnen zugetraut hatte. Zweifellos war ein Alarm ausgelöst worden, als sie und Benji zum ersten Mal die Sicherheitslücke entdeckt hatten, was bedeutete, dass ihre Befürchtungen begründet gewesen und sie beobachtet worden waren.
Sie schloss die Vorhänge und schaltete die Klimaanlage aus, dann schob sie ihren Koffer unter das Bett und zog die Bettdecke so weit herunter, bis sie das Gepäckstück verdeckte. Als Nächstes holte sie ihr Handy heraus, schaltete es auf stumm und deaktivierte auch die Vibrationsfunktion, anschließend tippte sie die Kurzwahlnummer für die Ranch ihres Vaters in Arizona an.
Sie bemerkte, dass sich der Deckenventilator noch drehte, und schlug auf den Schalter neben ihrer Schulter, während sie dem Wählton lauschte.
Anna fluchte, als sie sofort zur Mailbox weitergeleitet wurde, und beendete den Anruf. Als plötzlich zwei laute Schüsse durch den Komplex donnerten, ließ sie fast das Telefon fallen.
»Nein«, murmelte sie erschrocken.
Anna huschte zurück zum Fenster und ging in die Knie, bevor sie die Unterkante des Vorhangs zur Seite zerrte. Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um sich selbst am Schreien zu hindern, als Benjis zappelnder Körper von zwei Männern aus seinem Zimmer geschleppt und auf der kleinen, holzüberdachten Terrasse, die den Bungalow umgab, fallen gelassen wurde.
Er blutete aus einer Wunde am Bein und schrie vor Qual und Schrecken, bis einer der Männer eine Pistole auf sein Gesicht richtete und den Abzug drückte.
Anna wimmerte, ließ den Vorhang zurückfallen und hastete durch den Raum. Als sie an ihrem Rucksack vorbeikam, der neben dem Bett auf dem Boden lag, schnappte sie ihn, schwang ihn sich über die Schulter und schlich dann ins Badezimmer.
Sie hockte sich auf den gefliesten Boden und gab erneut die Kurzwahlnummer für ihren Vater ein. Es klingelte dreimal, und vor ihrem inneren Auge sah sie Bilder des Satellitentelefons, das im Büro ihres Vaters in der Ladestation steckte, während er auf der Ranch unterwegs war, um die Arbeit seines geschäftigen Betriebs zu überwachen.
Sie unterdrückte ihre Tränen, als der Klingelton erneut verstummte und durch einen einzigen, einsamen Piepton ersetzt wurde, dann unterbrach sie die Verbindung.
Von draußen drangen jetzt Schreie an ihre Ohren und ihr wurde bewusst, dass ihr die Zeit in rasantem Tempo davonlief.
Sie steckte das Telefon in die Seitentasche ihres Rucksacks und richtete ihre Aufmerksamkeit nun auf das kleine Fenster über dem Waschbecken.
Sie krallte ihre Finger um den Metallriegel und zog fest daran.
Doch er bewegte sich nicht.
Sie fluchte unterdrückt, dann positionierte sie ihre Füße links und rechts vom Waschbecken, sodass sie sich gegen den Waschtisch abstützen konnte und drückte ihre Beine dagegen, während sie mit aller Kraft am Riegel zog.
Sie keuchte, als die Verriegelung unter ihren Anstrengungen ein wenig nachgab, dann zog sie noch einmal so fest sie konnte, mit zusammengebissenen Zähnen.
Der Riegel verschob sich in seiner Befestigung und eine kleine Menge getrockneter Farbe regnete auf das Waschbecken hinab, als die Metallbefestigung endlich nachgab.
Annas Aufmerksamkeit richtete sich jetzt auf den Rahmen, dessen Holzoberfläche von mehreren dicken Farbschichten überzogen war. Sie legte ihre Handflächen darauf und schob, doch er hielt stand.
Als von unten ein Schrei durch das Badezimmerfenster hinauf schallte, erstarrte sie und hielt den Atem an.
Aus größerer Entfernung wurde ein Befehl gebellt, dann zogen sich die Schritte vom Bungalow zurück.
Haben sie mich gehört?
Sie zählte bis zehn, atmete dann aus und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die anstehende Aufgabe. Verzweiflung ergriff sie, als sie erkannte, dass ihr Leben davon abhing, ein Versteck zu finden, und das so schnell wie möglich.
Die Stimmen draußen überzeugten sie davon, dass jeder Fluchtversuch sinnlos wäre. Sie würde gefunden und innerhalb von Sekunden getötet werden, genau wie Benji.
Bei dem Gedanken an den Schrecken, den er gefühlt haben musste, als die bewaffneten Männer in sein Zimmer gestürmt waren, kämpfte sie gegen ihre Tränen an und versuchte stattdessen, ihre Wut und Angst auf den Fensterrahmen unter ihren Händen zu fokussieren.
»Komm schon«, zischte sie verhalten und drückte erneut.
Sie zwang sich, die furchterregenden Geräusche, die von außerhalb des Bungalows hereindrangen, auszublenden und benutzte stattdessen ihren Handballen, um gegen das Fenster zu schlagen, um es von dem Belag zu befreien.
Sie fluchte leise vor sich hin und schob dann noch einmal mit beiden Händen.
Der Fensterrahmen gab jetzt so schnell nach, dass sie fast rückwärts auf die Badezimmerfliesen gestürzt wäre. Für ein paar kostbare Sekunden musste sie sich mit den Händen auf beiden Seiten des Waschbeckens abstützen und atmete schwer.
Ein weiterer Schrei von draußen, gefolgt von einem einzelnen Schuss, ließ sie endlich aus der Starre erwachen.
Sie durchsuchten jetzt offenbar die Bungalows … einen nach dem anderen, und töteten jeden, der ihnen im Weg stand.
Ein Stöhnen entwich ihren Lippen und die Stimme ihres Vaters hallte in ihrem Kopf wider: Wenn du jemals in einen Terroranschlag verwickelt werden solltest, versuch nicht, zu fliehen, es sei denn, es ist wirklich sicher. Versteck dich stattdessen. Halte den Kopf unten. Bleib still.
Anna riss ihren Rucksack vom Boden hoch und warf ihn auf den Waschtisch, bevor sie hinaufstieg.
Dann schob sie das Fenster weiter auf, verzog aber das Gesicht, als die Scharniere an der Oberkante des Holzrahmens ein Quietschen von sich gaben.
Ihr Herzschlag pochte laut in ihren Ohren, als sie sich bemühte, jede Bewegung auf der Rückseite des Bungalows zu registrieren.
Schreie und Rufe, dicht gefolgt von weiteren Schüssen, hallten durch das Hauptlager, aber sie sah niemanden hinter dem Gebäude auftauchen.
Annas Kopf zuckte hoch, als laut gegen die Eingangstür des Bungalows gehämmert wurde, dann sprang sie in die Höhe und schob das Badezimmerfenster auf, wobei sie leider staubige Handabdrücke an der Wand hinterließ.
Sie tauchte in die kleine Öffnung hinein und fing an, sich mit dem Kopf voran hindurch zu winden.
Anna fluchte, als ihre Hüfte an der Rahmenkante entlang schabte. Sie glitt wieder zurück und versuchte erneut, sich durch den schmalen Spalt zu schlängeln. Sie verdrehte ihre Schultern so weit, bis sie die obere Hälfte ihres Körpers hindurchschieben konnte, und versuchte dann, sich zu drehen.
Doch ihr Gürtel verhakte sich im Rahmen und Holzsplitter gruben sich in ihr Fleisch.
Sie biss sich auf die Lippen, weil sie genau wusste, dass die bewaffneten Männer sie innerhalb von Sekunden finden würden, wenn sie schrie.
Sie knirschte mit den Zähnen und drückte erneut, aber sie schaffte es einfach nicht durch die Lücke.
Frustriert schlängelte sie sich zurück, bis ihre Knie auf die Oberfläche des Waschtischs trafen, und ließ sich dann langsam auf den Boden gleiten. Sie wühlte in der Seitentasche ihres Rucksacks und zog ihr Handy heraus, dann lehnte sie sich an das Waschbecken und drückte erneut die Kurzwahlnummer für ihren Vater.
Endlich bekam sie ein Signal, doch dann hörte sie erneut die Mailbox-Ansage ihres Vaters. Sie atmete tief durch.
»Dad? Sag Mom, dass es mir leidtut. Ich liebe dich.«
KAPITEL 3
Nasir Abbas eilte dem großen Engländer hinterher, seine Djellaba hatte er hochgezogen, damit er seine Füße besser bewegen und mit den ausgreifenden Schritten des Mannes mithalten konnte.
Er schimpfte leise auf Arabisch vor sich hin … eine stetige Schimpftirade, mit der er Dan und sein Glück verfluchte. Man hatte ihn gewarnt, dass der Mann ein hoch qualifizierter Agent war, aber er hatte in den letzten zwei Wochen, in denen er ihn beobachtet hatte, nichts entdeckt, was auf etwas anderes als auf einen typischen Engländer im Urlaub hindeutete.
Der Mann trank Bier, hing mit seinen Nachbarn im Hafen herum und ging jeden Tag in dasselbe Café und besuchte denselben Lebensmittelladen.
Er hatte die Spur des Engländers vor einigen Monaten in Frankreich verloren. Das Boot des Mannes war einfach im Schutz der Dunkelheit von seinem Liegeplatz verschwunden, und mehrere Wochen harter Arbeit sowie einige unverschämt hohe Schmiergelder waren notwendig gewesen, um ihn wieder aufspüren zu können.
Wie er der Explosion auf dem Boot hatte entkommen können, war ihm immer noch unbegreiflich.
Abbas ballte die Faust, als er an einer belebten Kreuzung mehrere Schritte hinter dem Mann stehen blieb und Interesse an Küchengeräten in einem der Schaufenster entlang der Straße heuchelte.
Er blickte gerade noch rechtzeitig über seine Schulter, um Dan über die Straße laufen zu sehen.
Der Mann fluchte, scheuchte den Ladenbesitzer, der sich ihm gerade näherte, hastig weg und murmelte etwas darüber, dass er spät dran sei und rannte dann seiner Beute hinterher.
Als er die Straße überquerte, wurde er wieder langsamer und ließ sich extra Zeit, weil er sich der Notwendigkeit bewusst war, die Fahrer der vorbeifahrenden Wagen nicht zu verärgern, damit diese ihn nicht anhupten und damit unerwünschte Aufmerksamkeit auf ihn lenkten.
Abbas erreichte jetzt die andere Seite und blieb bewusst im Schatten, während er keine Sekunde lang Dans Rücken aus den Augen ließ, als dieser nach rechts auf einen geschäftigen Markt abbog.
Der Engländer war leicht zu verfolgen, weil er viel größer als alle Einheimischen und selbst als die meisten Touristen war, die um die Stände herumschwärmten. Das war auch gut so, denn die schmale Fußgängerzone war voller Menschen, die um Obst und Gemüse feilschten oder die Souvenirs durchstöberten, die auf Decken und Teppichen ausgebreitet auf dem Boden lagen.
Die Straßen der Stadt kreuzen sich auf eine Art, die fast an europäische Stadtplanungen erinnerte, dennoch war es leicht möglich, sich im Labyrinth der Gassen zu verirren.
Als er die Stadt das erste Mal betreten hatte, hatte sich Abbas an den breiteren Hauptstraßen orientiert. Wenn er sich verirrt hatte, war er einfach so lange weitergegangen, bis er eine der breiteren, belebteren Straßen erreicht hatte, und dann hatte er sich erneut auf den Weg gemacht.
Seine Arbeit hatte sich bezahlt gemacht, denn jetzt ging er so selbstbewusst durch die Straßen wie ein Einheimischer.
Er zuckte beim lauten Rufen eines älteren Kaufmanns zu seiner Linken zusammen, der gerade einen mit Obst beladenen Handkarren zog und die Fußgänger anbrüllte, damit diese ihn durch die Menge ließen, bevor eine Ziege vorbeihuschte, dicht gefolgt von einem kleinen Jungen, der ihr etwas hinterherschrie, während er sich an Abbas vorbeidrängte und außer Sicht verschwand.
Vor ihm hatte der Engländer jetzt an einem der Stände angehalten, als müsse er sich kurz orientieren, und war dann links abgebogen.
Abbas beeilte sich, zu ihm aufzuschließen, gerade noch rechtzeitig, um den Mann in einer schmalen Seitenstraße verschwinden zu sehen.
Doch er hielt sich zurück, weil er sah, dass die Straße extrem eng war. Die Türen öffneten sich direkt in die Straße hinein und er konnte sich nirgendwo verstecken, falls sich der Mann umdrehen sollte … Abbas würde einfach zu sehr auffallen.