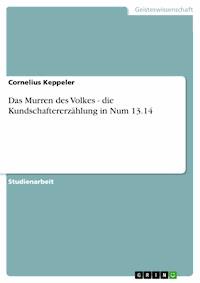Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Theologische Studien
- Sprache: Deutsch
Gnaden- und Trinitätstheologie gelten als schwierige Themen, die mit dem alltäglichen Leben nichts zu tun haben. Dass dem nicht so sein muss und dass sie wichtige Beiträge für ein zeitgemäßes geistliches Leben leisten können, zeigen die in diesem Band zusammengestellten Texte. Die ignatianische Spiritualität bietet dabei einen hilfreichen Weg, wie sich Gott im Alltag finden lässt. Grunderfahrungen wie der Trost oder die Erfahrung der Spannung zwischen Wort und Schweigen bilden Ansatzpunkte für Reflexionen über die zwischenmenschliche Kommunikation und das Gebet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cornelius Keppeler
Gnade – Geist – Gebet
Texte zu Theologie und Spiritualität
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einführung
Begnadung als berechtigte Forderung?
Ist Reinhard Mey ein Frommer von heute?
Der Heilige Geist – tatsächlich Gott, Person und Herr?
Wort und Schweigen
Trost ohne Ursache?
Literaturverzeichnis
Impressum neobooks
Einführung
Gnade – Geist – Gebet
Texte zu Theologie und Spiritualität
Cornelius Keppeler
Der vorliegende 5. Band der Theologischen Studien umfasst Texte aus dem Themenspektrum der Gnaden- und Trinitätstheologie sowie der Spiritualität. Die verschiedenen Beiträge durchzieht der prägende Einfluss von Karl Rahner wie ein roter Faden. Demzufolge sind sie durch die ignatianische Haltung gekennzeichnet, die die Theologie nicht als »l’art pour l’art« versteht, sondern als Basis für eine Seelsorge und Pastoral begreift, die Gott erfahrbar vorstellt. So entwickelte Rahner seine Gnadentheologie vom Heilswillen Gottes her1 und forderte eine Mystagogie in das absolute Geheimnis2. Dies korrespondiert mit einer Spiritualität, die Mystik nicht als Erlebnis einer besonderen Erleuchtung oder Erscheinung betrachtet, sondern sie im Alltag verwurzelt erkennt und Gotteserfahrung im Kleinen und Naheliegenden für möglich hält.
Die zusammengestellten Texte sind zwischen 2006 und 2021 entstanden und sind von ihrer Charakteristik teils theologisch, teils spirituell, teils betrachtend, aber stets haben sie einen Bezug zum Alltag oder zu alltäglichen Fragestellungen. Der Beitrag »Begnadung als berechtigte Forderung?« geht auf das Verhältnis von Natur und Gnade ein, welches im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) kontrovers diskutiert wurde. Karl Rahner und Henri de Lubac haben in dieser Frage um eine Überwindung des damals vorherrschenden neuscholastischen Zwei-Stockwerk-Denkens und ein erneuertes Gnadenverständnis gerungen.
Im zweiten Artikel werden die Texte des Liedermachers Reinhard Mey auf christliche Bezüge, biblische Bilder und Aussagen über die Kirche durchleuchtet. Da diese zahlreich sind, obwohl Mey keinen kirchlichen Hintergrund hat, wird die Frage gestellt, ob er als »anonymer Christ« bezeichnet werden könne.
Der Aufsatz »Der Heilige Geist – tatsächlich Gott, Person und Herr?« ist wieder überwiegend theologischer Natur. In ihm wird zunächst der Stellenwert des Heiligen Geistes innerhalb der Trinität thematisiert, der kirchen- und dogmengeschichtlich unterbelichtet erscheint, so dass es den Eindruck macht, als sei die dritte Person von untergeordneter Bedeutung. Da der Heilige Geist jedoch nicht nur das Bindeglied zwischen Vater und Sohn, sondern auch zwischen Mensch und Gott ist, ist er nicht bloß theologisch, sondern auch pastoral eminent wichtig.
Zu Beginn seiner Publikationstätigkeit veröffentlichte Karl Rahner „Worte ins Schweigen“. In diesen Meditationstexten wird deutlich, aus welchem spirituellen Fundament seine Theologie erwächst. Die Spannung zwischen Wort und Schweigen wird auch in einem zeitgenössischen Songtext greifbar, welcher Anlass für eine Verhältnisbestimmung beider zueinander gewesen ist.
Den Abschluss bildet die Auseinandersetzung mit dem Trost. Die Frage, was Trost überhaupt ist, wo er herkommt und welche Funktion er hat, ist in erster Linie eine alltägliche, dann aber schnell eine theologisch-spirituelle, so dass zuletzt der Bogen geschlagen werden kann zu den anfangs angesprochenen gnadentheologischen Fragestellungen. Es wird offensichtlich, wie sehr Trost, Gnade, Sinn und Gotteserfahrung zusammenhängen.
1 Vgl. Rahner, De Gratia Christi/Über die Gnade Christi, 239-491.
2 Vgl. Fischer, Philosophie und Mystagogie.
Begnadung als berechtigte Forderung?
Gedanken zur Bedeutung des übernatürlichen Existentials in der Gnadenlehre Karl Rahners
(Bereits erschienen in: Zeitschrift für Katholische Theologie 126 (2004) 65-82)
Die Ungeschuldetheit der Gnade ist Grunddatum der katholischen Gnadenlehre. Sie nicht zu gefährden, war das Bemühen Karl Rahners in der Auseinandersetzung mit der »nouvelle théologie« im Allgemeinen und mit der Position seines Ordensbruders Henri de Lubac im Speziellen. Er versuchte, dessen wichtige Impulse aus der Tradition aufzunehmen und weiterzuführen, zugleich jedoch den Verwerfungen der Enzyklika Humani generis1 zu entgehen. Den Fragen, ob dies Rahner gelingt und inwieweit sein Lösungsansatz das Verhältnis von Natur und Gnade befriedigend ausdrücken kann, soll hier nachgegangen werden. Innerhalb dieses Problemhorizonts hat Paul Rulands den zentralen Terminus des übernatürlichen Existentials und dessen inhaltliche Füllung in den ersten Jahren seines Vorkommens neu in das Blickfeld gerückt.2 Daher wird seine Position eine ausführliche Beachtung finden.
Henri de Lubac wollte mit dem Vorstoß in seinem Buch »Surnaturel«3 das neuscholastische Zwei-Stockwerk-Denken, nach dem die Gnade lediglich als Überbau der Natur verstanden wurde, überwinden, indem er von Thomas von Aquin den Begriff des »desiderium naturale« aufnahm und neu – er meinte im thomistischen Sinn – interpretierte. Damit konnte er zwar dem Gnadenextrinsezismus wirksam begegnen. Doch wurde er von vielen Theologen missverstanden, die ihm vorwarfen, er stelle mit seiner These die Ungeschuldetheit der Gnade in Frage, da darin die Begnadung als Teil der Natur betrachtet werde.4 Im deutschsprachigen Raum kam es zu diesen Fehldeutungen, nachdem Émile Delaye Lubacs Neuansatz in einem anonym veröffentlichten Aufsatz5 in extremer Weise vorgestellt und zusammengefasst hatte, wobei es zu nicht unwichtigen Verständnisunschärfen gekommen war. Da Karl Rahner6 direkt darauf antwortete, machte er diesen Artikel dennoch zum hauptsächlichen Bezugspunkt für seine Entgegnung7 und die Darlegung seiner eigenen Auffassung.
Diese Entgegnung ist jedoch mehr als eine bloße Antwort. In ihr entwickelt Rahner die Grundzüge seiner Gnadenlehre, die sowohl das Verhältnis von geschaffener und ungeschaffener Gnade, als auch das Verhältnis von Natur und Gnade in einer neuen Weise vorstellt. Hierbei spielt der von ihm eingeführte Begriff des übernatürlichen Existentials eine entscheidende Rolle.
1 Papst Pius XII. wendet sich mit Humani generis (1950) u.a. gegen einige Lehrinhalte der sogenannten »nouvelle théologie«. So wird das intrinsezistische Verständnis des Verhältnisses von Natur und Gnade, das behauptet, „Gott könne keine vernunftbegabten Wesen schaffen, ohne diese auf die seligmachende Schau hinzuordnen und dazu zu berufen” (DH 3891), verworfen.
2 Vgl. Rulands, Menschsein unter dem An-Spruch der Gnade.
3 Lubac, Surnaturel.
4 „Aus diesem Verlangen und der Ablehnung eines status naturae purae ein (die Gratuität der Gnade aufhebendes) Recht des Menschen auf die Gnadenschenkung herzuleiten, ist nach de Lubac völlig abstrus”, Berger, Natur und Gnade, 265.
5 D., Ein Weg zur Bestimmung des Verhältnisses von Natur und Gnade.
6 Rahner, Über das Verhältnis von Natur und Gnade.
7 Lubac äußert sich später enttäuscht darüber, dass Rahner meint, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen, obwohl er lediglich diese verfälschende Darstellung und einen weiteren Aufsatz gelesen habe. Vgl. Lubac, Die Freiheit der Gnade, 152f, Anmerkung 36.
1. Eine Antwort
Als längst überfällig anerkennt Rahner den Versuch einer Überwindung eines Natur-Gnade-Verhältnisses, nach dem die Gnade „als ein bloßer, in sich zwar sehr schöner Überbau [erscheine], der durch Gottes freie Verfügung auf die Natur aufgesetzt sei, und zwar so, daß das Verhältnis zwischen beiden nicht viel intensiver sei als das einer Widerspruchslosigkeit“1. Er kritisiert ebenso die strikte Trennung, die voraussetzt, „daß das konkret erfahrene (faktische) Wesen des Menschen sich mit der ›Natur‹ des Menschen adäquat decke, die in der Theologie Gegenbegriff zum Übernatürlichen ist“2, und problematisiert die Begegnung von Mensch und Gnade nach diesem Denkmodell.3 Rahner bedient sich für seine Kritik zweier Zugänge. Zunächst hinterfragt er die Auffassung hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und bezeichnet sie als problematisch, da sie weder angebe, was zur »Natur« gehöre, noch berücksichtige, dass Erfahrbarkeit der Gnade und Erfahrbarkeit der Gnade als Gnade nicht dasselbe sind.”4 Sodann hält er die ontologische Vorstellung, dass das Hingeordnetsein des Menschen auf das übernatürliche Ziel durch äußeres göttliches Dekret bestehen könnte, für nicht einleuchtend. An diesem Punkt erscheint nun der Begriff, der für die Gnadenlehre Rahners von zentraler Bedeutung ist – das übernatürliche Existential. Er wird fast nebensächlich in einer Frage in die Diskussion eingeführt. Doch steht er sofort im Spannungsfeld von menschlicher Natur und Gnade und ist zugleich mit der Problematik konfrontiert, wie solch ein Konstitutiv gedacht werden kann.5 Aber Rahner stellt seinen eigenen Ansatz vorerst noch zurück und wendet sich unterschiedlichen Wegen zu, die eine Überwindung des Gnadenextrinsezismus versuchen. Dieses Ziel wird seiner Meinung nach nicht erreicht, wenn man lediglich betont, „daß die potentia oboedientialis der Natur doch irgendwie eine Velleität, ja eine, freilich nur bedingte, Sehnsucht nach dem unmittelbaren Gottesbesitz in den Tiefen des Wesens einschließe und dieser appetitus wirklich von einer Geistnatur nicht weggedacht werden könne“6. Denn eine bloß »bedingte Sehnsucht« ist nicht ausreichend, um die Natur übernatürlich zu finalisieren. Eine »unbedingte« Hinordnung auf Gnade als Konstitutiv der Natur – wie es Anonymus D. vertritt – wirft jedoch die Frage nach der Gratuität auf. Sie kann Rahner nur verneinen und zieht zudem in Zweifel, ob der anonyme Autor überhaupt über eine Betrachtung der ungeschuldeten Schöpfung hinauskommt, sich die Gnade also gar nicht von deren Ungeschuldetheit unterscheide.7 Gerade auf diese Unterscheidung kommt es aber Rahner an. Denn eine doppelte Gratuität und damit die Ungeschuldetheit der Gnade als solche lässt sich nur begründet vertreten, wenn die Hinordnung auf die Gnade keine Anlage der Natur ist.
Ausgehend von diesen Ergebnissen der Auseinandersetzung mit dem Aufsatz von Anonymus D. zeichnet Rahner nun sein eigenes Bild des Verhältnisses zwischen Mensch und Gnade. Die Grundlage für den Empfang der Gnade sind zum einen der Wunsch Gottes, sich mitzuteilen, und zum anderen die Schaffung des Menschen als sein Gegenüber. Da Gott sich ungeschuldet mitteilen will, muss er den Menschen in einer Weise schaffen, in der er diese Selbstmitteilung nur als Gnade empfangen kann – „er muß ihm also nicht nur ein Wesen geben, sondern ihn als eine ›Natur‹ (im Gegensatz zu einem ungeschuldeten Übernatürlichen) konstituieren.“8 Diese Kreatürlichkeit ist der Grund dafür, dass die Gnade dem Menschen nur ungeschuldet sein kann. Auf diesem Fundament entwickelt Rahner in vier Punkten seinen Denkansatz.
Zunächst soll der Mensch die göttliche Liebe empfangen können. Dazu muss er sowohl eine Kongenialität für diese Liebe als auch die Möglichkeit des Empfangs haben. Diese reale Potenz muss der Mensch immer haben, da er „ja der immer von dieser Liebe Angeredete und Angeforderte“9 ist. Für Rahner ist sie daher „die Mitte und der Wurzelgrund dessen, was er [der Mensch] überhaupt ist“10, wodurch auf das übernatürliche Existential angespielt wird.11
Als zweiten Schritt soll der Mensch diese Liebe als freies Geschenk annehmen können. Das setzt voraus, dass diese Hinordnung auf die Liebe Gottes „selbst als ungeschuldet, als ›übernatürlich‹ zu kennzeichnen“12 ist. Denn nur wenn dieses Verlangen selbst ungeschuldet ist, kann es die empfangene Gnade ungeschuldet sein lassen. Dass diese existentiale Hinordnung übernatürlich ist, wird jedoch erst im Augenblick ihrer Erfüllung bewusst.
Darauf baut der dritte Schritt auf. Im Empfang der Gnade erkennt der Mensch sie und sein Verlangen nach ihr als ungeschuldet. Von dem her – meint Rahner – könne der Mensch zwischen der ungeschuldeten realen Empfänglichkeit und dem Rest unterscheiden, der bleibt, wenn man das übernatürliche Existential von seiner »Natur« abzieht. Unter dieser »Natur« versteht Rahner den faktisch immer antreffbaren substantiellen Bestand des konkreten menschlichen Wesens. Dieser Begriff ist streng zu unterscheiden vom theologischen »Natur«-Begriff, der als Gegenbegriff zum Übernatürlichen verstanden wird. In diesem zweiten Sinn kann »Natur« als natura pura jedoch nur ein Restbegriff sein. Um die Ungeschuldetheit der Gnade nicht zu gefährden, hält Rahner die natura pura als abstrakten Begriff bei aller Schwierigkeit13 für unerlässlich. Denn es muss davon ausgegangen werden können, dass Sinn und Daseinsmöglichkeit für den Menschen auch ohne übernatürliches Existential beständen, um von seiner Ungeschuldetheit sinnvoll sprechen zu können.14
Im vierten Schritt wendet sich Rahner dem Kernproblem zu, dem Verhältnis von Übernatürlichem und Natur. Hierbei greift er auf den Begriff der potentia oboedientialis zurück. Er versteht sie aber nicht als bloße Nicht-Widersprüchlichkeit, sondern als eine bedingte Hingeordnetheit auf das übernatürliche Existential. Rahner hält es in Bezug auf Anonymus D. für legitim, die potentia oboedientialis mit einem unbegrenzten Dynamismus des Geistes in Zusammenhang zu bringen. Doch grenzt er sich klar davon ab, ihn mit dem im konkreten Leben erfahrenen Dynamismus zu identifizieren, da dieser schon durch das übernatürliche Existential geprägt ist. Daher warnt er auch eindringlich davor, „diesen naturalen Dynamismus als unbedingte Forderung für die Gnade zu behaupten.“15
Abschließend ist sich Karl Rahner bewusst, dass über seine vorgelegten Gedanken hinaus eine umfassende Beschäftigung notwendig ist. Doch ist er überzeugt, dass diese sich lediglich mit Einzelaspekten, nicht aber mit der Gesamtkonzeption als solcher auseinandersetzen werde.
1 Rahner, Über das Verhältnis von Natur und Gnade, 67.
2 Ebd., 67f.
3 „Er [der Mensch] kann dann den Ruf Gottes über diesen menschlichen Kreis hinaus nur als Störung empfinden, die ihm etwas – mag dieses in sich auch noch so erhaben sein – aufzwingen will, wozu er nicht gemacht ist (...), zumal dieses Angebot der innerlich erhebenden Gnade ex supposito außerhalb oder überhalb seiner realen Erfahrung bleibt und nur in einem Glauben gewußt wird, der von seinem Objekt nur ex audito weiß“, ebd., 68 (Hervorhebung im Original).
4 Ebd., 69 (Hervorhebung im Original).
5 „Selbst wenn man eine solche verpflichtende Hingeordnetheit nicht zu den Konstitutiven der menschlichen Natur als solcher rechnet, wer kann beweisen, daß sie dem Menschen nur als schon rechtfertigende Gnade innerlich sein könne, daß ein inneres übernatürliches Existential des erwachsenen Menschen nur in der in Glaube und Liebe schon ergriffenen Rechtfertigungsgnade bestehen könne? Muß nicht vielmehr, was Gott über den Menschen verfügt, eo ipso ›terminativ‹ ein inneres ontologisches Konstitutiv seines konkreten Wesens sein, selbst wenn es nicht ein Konstitutiv seiner ›Natur‹ ist?“, ebd., 70 (Hervorhebung im Original).
6 Ebd., 71.
7 Vgl. ebd., 70-73.
8 Ebd., 77, Anmerkung 11.
9 Ebd., 77.
10 Ebd., 77f.
11 Vgl. ebd., 78f.
12 Ebd., 79.
13 „Wir haben diese postulierte reine Natur ja nie für sich allein, um überall genau sagen zu können, was in unserer existentiellen Erfahrung auf ihr Konto, was auf das des Übernatürlichen kommt“, ebd., 80 (Hervorhebung im Original).
14 Vgl. ebd., 79-83.
15 Ebd., 81.
2. Rahners Gnadenlehre
Aufbauend auf diesen Aufsatz aus dem Jahre 1950 soll nun die Gnadenlehre Karl Rahners und die Bedeutung des übernatürlichen Existentials eingehender betrachtet werden. Hierbei wird in Bezug auf die theologischen Fragen vorrangig auf zwei weitere Aufsätze1 zurückgegriffen. Die philosophische Grundlage dazu bildet das Werk »Hörer des Wortes«2, welches besonders für die Auseinandersetzung mit dem Begriff der potentia oboedientialis von Bedeutung ist.
Rahners Lehrtätigkeit beginnt mit einer Vorlesung zum Traktat »De gratia«.3 Auch wenn er sich hierzu eng an den Stoffplan seines Lehrers Hermann Lange hält, nimmt er doch einige grundsätzliche Änderungen vor, die seine neue Akzentsetzung deutlich zum Ausdruck bringen. So nennt er die Vorlesung »De gratia Christi« und betont damit den christologischen Charakter der Gnade(-nvermittlung). Zudem stellt er den allgemeinen Heilswillen Gottes an den Anfang und macht ihn so zum Ausgangs- und Angelpunkt seiner Gnadenvorlesung.4
Neue Wege beschreitet Rahner jedoch vor allem im Verhältnis von geschaffener und ungeschaffener Gnade. Er setzt bei der ungeschaffenen Gnade an, die er von der visio beatifica her theologisch zu erschließen versucht. Dabei wird deutlich, dass sich das Verhältnis zwischen visio und lumen gloriae zu dem zwischen ungeschaffener und geschaffener Gnade analog verhält. Das lumen gloriae ist die geschaffene Disposition für die visio, wie die geschaffene Gnade die Voraussetzung für den Empfang der ungeschaffenen darstellt. Da Rahner die ungeschaffene Gnade jedoch nicht nur in einer kategorialen Beziehung des Menschen zu Gott betrachtet, sondern sich Gott „selbst mit seinem eigenen Wesen in einer formalen Ursächlichkeit dem begnadeten Menschen [mitteilen sieht], so daß also diese Mitteilung nicht bloß Folge einer effizienten Verursachung der geschaffenen Gnade ist [, ... kann] mit der Schrift und den Vätern die Mitteilung der ungeschaffenen Gnade als der geschaffenen Gnade unter bestimmter Rücksicht logisch und sachlich vorausgehend gedacht werden (...); in der Weise nämlich, in der eine Formalursache der letzten materialen Disposition vorausgeht.“5 Bevor nun aber von den daraus resultierenden Konsequenzen gehandelt wird, sollen zunächst die Begriffe »ungeschaffene Gnade«, »geschaffene Gnade« und »quasi-formale Ursächlichkeit« kurz erläutert werden.
1 Rahner, Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade.
2 Rahner, Hörer des Wortes, 1-281.
3 Vgl. Rahner, De Gratia Christi/Über die Gnade Christi.
4 Vgl. Siebenrock, Gnade als Herz, 35.
5 Rahner, Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade, 52f (Hervorhebung im Original).
2.1 Die ungeschaffene Gnade
Rahner übersetzt die (scholastische) »gratia increata« – wie oben gesehen – mit »Selbstmitteilung Gottes«. Da nun diese Mitteilung als das eigentliche Wesen von Gnade verstanden wird, wird sie nicht nur Ausgangspunkt seiner Gnadenkonzeption, sondern es erfolgt dadurch eine fundamentale Neuinterpretation. In der Gnadenvermittlung wird nicht mehr etwas vermittelt, sondern Gott teilt sich selbst mit. Nach Rahner ist daher die ungeschaffene Gnade „der gleichartige, jetzt schon gegebene, wenn auch noch verborgene und zu entfaltende Anfang jener in formaler Ursächlichkeit geschehenden Mitteilung des göttlichen Seins an den geschaffenen Geist, die die ontologische Voraussetzung der visio ist.“1 Dies hat wiederum die Konsequenz, dass sich auch „die innere Natur der diesseitigen Gnade als Ganzes (...) näher bestimmen lassen [muss] von der Natur der ontologischen Voraussetzung der unmittelbaren Gottesschau her.“2
1 Rahner, Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade, 53 (Hervorhebung im Original).
2 Ebd., 46.
2.2 Die geschaffene Gnade
In der Tradition wird die geschaffene Gnade als heiligmachende, habituelle Gnade verstanden. Sie bezeichnet also eine „Änderung des individuellen Menschen, die der angekommenen Selbstmitteilung entspricht und die so als ontologisches Fundament des Glaubens, der Freundschaft mit Gott, der Rechtfertigung beschrieben werden muß.“1 Die geschaffene Gnade kann daher als Disposition für die ungeschaffene Gnade aufgefasst werden und hat als solche „den Charakter einer formalen seinshaften übernatürlichen Bestimmung des menschlichen Geistes“2.
Die geschaffene Gnade ist als causa formalis die Bedingung der Möglichkeit des Empfangs der ungeschaffenen Gnade, die wiederum in der Gottesschau ihre Erfüllung findet. Damit ist die Linie von der geschaffenen Gnade über die ungeschaffene Gnade bis hin zur visio nachgezeichnet und der Zusammenhang der einzelnen unterschiedlichen Elemente dargestellt. Die einzelnen Beziehungsstrukturen bedürfen freilich noch einer genaueren Betrachtung – gerade im Hinblick auf die zu behandelnde Fragestellung.
1 Heijden, Karl Rahner. Darstellung und Kritik seiner Grundpositionen, 15.
2 Rahner, Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade, 59 (Hervorhebung im Original).
2.3 Die quasi-formale Ursächlichkeit
Die grundsätzliche Schwierigkeit des Verhältnisses von Gnade zur Natur wird in der Frage konkret, wie sich ein Zusammenspiel der menschlichen und göttlichen Freiheit denken lässt, ohne dass Gott seine Souveränität und sein Gnadengeschenk seine Ungeschuldetheit verliert. So stellt sich mit der göttlichen Selbstmitteilung das erkenntnistheoretische Problem, in welcher Weise eine Wirkursächlichkeit Gottes möglich ist, ohne dass das Geschöpf als Erkennendes durch sein Erkennen des Erkenntnisobjekts – in diesem Fall Gott – in dieses eine neue Bestimmung hineinträgt mit der Folge, dass Gottes absolute Transzendenz und Unveränderlichkeit aufgehoben würde. Rahner löst dieses Problem mit Verweis auf Thomas von Aquin, indem er durch das Präfix »quasi« die Begrifflichkeit relativiert, um mit einem analogen Sprechen überhaupt Aussagen über Gott zu ermöglichen: „Man mag auf diese Überkategorialität der transzendent bleibenden formalen Ursächlichkeit Gottes durch ein vorausgesetztes ›quasi‹ ausdrücklich aufmerksam machen und so in unserem Fall mit Recht sagen, daß das Sein Gottes in der Schau Gottes eine quasi-formale Ursächlichkeit ausübe. Dieses ›Quasi‹ besagt aber nur, daß diese ›forma‹ trotz ihrer formalen Ursächlichkeit, die wirklich ernst genommen werden muß, in ihrer absoluten Transzendenz (Unberührtheit, ›Freiheit‹) verbleibt. Dieses Quasi besagt nicht, daß die Aussage, Gott nehme in der visio beatifica in einer formalen Ursächlichkeit die Stelle einer species ein, eine unverbindliche Redensart sei, sondern ist das Quasi, das vor jeder Anwendung einer an sich innerweltlichen Kategorie auf Gott gesetzt werden muß.“1