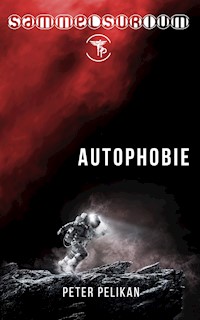3,99 €
3,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gorotan, ein von Elben, Warc, Ogern, Menschen und Bergmenschen bewohnter Kontinent, welcher seit seinen Ursprüngen zwischen den Fronten zweier Götter steht. Ein Kampf übernatürlicher Mächte und epische Schlachten prägen dessen Vergangenheit. Die Götter jedoch sind bereits vor Äonen zur Ruhe gekommen. Die Völker haben ihre Einigkeit verloren und ihre Vielseitigkeit vergessen. Plötzlich sehen die Bewohner sich einer unbekannten Bedrohung gegenüber stehen. Nicht nur der Gleichmut der Völker schwindet allmählich, sondern auch die Ruhe der Götter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Gorotan
Blut für den Blutgott
Peter Pelikan
Weltkarte von Gorotan
digital und in Farbe
scannen oder
>klicken<
1. Königreich Eberòn, Sommer 1006Baronie Midur, Wildhain
„Bürgermeisterin! Bürgermeisterin! Schnell wir brauchen Euch!“, keuchte der Wachsoldat schwer atmend.
Das zeigte ihr, dass er den ganzen Weg von der Hütte bis hierher gerannt war.
Marin Eydas war eine klein gewachsene Frau Mitte zwanzig mit kurzen schwarzen Haaren, die eine gute Mahlzeit körperlicher Betätigung stets vorzog, was man ihr auch ansah. Sie stand auf der Dachterrasse des Rathauses und ließ ihre Gedanken schweifen. Hier oben kam sie immer auf die besten Ideen. Sie trug die traditionelle graue Bürgermeisteruniform. Ihrer Figur schmeichelte das steife Gewand nicht sonderlich. Allerdings spielte ein modisches Aussehen bei ihr im Vergleich zu den meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen eher eine untergeordnete Rolle. Marin ließ ihre Aufmerksamkeit lieber wichtigeren Dingen zukommen. Sie war eine begnadete Politikerin. Schon in früher Jugend kannte sie sich mit den Regierungsgeschäften bestens aus. Als ihre Eltern bei einem Feuer gestorben waren, nahm sie die Frau des damaligen Bürgermeisters, welche eine Freundin ihrer Mutter war, auf. Sie entwickelte früh Interesse für alle Ländereien Gorotans und deren Politik. Darüber las sie Unmengen an Büchern in der riesigen Bibliothek des Rathauses und löcherte ihren Ziehvater permanent mit Fragen zu seinem Beruf.
Als vor zwei Zyklen das Dorfoberhaupt bei einem Jagdunfall ums Leben kam, konnte man keinen angemessenen Ersatz finden. Die Fähigkeiten der meisten Menschen beschränkten sich schlicht und ergreifend auf die Jagd. Nach endlosen Diskussionen und Abwägen von Möglichkeiten wurde sie dann im Alter von 23 Zyklen zur Bürgermeisterin ernannt. Das machte sie zur jüngsten Regentin der Geschichte Wildhains.
Aber nicht nur auf ihren beruflichen Werdegang war sie stolz.
Sie besaß eine Gabe, die sie für die Einwohner fast noch bedeutender machte als ihr Titel. Beinahe schon protzig, als ob sie es jedem auf die Nase binden wollte, zierte ein Mal ihren Hals. Ein Punkt und darüber ein Halbmond mit der Öffnung nach unten. Handflächengroß und ähnlich einem Muttermal schmückte das Zeichen der Weißen Göttin ihre Haut unter dem linken Ohr bis zum Schlüsselbein.
Sie war eine Ralesha Optora, eine göttlich Berührte. Sie besaß die Gabe des Lichts. Dadurch war sie in der Lage, mithilfe von Magie, Menschen von Verletzungen und Leiden zu heilen. Zwar zehrte es an ihren Kräften, schwere Wunden zu kurieren, aber dennoch war es so möglich, Dorfbewohner nach Jagdunfällen oder Ähnlichem vor dem Tod zu bewahren. Falls sie es schafften vor dessen Eintreten bei ihr zu sein.
„Nur die Ruhe, mein lieber Hektor. Ich befinde mich sozusagen schon in der Vorbereitung“, entgegnete sie dem Soldaten mit einem beruhigenden Lächeln.
Was der Mann so dringend von ihr wollte, war ihr bereits klar. Die Schreie von Nora Gardin hallten seit einigen Minuten durch das ganze Dorf. Die schwangere Frau war ohnehin schon überfällig und heute schien es so weit zu sein.
Dass sie nach Geburten zugegen war, um der Mutter ein wenig Linderung der Schmerzen zu verschaffen, war normal.
Aber dass Hektor Martan, der Hauptmann der Wache, so eilig zu ihr gerannt kam und um ihre Hilfe bat, war ungewöhnlich.
„Es steht nicht gut um Nora, sie verliert zu viel Blut. Die Hebamme befürchtet, sie könne es nicht schaffen. Sie braucht den Beistand einer Optora. Ihr müsst schnell zu ihr, Bürgermeisterin“, sagte Hektor, der wieder zu Atem gekommen war, nun in seiner, wie gewohnt tiefen und emotionslosen, Militärstimme. Durch sie klang alles, was er von sich gab, grundsätzlich wie ein Befehl, der keinen Widerspruch duldete.
Sie kannte Hektor schon lange, da sie zusammen zur Schule gegangen waren. Seit sie in den Rang der Bürgermeisterin erhoben worden war, bestand er jedoch darauf, Marin zu siezen und sie mit ihrem Titel anzusprechen. Anfangs fand sie das etwas seltsam, aber sie hatte sich inzwischen daran gewöhnt. Mittlerweile mochte sie es sogar.
„Lass uns keine Zeit verlieren! Am Ende ist noch jemand tot, bevor wir eintreffen, dann kann selbst ich nichts mehr ausrichten“, antwortete sie ihm so ruhig wie möglich und machte Anstalten ihm zu folgen.
Wortlos hetzten sie durch das Rathaus und über den Dorfplatz direkt auf die Hütte der Familie Gardin zu. Der stämmige Hauptmann eilte voran und verschaffte der kleinen Frau Platz, um keine Zeit mehr zu verlieren.
Die Schreie wurden mittlerweile immer lauter, was die beiden zu zusätzlichem Tempo anspornte.
Als sie endlich ihr Ziel erreichten, stieß der Soldat die Tür derart heftig auf, dass es sie fast aus den Angeln gerissen hätte. Das Bild, welches sich Marin im Inneren der Hütte zeigte, verdeutlichte, dass die Situation alles rechtfertigte, was in irgendeiner Weise dafür sorgte, dass sie früher ankamen.
Schreiend lag die blonde, hochschwangere Nora auf dem Bett. Ihr sonst so hübsches Antlitz war vom Schmerz verzerrt. Die Augen der Frau verrieten, dass sie der Ohnmacht bereits sehr nahe war. Ihr Gatte, Torben Gardin, einer der besten Jäger im Dorf, stand völlig aufgelöst neben ihr. So verzweifelt hatte sie den Mann selten gesehen. Selbst seine kantigen Züge, der kahle Kopf und der kurz gestutzte Bart, welche ihm sonst ein sehr ernstes Äußeres verliehen, verhinderten nicht, dass er im Moment aussah wie ein hilfloses Kind.
Vor dem Bett der Frau kniete die Hebamme. Sie ging ihrer Tätigkeit schon lange nach und galt im Dorf als die erfahrenste Geburtshelferin. Derzeitig wirkte sie jedoch überfordert. Sie versuchte die Blutung zu stillen, dessen Fluss kein Ende nehmen wollte. Unzählige Handtücher lagen blutgetränkt um die Hebamme, selbst die große, mit Wasser gefüllte Schüssel hatte bereits die rote Farbe des Lebenssaftes angenommen.
„Schnell, Optora! Sie stirbt, wenn Ihr nichts unternehmt!“, schrie sie der Bürgermeisterin entgegen, „das Baby ist so gut wie geboren. Aber um die Mutter steht es schlecht!“
„Keine Sorge, die Gabe der Weißen Göttin wird sie vor der Endlichkeit bewahren!“, sagte die Optora beinahe schon andächtig.
Marin hatte großen Respekt vor der Macht, die ihr geschenkt worden war.
Sie konzentrierte sich auf ihre Magie, die sie innerlich als wohlige Wärme wahrnahm, stellte sich an das Bett der Sterbenden und legte die Hände auf deren Leib.
In einem leisen und monotonen Tonfall begann sie Gebete an Ralesha aufzusagen, was von den Anwesenden eher als ein Murmeln wahrgenommen wurde. Das war zwar nicht notwendig, half ihr aber dabei, sich zu konzentrieren. Sie erfasste die Wärme in ihrem Innern und schickte sie in Noras Körper.
Augenblicklich leuchteten ihre Hände weiß, erst ganz schwach und dann immer stärker. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Licht über der Schwangeren aus. Sie forschte mit den Lichtwellen nach Schäden in der Frau und sandte Magie aus, um diese zu beheben. So einfach, wie es klang, so kompliziert war es.
Sie hatte bereits mit Komplikationen bei Geburten zu tun, aber normalerweise brauchte sie dafür nur einen Bruchteil ihrer Heilkräfte. Nora musste dem Tod schon sehr nahe sein. Die Verletzungen passten so gar nicht zum Erwarteten und zudem konnte sie diese nicht mit ihrer Magie fassen. Es wollte einfach nicht gelingen. Es fühlte sich beinahe so an, als ob sie sich bewusst widersetzte. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Es war, als würde sie mit Morkan persönlich um das Leben der Frau ringen.
Der Schweiß stand ihr auf der Stirn, sie fing an zu zittern und wurde weich in den Knien. Die Anstrengung war der Bürgermeisterin nun deutlich anzusehen.
Keiner der Anwesenden traute sich, ein Wort zu sagen.
Marin war so in ihr Werk vertieft, dass sie das Weinen des Babys, welches soeben das Licht der Welt erblickt hatte, nicht mitbekam.
Als sie selbst der Ohnmacht nahe war, spürte sie endlich, dass die Heilung einsetzte. Das warme Gefühl ging auf Nora über und der verspürte Widerstand löste sich auf. Ihr fehlten jedoch die Kräfte, um die Frau sofort wieder vollständig vom Blutverlust genesen zu lassen. So brach sie den Zauber ein wenig früher ab, aber es würde reichen.
Völlig erschöpft blickte sie in die Runde und bemerkte, dass alle auf sie fixiert waren.
„Sie wird es schaffen, aber sie braucht jetzt Ruhe und muss schlafen“, hauchte sie.
Da sprang Torben auf und umarmte sie:
„Ich danke dir, Optora, du hast mir meine Gattin bewahrt. Wie kann ich das wiedergutmachen? Verlang von mir, was du möchtest!“
Anstatt der Hilflosigkeit sah sie in seinem Gesicht nun Tränen der Freude.
„Nein, Torben, danke nicht mir. Danke der Göttin, ihre Gabe hat deine Frau bewahrt. Bete zu ihr und zeige so deine Dankbarkeit“, beschwichtigte sie den aufgewühlten Vater.
Dann richtete sie ihren Blick auf die Hebamme: „Wie geht es dem Neugeborenen?“
Sie war auf alles gefasst, denn sie erkannte Sorge im Gesicht der Geburtshelferin und hoffte, dass ihre Kräfte im Notfall noch ausreichen würden, das Kind zu retten.
„Es ist ein Mädchen ... und es geht ihr gut ... aber ...“, stammelte sie etwas unsicher. Eine lange Pause entstand und die Anspannung im Raum stieg spürbar an.
„Was ist mit ihr? Ist sie etwa entstellt? Ist meine Tochter ein Krüppel? Los, sprich schon!“, fuhr Torben sie beunruhigt an.
„Nein, nein! Sie ist ein völlig gesundes Mädchen, und sie hat die leuchtend grünen Augen ihres Vaters“, sagte sie nun mit ruhiger Stimme, da sie gemerkt hatte, wie ihre Unsicherheit auf den Mann abstrahlte.
„Was ist los?“, fragte Marin sie ernst.
„Sie hat ein Mal. Seht da, auf ihrem rechten Handrücken“, sie hob das Mädchen etwas in die Richtung der Bürgermeisterin, sodass sie es sehen konnte. Auf der kleinen Hand zeigte sich ein Muttermal – ein Kreis, durch den horizontal ein Strich ging.
„Das Zeichen Morkans“, entfuhr es dem Vater.
„Sie trägt das Mal des Schwarzen Gottes! Was bedeutet das, Bürgermeisterin? Ist meine Tochter eine Morkan Optora?“, wandte er sich sichtlich beängstigt an Marin.
„Nein, nur die Ruhe, Torben. Morkan hat noch nie Sterbliche berührt und mit einer Gabe oder einem Fluch belegt. So etwas wie eine Morkan Optora gibt es nicht. Dieses Muttermal wird einfach ein gewöhnliches Mal sein, dessen Form ein wenig unglücklich geraten ist“, beruhigte sie den Vater.
„Sie ist unsere Tochter, Torben“, klang es auf einmal schwach von hinten, „sie ist ein starkes und gesundes Mädchen, mit dem alles in Ordnung ist.“
Nora war inzwischen aufgewacht und hörbar verärgert, dass man ihrem Baby schon im Alter von wenigen Minuten ein böses Omen anhaften wollte.
Die Hebamme stand auf und drückte der Mutter das Neugeborene in den Arm.
Die Kleine lachte und auch Nora musste lachen:
„Sie hat wirklich deine Augen. Wie wollen wir sie nennen?“
Torben trat an das Bett und fasste die Hand seiner Tochter: „Wie wäre es mit Garcia?“
Noras Blick richtete sich auf ihren Mann und sie sagte:
„Das bedeutet in der Sprache der Götter so viel wie 'viel Glück'. Es ist ein schöner Name und ich denke, bei dem Trubel während ihrer Geburt ist er durchaus gerechtfertigt.“
Sie betrachtete wieder ihre Tochter: „Na, was hältst du davon? Bist du meine kleine Garcia?“
Das Baby lachte und Torben stimmte mit ein.
In der allgemeinen Freude machte sich die Bürgermeisterin heimlich davon. Hektor hatte sie unauffällig begleitet und stützte sie. Marin war froh darüber, da sie sich nicht sicher war, ob ihre Kräfte sie noch bis in ihr Zimmer im Rathaus tragen würden. Sie war von der Heilung erschöpft und musste sich ausruhen.
Zudem war sie sehr beunruhigt. Die eine Aussage des Vaters rumorte in ihrem Verstand – Morkan Optora.
Es musste ein Zufall sein. Dennoch würde sie in den Archiven nach einem ähnlichen Fall suchen, nur um sicherzugehen. Aber vorher brauchte sie Schlaf.
Legenden von Gorotan
Einst schufen die Götter Morkan und Ralesha den Kontinent Gorotan und teilten sich das Land untereinander auf. Morkan erhielt Tulan und Eberòn. Ulldriell und Strastiel samt seinen Inseln bekam dessen Schwester Ralesha.
Morkan, auch bekannt als der Schwarze Gott, besiedelte das Bergreich Tulan mit den Bergmenschen und den mächtigen Ogern. Eberòn ließ er den Menschen.
Ralesha füllte die Wälder von Ulldriell mit Elben. Strastiel gab sie den Menschen. Für die Inseln schuf sie die Warc, die für das Leben umgeben von Wasser besser geeignet waren.
Die Weiße Göttin, wie sie auch genannt wurde, erlaubte ihren Geschöpfen ein Dasein nach ihrem eigenen Willen. Diese verehrten sie in Tempeln und beteten zu ihr, dafür ließ sie deren Ernte gedeihen und gab einigen Auserwählten die Gabe des Lichts.
Morkan jedoch gab sich nicht mit einfachen Gebeten zufrieden. Er forderte von seinem Volk Blutopfer. Mit jedem Opfer gewann der Schwarze Gott mehr Macht. Mit dieser schuf er schreckliche Kreaturen, welche dessen Anhänger heimsuchten und sie daran erinnerten, wem sie dienten und auf wessen Gnade sie angewiesen waren.
Die Zahl der geforderten Blutopfer steigerte sich von Umlauf zu Umlauf. Die Menge der geopferten Leben wurde so gewaltig, dass sich der Boden um die Tempel des Schwarzen Gottes durch das Blut in einen roten Sumpf verwandelte.
Seine Untertanen litten unter dessen Gier. Jedoch hatten sie weder den Mut noch die Kraft sich seinem Willen zu widersetzen.
2. Wälder von Ulldriell, Frühjahr 1022Goldene Ebene, Neban
Orthas stand auf der Wehranlage der alten Küstenfestung in Neban. Der große Elb hatte wie immer die goldene Rüstung angelegt, die ihn mehr als nur auffallen ließ. Seine langen weißen Haare und die helle Haut betonten die Farbe zusätzlich.
Auch die Waffe, welche er mit sich führte, stellte eine Abweichung der Norm auf der kleinen Burg dar. Alle Soldaten waren ausnahmslos in schlichte braune Lederrüstungen gehüllt und mit Stahlspeeren bewaffnet. Diese maßen eineinhalb Mann und am Ende hatten sie eine armlange Klinge, die auf der einen Seite flach und auf der anderen gezackt war. Es war eine gute Waffe und Orthas konnte sie perfekt führen. Auch widerstrebte ihm der Lederharnisch nicht, der sicher um einiges leichter als seine goldene Plattenrüstung war, doch er wollte sich nicht den Anderen unterordnen.
Die übrigen Elben auf der Festung waren jung, die meisten nicht einmal 300 Zyklen. Orthas hingegen war ein Veteran. Er hatte schon zu viel erlebt, um sich mit ihnen auf eine Stufe zu stellen. Darum trug er stets mit Stolz den goldenen Panzer und hatte in einer Halterung am Rücken einen fast mannslangen Zweihänder befestigt. Das Schwert hatte einen überlangen Griff, der sowohl praktisch zum Angreifen als auch zum Abwehren war und der Waffe durch das Gegengewicht etwas mehr Stabilität gab. Schon viele Schlachten hatte er damit geschlagen, gewonnen und auch verloren. Aber alle hatte er sie überlebt. Er beherrschte den Umgang mit dem Schwert meisterhaft. Es hatte sich in seinen Händen über die Zyklen einen Ruf gemacht und letztendlich wurde es die 'Friedensklinge' genannt. Da das Schwert meist in Kriegen geführt wurde, war die Bezeichnung etwas merkwürdig, allerdings mündeten die Resultate und Ausgänge der Schlachten letztlich immer im Frieden für das Land. Zudem stand es ihm nicht zu, Namen zu vergeben. Das Privileg der Taufe war dem Fürst und der Fürstin der Elben vorbehalten. Dies taten sie nur äußerst selten für Waffen von Kriegern, die sich die Gunst der Herrscher durch besondere Heldentaten verdient hatten.
Aber nicht nur die Ausrüstung zeugte von Orthas Alter. Auch sein Antlitz hatte durch das Erlebte gelitten. Er sah in den unzähligen Schlachten viele Freunde sterben. Sah Leid und Elend des Krieges. All diese Schrecken machten seine Züge ernst. Das Leuchten war schon vor langer Zeit aus den stahlblauen Augen verschwunden. Im Gesicht trug er die Quittung für jugendlichen Übermut. Von der Mitte der Stirn zog sich eine Narbe über das linke Auge und endete erst am Halsansatz.
Sie erinnerte ihn nun schon seit mehr als 1000 Zyklen daran, die Fähigkeiten seiner Gegner nie zu unterschätzen.
Ja, er war wirklich alt. Er hatte bereits vor 1022 Zyklen das Recht der Elben verteidigt. Er stand damals in der 'Goldenen Schar' als einfacher Soldat auf dem Schlachtfeld. Dies war eine Eliteeinheit, welche in dem Heer der vereinten Völker kämpfte. Er selbst hatte sich dem Monster Morkans gestellt und die Kraft Damorns sträflich unterschätzt. Dabei hatte er damals Glück, dass er weder Leben noch Augenlicht verlor. Seit dieser Lektion war ihm nie wieder der Fehler unterlaufen, sich selbst zu überschätzen.
Er war ein verdienter Veteran, allerdings hatte man für Elben wie ihn in der heutigen Zeit kaum noch Verwendung. Es gab keine großen Schlachten mehr. Vor 150 Zyklen waren die Bergmenschen die Letzten, die versuchten sich gewaltsam ein Stück des Elbenreichs zu nehmen und kläglich scheiterten. Die kleinen Scharmützel davor waren nichts Erwähnenswertes gewesen, was nach großen Kriegern oder Helden verlangt hätte. Und in die Angelegenheiten außerhalb Ulldriells mischten sich die Elben ohnehin nicht ein.
Die Ernennung zum Kommandanten auf der Küstenfestung in Neban war für ihn mehr ein Abschieben denn eine Belohnung. Wer würde so weit im Norden die Küsten Ulldriells angreifen? Nichtsdestotrotz, der Befehl seines Fürsten Gabriell war für ihn ohne Widerspruch hinzunehmen. Dieser war zwar jünger als er, aber dennoch der unangefochtene Herrscher der Elben der Goldenen Ebene. Für eine Verweigerung war er zu sehr Soldat und so verrichtete er den Dienst Umlauf für Umlauf.
Trotz des im Grunde nicht vorhandenen Risikos angegriffen zu werden, achtete er peinlichst genau auf die Disziplin seiner Männer. Er prüfte regelmäßig die Aufmerksamkeit der Wache und bestrafte Vergehen stets streng. Auch die Kampfausbildung, die er den Soldaten erteilte, war härter denn notwendig. Wenn er schon dieses niedere Amt verrichtete, wollte er sich keine Halbherzigkeit nachsagen lassen. Am Ende würde er noch als alt und nachlässig bezeichnet werden.
Und so stand er, außerhalb der Übungseinheiten und Verwaltungsgeschäfte, oft auf dem Wehrgang und erinnerte sich an Zeiten, zu denen man Elben wie ihn als Helden gefeiert hatte und nicht als übergenaue Veteranen abtat.
Schon lange bevor der Wachposten in Sichtweite kam, hörte er mit seinem exzellent trainierten Kriegergehör den Soldaten.
Während dieser hinter ihm zum Stehen kam und gerade Luft holte, um eine dringende Nachricht loszuwerden, fiel Orthas ihm hart ins Wort: „Ich hoffe, es gibt einen sehr guten Grund dafür, dass Ihr Euren Wachposten im Leuchtturm verlassen habt, Soldat! Wenn ich etwas nicht mag, ist es mangelndes Pflichtbewusstsein und Ihr wisst, was Euch nach einem derartigen Vergehen erwartet!“
Trotz der drohenden Strafe nahm der Elb Haltung an und begann, sich zu erklären: „Guten Abend, Kommandant! Der Hauptmann hat mir befohlen, meinen Posten zu verlassen und Euch direkt zu informieren.“
„Was kann es sein, dass man es für so wichtig erachtet, mich mitten in der Nacht damit zu belasten?“, fragte Orthas nicht weniger hart als zuvor.
„Wir denken, dass wir angegriffen werden, Kommandant!“, sagte der Soldat verunsichert.
Orthas war sicher, sich verhört zu haben: „Wer um alles in der Welt sollte uns angreifen? Wie kommt der Hauptmann zu dieser mehr als lächerlichen Aussage?“
„Schiffe, Kommandant. Es kommen viele Schiffe auf die Bucht zugesteuert“, stammelte der Elb.
„Das werden wohl verirrte Handelsschiffe sein, die eine Anlegestelle suchen, um sich neu zu orientieren, aber mit einem Angriff ist doch deswegen noch lange nicht zu rechnen!“
Der Soldat sammelte sich etwas, um seinem Herrn das Problem genauer darzulegen: „Es sind sechzehn Schiffe und eine ... na ja, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, Kommandant. Ich würde sagen eine Galeere, nur viel größer. Und die Schiffe, sie sind aus Metall. Ich habe derartige Konstruktionen noch nie gesehen.“
Orthas war sich nun sicher, dass der Soldat verrückt geworden war. Keines der Länder, mit Ausnahme der Warc im Osten, verfügte über solch eine große Seestreitmacht. Und von Schiffen aus Metall hatte nicht einmal er, der gestandene Veteran, jemals etwas gehört.
„Ich werde mir das selbst ansehen, gebt dem Leuchtturm Bescheid. Sie sollen signalisieren auf See zu warten. Wir schicken ein Beiboot raus, um ihre Absichten zu ergründen. Und Gnade euch Ralesha, wenn Ihr Euren Dienst betrunken verrichtet habt!“, sagte er streng und ging in Richtung Turm.
„Nein, Kommandant, ich habe nicht getrunken. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Überzeugt Euch selbst. Wir haben den Schiffen bereits signalisiert anzuhalten, aber sie reagieren nicht!“, rechtfertigte sich der Elb, während sie sich dem Wachturm näherten.
Dort angekommen ergriff Orthas das Fernrohr und blickte in Richtung Bucht.
Und tatsächlich, der Soldat hatte nicht gelogen. Es waren sechzehn Schiffe aus Metall und ein riesiges eisernes Etwas, das von den Ausmaßen eher einer Burg gleichkam.
Orthas schlug sofort in den Befehlston um: „Gebt den Hauptleuten Bescheid, sie sollen alle Geschütze besetzen lassen. Weckt die gesamte Besatzung und formiert sie in voller Rüstung im Innenhof!“
„Jawohl, Kommandant!“, quittierte der Soldat den Befehl knapp und eilte sofort los.
Orthas ließ die Schiffe nicht mehr aus den Augen. Was immer da auf sie zukam, hatte auch er in seinem langen Leben noch nie gesehen.
„Welches dämonische Werk schickt Morkan gegen uns? Ralesha, steh uns bei“, sagte er angespannt zu sich selbst.
Im Hintergrund ertönte der Alarm und weckte die Besatzung. Das Rascheln und Klappern der Rüstungen sowie der Klang vieler Schritte kündigte die Umsetzung seines Befehls an.
Orthas sah auf den Schiffen reges Treiben. Der Großteil der arbeitenden Besatzung bestand aus ihm unbekannten Bestien. Er erkannte einige Kreaturen an Deck, die den anderen Anweisungen gaben. Diese Wesen konnte er ebenfalls nicht zuordnen. Es waren gut zwei Mann große Gestalten mit menschenähnlichen Körpern. Sie trugen eine Art schwarze Robe, die jedoch eher einer Uniform glich. Ihre Gesichter wirkten ausdruckslos. Zwei rot leuchtende Punkte stellten die Augen dar. Anstatt einer Nase besaßen sie nur zwei Löcher im Antlitz. Ihr Maul schien sich von einem Ohr bis zum anderen zu erstrecken und Orthas erkannte kleine Reißzähne in ihren Gebissen. Haare hatten sie keine. Auf ihren Köpfen zeigte sich die hellbraune nackte Haut, die ihren ganzen Körper überzog. Die Arme dieser Kreaturen waren überlang. Die Hände hingen fast auf Kniehöhe.
Die scheinbar untergebenen Bestien, die sich in den unterschiedlichsten Ausführungen an Deck tummelten, machten sich an etwas zu schaffen, was einer Waffe ähnelte. Jedoch war es kein Katapult oder Basilisk. Orthas war es nicht möglich, die Apparatur einzuordnen. Plötzlich blitzte es und Rauch stieg von der Gerätschaft auf. Nahezu im selben Moment durchfuhr eine Erschütterung die Mauern und einer der Türme explodierte in einem gewaltigen Feuerball.
Riesige Trümmer aus den Überresten verteilten sich über die Burg und verletzten oder töteten ein Dutzend seiner Männer. Die Druckwelle hatte Orthas umgeworfen. Sofort richtete sich der Kommandant auf, betrachtete nur kurz das Ausmaß des verheerenden Angriffs und begann Befehle zu brüllen:
„Wir werden angegriffen! Besetzt die Geschütze, eröffnet das Feuer auf alles, was sich in der Bucht bewegt! Formiert die Armee, sie sollen sich auf ein Gefecht vorbereiten!
Bei Ralesha, diese Burg wird heute Nacht nicht fallen!“
Er kletterte vom Turm und auch, wenn er sich nicht sicher war, ob sie der bevorstehenden Invasion gewachsen waren, freute sich der Veteran, wieder sein Handwerk ausüben zu können. Während er die Friedensklinge aus der Scheide zog und sich in den Hof an die Spitze seiner Truppen begab, geschah etwas, was dem Elb seit vielen Zyklen nicht mehr widerfahren war: Er lächelte.
Legenden von Gorotan
Ralesha sah das Leid der Wesen, welches Morkan verursachte, wollte sich aber nicht offen gegen ihren Bruder wenden. Immerhin war es sein Land und sein Volk.
Im Verborgenen ließ sie dennoch die Ernten gedeihen und segnete Einzelne mit ihrer Gabe, um die Pein erträglicher zu machen.
Als Morkan das sah, wurde er zornig. Um sich an seiner Schwester für ihre Einmischung zu rächen, beschloss er, ihr ihre Ländereien zu nehmen.
Mit der großen Macht, die er durch die unzähligen Opfer erlangte, schuf er ein dämonisches Heer, geführt von dem schrecklichsten Wesen, das der Kontinent jemals gesehen hatte. Damorn wurde von Morkan einzig und allein zu dem Zweck geschaffen, seine Armee gegen die Länder von Ralesha zu führen. Er war so groß wie drei Männer. Sein muskulöser Körper war von einem schwarzen Schuppenpanzer bedeckt. Dieser war so dick, dass er jegliche Rüstung ersetzte. In der Schlacht führte er an jedem seiner vier Arme ein riesiges, sichelartiges Schwert. Diese schwang er mit solcher Wucht und tödlicher Präzision gegen dessen Gegner, dass jeder Hieb den Tod über mehrere Leben brachte.
Das Heer von Morkan fiel unter der Führung von Damorn in die Ländereien von Ralesha ein. Ihr Volk hatte den schrecklichen Kreaturen und dem monströsen Heerführer kaum etwas entgegenzusetzen und so verlor sie Stück für Stück ihres Landes.
Die Bewohner fürchteten sich und beteten um den Beistand Raleshas, damit sie diese schreckliche Bedrohung von ihnen abwenden würde.
3. Wälder von Ulldriell, Frühjahr 1022Goldene Ebene, Neban
„Wir wissen nicht, wer oder was uns angreift! Wir wissen nicht, was der Feind von uns will!“, der Kommandant hatte sich vor seinen Truppen aufgebaut und schritt die Reihen ab. „Der Feind denkt, er hätte leichtes Spiel mit einem Überraschungsangriff!“, schrie er den Männern Mut zu, während hinter ihm ein weiterer Teil der Burgmauer von einer Explosion weggerissen wurde. Nachdem der Knall erstarb, fuhr er fort:
„Das dachten damals auch die Bergmenschen vor 150 Zyklen, das dachten auch die Herrscher von Strastiel vor 300 Zyklen und all die Anderen, die versucht haben, uns den Boden, der uns von Ralesha geschenkt wurde, streitig zu machen! Sie alle scheiterten letztendlich! Sogar der Schwarze Gott selbst scheiterte, als er vor über 1000 Zyklen Damorn und sein Heer gegen uns warf!“
Jubel ging durch die Reihen und er erkannte, dass er mit seiner Rede die durch die unbekannten und mächtigen Waffen eingeschüchterten Männer erreichte. In ihren Augen sah er wieder Kampfeswillen aufflackern – und den brauchten sie jetzt.
Die Geräte, mit denen die Angreifer auf sie schossen, waren ihren Katapulten, Basilisken und Steinschleudern haushoch überlegen. Die eigenen Waffen richteten kaum Schaden an den metallenen Schiffen an. Nur vereinzelt wurden Bestien von Pfeilen auf dem Deck getötet oder von Steinen in die Fluten gestoßen, während die feindlichen Geschütze große Teile der Wehranlagen zerstörten. Die gewaltigen Detonationen, die der Feind ihnen sendete, hatten bereits über die Hälfte der Verteidigungsanlagen beschädigt und die Mauer um die Burg wies ebenfalls Lücken auf. Von den rund 700 Mann, die unter Orthas Befehl standen, waren jetzt nur noch 650 bewaffnet vor ihm angetreten. Der Rest war entweder tot oder zu schwer verletzt, um zu kämpfen.
Ihm war bewusst, dass ein defensives Verbleiben in der Burg, wegen der effizienten Belagerungswaffen des Gegners, keinen Sinn machen würde. Deshalb entschied er, mit seinen restlichen Männern in der Deckung des Hofs zu warten und den Feind an Land kommen zu lassen.
Dann wollte er die Invasoren mit einem Ausfall aus der scheinbar gefallenen Burg überraschen, die übrigen Geschütztürme würden das Feuer ebenfalls wieder eröffnen.
Er spürte trotz der aussichtslosen Situation den Mut der Truppen. Orthas bekam von einem Aussichtsposten gemeldet, dass der Feind angelegt hatte.
Er wandte sich wieder an seine Soldaten:
„Und Ralesha sei meine Zeugin! Kein Gegner wird die Goldene Ebene oder Ulldriell geschweige denn die Elben bezwingen!“
Er drehte sich in Richtung Tor. Die letzten Worte schrie er, während er, gefolgt von seinen Männern, auf die Pforte zulief:
„Was auch immer sich nun gegen uns wirft, haltet stand! Geben wir diesen Wesen einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, wenn sie sich mit der Schöpfung Raleshas anlegen!“
Klackernd öffnete sich das Tor und bei dem Anblick, welcher sich Orthas bot, musste selbst er sich beherrschen, um sich nicht umzudrehen und zu flüchten.
Drei der Schiffe waren nahe an die Bucht gekommen und setzten mit Beibooten unzählige Fußtruppen ab. Einige der Bestien sprangen sogar direkt von Deck, um an Land zu schwimmen. Ihr Kampfeswille musste enorm sein.
Bereits jetzt schätzte er die Zahl der Gegner, die sich am Strand aufhielt, auf über 1000 Wesen. Mit den Bestien, die in den Beibooten saßen, waren sie mindestens eins zu vier unterlegen. Aber an Flucht war nicht mehr zu denken.
Schreiend rannte der Kommandant mit seinen Männern gegen die anstürmende Horde.
Als Erstes erreichten hundeartige Wesen die Elben. Sie waren hüfthoch, schwarz-grau und weitaus muskulöser denn ein gewöhnlicher Hund. Das Gebiss mit den scharfen Reißzähnen erinnerte eher an einen Hai als an eines der lieben Haustiere.
Er schwang den Zweihänder über den Kopf rückwärts und vollführte dann aus der Drehung einen Hieb vom Boden aufwärts, der gleich zwei der Vierbeiner den Tod brachte. Ansatzlos duckte sich der erfahrene Krieger unter dem dritten Köter, welcher nach seiner Kehle schnappte, weg und drosch ihm im Flug die überlange Parierstange in den Hals, woraufhin dieser röchelnd liegen blieb.
Mit Freude registrierte er, dass der Großteil der Elben mit dem Feind umgehen konnte. Nur wenige Soldaten lagen von den Hunden zerfleischt auf dem Boden. Dafür zuckten die langen Elbenspeere mit den gezackten Klingen unaufhörlich durch die Körper der Wesen. Das überharte Training zahlte sich gegenwärtig aus.
Ein Blick nach vorn ließ den Gedanken an einen Sieg schnell wieder verblassen. Nur eine Speerwurfweite entfernt kamen die größeren Bestien angestürmt.
Orthas war es nicht möglich, feste Merkmale an ihnen auszumachen. Jedes Ungetüm schien sich grundsätzlich zu unterscheiden. Die einen sahen aus wie kräftige, behaarte Menschen und schwangen Keulen oder Äxte, die anderen ähnelten eher einer Mischung aus Schlange und Echse mit zwei Köpfen. Das Einzige, was sie gemein hatten, war ihre beängstigende Größe und Muskelkraft.
Der elbischen Verteidigung kam zugute, dass die Gegner keine Fernwaffen einsetzten. Die Überraschung mit dem Ausfall schien geglückt zu sein.
Orthas spaltete noch einen der Köter und drehte sich um. Er schwenkte sein großes Schwert gut sichtbar über dem Kopf. Das war das verabredete Zeichen für die verbliebenen Geschütze.
Als er sich wieder dem Feind zuwandte, sah er die ersten Felsbrocken und Speere in die Reihen der Gegner einschlagen, was deren Zahl schnell dezimierte.
„Lasst sie zu euch kommen, sonst treffen euch die eigenen Geschütze!“, befahl er seinen Männern. Der Einsatz der Fernkampfwaffen in einem laufenden Gefecht war riskant. Die Elben beherrschten die Geräte jedoch präzise und wenn sie sich nicht über die vereinbarte Markierung hinwegbewegten, bestand keine Gefahr, von den eigenen Projektilen getroffen zu werden.
Die Soldaten, die in diesem Moment den Rest der ersten Welle zurück zu Morkan schickten, formierten sich neu, um den übermächtigen Wesen in voller Stärke entgegenzutreten. Von den 600 Elben war der Großteil noch auf den Beinen und nur wenige leicht verletzt. Die Hunde erwiesen sich nicht als würdige Gegner.
Kurz bevor die anderen Wesen auf den Trupp trafen, sah Orthas, dass zwei der Schiffe das Feuer auf die Burg eröffnet hatten.
‚Das wird es dann bald mit unserer Rückendeckung gewesen sein‘, dachte er für sich. Doch ehe er Zeit hatte, die Situation neu zu bedenken, brachen schon die ersten Scheusale in die Reihen der Elben.
Orthas drehte sich blitzschnell zur Seite und wich der riesigen Keule eines ogerähnlichen Wesens aus. Es war doppelt so groß wie er selbst und fixierte den goldenen Elb aus nur einem Auge, das in der Mitte seines Schädels saß. Als er sich zurückdrehte, nutzte er den Schwung aus und die Friedensklinge nahm dem Ungetüm den Arm mitsamt der Keule. Grünes Blut, in welchem es stellenweise schwarz schimmerte, als würden sich zwei Flüssigkeiten nicht richtig miteinander vermischen, ergoss sich über den Kommandanten und der Oger schrie auf. Doch nur kurz. Orthas gab ihm keine Zeit sich zu sammeln. Er drehte sich aus der Bewegung einmal um die eigene Achse, drückte sich vom Boden ab und schraubte sich auf Kopfhöhe des Monsters. Schlagartig erloschen dessen Schreie und sein Kopf flog in hohem Bogen davon.
Doch dem Krieger blieb keine Zeit zu verschnaufen. Im selben Moment, in dem seine Füße den Boden berührten, sah er, dass ein echsenartiges Wesen mit einem Schwert nach ihm schlug. Während er den Schlag mit der übergroßen Waffe parierte, bemerkte er, dass viele der Elben solchen Gegnern nicht gewachsen waren.
Einige seiner Soldaten lagen tot im Gras und deren rotblaues Blut mischte sich mit dem grünschwarzen der Bestien.
Unter den Übrigen erkannte er großteils die Hauptleute und älteren Krieger.
Hier trennte sich die Spreu vom Weizen. Nur wenige der jungen, kriegsunerfahrenen Elben beherrschten ihre Waffen gut genug, um solchen, an Kraft und Anzahl überlegenen, Feinden zu widerstehen.
Die verbliebenen Soldaten hielten sich allerdings wacker und setzten den Bestien schwer zu. Zu allem Überfluss fiel eine weitere Welle der Hundewesen über sie her. Waren sie vorher unterlegene Gegner, die den Elben weniger Probleme bereiteten, griffen sie jetzt die mit den übermächtigen Ungetümen kämpfenden Soldaten von allen Seiten an und brachten sie zusätzlich in Bedrängnis. Doch der harte Kern seiner Streitkräfte war in der Lage, den zwar starken, aber offensichtlich nicht besonders intelligenten Bestien standzuhalten. Die mehr auf brachiale Gewalt und Übermacht ausgelegte Kampfweise der Gegner scheiterte an der Geschwindigkeit und Kampferfahrung der als Einheit auftretenden Elben. Unzähligen der Kreaturen brachten Orthas und seine Soldaten den Tod.
Der Veteran bemerkte, dass sich nun auch die großen, schlaksigen Wesen mit den langen Armen auf dem Schlachtfeld sehen ließen. Sie trugen jedoch keine Schwerter, Keulen oder Ähnliches. Die Waffen in ihren Händen glichen eher einer Armbrust, nur ohne Bügel und Sehnen und sie waren aus Metall.
‚Was haben sie damit vor?‘, überlegte Orthas.
Im Nahkampf konnte er sich die Dinger beim besten Willen nicht vorstellen und der Einsatz von Fernwaffen war bei diesem wilden Durcheinander nicht möglich, ohne die eigenen Leute zu treffen.
Doch das schienen die Wesen in Kauf zu nehmen. Sie richteten die Waffen auf das Getümmel und es knallte ähnlich wie bei den Geschützen auf den Schiffen. Elben und Scheusale gingen zeitgleich zu Boden. Grünes und rotes Blut spritze über das Schlachtfeld.
Die neue Situation brachte nun auch die erfahrenen Soldaten aus dem Konzept. Der Kampf mit den übermächtigen Bestien, während man den unaufhörlichen Angriffen der Köter ausweichen musste, war bereits ohne diesen gnadenlosen Beschuss, der weder auf Freund noch Feind Rücksicht nahm, anspruchsvoll. Zwar fanden immer noch viele der Wesen ein jähes Ende, aber die Zahl der Elben reduzierte sich nun schnell und die Übermacht wuchs dadurch. Die anfängliche eins zu vier Situation hatte Orthas falsch eingeschätzt. Es mussten sich weit mehr Kreaturen eng auf den Schiffen zusammengepfercht haben. Gegen diese Armee konnte die kleine Besatzung von Neban ohne Unterstützung nicht bestehen. Allerdings war es für einen Rückzug zu spät.
Orthas wollte nicht kampflos fallen und mindestens eines der langen, schlaksigen Wesen mit auf seinen Weg zu Ralesha nehmen. Er hob das breite Schwert wie einen Schild vor den Körper und stürmte los. Die Kreatur bemerkte den Vorstoß und richtete die Waffe gegen ihn. In dem Moment, als er es knallen hörte, sah er, wie die Friedensklinge vor ihm in zwei Teile zerbarst.
‚Was bei Ralesha sind das für Apparate?‘, seine Gedanken überschlugen sich.
Kurz darauf ertönte ein weiterer Knall und eine Schockwelle durchfuhr seine Brust.
Der Einschlag war so heftig, dass es den Veteranen auf den Rücken warf. Benommen und nicht fähig zu atmen lag der Elb auf dem Boden. Er hörte den Köter, der die leichte Beute zu wittern schien, knurren, bevor er ihn sah. Er setzte die beiden Vorderpfoten auf seinen Brustkorb und öffnete sein mit Zähnen versetztes Maul, um ihm die Kehle zu zerfleischen. Orthas war nicht fähig, sich zu rühren.
„Ralesha, ich komme zu dir, steh unserem Volk gegen diesen Feind bei!“, flüsterte er und blickte der Bestie in die gelben Augen.
Der anhaltende Laut eines Signalhorns ließ schlagartig die Mordlust aus den Augen des Hundes weichen. Er schloss das Maul und kletterte von ihm herunter, um sich in Richtung Schiff zurückzuziehen. Orthas, der langsam wieder Herr über seinen Körper wurde, richtete sich auf und blickte prüfend zu den übrigen Elben.
Er sah, dass von den Soldaten lediglich drei Dutzend am Leben waren. Alle lagen, mehr oder weniger schwer verletzt, auf dem Boden. Dem gnadenlosen Einsatz der unbekannten Fernwaffen in Verbindung mit der Übermacht konnten sie nicht standhalten. Der Blick auf seine eigene Rüstung zeigte ihm, dass der goldene Panzer zwar eingedellt war, aber die Geschosse nicht in der Lage gewesen waren, ihn zu durchdringen. Die Elben in den Lederharnischen hatten weniger Glück und die, die überlebten, bluteten stark.
Der Kommandant erkannte fünf der langarmigen Wesen mit ihren fremdartigen Waffen, die sie auf den Rest seiner Soldaten gerichtet hielten.
Eine der Kreaturen, die als einzige an ihrer Robe ein weißes Rüstungsteil um die rechte Schulter trug, kam auf Orthas zu.
Der Kommandant erhob sich, um nicht vor dem Feind im Dreck zu liegen, wenn er mit dem vermeintlichen Heerführer der Invasoren verhandelte. Die Schmach der drohenden Niederlage haftete ohnehin schon groß genug an ihm.
Die leuchtend roten Augen fixierten Orthas und er öffnete seinen Mund, sodass die spitzen Zähne zum Vorschein kamen.
„Meines Wissens müsste es sich bei deinesgleichen um Elben handeln. Spreche ich in einer Sprache, die du verstehst?“
Seine Stimme vibrierte fast wie ein Summen.
„Ich bin Orthas, Kommandant der Küstenburg von Neban, Veteran der Goldenen Ebene und in der Tat ein Elb, Diener der Weißen Göttin Ralesha und ich verstehe dich, Kreatur Morkans.“ Er nahm eine schon fast arrogante Haltung an. Er reckte das Kinn in die Höhe und streckte die Brust nach vorn. Seine stattliche, aufrechte Erscheinung ließ eher den Schluss zu, als hätte er die Schlacht gerade gewonnen und täuschte beinahe darüber hinweg, dass er schmutzig und in verbeulter Rüstung vor dem Wesen stand. Angst hatte er keine. Er hat ehrenvoll gekämpft und der Überzahl an Gegnern so lange wie möglich getrotzt.
„Ich wüsste nicht, was dich dazu veranlasst, meine Sprache für dein dämonisches Maul zu missbrauchen. Ich verhandle nicht mit den Schöpfungen des Schwarzen Gottes!“, spie er dem Wesen hasserfüllt entgegen.
Die Kreatur drehte den Kopf zur Seite und gab summend etwas in einer Sprache von sich, die Orthas noch nie gehört hatte. Seine Mitstreiter zeigten ihre Reißzähne und begannen in ein monotones Geräusch, was man nur als Lachen deuten konnte, zu verfallen.
Dann wandte er sich wieder an den Veteranen: „Wir dienen weder diesem Morkan, noch verehren wir einen Schwarzen Gott. Auch befindest du dich nicht in der Position, um zu verhandeln. Aber wie unhöflich von mir, dich nach deiner netten Vorstellung im Unklaren zu lassen. Ich bin Minas, ToCarb der Zweiten. Wir kommen vom Kontinent Ida und gehören zu dem Volk der Singali.“
Etwas verdutzt antwortete der Kommandant: „Es ist mir egal, was ihr seid oder woher ihr kommt. Ihr habt die Goldene Ebene angegriffen und das macht euch gleichermaßen zu Feinden wie die Dämonen Morkans. Dieses Gespräch wird mir langsam zuwider. Sagt, was ihr von mir wollt und warum ihr euren Köter zurückgepfiffen habt!“
Orthas glaubte, auf dem lippenlosen Mund von Minas eine Art Schmunzeln auszumachen, bevor der Singali antwortete:
„Wir werden das Land und diesen Kontinent wie viele davor erobern und seine Bewohner versklaven oder vernichten. Im Namen unseres Gottes Samir werden wir sein Reich und seinen Einfluss vergrößern. Du wirst diese Kunde zu deinen Herren tragen und ihnen raten, sich zu ergeben und zu unterwerfen oder zu sterben.“
Im Angesicht besagter Anmaßung wurde der Elb ungehalten und ungewollt wurde seine Stimme wütender und lauter: „Ihr werdet diesen Kontinent niemals erobern.“
Orthas lachte dem fremden Heerführer ins Gesicht: „Ihr werdet schon am Elbenreich Ulldriell scheitern. Ihr werdet noch nicht einmal die Grenzen der Goldenen Ebene überschreiten. Verfallt nicht dem Glauben, dass diese kleine Festung auch nur ansatzweise die Kampfkraft der Elben widerspiegelt!“
Nachdem er seinem Ärger Luft gemacht hatte, beruhigte er sich und fragte: „Was ist mit meinen Männern?“
Nun erkannte Orthas ein deutliches Grinsen in dessen Gesicht: „Deinen Männern gebührt die Ehre, ihr Blut als Erste auf deinem Kontinent unserem Gott zu opfern.“
Er begann wieder summend zu lachen und die anderen Singali fielen in das Gelächter ein.
Angesichts des Schicksals seiner Soldaten gewann die Wut in Orthas erneut die Überhand.
„Du verdammte Kreatur, ich werde dich persönlich zu deinem Gott schicken!“
Er hob die Reste der Friedensklinge und stürmte auf Minas zu. Der Singali hatte offensichtlich mit einem solchen Ausbruch gerechnet und blieb gelassen stehen, gab etwas in seiner Sprache von sich und augenblicklich kamen mehrere der großen Kreaturen auf Orthas zu. Dieser unterlief den Schlag des heranstürmenden Ungetüms, übersah jedoch das kleinere Ungeheuer dahinter. Den schweren Holzknüppel erblickte er erst kurz vor seinem Gesicht.
Er nahm nur noch einen dumpfen Knall, ein Knacken und den Geschmack von Blut wahr. Dann wurde es dunkel vor seinen Augen.
Legenden von Gorotan
Ralesha jedoch hatte keine Blutopfer von ihren Untertanen gefordert und somit reichte sie an die Macht Morkans nicht heran. Auch sie konnte den Vormarsch nicht aufhalten.
Als es fast verloren schien und ihre Anhänger den Glauben schon so gut wie aufgegeben hatten, erkannte sie die Schwäche ihres Bruders.
Ralesha erschien seinen Völkern und versprach ihnen, sie von der Pein des Schwarzen Gottes zu erlösen, wenn sie sich zu ihr bekennen und gemeinsam mit den ihren in die Schlacht zögen, um das Heer Damorns vom Kontinent zu tilgen und die Macht Morkans ein für alle Mal zu brechen.
Die Völker, die jahrelang unter dem Joch des Gottes gelitten hatten, sahen ihre Chance, sich und ihre Kinder von ihrem Peiniger zu befreien, und ergriffen sie. Sie schworen Morkan ab und der Verlust seiner Anhänger minderte dessen Macht.
Als die Kreaturen der Weißen Göttin den unerwarteten Beistand sahen, fassten sie neuen Mut. So formierte sich aus allen vier Ländern des Kontinents ein gewaltiges Heer der verschiedenen Rassen, das sich Damorn und seiner Armee stellte.
Überrascht von der plötzlichen Gegenwehr mussten die Wesen des Schwarzen Gottes derbe Verluste hinnehmen. Die Schlacht schien sich zugunsten der vereinten Völker zu wenden, doch dann erschien Damorn auf dem Schlachtfeld. Jeder Schlag tötete gleich mehrere seiner Widersacher. Kein Schwert und kein Pfeil konnte dessen Schuppen durchdringen und das Heer, verunsichert durch den übermächtigen Feind, verlor die Oberhand. Als Ralesha das sah, griff sie selbst in den Kampf ein und schützte ihre Soldaten vor den tödlichen Angriffen Damorns. Ihre Krieger schöpften neuen Mut durch den Beistand der Göttin. Sie stemmten sich mit aller Kraft gegen die schwarze Armee aus Scheusalen und schafften es letztendlich, sie zu bezwingen und die Schlacht für sich zu entscheiden.
Morkan war seitdem ohne Anhänger. Keiner betete zu ihm oder opferte mehr in dessen Namen. Dadurch war seine Macht gebrochen. Ralesha nahm alle Ländereien wie versprochen zu sich und wurde seither auf dem ganzen Kontinent verehrt. Die Völker waren so glücklich über den Ausgang der Schlacht und die Vertreibung des Bösen, dass sie eine neue Zeitrechnung ausriefen und zählten seitdem die Zyklen nach Damorn (n. D.).
Doch Morkan versprach Ralesha und den Verrätern seiner eigenen Schöpfung Rache. Er schwor, es würde eine Zeit kommen, in der Ralesha ihnen nicht helfen könne. Dann werden sie sich an ihn wenden und er wird neue Macht erlangen. Seitdem lebten die Völker auf Gorotan im Namen der Weißen Göttin und mussten nie wieder Blutopfer erbringen. Und versteckt im Dunkeln lauert der Geist Morkans und wartet auf seine Rache.
4. Königreich Eberòn, Sommer 1023Baronie Midur, angrenzende Wälder von Wildhain
Langsam schlich Garcia durch das Unterholz. Ihre braunen Schuhe mit den Ledersohlen ermöglichten ihr, sich nahezu geräuschlos fortzubewegen. Was für den Beruf, den sie gewählt hatte, durchaus von Vorteil war. Sie folgte dem Berufszweig ihres Vaters und auch wenn er es nur ungern zugab, waren ihre Jagderfolge zumal besser als seine. Zu gut war ihre Treffsicherheit mit dem Bogen und die Fähigkeit sich dem Wild unbemerkt zu nähern. Die junge Jägerin war mittlerweile zur Frau gereift. Bis über die Schultern fiel ihr langes schwarzes Haar, das sie meistens aus pragmatischen Gründen zum Zopf geflochten hatte, damit es nicht im Unterholz hängen blieb oder sie anderweitig behinderte.
Es war ein heißer Tag und selbst jetzt am Abend wehte ein warmer Wind durch die Wälder. Sie trug einen braunen Lederharnisch und hatte die Unterarme zusätzlich in dickes Leder gewickelt. Dies diente zum Schutz vor einem wütenden Gebiss oder scharfen Krallen. Obwohl sie sich derart sicher und lautlos durch das Unterholz bewegte und sie seit etlichen Zyklen nicht mehr von einem wilden Tier überrascht worden war, bestand ihr Vater stets auf dieses Stück Rüstung.
Die Wälder von Ulldriell waren für die Bewohner Midurs überlebenswichtig. Lange hatte man gebraucht, um sich mit den Elben über die Nutzung zu einigen. Letztendlich ließen sie sich jedoch mit Erzen und Stoffen zu einem Nutzungsrecht bewegen. So lebten die Menschen an den Waldrändern und verdienten ihren Lebensunterhalt als Holzfäller, Jäger, Sammler und handelten mit Tieren, die sie im Wald fingen.
Das Leben in Midur war einfach. Keiner musste hungern oder hatte unter habgierigen Herrschern zu leiden.
Bürgermeisterin Eydas war eine faire Frau und ihr politisches Geschick sorgte zu guter Letzt dafür, dass der Baron Dogan Cerus seine Finger von dem Dorf ließ. Zumal dieser weit weg in Hochburg saß und sich eher in Richtung des Königs orientierte. Solange ihn die kleinen Siedlungen mit Holz, Fleisch und Tieren versorgten, kümmerte er sich nicht sonderlich um dessen Regierung.
Mittlerweile lebte Garcia gern in Wildhain, das war nicht immer so. Besonders in ihrer frühen Jugend hatte sie es schwer. Seit ihrer Geburt trug sie ein Muttermal auf ihrem Handrücken, welches dem Zeichen des Schwarzen Gottes ähnelte. Viele im Dorf sahen sie als böses Omen und einige wollten sogar so weit gehen, sie davonzujagen oder gar zu töten, um die Göttin nicht zu erzürnen.
‚Genau! Einfältige Dorfmenschen! Als ob Ralesha der Tod eines Babys erfreuen würde‘, dachte sie für sich.
Als sie aufwuchs und in die Schule kam, wurde sie zumeist von den anderen Kindern gemieden und oft aus der Gemeinde ausgeschlossen. Allerdings verlor sich dieses Verhalten mit der Zeit und die Menschen fanden neue Begebenheiten, über die sie sich echauffieren konnten. Seit die Goldene Ebene im Norden von den Singali, wie sie sich nannten, überrannt worden war, hatten die Leute ohnehin nur noch eine Sache, um die sich ihre Gespräche drehten.
Vor über einem Zyklus überfiel das unbekannte Volk das Reich der Elben. Die sonst im Kampf unbezwingbare Rasse hatte dem plötzlichen Gegner nichts entgegenzusetzen. Zu zahlreich war der Feind und zu fortschrittlich seine Waffentechnologie – hieß es. Im Dorf erzählte man sich, dass selbst die riesige Küstenfestung in Neban an einem einzigen Tag gefallen sein soll. Garcia glaubte aber nicht immer alles, was in der Schenke an Informationen ausgetauscht wurde. Sicher war manches wahr, dennoch handelte es sich meist nur um 'Geschichten von Waldgeistern' und wenn sie nicht erfunden waren, dann zumindest maßlos übertrieben.
Es wurde viel über die Singali erzählt: Sie seien so groß wie zwei Mann und so stark wie ein Bär. Sie schießen mit Feuerstöcken, die selbst schwere Rüstungen durchschlugen und andere Dinge. Dabei hatte noch nie jemand so weit im Süden einen gesehen. Das Einzige, was man sicher wusste, war, dass die Goldene Ebene und die Eisernen Hallen innerhalb eines halben Zyklus fielen. Seitdem leisteten die Elben in Ballandria und die Bergmenschen in den Weißen Bergen erbittert Widerstand gegen das Vorrücken des Feindes. Von den übrigen Reichen kam keiner den Elben zu Hilfe. Ihre Arroganz und der Umstand, dass sie sich jahrhundertelang nie um die Probleme Anderer gekümmert hatten, sorgte letztendlich dafür, dass die Menschen und Warc sie ihre eigene Medizin nur zu gern schmecken ließen. Die Bergmenschen im Westen waren ohnehin viel zu stolz, irgendeines der benachbarten Reiche um Unterstützung anzuflehen. Der Vormarsch der Singali stockte auch ohne weitere Hilfe schon fast einen Zyklus in den Wäldern von Ulldriell und in den Weißen Bergen kamen sie seit vielen Monden nicht voran. So machte sich der Rest des Kontinents immer weniger Gedanken um die fremden Eroberer.
Dennoch hatte die Ausbreitung der Singali durchaus Auswirkungen auf die Menschen in Midur. Zumindest auf die, die von den Wäldern lebten. Die Arbeit wurde gefährlicher. In der ehemaligen Goldenen Ebene hatten sich die Singali ein Heerlager eingerichtet. Man erzählte sich, dass ihr Führer, ToCarb Minas, große Teile des Landes übernahm und sich eine Art Laboratorium einrichtete. Er experimentierte dort mit den verschiedenen Lebewesen auf Gorotan und kreuzte sie mit seinen eigenen Schöpfungen. Das Treiben der Singali hatte das einst fruchtbare Land über die Zeit in ein totes und schlammiges Gebiet verwandelt. Die Mutanten aus diesen Sümpfen schickte der ToCarb nun in die Wälder, um den Widerstand der Elben zu schwächen. Hin und wieder kam eine der Bestien zu weit nach Süden und tötete einige der Dorfbewohner auf der Jagd. Garcia hatte bislang zum Glück noch keinen Kontakt mit einem dieser Wesen gehabt. Sie waren von den Singali für das Töten geschaffen worden und dadurch perfekte Killer. Die Elben ihrerseits durchstreiften die Wälder und versuchten, die Monster zur Strecke zu bringen, bevor sie Schaden an Dörfern anrichten konnten. Besonders die Flüchtlinge aus der Goldenen Ebene, die ohnehin heimatlos waren, nahmen sich jeder gefährlichen Aufgabe, meist aus persönlicher Rache, an.
Dieser Umstand war auch der Grund dafür, dass Garcia ihren Eltern diese Unternehmung verheimlichte. Offiziell verbrachte sie den Abend bei einer Freundin. Gerade ihre Mutter hätte es niemals gebilligt, dass sie ganz allein durch den Wald streifte, noch dazu nachts und mittlerweile schon tief im Norden.
Aber sie folgte seit Wochen einer Spur – einem Praak. Diese, vom Äußerlichen her einem Drachen nicht unähnlichen Wesen, konnte man nur äußerst selten finden. Sie waren in etwa halb so groß wie ein Mensch, schwarz und galten als sehr klug. Außerdem waren sie gefährlich. Das lag nicht nur an den scharfen Klauen und Zähnen, zu allem Überfluss war ein Praak auch noch in der Lage, Feuer zu spucken.
Die Schuppen dieses Tieres, welche seine Vorderseite vom Hals bis zum Becken zierten, waren nahezu undurchdringlich.
Deswegen machte sich Garcia auch auf die Jagd nach dem Wesen, dessen Spur sie vor geraumer Zeit ausgemacht hatte. Jedoch war es ihr bis heute nicht gelungen, den Praak zu erlegen. Vor einigen Umläufen hatte sie ihn erstmals erwischt, aber durch eine unglückliche Fügung verfehlte ihr Pfeil sein Ziel und verletzte das Tier nur leicht. In dieser Nacht hingegen sollte es so weit sein. Sie würde ihn töten und sich einen Harnisch aus seinen Schuppen fertigen. Damit wäre sie eine echte Augenweide, nicht nur im Dorf oder in Midur. Im ganzen Königreich gab es ihres Wissens nach nur eine Rüstung aus Praakschuppen und die fristete in der Schatzkammer des Königs ihr unzweckmäßiges Dasein.
Sie erhob sich nahezu lautlos aus dem Unterholz und sah ihn vor sich. Das Tier saß anmutig auf einer Lichtung und verzehrte ein kleines Reh, welches es sich grade gerissen hatte. Auf seinem linken Flügel sah Garcia das Einschussloch, dass sie ihm bei ihrer ersten Begegnung verpasst hatte. Leider schubste sie damals einer der anderen Jäger in Deckung, um sie vor dem Scheusal zu retten. Dank ihres unerwünschten Helfers verfehlte sie den Kopf des Praak. Heute aber war sie allein. Nur der Jäger und seine Beute. Und es lief hervorragend. Sie hatte sich auf Pfeilreichweite an das abgelenkte Tier herangeschlichen und wurde nicht bemerkt. Ohne ein Geräusch zu verursachen, nahm sie einen Pfeil aus ihrem Köcher, der am linken Unterarm befestigt war und die Geschosse zwischen zwei Tierfellen einklemmte. Dies erlaubte ihr eine lautlose und schnelle Entnahme. Damit war es ihr möglich, nach einem Schuss in einer fließenden Bewegung den nächsten Pfeil zu spannen und sofort einen weiteren nachzusetzen. Den Köcher hatte sie sich selbst erdacht und errang sich gleich beim ersten Einsatz den Respekt der anderen Jäger für das zunächst belächelte Utensil. Aber am Bogen galt sie auch vorher, trotz ihres jungen Alters, bereits als Koryphäe im Dorf.
Ganz langsam zog sie die Sehne zurück, um sich beim Spannen des Pfeils nicht durch ein Geräusch zu verraten, und visierte den Kopf des Tieres an.
Es gab nicht viele Möglichkeiten das drachenartige Wesen zu erlegen. Entweder ein Schuss ins Antlitz oder auf Herzhöhe in den Rücken. Von hinten sah man diese Echsen nur selten. Man sagte ihnen nach, dass sie einen besonderen Sinn dafür hätten, es zu spüren, wenn sich Feinde rücklings näherten. Garcia glaubte zwar nicht wirklich daran, wollte es aber auch nicht darauf anlegen und kam daher von vorn.
Mit voller Konzentration zielte sie auf das linke leuchtend gelbe Auge des Praak. Sie atmete nochmal ein und aus. Dann hielt sie die Luft an. Kurz bevor sie die Sehne losließ, passierte es. Der Wind drehte und wehte ihren Geruch dem Tier entgegen.
‚Jetzt oder nie!‘, dachte sie und schickte den Pfeil auf die Reise. Der Praak nahm ihre Witterung auf und hob leicht den Kopf, um prüfend in ihre Richtung zu schauen. Leider genügte diese kleine Bewegung bereits, um den Pfeil sein Ziel verfehlen zu lassen. Wirkungslos zerbarst das Geschoss am Brustpanzer. Dann hatte er Garcia auch schon entdeckt. Kurz meinte sie, Wut in den Augen des Tieres zu erkennen. Vermutlich hatte er die Jägerin, der er den Makel in seinem Flügel zu verdanken hatte, wiedererkannt.
„Dieses Mal entkommst du mir nicht!“, schrie Garcia ihrer Beute entgegen und in einer fließenden Bewegung nahm sie den nächsten Pfeil aus dem Köcher, spannte ihn und schoss erneut auf den kleinen Drachen. Sie zielte absichtlich etwas über den Kopf, da sich der Praak das letzte Mal nach ihrem Schuss sofort in die Luft geschwungen und sich verdrückt hatte. So würde er diesmal direkt in das Geschoss fliegen.
Der Praak jedoch hatte heute nicht die Flucht im Sinn. Der Pfeil flog wirkungslos über ihn hinweg. Ein wildes Knurren entwich seiner Kehle. Offenbar sah er sich allein mit der Jägerin nicht als Unterlegenen an. Er öffnete den Kiefer und Garcia wurde von der Helligkeit der kleinen Feuerkugel, die sein Maul rasend schnell verließ, geblendet. Instinktiv warf sie sich im letzten Moment zur Seite. Der Feuerball verfehlte ihren Kopf nur knapp und schlug in einem Baum drei Schritte hinter ihr ein. Sofort stieg ihr der Geruch von verbrannten Haaren in die Nase. Zu allem Überfluss ließ sie in der hektischen Ausweichbewegung ihren Bogen fallen. Der Praak setzte ihr schnell nach. Fauchend schoss er ins Unterholz, um seiner Häscherin den Garaus zu machen. Die Jägerin wurde zur Beute. Er holte mit einer krallenbesetzten Klaue aus und zielte auf ihre Kehle. Mit all ihrer Wendigkeit und Reaktionsfähigkeit gelang es ihr, sich kurz bevor sie aufgeschlitzt wurde zur Seite zu rollen und dem tödlichen Hieb zu entgehen. Der Drache war jedoch nicht weniger beweglich und flink als sie. Blitzschnell sprang er in die Höhe und landete auf ihrem Bauch, um ihren Ausweichmanövern ein Ende zu setzen. Durch die Kraft des Aufpralls wich die Luft aus ihrer Lunge und nur dem Harnisch hatte sie es zu verdanken, dass sich seine Klauen nicht in ihr Fleisch bohrten. Er öffnete das Maul und Garcia sah die Reißzähne auf ihren Hals zukommen. Aus Reflex hob sie den rechten Arm schützend vor sich und der Praak verbiss sich darin. Dank des gestärkten Leders wurde dieser nicht schwer verletzt. Der Drache starrte sie aus gelben Augen an. Erneut hörte sie ein Knurren aus seiner Kehle. Dann spürte sie Hitze auf ihrer Haut. Kleine Flammen zuckten an der Seite des Mauls hervor und der Armschutz begann zu rauchen. Es roch nach verbranntem Leder und Fleisch. Die Pein, welche sich von ihrem Unterarm ausbreitete, war beinahe unerträglich. Hatte sie bis dahin instinktiv gehandelt und keine Zeit gehabt, die Situation zu überdenken, bekam sie es nun mit der Angst zu tun. Garcia schrie vor Schmerz und Schreck auf. Sie schlug nach dem Kopf des Tieres. Ihre Faust prallte wirkungslos gegen dessen Schädel.
Die Pein verstärkte sich von Lidschlag zu Lidschlag. Kleine Sterne verdeckten ihr Blickfeld und sie näherte sich der Ohnmacht.
Plötzlich begann ihre Hand stark zu pulsieren und färbte sich tiefschwarz.
Ein Kribbeln setzte ein und wurde immer intensiver.
Mit einem Schlag hörte es wieder auf und es schien so, als würde die Zeit für einen Moment stillstehen. Garcia sah die grellen Flammen und die gelb glühenden Augen des Praak. Sie nahm den ansonsten lautlosen und dunklen Wald um sich herum intensiv wahr. Zuletzt richtete sich ihre Aufmerksamkeit zurück auf das unnatürliche Pulsieren, welches von ihrer Hand ausging. Dann geschah alles sehr schnell. Eine Welle aus schwarzem Licht breitete sich in enormer Geschwindigkeit aus. Der erschrockene Praak wurde von ihr weggestoßen und blieb benommen auf dem Rücken liegen.
‚Was war das?‘, jedoch hatte die Jägerin keine Zeit, weiter über dieses seltsame Phänomen nachzudenken. Der Drache kam langsam wieder zur Besinnung und zog sich taumelnd auf die Füße.
Ungeachtet der Schmerzen in ihrem Arm umrundete sie den Praak und zog ihren Dolch, den sie normalerweise nur zum Ausweiden von Tieren benutze. In solch einem Nahkampf hatte sie sich bis heute noch nie befunden.
Ehe er wieder bei vollem Bewusstsein war, sprang sie ihm auf den Rücken, umgriff mit dem linken Arm seinen Hals und zog den Kopf nach hinten. Mit aller Kraft rammte sie den Dolch durch das Auge in den Schädel des Drachen. Augenblicklich erschlaffte der muskulöse Leib des Tieres. Ein letztes Grollen ertönte. Dann erlosch das Gelb in dem verbliebenen Sehorgan und der kräftige Körper brach unter ihr zusammen.
Die Jägerin verdrängte den Schock und ging auf die Knie. Sie sprach Ralesha ihren Dank für ihre Beute aus, wie es bei jedem Fang üblich war.
‚Was auch immer gerade passiert ist, es hat mir mein Leben bewahrt. Ich danke der Göttin für diesen Beistand‘, schoss es ihr dabei durch den Kopf.
Langsam wich das Adrenalin aus ihren Adern und der Schmerz in ihrem Unterarm meldete sich zurück.
Sie wollte die Verbrennung eigentlich gar nicht sehen und so entschied sie, dieses Privileg der Bürgermeisterin als Optora vorzubehalten.
Als sie den schlaffen Körper des Praak betrachtete, fiel ihr ein großer Nachteil daran auf, allein zu jagen. Sie musste das Wesen, das mindestens ihrem Gewicht ebenbürtig war, ohne Hilfe ins Dorf zurücktragen. Wie hatte sie es geschafft, darüber nicht nachzudenken? Das würde eine anstrengende Reise werden. Aber nach der endlosen Suche und den Gefahren, die diese Beute gefordert hatte, wollte sie ihn unter keinen Umständen hier liegen lassen.
So schulterte sie den Drachen und machte den ersten Schritt auf ihrem beschwerlichen Rückweg.
5. Königreich Eberòn, Sommer 1023Baronie Midur, Wildhain
„Wir müssen uns über unsere Tochter unterhalten!“, sagte Nora zu ihrem Mann.
„Sieht Layla wohl schon wieder Monster unter ihrem Bett und will lieber bei uns schlafen?“, entgegnete Torben amüsiert.
„Nein, nicht DIE Tochter, im Gegensatz zu ihrer Schwester bereitet Layla mir nie schlaflose Nächte“, meinte Nora schnippisch, „als Garcia mir sagte, dass sie bei einer Freundin übernachten würde, kam mir das gleich komisch vor. Sie hat noch nie bei einer Freundin übernachtet. Deswegen war ich gerade in ihrem Zimmer.“
Die Augen des großen Mannes verengten sich zu Schlitzen und er fixierte seine Frau: „Du hast das Zimmer unserer Tochter durchwühlt? Findest du das nicht ein bisschen ...“
Nora schnitt ihm das Wort ab: „Ihre Jagdausrüstung ist weg, Torben. Sie ist nicht bei einer Freundin, sie ist im Wald. Mitten in der Nacht. Und weil ich keinen kenne, der verrückt genug wäre, so etwas zu tun, vermute ich, dass sie auch noch allein gegangen ist!“
Nun wich die amüsierte Miene des kahlen Mannes der eines sorgenden Vaters.
„Ich kenne ihre Jagdplätze, ich mach mich auf die Suche nach ihr“, sagte er und zog sich seine Jagdausrüstung an, „das Mädchen ignoriert die Gefahr. Ich hoffe, es ist ihr nichts passiert.“
Nora hatte sich nun auch etwas beruhigt, da bei ihr ebenfalls die Sorge Überhand gewann, war aber immer noch verärgert über das heimliche Davonschleichen und die Lüge ihrer Tochter: „Es wird ihr schon nichts passiert sein, ihr passiert doch nie was. Diesmal müssen wir konsequenter sein. Sie macht sonst, was sie will und irgendwann passiert ihr wirklich mal was!“
Torben, der nun in voller Jägermontur im Raum stand, ging auf die Tür zu: „Bist du nicht ein bisschen hart? Ich meine, Garcia hatte es nie leicht in ihrem Leben. Und ich finde es nicht rechtens, dass du ihr Zimmer durchsuchst!“
Dann blieb der kräftig gewachsene Mann stehen, drehte sich zu seiner Frau um und wartete auf ihre Entgegnung.
Die Meinung der beiden Erziehungsberechtigten über das Verhalten ihrer Tochter ging schon immer auseinander. Und gelegentlich gerieten sie deswegen heftig aneinander.
Sie starrten sich an, man konnte die Spannung zwischen ihnen fast greifen.
Nora öffnete den Mund und begann den Schlagabtausch: „Es ist mir egal, dass …“
Ein lauter Schrei unterbrach ihre Ausführungen vorzeitig.
„Das kam von draußen!“, meinte Torben und rannte zum Eingang. Weitere Schreie erklangen und als er die Tür öffnete, sah er den Grund für die verzweifelten Rufe.
Vor dem Brunnen türmte sich eine zweieinhalb Mann große Kreatur auf. Sie hatte graues Fell und einen Kopf wie ein Wolf. Ihr Körper strotzte nur so vor Muskeln. Zu ihren Füßen lagen zwei regungslose Personen, Torben vermochte nicht auszumachen, um wen es sich handelte.
Er drehte sich um. „Geh nach oben zu Layla und versteckt euch!“, sagte er zu seiner Frau.
„Und was tust du? Ich möchte nicht, dass du von dem Ungeheuer gefressen wirst!“, entgegnete diese völlig hysterisch.