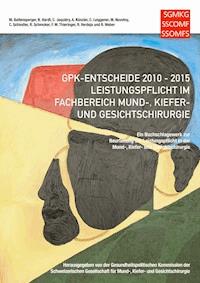
GPK-Entscheide 2010-2015: Leistungspflicht in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie E-Book
Marc Baltensperger
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das schweizerische Gesundheitswesen befindet sich in einem Umbruch, den es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat. DRG, Tarvision, Ärztemangel und Ärztestopp sind nur wenige Stichworte, die täglich den Medien zu entnehmen sind. Das grundlegende Problem unseres Gesundheitssystems sind die immer höher werdenden Kosten bei immer knapper werdenden Ressourcen. Daher ist es für alle beteiligten Parteien wichtig, eine transparente, nachvollziehbare und klar definierte Qualität und damit verbundene Kostenstruktur für erbrachte Leistungen zu haben. KVG, UVG, IV und MV liefern hierfür die allgemeinen Rahmenbedingungen, die einzelnen Tarife den effektiven Kostenrahmen einer medizinischen Leistung. Es liegt in der Natur eines solch komplexen Systems, dass nicht alle Fragestellungen klar und eindeutig geregelt werden können. Dieses Buch fasst die Grundsätze und Tätigkeiten der Gesundheitspolitischen Kommission (GPK) der SGMKG zusammen. Die wichtigsten Regeln in der Kommunikation von Leistungserbringern mit dem Versicherer, insbesondere im KVG werden dargelegt. Zudem beinhaltet das Werk sämtliche einstimmig gefällten Entscheide der Jahre 2010 bis 2015. Wir hoffen, dass dieses Buch allen Kolleginnen und Kollegen bei der täglichen Arbeit nützlich sein wird und dass rege davon Gebrauch gemacht wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einführung
Grundsätze und Tätigkeiten der GPK
Anmerkungen zum Datenschutz und Tarifschutz
Kapitel 2: Kommunikation mit dem KVG-Versicherer
Kapitel 3: Publizierte Fälle der GPK
Grundsätzliches
Auflistung der publizierten Fälle der GPK
Die beurteilten Fälle im Detail
Kapitel 4: Die Gesundheitspolitische Kommission der SGMKG
Kapitel 5: Schlussbericht des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten zur Arbeit der GPK
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Das schweizerische Gesundheitswesen befindet sich in einem Umbruch, den es in diesem Ausmass noch nicht gegeben hat. DRG, Tarvision, Ärztemangel und Ärztestopp sind nur wenige Stichworte, die täglich den Medien zu entnehmen sind. Das grundlegende Problem unseres Gesundheitssystems sind die immer höher werdenden Kosten bei immer knapper werdenden Ressourcen. Daher ist es für alle beteiligten Parteien im Gesundheitssystem wichtig, eine transparente, nachvollziehbare und klar definierte Qualität und damit verbundene Kostenstruktur für erbrachte Leistungen zu haben. KVG, UVG, IV und MV liefern hierfür die allgemeinen Rahmenbedingungen, die einzelnen Tarife den effektiven Kostenrahmen einer medizinischen Leistung. Es liegt in der Natur eines solch komplexen Systems, dass nicht alle Fragestellungen klar und eindeutig geregelt werden können. Grauzonen mit einem nicht unerheblichen Spielraum für Interpretationen sind deshalb unvermeidbar. Diese Grauzonen sind die Schwachstellen des Systems, welche in der täglichen Arbeit mit den Gesetzen, Regelwerken und Tarifen ersichtlich werden. Sie führen dazu, dass die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens – Krankenkassen, Versicherungen, Behörden, aber auch die Leistungserbringer – die Tarife und Gesetze oftmals zu ihren Gunsten anwenden bzw. optimieren, um den für sie grösstmöglichen Gewinn aus dem System zu erwirtschaften. Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Parteien, vor allem aber zwischen Versicherern und Leistungserbringern, sind deshalb vorprogrammiert und nahmen in den letzten Jahren stetig zu.
Dieser Entwicklung kann nur mit Erfolg entgegengetreten werden, wenn alle Akteure bereit sind, ihre Arbeit einer strikten und transparenten Qualitätskontrolle zu unterziehen und diese auch von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Die Gesundheitspolitische Kommission (GPK) der Schweizerischen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (SGMKG) versucht, diesem Anspruch für unsere Fachgesellschaft gerecht zu werden. Die GPK hilft dabei, strittige Fälle zwischen Versicherern und anderen Drittpersonen sowie einzelnen Mitgliedern oder der Fachgesellschaft zu klären. Die einstimmig von der GPK beurteilten Fälle (und nur diese) können dann von jedem Mitglied der SGMKG in der Argumentation gegenüber Versicherern und Drittpersonen verwendet werden. Dabei kann die Kommission auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Dieses Buch beinhaltet sämtliche einstimmig gefällten Entscheide der GPK (nur solche werden publiziert) der letzten Jahre. Eine regelmässig aktualisierte Liste der Entscheide findet sich auf der Homepage der SGMKG im geschützten Bereich. Zugangsdaten erhält jedes Mitglied der SGMKG auf Anfrage durch den Webmaster der Gesellschaft Dr. med. et med. dent. Florian M. Thieringer, E-Mail: [email protected].
Das erste Kapitel des Buches fasst die Grundsätze und Tätigkeiten der GPK zusammen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Aspekt des Datenschutzes, dem sich die GPK besonders verpflichtet fühlt. So hat sie in ihren Statuten eine strikte Anonymisierung von Personendaten festgelegt; in den Fallbeschreibungen werden somit keine Datenschutz-relevanten Daten verwendet. Auf die Problematik der Bearbeitung sensibler Personendaten durch die GPK geht auch der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) in seiner Beurteilung der Arbeit der GPK ein.
Im zweiten Kapitel dieses Buchs werden die wichtigsten Regeln in der Kommunikation von Leistungserbringern mit dem Versicherer, insbesondere im KVG dargelegt, welche immer wieder zu Irrtümern und Missverständnissen führen.
Im dritten Kapitel dieses Buchs, dem Kernstück dieses Werkes, sind alle bisher veröffentlichten Entscheide der GPK der letzten Jahre aufgeführt. Damit dieses Buch als Nachschlagewerk dienen kann, wurde jedem Entscheid ein Stichwort zugeteilt und ein entsprechendes alphabetisches gegliedertes Inhaltsverzeichnis unter Kapitel 3.2. erstellt. Abgerundet wird das Buch durch das Reglement der GPK der SGMKG in Kapitel 4 und den Schlussbericht des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten zur Arbeit der GPK in Kapitel 5.
Wir hoffen, dass dieses Buch allen Kolleginnen und Kollegen in unserer Gesellschaft bei der täglichen Arbeit nützlich sein wird und dass rege davon Gebrauch gemacht wird.
Nur vereint als SGMKG können wir angesichts der immer grösser und schwieriger werdenden Herausforderungen des Gesundheitssystems in unserem Fach erfolgreich bestehen. Dazu braucht es den täglichen Einsatz eines jeden SGMKG-Mitglieds, indem es sich stets an die Vorgaben des Gesetzte bzw. an die für die Abrechnung vorgesehenen Tarifstrukturen des Tarmed und des SSO-Tarifes hält und diese, wenn nötig, auch konsequent zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten durchzusetzen versucht.
Die GPK steht euch hierbei gerne zur Verfügung.
Für die GPK der SGMKG im Herbst 2015
Dr. Dr. med. Marc Baltensperger
Präsident der GPK
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Florian Zeilhofer
Präsident SGMKG
Kapitel 1: Einführung
Grundsätze und Tätigkeiten der GPK
Qualitätskontrolle ist ein entscheidendes Kriterium im Technical Assessment einer medizinischen Behandlung. Darin stellt die vertrauensärztliche Tätigkeit ein entscheidendes Element dar. Für die Qualitätssicherung der vertrauensärztlichen Tätigkeit in unserm Fachgebiet wurde von der Schweizerischen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (SGMKG) die Gesundheitspolitische Kommission (GPK) ins Leben gerufen, deren Aufgaben sich wie folgt charakterisieren lassen:
Die GPK setzt sich aus gewählten Mitgliedern der SGMKG zusammen. Diese verfügen über eine weit abgestützte fachliche Qualifikation basierend auf Berufserfahrungen an der Klinik und in der Praxis, aus vertrauensärztlicher Tätigkeit, Mitarbeit bei der Entwicklung verschiedener Tarife, der Gestaltung des Tarmed und des SSO-Tarifs und deren Revisionen sowie aus Verhandlungen mit den Tarifpartnern. Diese Aufzählung verdeutlicht die einzigartige Fachkompetenz sowohl der einzelnen Mitglieder der GPK, als auch der GPK als Gremium.
Sämtliche GPK-Mitglieder leisten ihre Arbeit im Gremium unentgeltlich, d. h. ehrenamtlich.
Gemäss den Statuten der GPK, die auf der Homepage und in Kapitel vier dieses Buches für jedes Mitglied der SGMKG einsehbar sind, bemüht sich die GPK, alle ihr vorgelegten Fälle neutral, korrekt und datenschutzkonform zu beurteilen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden alle Fälle strikt anonymisiert beurteilt. Für die Beurteilung der einzelnen Fälle liegen den GPK-Mitgliedern somit weder Angaben zum Patienten, zum Behandler, zur beteiligten Versicherung noch zu allfälligen beteiligten Personen (Vertrauensärzte usw.) vor.
Die Korrespondenz über die Fälle, die von der GPK behandelt werden, läuft ausschliesslich über den Präsidenten der GPK. Dieser kontrolliert, dass die Fälle dem Gremium korrekt anonymisiert aufbereitet zur Beurteilung vorgelegt werden.
Jeder an den Präsidenten der GPK eingereichte Fall soll von der einreichenden Partei bereits gemäss den obigen Ausführungen anonymisiert sein. Der Präsident behält sich das Recht vor, nicht korrekt eingereichte (d. h. nicht vollständig anonymisierte) Fälle zur diesbezüglichen Überarbeitung zurückzuweisen.
Nur einstimmig beurteilte Fälle werden auf der Homepage der SGMKG aufgeschaltet und sind für alle Mitglieder im geschützten Bereich einsehbar.
Die publizierten Fälle können als Argumentarium von allen Mitgliedern gegenüber Versicherern und anderen Parteien verwendet werden. Es sei aber betont, dass diese Entscheide weder für den Versicherer noch die Gerichte rechtlich nicht bindend sind. Nicht tangiert wird auch die Weisungsungebundenheit des Vertrauensarztes welches im KVG verankert ist.
Hingegen darf durchaus davon ausgegangen werden, dass es sich auf Grund der oben erwähnten Zusammensetzung der GPK und der Einstimmigkeit der publizierten Beschlüsse um eine hochkarätige Expertenmeinung handelt. Entscheide von Vertrauensärzten oder Krankenkassen, die mit den Beschlüssen der GPK nicht übereinstimmen, dürfen somit bezüglich Qualität und Kompetenz zumindest hinterfragt werden.
Nicht einstimmig beurteilte Fälle werden nicht publiziert. Die einreichende Partei wird in dieser Situation direkt vom Präsidenten persönlich informiert.
Entscheide der GPK sind nicht absolut und für alle Zeit gültig. Sind neue Aspekte bei der Beurteilung eines publizierten Falls zu berücksichtigen bzw. veränderte Rahmenbedingungen oder Gesetze aufgetreten, so werden diese Fälle entsprechend von der GPK nachbearbeitet und dann bei Einstimmigkeit des GPK Gremiums wiederum auf der Website der SGMKG in korrigierter Form wieder publiziert.
Es steht jedem Mitglied der SGMKG zu Kritik und / oder Ergänzungen zu den publizierten Fällen der GPK zu äussern. Diese soll in schriftlicher Form an den Präsidenten der GPK gelangen. Die GPK wird dann im Rahmen ihrer Sitzungen darauf eintreten.
Die Tätigkeiten, Rechte und Pflichten der GPK der SGMKG wurden im Reglement der GPK zusammengefasst, welches 2012 vom Vorstand der SGMKG erlassen wurde. Das Reglement im Detail findet sich in Kapitel 4 dieses Buches.
Anmerkungen zum Datenschutz und Tarifschutz
Entscheidend für die Glaubwürdigkeit der GPK, wie auch für die Leistungserbringer und Versicherer im Allgemeinen, ist der sensible Umgang mit medizinischen Daten. Die GPK bekennt sich dabei klar zum Datenschutz und hat dies entsprechend auch in ihren Statuten klar festgehalten.
Dass der Datenschutz immer wieder ein Problem für Versicherer als auch Leistungserbringer darstellt, zeigen die in den letzten Jahren behandelten Fälle der GPK. Im Detail werden diese Fälle in Kapitel 3.3. diskutiert.
Einige unserer Ansicht nach wichtigen und zentralen Punkte sollen an dieser Stelle aber gesondert zusammengefasst werden:
Beispielsweise wird oft gefordert, dass auf Grund von Bestimmungen in Verträgen zwischen Spitälern und Versicherern, zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen, gemäss offiziellen Tarifen wie Tarmed oder SSO-Tarif oder gemäss ATSG 28 oder 42 (Mitwirkung beim Vollzug) Unterlagen aus der Krankengeschichte (wie Röntgenbilder, Arztberichte, Operations- und Austrittsbericht usw.) unbesehen der Krankenkasse oder zumindest dem Vertrauensarzt einzureichen seien. Gegenüber den Vorgaben des KVG sind solche vertraglichen Abmachungen und Tarifbestimmungen null und nichtig; die Mitwirkung beim Vollzug gilt sowieso nur für denjenigen, der eine Versicherungsleistung beansprucht, also für den Patienten und nicht etwa für den Leistungserbringer. Die Einhaltung des Datenschutzes ist oberstes Gebot; das KVG hat Vorrang vor allen anderslautenden Abmachungen.
Neben dem Datenschutz ist der Tarifschutz ein wichtiger Pfeiler des KVG. Dieser obliegt der Ärzteschaft, die diesbezüglich sehr gewissenhaft sein muss und den Tarifschutz konsequent einhalten soll. Die Kontrolle liegt im Interesse der Krankenkasse und ist rigoros.
Der Datenschutz dagegen obliegt vor allem den Krankenkassen. Diese sind am Datenschutz jedoch nicht so stark interessiert wie am Tarifschutz. So halten die Krankenkassen den Datenschutz oftmals nur mangelhaft ein; an einer strikten Kontrolle des Datenschutzes sind sie zumeist noch weniger interessiert. Die Kontrolle erfolgt bestenfalls im Rahmen eines Gesamtkonzepts, nicht jedoch beim einzelnen Patienten. Krankenkassen müssen vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten daher immer wieder gerügt werden.
Auf Leistungserbringerseite ist der Vergleich mit dem Tarifschutz leicht ersichtlich: Bezüglich des Tarifschutzes kann das KVG auch mit ausgeklügelten Vereinbarungen nicht ausgehebelt werden. Auch wenn die Leistungserbringer keine Juristen sind, haben sie dies auf Basis ihrer einschlägigen Erfahrungen verstanden.
Auf Versichererseite sieht dies anders aus: Trotz der hohen Zahl an Juristen unter ihnen gewinnt man den Eindruck, dass häufig versucht wird, den Datenschutz zu umgehen.
Welche datenschutzrechtlichen Aspekte gilt es nun – in aufsteigender Reihenfolge vom Arztbericht über das Röntgenbild bis zum Operations- und Austrittsbericht – zu beachten und unbesehen jeder Forderung von Kassenseite einzuhalten? Die folgende Aufstellung soll dem Leistungserbringer das Vorgehen gegenüber den Krankenkassen im KVG aufzeigen (siehe hierzu auch
Kapitel 2
):
Arztberichte inkl. genauer Diagnose oder zusätzlich angeforderte Auskünfte medizinischer Natur (Art. 42 KVG) sowie Angaben, die der Vertrauensarzt zur Beurteilung der Leistungspflicht benötigt (Art. 57 KVG), stellen in puncto Datenschutz kein Problem dar.
Arztberichte an mitbehandelnde Kollegen sollen nur bezüglich Vorhandensein und Länge des Textes im Sinne eines Nachweises für die Abrechenbarkeit offengelegt werden. Der Inhalt des Textes ist mit einem Raster unleserlich zu machen.
Angeforderte Röntgenbilder können an den Patienten abgegeben werden.
Der Operations- und der Austrittsbericht geniessen gemäss EDÖB eine Sonderstellung. Für die Behandlung verfasste Operations- und Austrittsberichte dürfen weder der Krankenkasse noch dem Vertrauensarzt eingereicht werden. Bei entsprechender Begründung kann die Krankenkasse konkrete Fragen zu Verhältnismässigkeit und Zweckbindung stellen.
Dieses Konzept stützt sich auf die Vorschriften des Datenschutzes und des Tarifschutzes und sichert dessen Einhaltung zu. Rechtsdienste und vertrauensärztliche Dienste sind mit einem solchen Konzept jedoch oftmals nicht einverstanden und äussern gewisse Vorbehalte. Dabei ist dieses absolut wasserdicht und berücksichtigt folgende Prinzipien des Datenschutzes, die in entsprechenden GPK-Entscheiden bereits aufgeführt sind:
Art. 42 KVG:
Diagnosen und Auskünfte
Art. 57 KVG:
Angaben an den Vertrauensarzt
Datenschutz:
Verantwortung der Krankenversicherer Verantwortung des Leistungserbringers Stellungnahmen des Datenschützers Prinzipien des Datenschutzes
EVG-Entscheide:
beispielsweise K7/05 oder BEG 125 II 473
Art. 28/43 ATSG:
Pflicht zur Auskunft und Mitwirkung
Art. 33 ATSG:
Schweigepflicht des Personals (entbindet nicht vom Datenschutz)
Kapitel 2: Kommunikation mit dem KVG-Versicherer
Arztberichte an Kostenträger
Arztberichte müssen Art. 42 KVG (genaue Diagnose oder angeforderte zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur) und Art. 57 KVG (Angaben, die der Vertrauensarzt zur Beurteilung der Leistungspflicht benötigt) einhalten. Es geht also keinesfalls um Unterlagen aus der Krankengeschichte, sondern um Angaben des Leistungserbringers in Form von formatierten oder nicht formatierten kostenpflichtigen Arztberichten.
Röntgenbilder
Für das Einreichen eines Röntgenbildes ist in jedem Fall die Zustimmung des Patienten erforderlich. Dies gilt auch für das Weiterreichen eines Röntgenbildes an einen weiteren Behandler. Wie einschlägige Gerichtsurteile zeigen, kann andernfalls der Patient den Behandler für alle Folgen verklagen, im Extremfall sogar für die Ablehnung der Leistungspflicht auf Grund des vom Leistungserbringer ohne Zustimmung des Patienten eingereichten Röntgenbildes. Das Unterschreiben lediglich einer Einverständniserklärung durch den Patienten genügt für die Zustimmung nicht, weil eine Aufklärung durch den Behandler über die möglichen Folgen erforderlich ist, beispielsweise schon darüber, dass der Patient Gefahr läuft, dass ihm das Röntgenbild nicht vergütet wird, wenn der Behandler es einfach einreicht. In einem solchen Fall könnte die Kasse dann (mit Recht) behaupten, dass sie das Röntgenbild für ihren Entscheid gar nicht benötigt hätte. Somit muss stets nachgewiesen werden, dass die Kasse das Röntgenbild wirklich angefordert hat.
Wie empirische Erfahrungen zeigen, muss der Datenschutz konsequent strikt eingehalten werden. Ein Röntgenbild sollte daher nie einer Krankenkasse – oder dem Vertrauensarzt – eingereicht, sondern immer dem Patienten gegeben werden. Er allein hat zu entscheiden, ob und wem er das Röntgenbild überreicht. Wenn die Krankenkasse es bei ihm anfordert, muss sie es auch bezahlen, selbst bei ablehnendem Entscheid. Streng datenschutzkonform müsste der Patient auch von der Krankenkasse über mögliche Folgen beispielsweise für das Überreichen eines Röntgenbildes aufgeklärt werden.
Der Weg, angeforderte Röntgenbilder vom Patienten einreichen zu lassen, ist einfach und effizient. Dabei werden der Datenschutz sowie alle Anforderungen bezüglich Mitarbeit beim Vollzug gemäss Art. 28 und 43 ATSG eingehalten. Der Kostenträger muss das angeforderte Röntgenbild vergüten.
Dass die Krankenkasse den Patienten durch ihre Aussage, ohne Röntgenbild gebe es keine Kostengutsprache, nötigt, ist nicht mehr Sache des Leistungserbringers.
Berichte an Mitbehandler
Bei den Berichten an Mitbehandler verhält es sich im Prinzip wie beim Röntgenbild, nur, dass der Behandler selbst eine Verantwortung für den Datenschutz des Inhalts seines Berichtes tragen muss. Hier ist somit zu unterscheiden zwischen der Pflicht zum Nachweis, dass der Bericht verfasst worden ist und welche Länge er aufweist – dies unterliegt nicht dem Datenschutz – und dem Inhalt des Berichtes – dieser unterliegt dem Datenschutz. Dies geht klar aus dem EVG-Entscheid hervor, auf den sich die Rechtsdienste der Krankenkassen für die Forderung auf Herausgabe von Berichten berufen. Beim diesem EVG-Entscheid ging es lediglich darum, eine bestimmte Anzahl verfasster Berichte nachzuweisen, sowie die Länge der Berichte festzustellen, um das korrekte Abrechnen zu überprüfen. Der Inhalt des Textes stand nicht zur Diskussion. Gemäss den Vorgaben des Datenschutzes muss er mit einem Raster unleserlich gemacht werden. Mehr steht der Krankenkasse nicht zu. Für Fragen zum Textinhalt kann sie einen Arztbericht einfordern. Dieser unterliegt den Anforderungen des Datenschutzes und ist kostenpflichtig.
Operations- und Austrittsberichte
Wesentlich komplexer sind die Anforderungen des Datenschutzes bei Operations- und Austrittsberichten. Die Verantwortung kann nicht einfach an den Patienten delegiert werden; vielmehr steht der Behandler als Verfasser des Textes in der Pflicht. Angaben dazu finden sich in mehreren GPK-Entscheiden unter dem Stichwort „Datenschutz“.
Bei Operations- und Austrittsberichten hängt die Problematik und mögliche Lösungsansätze davon ab, ob diese für die Behandlung oder für den Versicherer geschrieben sind. Dies beinhaltet auch die Problemlösung
Problemlos sind für den Versicherer verfasste Berichte, die bezüglich Operation und Austritt unter Einhaltung von Art. 42 KVG eine genaue Diagnose, angefragte zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur oder gemäss Art. 57 ATSG Angaben, die der Vertrauensarzt zur Begründung der Leistungspflicht benötigt, enthalten. Generell empfiehlt sich, zwecks Einfordern vonseiten der Kostenträger nur noch solche Operations- und Austrittsberichte zu verfassen. Sie enthalten die Diagnose und die durchgeführten Operationsschritte, beispielsweise gemäss SSO-Tarif, Tarmed, VVG-Tarif oder OKP-Pauschale, d. h. das, was zur Überprüfung der Abrechnung notwendig ist. Sie können zwecks genauerer Angaben über die Behandlung um einen Arztbericht ergänzt werden.
Ein für den Versicherer geschriebener Operations- oder Austrittsbericht hält die Vorgaben von Art. 42 KVG (genaue Diagnose und verlangte zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur) und von Art. 57 (Angaben, die der Vertrauensarzt zur Beurteilung der Leistungspflicht benötigt) und damit den Datenschutz ein und darf damit wie ein an die Krankenkasse verfasster Arztbericht eingereicht werden.
Er enthält, wie bereits erwähnt, die Diagnose und die durchgeführten Operationsschritte gemäss dem Tarif, mit dem abgerechnet wird. Damit kann die Krankenkasse die Leistungspflicht und die Abrechnung datenschutzkonform überprüfen.
Tarifbestimmungen in Verträgen oder Tarifen
Solche Bestimmungen regeln immer Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Versicherern; dabei gehen sie zu Lasten Dritter, nämlich der Patienten. Gemäss dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sind sie immer nur unter Einhaltung des Datenschutzes zu verstehen, auch wenn in den betreffenden Verträgen nicht speziell darauf hingewiesen wird.
Vorbildlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist das KVG-Formular der SSO. Hier sind Art. 42 und Art. 57 KVG sowie das Prinzip der Verhältnismässigkeit, der stufenweisen Datenbekanntgabe und der Zweckbindung eingehalten. Weitere Angaben erhält die Krankenkasse nur auf Nachfrage in Form eines leistungspflichtigen Arztberichtes. Auch die Leistungspflicht des KVG-Formulars an sich ist geregelt: Ob von der Kasse nachgefragt oder nicht – es ist leistungspflichtig, sobald es einen Antrag gemäss Art. 17–19a KLV enthält, unabhängig davon, ob die beantragte Leistung schlussendlich dem Patienten letztlich zugesprochen wird oder nicht.
Verantwortung des Krankenversicherers und des Leistungserbringers, Stellungnahmen des Datenschützers, Prinzip der Verhältnismässigkeit, der stufenweisen Datenbekanntgabe und der Zweckbindung
Diese Punkte gehören unabdingbar zum Datenschutz und wurden bereits in vorgängigen Kapitel 1.2 andiskutiert. Sie werden in mehreren GPK-Entscheiden näher erläutert. Leider werden sie vom Rechtsdienst oder vertrauensärztlichen Dienst der Krankenkassen oft nicht wahrgenommen. Oft fehlt auch die Erkenntnis, dass Art. 33 ATSG trotz Schweigepflicht des Personals keineswegs vom Datenschutz entbindet. So hat der EDÖB verschiedentlich Krankenkassen wegen eklatanter Verletzung des Datenschutzes gerügt, wenn dem Personal Einsicht in die dem Vertrauensarzt vorbehaltenen Angaben der Leistungserbringer gewährt wurde. Bei Telefonanrufen von Seiten der Krankenkasse lässt sich dementsprechend oftmals unschwer feststellen, dass das Personal in aller Selbstverständlichkeit auf solche aus Datenschutzgründen nicht zugänglichen Angaben zurückgreift. Dabei geht es oftmals um Sachbearbeiterinnen ausserhalb des vertrauensärztlichen Dienstes. Sie berufen sich auf ihre Schweigepflicht und glauben damit ein Anrecht darauf zu haben, Arztberichte, Röntgenbilder sowie Operations- und Austrittsberichte einfordern zu können. Dabei verkennen sie, dass Schweigepflicht allein nicht Datenschutz bedeutet und dass trotz Schweigepflicht der Datenschutz eingehalten werden muss.
Zusammenfassende Bemerkungen
Erfahrungen der letzten Jahre haben immer wieder aufgezeigt, dass Vorwürfe der Versicherer an die Adresse der Leistungserbringer bezüglich Verweigern des Einreichens von Unterlagen aus der Krankengeschichte (wie beispielsweise Röntgenbilder, Operations- und Austrittsberichte) oftmals nur auf Unkenntnis des Wesens des Datenschutzes beruhen. Dies gilt auch für das Beharren auf Tarifbestimmungen, Vereinbarungen zwischen Versicherern und Leistungserbringern sowie internen Regelungen innerhalb der Krankenkassen usw. Erfahrungsgemäss entstehen dann Missverständnisse und Anschuldigungen immer dort, wo die Anforderungen des Datenschutzes nicht bekannt sind. Diejenigen hingegen, die den Datenschutz kennen, klagen nicht an, sondern halten ihn einfach ein. Dies bedeutet nicht Kleinlichkeit oder Sturheit, sondern – wie beim Tarifschutz – Respektieren der Gesetzlichen Grundlagen der im KVG verankerten Rechte des Patienten. Eine strikte Einhaltung des Datenschutzes führt ausserdem zu hoher Effizienz der administrativen Abläufe. Ineffizienz hingegen entsteht dann, wenn Krankenkassen, Sachbearbeiterinnen und der vertrauensärztliche Dienst über den Datenschutz zu wenig informiert sind. Vergleichbar ist dies mit der Einhaltung der Hygieneregeln im Operationssaal: Die Effizienz wird nur dann gestört, wenn jemand darüber zu wenig informiert ist oder sich nicht daran hält.
Kapitel 3: Publizierte Fälle der GPK
Grundsätzliches
Die vorliegende Sammlung von publizierten Fällen der GPK umfasst ausschliesslich einstimmig beurteilte Fälle. Sie ist identisch mit den publizierten Fällen der GPK, die sich im passwort-geschützten Mitgliederbereich der SGMKG-Homepage befinden. Da die Homepage laufend aktualisiert bzw. falls nötig korrigiert und ergänzt wird, gilt diese als Referenz für die Publizierten Fälle.
Die publizierten Fälle können von allen Mitgliedern gegenüber Versicherern und anderen Parteien verwendet werden. Es sei aber betont, dass diese Entscheide für den Versicherer oder die Gerichte rechtlich nicht bindend sind. Nicht tangiert wird auch die Weisungsungebundenheit des Vertrauensarztes.
Hingegen darf durchaus davon ausgegangen werden, dass es sich auf Grund der im ersten Kapitel erwähnten Zusammensetzung der GPK mit der breiten Fachexpertise und der Einstimmigkeit der publizierten Beschlüsse um eine qualitativ hochwertige Expertenmeinung handelt. Daraus folgt, dass Entscheide von Vertrauensärzten oder Krankenkassen, die mit den Beschlüssen der GPK nicht übereinstimmen, bezüglich Qualität und Kompetenz zumindest kritisch hinterfragt werden dürfen.
Nicht einstimmig beurteilte Fälle werden nicht auf der Homepage der SGMKG publiziert und sind somit auch nicht in diesem Buch aufgeführt.
Auflistung der publizierten Fälle der GPK
(in alphabetischer Reihenfolge)
Abklärungskosten gemäss Art. 45 ATSG
Administrativer Leerlauf als Kostentreiber
Akteneinsicht
Angaben, die notwendig sind
Angaben versus Unterlagen
Arztäquivalente Leistungen gemäss Art. 25 KVG
Ärztliche Leistungspflicht gemäss Art. 25 KVG
Arztbericht Pos. 4044
Ambulant versus stationär: Sekundäre Spaltchirurgie
Aufklärung und Patienteninformation (Pos. 4011)
Auskunfts- und Mitwirkungspflicht
Behandlungsbeginn
Beschwerderecht
Cawood-Klasse VI: Art. 17c 3 KLV
Datenschutz: Nachgereichte Unterlagen
Datenschutz: Operations- und Austrittsberichte
Dauer des Spitalaufenthaltes
Dysgnathien
Dysgnathie-Patienten mit Kiefergelenksbeschwerden
Dysgnathie nach dem 20. Altersjahr
Dysgnathie: IV-Fall nach dem 20. Altersjahr
Eröffnung der Kieferhöhle (MAV)
Eröffnung der Kieferhöhle als akzidentelle Komplikation
Fehlinterpretation PIK-Entscheid
Fehlinterpretationen (Merkblatt)
Folgeschäden / Schulunfallversicherung
Hämorrhagische Diathese – Art. 18a 5 KLV
Herdsanierung bei Gefässprothesen- oder Herzklappenersatz gemäss Art. KLV 19a KLV
Implantatverlust UVG/KVG
IV-Verfügung gültig ab OP-Datum
Karies distal der Zähne 37 und 47 bei verlagerten und teilretinierten Zähnen 38 und 48
Kassenpflicht für Zahnschadenformular, Röntgenbild, Arztzeugnis, Erstkonsultation
Knochenaugmentation Pos. 4261 / 4262 / 4360 / 4361
Knochenersatzmaterial
Knochenverlust Cawood-Klasse VI
Kombiniert kieferchirurgisch/zahnärztliche Leistungen
Kompetenz für Art. 25 KVG / Therapiefreiheit
Komplikationen
Komplikation nach Weisheitszahnentfernung
Kostenvoranschlag
KVG-Formular
KVG-Formular, Röntgenbilder, Erstuntersuchung
Leistungspflicht für Material und Medikamente
Materialkosten bei Anschlingung eines retinierten Zahnes
Missbrauch des PIK-Entscheids
Missbrauch Ziff. 3 – PIK 05051-B am Beispiel Weisheitszahnentfernung
Missbrauch Ziff. 3 – PIK 05051-B am Beispiel OSME und Weisheitszahnentfernung
Mitwirkung beim Vollzug
Modelloperation und Schienen im DRG
Mund-Antrum-Fistel (Art. 17e 2 KLV)
Narkose
Narkosekosten
Notfallbehandlung: Pos. 4000 bzw. 4002
Operationsbericht
Operationslisten: spitalambulant vs. spitalstationär
Originalunterlagen
OSME nach Dysgnathie-Operation
Parkinson-Syndrom und andere schwere psychische Erkrankungen (Art. 18c 7 KLV)
Patientenaufklärung Pos. 4011
PIK-Entscheid 05051-B Ziff. 3: Abszessinzision
PIK-Entscheid 05051-B-3 und Doppeltitelträger
Pflichtleistung Art. 25 KVG im Kausystem
PIK-Entscheid und Wirtschaftlichkeit: Kiefergelenk
PIK-Entscheid: Osteosynthese-Materialentfernung (OSME)
PIK-Entscheid: Semimaligner Tumor
Prämedikation
Qualifizierter Krankheitswert bei der Entfernung von Weisheitszähnen
Reposition und Zugang bei Osteosynthesen und OSME (aktualisiert
)
Röntgenbilder einreichen
Röntgenkontrolle präoperativ
Röntgenkontrolle intraoperativ
Röntgenkontrolle postoperativ
Röntgenkontrolle nach Entfernung verlagerter Weisheitszähne
Röntgenkontrolle unter Artikel 56 KVG
Rückforderungsklage
Rückfragen von Versicherungen
Sparten UBR / Praxis-OP / OP I / OP II
Tiers payant
Tiers payant versus Tiers garant
Überwachung Pos. 4986 und Bettenbenützung Pos. 4985
Untersuchung Pos. 07.0010
UV/IV/MV Arzthonorar im DRG: Tarmed oder SSO?
Verhaltensregeln innerhalb versus ausserhalb Kap. V/VI
Verlagerung von Zähnen Art. 17 lit. a Ziff. 2 KLV
Verlagerung Eckzahn – Kostenvoranschlag
Vertrauensarzt: Bekanntgabe von Name und Adresse
Wirtschaftlichkeit: Tarmed versus SSO-Tarif
WZW-Kriterien: Tarmed versus SSO-Tarif
Zeugniskosten
Zugang bei OSME
Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen
Zusätzliche Entschädigung
Zusatzhonorar im VVG-Bereich
Zuschlag für Zugänge 4335/4336/4337
Die beurteilten Fälle im Detail
Abklärungskosten gemäss Art. 45 ATSG
Der Versicherungsträger übernimmt gemäss Art. 45 ATSG die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten nur dann, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich sind oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen waren.
Administrativer Leerlauf als Kostentreiber
Pos. 4011 Operationsaufklärung
Pos. 4227 Abszessinzision
Pos. 4238 Odontogene Zyste zu Nachbarstruktur
Pos. 4261 Knochenaugmentation als Zusatzeingriff bei Implantatinsertion
Pos. 4262 Knochenaugmentation als selbständiger Eingriff
Pos. 4361 Knochenaugmentation als Konturaufbau
Art. 47 ATSG Akteneinsicht
Eine 32-jährige Patientin kommt notfallmässig wegen eines Abszesses im Oberkiefer rechts bei einem Rezidiv einer 6 Jahre zuvor operierten odontogenen Zyste zur Nasennebenhöhle rechts.
Auf ein Kostengutsprachegesuch mit Zahnschadenformular, Arztbericht und Orthopantomogramm erfolgt ein ablehnender Entscheid der Krankenkasse. Ein Wiedererwägungsgesuch mit Hinweis auf die Leistungspflicht sowohl des Abszesses als auch der Zyste zur Nachbarstruktur – beides gemäss Art. 25 KVG und gemäss Rechtsprechung kassenpflichtig – lehnt die Krankenkasse in Bestätigung ihres ersten Entscheids erneut ab.
Daraufhin wendet sich die Patientin an den Ombudsmann der Krankenversicherungen. Dazu verlangt sie bei der Krankenkasse Akteneinsicht in die Stellungnahme des Vertrauensarztes. Dies wird von der Krankenkasse nicht gewährt. Deswegen beschwert sich die Patientin beim kantonalen Verwaltungsgericht wegen Rechtsverweigerung.
In der Zwischenzeit entscheidet der Ombudsmann unter Hinweis auf die Möglichkeit, den Rechtsweg einzuschlagen, dass die Behandlung nicht unter Art. 17–19 KLV eingeordnet werden könne. Dies hatte die Patientin gar nicht beantragt. Der Antrag der Patientin auf Art. 25 KVG wird nicht geprüft.
Auf Verfügung des kantonalen Verwaltungsgerichts mit Fristsetzung erhält die Patientin Akteneinsicht in den Entscheid des Vertrauenszahnarztes. Auf die Ankündigung der Patientin, den Rechtsweg jetzt auch für die Kostenübernahme des Abszesses zu beschreiten, erklärt sich die Krankenkasse zu einer Teilübernahme bereit, unter Ablehnung der Pos. 4011 „Operationsaufklärung“.
Auf einen Arztbericht mit Verweis auf die Leistungspflicht von Pos. 4011 hin lenkt der Vertrauenszahnarzt schliesslich ein.
Nun verlangt die Patientin bezüglich Ablehnung der Leistung "Operation einer Zyste mit Verbindung zur Nachbarstruktur" von der Krankenkasse eine Verfügung. Stattdessen erteilt die Krankenkasse eine Zusage für die Übernahme der Operationskosten für die Zystenoperation, jedoch erneut unter Abänderung von Positionen in der Abrechnung. Sie ersetzt Pos. 4238 „Zyste zur Nachbarstruktur“ durch Pos. 4236 „Zyste über 1 cm“ und streicht die Pos. 4262 „Knochenaufbau“. Auf einen weiteren Arztbericht hin erkennt die Kasse die Übernahme von Pos. 4238 an und schlägt für den Knochenaufbau Pos. 4261 „Knochenaufbau bei gleichzeitiger Insertion eines Implantats“ vor.
Dies erfordert einen weiteren Arztbericht, um auf die drei möglichen Varianten einer Knochenaugmentation hinzuweisen.
Beurteilung
Trotz Kostengutsprachegesuchs mit allen notwendigen Angaben und klarem Hinweis auf die Leistungspflicht lehnte die Krankenkasse die Kostenübernahme ohne Begründung offenbar routinemässig ab. Das Gleiche gilt für das Wiedererwägungsgesuch, auch hier wurde für die Ablehnung kein Grund genannt.
Trotz des selbstverständlich anmutenden Rechts der Patientin auf Einsicht in ihre Akte bei der Krankenkasse gemäss Art. 47 ATSG wurde der Patientin dies von der Krankenkasse nicht gewährt.
Der Ombudsmann prüfte und bejahte nur den Entscheid der Krankenkasse. Zum Antrag der Patientin bzw. zur fachärztlichen Beurteilung nahm er nicht Stellung.
Mit einer Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht konnte die Patientin ihr Recht auf Akteneinsicht rasch durchsetzen. Aus der Akteneinsicht ging klar hervor, dass der Fehlentscheid vom Vertrauenszahnarzt auf einer nicht haltbaren Beurteilung basierte.
Die Korrektur des Entscheids in Teilschritten verlief extrem langwierig. Tarifarisch nicht haltbare Korrekturen an den Positionen der Abrechnung durch die Krankenkasse mussten mit einer Reihe zusätzlicher Arztberichte bestritten werden. Dass ein operativer Eingriff der durchgeführten Art nicht aufklärungspflichtig oder die Operationsaufklärung nicht abrechnungsberechtigt sein sollte, ist nicht nachvollziehbar und käme einer klaren Sorgfaltspflichtverletzung gleich. Der Unterschied in der Behandlung einer allseitig von Knochen umgebenen Zyste grösser als 1 cm gegenüber einer Zyste mit Übergreifen auf die Kiefer- oder Nasenhöhle ist evident. Das Gleiche gilt für die nach erfolgter Zystenoperation möglichen unterschiedlichen Arten des Knochenaufbaus, nämlich als Zusatzeingriff zu einer anderen rekonstruktiven Massnahme wie dem gleichzeitigen Einsetzen eines Implantates, als selbständiger rekonstruktiver Eingriff oder als konturaufbauende Rekonstruktion.
Der administrative Leerlauf über nahezu zwei Jahre kommt einem enormen zusätzlichen finanziellen Aufwand gleich, der bezeichnenderweise nicht bei den Verwaltungs-, sondern zum grössten Teil bei den Behandlungskosten verbucht wird. Der kassenseitige Anteil läuft unter Rechnungskontrolle, und zwar zur Aufdeckung einerseits von arztseitig unrechtmässig beanspruchten bzw. erschlichenen Auszahlungen, die – wenn schon – nicht dem Arzt, sondern dem Kassenmitglied zugutekommen (also keineswegs das Arzteinkommen erhöhen, sondern die Patienten fairer entschädigen würden), und andererseits zum Nachweis von arztseitiger Tarifaushöhlung bzw. unkorrekter Tarifanwendung.
Von der Krankenkasse einmal als Erfolg in ihrer Bilanz zur Rechnungsbeanstandung verbucht, bleibt dieser Erfolgsausweis in ihrer Statistik erhalten, unbesehen der Realität, dass der Grossteil der geltend gemachten Beanstandungen nach obgenanntem administrativem Leerlauf wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt und die Honorarforderungen, wie im vorliegenden Fall, exakt so entschädigt werden müssen, wie sie das erfahrene Abrechnungspersonal einer auf ihr Leistungsspektrum konzentrierten Arztpraxis ursprünglich gestellt hatte.
Akteneinsicht
Für die Beurteilung einer Verfügung und den Entscheid für oder gegen eine Einsprache ist es zweckmässig, den Entscheid des Vertrauensarztes zu kennen. Dazu muss Akteneinsicht gemäss Art. 47 ATSG beantragt werden:
Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu:
der versicherten Person für die sie betreffenden Daten,
den Parteien für die Daten, die sie benötigen, um einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach einem Sozialversicherungsgesetz zu wahren oder zu erfüllen oder um ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund desselben Gesetzes erlassene Verfügung geltend zu machen.
Angaben, die notwendig sind
Die Leistungserbringer müssen gemäss Art. 57 KVG den Vertrauensärzten und Vertrauensärztinnen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Beurteilung der Leistungspflicht notwendigen Angaben liefern. Keineswegs vorgesehen ist das Anfordern und Einreichen von Unterlagen aus der Krankengeschichte, aus denen dann der Vertrauensarzt im Interesse der Krankenkassen liegende Angaben heraussucht, sondern vielmehr die Beantwortung gezielter vertrauensärztlicher Anfragen durch den Behandler. Welche Angaben der Vertrauensarzt zur Beurteilung der Leistungspflicht benötigt, muss in einer gezielten Anfrage formuliert sein.
Angaben versus Unterlagen
Gemäss Art. 42 KVG ist der Datenschutz im KVG genau geregelt. Der Versicherer kann eine genaue Diagnose oder zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur verlangen.
Dabei handelt es sich nicht um Unterlagen, sondern um Angaben in Form eines honorarberechtigten Arztzeugnisses.
Arztäquivalente Leistungen gemäss Art. 25 KVG
Arztäquivalente Leistungen haben einen ärztlichen Ansatzpunkt oder eine ärztliche Zielsetzung. Anders als für die zahnärztlichen Leistungen nach Art. 17–19 und 19a ist keine Kostengutsprache nötig. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte kein KVG-Formular eingesendet werden.
Auf der Rechnung sollte ein Diagnosecode angegeben werden, Hauptcode Q9. Abrechnung nach dem Zahnarzttarif.
Ärztliche Leistungspflicht gemäss Art. 25 KVG
Das EVG hat in einem Leitentscheid zur Definition ärztlicher und zahnärztlicher Behandlung festgehalten, dass sich die Definition vorrangig nach dem übergeordneten Behandlungsziel und nachgeordnet nach dem Behandlungsort richtet. Als ärztliche Behandlungen in der Mundhöhle gelten alle medizinischen Massnahmen, die nicht die Verbesserung der Zähne bezüglich Funktion und Aussehen bezwecken.
Beispiele:
Die Behandlung eines MAP-Syndroms u. a. mittels einer Aufbissschiene ist eine in der Regel vom Zahnarzt durchgeführte ärztliche Behandlung, weil das Behandlungsziel (Entlastung des Kiefergelenks und der Kaumuskulatur) ausserhalb des Gebisses liegt.
Auch die Behandlung eines submukösen, von der periapikalen Region eines Zahnes ausgehenden Abszesses durch Inzision und Drainage gilt als ärztliche Behandlung, weil keine Behandlung/Veränderung am Zahn erfolgt.
Das Gleiche gilt für den Verschluss einer oroantralen Verbindung.
Der für Art. 25 KVG vom EVG festgehaltene Krankheitsbegriff ist aus der Praxis des EVG abgeleitet und wurde negativ wie folgt definiert: „Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalls ist und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“.
Arztbericht Pos. 4044
Krankenkassen bzw. Versicherer inklusive SUVA lehnen regelmässig die Pos. 4044 für einen Arztbericht mit der Begründung ab, „die Krankenkasse habe keinen Arztbericht verlangt“ bzw. „es liege kein Auftrag für die Berichterstellung vor“.
Ausgleichskassen schreiben, „die Pos. 4044 werde von den Ergänzungsleistungen nur übernommen, sofern der Zahnarzt ein Spezialarzt sei. Deshalb müssten sie bei ihren Zahnspezialisten nachfragen, ob eine Berechtigung als Spezialarzt vorliege, um die Pos. 4044 für die Erstellung eines Berichtes in Rechnung zu stellen und diese von den Ergänzungsleistungen vergüten zu lassen“.
Weiter wird die Meinung vertreten, „dass Pos. 4044 nicht mit Pos. 4040 für das KVG-Formular kumuliert werden dürfe“.
Beurteilung
Bei den ärztlichen Zeugnissen wird in jedem Tarif zwischen formalisierten und nicht formalisierten Berichten unterschieden. Im SSO-Tarif stellen Pos. 4040–4042 formalisierte Berichte dar, Pos. 4043–4044 und Pos. 4047 hingegen nicht formalisierte Berichte. Demnach ist eine Kumulation von Pos. 4040 für ein formalisiertes Zeugnis mit Pos. 4044 für ein nicht formalisiertes Zeugnis nicht nur zulässig, sondern in vielen Fällen zwingend.
Bei den nicht formalisierten Zeugnissen gilt es zu unterscheiden, ob der Bericht von einer Krankenkasse ausdrücklich verlangt worden ist oder ob der Bericht einfach für die Behandlung notwendig war, beispielsweise für die Information eines mitbehandelnden Arztes, des Patienten, der Krankenkasse oder eines anderen Kostenträgers:
Pos. 4043
Verlangter ausführlicher Bericht über Befund und Therapie.
Diese Ziffer kommt nur zur Anwendung, wenn der Bericht ausdrücklich verlangt wird, sonst Pos. 4044.
Pos. 4044
Zwischenbericht, Ergänzungsbericht oder Schlusszeugnis.
Gilt nicht für Rezepte und Überweisungsschreiben.
Normale, übliche, kurze Überweisungsschreiben sind in der indirekten Arbeitszeit für den Patienten (Administration) erfasst. Dieses Mass übersteigende Schreiben können mit Pos. 4044 abgegolten werden.
Für die Behandlung notwendig und damit kassenpflichtig ist ein Bericht auch dann, wenn eine Kasse eine Leistungspflicht unkorrekterweise ablehnt und der Patient ohne einen deswegen notwendigen Arztbericht die ihm zustehende Entschädigung nicht erhalten würde. In dieser Situation einen ärztlichen Bericht zu schreiben gehört ausdrücklich zur ärztlichen Pflicht im Zusammenhang mit einer durchgeführten Behandlung.
Zudem wäre es ungerecht, wenn der Patient nicht auch einen kassenpflichtigen Bericht verlangen könnte, wie dies der Krankenkasse auch zusteht.
Damit sich Kassen in einer solchen Situation nicht von der Leistungspflicht drücken können, wurde dies ausdrücklich in Art. 45 ATSG aufgeführt:
Art. 45 ATSG:
Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden.
Die Leistungspflicht gilt auch für Kassen, die zu einem unentgeltlichen Zeugnis zu kommen glauben, wenn sie einen Bericht nicht direkt beim Leistungserbringer, sondern telefonisch beim Patienten anfordern. Auch dabei handelt es sich nicht um einen Gratisbericht, sondern um ein nicht formalisiertes Zeugnis, das für die Behandlung notwendig ist und demnach eine Pflichtleistung darstellt. Die Leistungspflicht hängt auch nicht davon ab, ob die eigentliche Behandlung kassenpflichtig ist oder nicht. Wenn nachzuweisen ist, dass die Kasse den Arztbericht angefordert hat, ist Pos. 4043 abrechenbar, in allen anderen Fällen zumindest Pos. 4044.
Ambulant versus stationär: Sekundäre Spaltchirurgie
Bei einem Patienten mit eingeschränkter Nasenatmung wird ein Kostengutsprachegesuch für eine funktionelle Rhinoseptoplastik mit Conchotomie beidseits ambulant in Intubationsnarkose eingereicht. Der Entscheid der Kasse lautet dahingehend, dass die ambulante Kostenübernahme aus wirtschaftlichen Überlegungen vollumfänglich abgelehnt, jedoch für einen zweitägigen stationären Aufenthalt mit Abrechnung nach Swiss DRG garantiert wird.
Beurteilung
1. Medizinische Indikation
Die Durchführung einer Behandlung erfolgt prinzipiell auf Basis einer medizinischen Indikation. Diese geht in jedem Fall allen WZW (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit) -Kriterien vor. Diese stehen nur bei gleichwertigen medizinischen Indikationen zur Diskussion.
Die medizinische Indikation liegt in der Verantwortung des behandelnden Arztes. Die Therapiefreiheit kann höchstens durch ärztlich anerkannte Guidelines eingeschränkt werden.
Völlig obsolet ist die Einmischung eines Versicherers in die medizinische Indikation (Gewaltentrennung). Dieser hat sich aus ethischen und haftpflichtrechtlichen Gründen jeder Einmischung oder Einflussnahme zu enthalten. Er kann für Vorgaben und Vorschriften weder Verantwortung, Sorgfaltspflicht noch Haftung übernehmen.
Bei der medizinischen Indikation ist nicht nur der Eingriff an sich zu berücksichtigen, sondern auch der Patient in seiner Ganzheit inkl. Alter, Gesundheitszustand, Psyche, Umfeld usw.
Obsolet ist insbesondere, wenn sich ein Vertrauenszahnarzt/-arzt vom Schreibtisch aus, ohne den Patienten zu kennen oder ihn untersucht zu haben, darüber auslässt, wie er den Fall behandeln würde. Fehl am Platze sind dozierende Meinungsäusserungen wie die eines Klinikchefs zu seinen Assistenten, und unerwünscht sind auch Bemerkungen im Sinne eines Obiter Dictum, die sich nicht auf die Fragestellung der Kasse beschränken, sondern darüber hinausgehen und daher inhaltlich irrelevant sind.
2. WZW-Kriterien
WZW-Kriterien gelten nur im Nachgang zur übergeordneten medizinischen Indikation. Sie dürfen nur in Fällen gleichwertiger medizinischer Indikationen angewendet werden. Insbesondere der Versicherer als Kostenträger unterliegt beim Vorbringen von WZW-Entscheiden strengen ethischen und moralischen Kriterien.
WZW-Entscheide und damit verbundene Einschränkungen der Behandlung dürfen den Patienten nicht gefährden, schädigen oder einem Risiko einer Schädigung aussetzen.
WZW-Kriterien haben die Gesamtkosten zu berücksichtigen. Neben den Kosten für die Kasse sind dies zumindest die Kosten der öffentlichen Hand, eventuell bis und mit Arbeitsunfähigkeit oder Rente. Ein Massstab für den diesbezüglich gesunden Menschenverstand ist die Überlegung, wie der Patient als Selbstzahler entscheiden würde, beispielsweise bei einem ästhetischen Eingriff. Dabei ist ambulant immer kostengünstiger als stationär.
Was bezweckt die Kasse, wenn sie sich auf die WZW-Kriterien beruft, um paradoxerweise die stationäre teurere Behandlung gegen die ambulante kostengünstigere Behandlung durchzusetzen? Nichts anderes, als die ca. 55 % der Kosten auf die öffentliche Hand abzuwälzen. Damit werden finanzielle Interessen der Kassen auf dem Rücken der Patienten verfolgt und die WZW-Kriterien ad absurdum geführt.
Solche Auswüchse finanzieller Eigeninteressen der Versicherer wurden bei Vertragsverhandlungen offensichtlich, wenn Versicherer angeblich WZW-basierte Listen ins Spiel brachten, die definieren sollten, welche Eingriffe sie nur ambulant und welche nur stationär übernehmen würden. Neben dem Einwand, dass es dabei nie um Eingriffe, sondern um Patienten (inkl. Gesundheitszustand usw.) im Einzelfall geht, waren eigenartigerweise die gleichen Eingriffe beim öffentlichen Spital stationär, beim Belegarztspital ambulant aufgelistet bzw. bei DRGs stationär, im Zusatzversicherungsbereich ambulant.





























