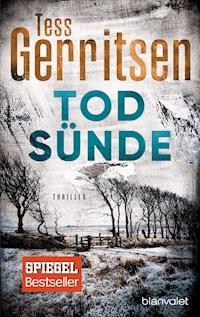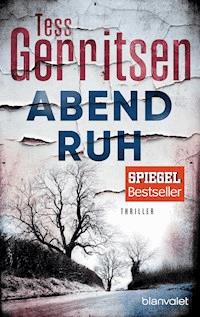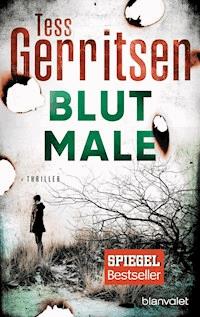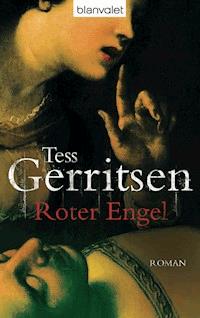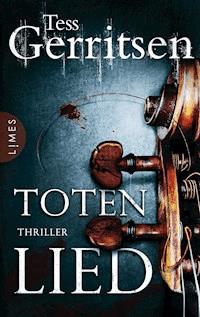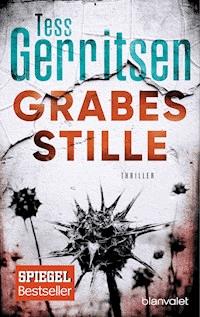
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
Boston, Chinatown. Eine Frau, hingerichtet mit einem Ritualschwert. Eine alte Legende, die zum Leben erwacht …
Jahraus, jahrein werden sie an den schrecklichen Tag erinnert, da in einem Restaurant in Chinatown ein Amokläufer ihre Angehörigen hinrichtete. Doch wer schreibt die Briefe, die besagen, dass der wahre Täter noch immer nicht gefasst sei? Erst als zwei Jahrzehnte später bei einer Stadtführung durch Boston die Leiche einer Frau gefunden wird, die mit einem chinesischen Ritualschwert verstümmelt wurde, wird der alte Fall wieder aufgerollt. Und nicht immer haben Jane Rizzoli und Maura Isles bei den Ermittlungen das Gefühl, es mit einem leibhaftigen Gegner aus Fleisch und Blut zu tun zu haben …
Verpassen Sie auch nicht »Spy Coast – Die Spionin« und »Die Sommergäste«, Tess Gerritsens brillante neue Thrillerreihe über eine Gruppe aus ehemaligen Spionen, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Tess Gerritsen
Grabesstille
Ein Rizzoli-&-Isles-Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Silent Girl« bei Ballantine Books, a division of Random House Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2011 by Tess GerritsenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2012 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenPublished by Arrangement with Tess Gerritsen Inc.Dieses Werk wurde im Auftrag von Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Covergestaltung: www.buerosued.deCovermotiv: Timothy Carroll/EyeEm/Getty Images
wr · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-07935-2V004www.blanvalet.de
Für Bill Haber und Janet Tamaro – weil Ihr an meine Mädchen geglaubt habt.
»Deine Aufgabe ist es«, sagte der Affe, »das Ungeheuer aus seinem Versteck zu locken. Aber du musst sicher sein, dass es ein Kampf ist, den du überleben kannst.«
Wu Cheng’en (ca. 1500 – 1582),Der rebellische Affe: Die Reise nach dem Westen
1
SAN FRANCISCO
Den ganzen Tag schon beobachte ich das Mädchen.
Sie lässt nicht erkennen, dass sie mich bemerkt hat, obwohl mein Mietwagen in Sichtweite der Straßenecke steht, an der sie und ihre Freunde sich an diesem Nachmittag versammelt haben, um zu tun, was gelangweilte Teenager eben so tun: die Zeit totschlagen. Sie wirkt jünger als die anderen, aber das liegt vielleicht daran, dass sie Asiatin ist und recht klein und zierlich für ihre siebzehn Jahre. Ihr schwarzes Haar trägt sie kurz geschnitten wie ein Junge, ihre Bluejeans ist zerrissen und ausgefranst. Kein Modegag, denke ich bei mir, sondern echte Gebrauchsspuren, eine Folge des harten Lebens auf der Straße. Sie zieht an einer Zigarette und bläst eine Rauchwolke in die Luft, mit der lässigen Pose eines Straßengangsters, die so gar nicht zu ihrem blassen Gesicht und ihren feinen chinesischen Gesichtszügen passt. Sie ist hübsch genug, um die gierigen Blicke zweier Männer anzuziehen, die an der Gruppe vorbeikommen. Das Mädchen registriert sie und starrt unerschrocken zurück, doch es ist leicht, furchtlos zu sein, wenn die Gefahr nur abstrakt ist. Wie, so frage ich mich, würde das Mädchen angesichts einer realen Gefahr reagieren? Würde sie sich nach Kräften wehren, oder würde sie klein beigeben? Ich will wissen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, aber noch habe ich keine Probe ihres Charakters gesehen.
Als der Abend hereinbricht, löst sich die Teenager-Versammlung an der Straßenecke allmählich auf. Einer nach dem anderen gehen sie ihrer Wege. In San Francisco sind die Nächte selbst im Sommer kühl, und die Verbliebenen drängen sich zusammen, in ihre Jacken und Sweatshirts gehüllt, und geben einander Feuer, kosten die flüchtige Wärme der Flamme aus. Aber schließlich vertreiben Hunger und Kälte auch die Letzten, und nur das Mädchen bleibt zurück – wohin sollte sie auch gehen? Sie winkt ihren Freunden nach und steht dann eine Weile allein herum, als ob sie auf jemanden wartet. Schließlich zuckt sie mit den Achseln und geht in meine Richtung davon, die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Als sie an meinem Wagen vorbeikommt, würdigt sie mich keines Blickes, starrt nur geradeaus, mit entschlossener, grimmiger Miene, als grübelte sie über irgendein Problem nach. Vielleicht überlegt sie, wo und wie sie sich heute ihr Abendessen organisieren soll. Oder vielleicht ist es auch etwas Schwerwiegenderes, was sie beschäftigt. Ihre Zukunft. Ihr Überleben.
Wahrscheinlich merkt sie gar nicht, dass die beiden Männer ihr folgen.
Sekunden nachdem sie an meinem Wagen vorbeigekommen ist, sehe ich die Männer aus einem Durchgang zwischen den Häusern treten. Ich erkenne sie wieder; es sind dieselben, die sie vorhin so angestarrt haben. Als sie sich an die Verfolgung machen und an meinem Wagen vorübereilen, sieht mich einer der Männer durch die Windschutzscheibe an. Es ist nur ein kurzer Blick, mit dem er einschätzen will, ob ich eine Bedrohung darstelle. Was er sieht, beunruhigt ihn nicht im Geringsten. Er und sein Begleiter gehen weiter, und jede ihrer Bewegungen strahlt die souveräne Selbstsicherheit des Jägers aus, der sich an eine schwächere, wehrlose Beute heranpirscht.
Ich steige aus und folge ihnen, so, wie sie dem Mädchen folgen.
Sie steuert eine Wohngegend an, wo allzu viele Gebäude leer stehen, wo die Gehsteige mit zerbrochenen Flaschen gepflastert scheinen. Das Mädchen lässt keine Furcht erkennen, kein Zögern; offenbar ist ihr die Umgebung vertraut. Sie schaut sich auch nicht um, und das verrät mir, dass sie entweder tollkühn ist oder keine Ahnung hat von der Welt und von dem, was diese Welt Mädchen wie ihr antun kann. Die Männer, die sie verfolgen, drehen sich auch nicht um. Und selbst wenn sie mich entdecken sollten, was ich zu verhindern weiß, würden sie nichts sehen, wovor sie sich fürchten müssten. So geht es allen.
Einen Block weiter wendet sich das Mädchen nach rechts und verschwindet in einem Hauseingang.
Ich ziehe mich in den Schatten zurück, um zu beobachten, was nun geschieht. Die beiden Männer bleiben vor dem Haus stehen und beraten sich kurz. Dann gehen sie ebenfalls hinein.
Vom Gehsteig aus blicke ich zu den mit Brettern vernagelten Fenstern auf. Es ist ein verlassenes Lagerhaus mit einem Schild, auf dem steht: ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN. Die Tür hängt schief in den Angeln. Ich schlüpfe hindurch, tauche ein in eine so tiefe Finsternis, dass ich einen Moment innehalten und mich auf meine anderen Sinne verlassen muss, um zu erspüren, was ich noch nicht sehen kann. Ich höre die Bodendielen knarren. Ich rieche heißes Kerzenwachs. Dann kann ich zur Linken eine Tür ausmachen, durch die ein schwacher Lichtschein dringt. Ich bleibe davor stehen und spähe durch den Türspalt ins Zimmer.
Das Mädchen kniet vor einem behelfsmäßigen Tisch; nur eine flackernde Kerze erhellt ihr Gesicht. Um sie herum entdecke ich Anzeichen dafür, dass jemand sich hier häuslich eingerichtet hat: einen Schlafsack, Konservendosen, einen kleinen Campingkocher. Sie kämpft gerade mit einem klobigen Dosenöffner und merkt nicht, dass die beiden Männer sich ihr von hinten nähern.
Ich hole eben Luft, um sie mit einem Ruf zu warnen, da wirbelt das Mädchen herum und stellt sich den Angreifern entgegen. In der Hand hält sie nur den Dosenöffner – eine bescheidene Waffe gegen zwei größere und kräftigere Angreifer.
»Das ist mein Zimmer«, sagt sie. »Raus hier!«
Ich hatte mich schon darauf gefasst gemacht einzugreifen. Stattdessen bleibe ich, wo ich bin, um zu sehen, wie es weitergeht. Um zu sehen, was in dem Mädchen steckt.
Einer der Männer lacht. »Wir kommen nur zu Besuch, Schätzchen.«
»Hab ich euch eingeladen?«
»Du siehst aus, als könntest du ein bisschen Gesellschaft gebrauchen.«
»Und du siehst aus, als könntest du eine Portion Hirn gebrauchen.«
Keine sehr kluge Bemerkung angesichts der Situation, denke ich. Jetzt ist die Begierde der Männer mit Zorn vermischt – eine gefährliche Kombination. Doch das Mädchen steht ganz ruhig da, mit nichts als diesem lächerlichen Küchenutensil in der Hand. Als die Männer sich auf sie stürzen, wippe ich schon auf den Fußballen, mache mich zum Sprung bereit.
Doch sie kommt mir zuvor. Ein Satz, und ihr Fuß kracht mit voller Wucht gegen das Brustbein des ersten Mannes. Kein sehr elegantes Manöver, aber wirkungsvoll. Der Mann taumelt und fasst sich an die Brust, als ob er keine Luft bekommt. Ehe der zweite Mann reagieren kann, schwingt sie bereits zu ihm herum und versetzt ihm mit dem Dosenöffner einen Schlag gegen die Schläfe. Er heult auf und weicht zurück.
Jetzt wird es wirklich interessant.
Der erste Mann hat sich gefangen und rennt auf sie zu, rammt sie mit solcher Wucht, dass beide der Länge nach zu Boden gehen. Sie traktiert ihn mit Tritten und Schlägen, und ihre Faust kracht gegen seinen Unterkiefer. Aber in seiner rasenden Wut spürt er die Schmerzen nicht; mit lautem Gebrüll wälzt er sich auf sie und drückt sie mit seinem Gewicht zu Boden.
Jetzt springt der zweite Mann wieder herbei. Er packt ihre Handgelenke und hält sie am Boden fest. Ihre Jugend und ihre Unerfahrenheit haben sie in eine fatale Lage gebracht, aus der zu entkommen schier unmöglich ist. Bei all ihrer ungestümen Energie ist sie doch naiv und untrainiert, und jeden Moment wird das Unvermeidliche passieren. Schon hat der erste Mann den Reißverschluss ihrer Jeans aufgezogen und zerrt ihr die Hose über die mageren Hüften. Deutlich zeichnet sich seine Erregung ab. Nie ist ein Mann so verwundbar.
Er hört mich nicht kommen. Gerade nestelt er noch an seinem Reißverschluss herum, im nächsten Moment liegt er schon mit zerschmettertem Kiefer am Boden und spuckt Blut und ausgeschlagene Zähne.
Der zweite Mann schafft es gerade noch, die Hände des Mädchens loszulassen und aufzuspringen, aber er ist nicht schnell genug. Ich bin ein Tiger, und er ist nichts als ein schwerfälliger, stumpfsinniger Büffel, hilflos meinem Schlag ausgeliefert. Mit einem schrillen Schrei stürzt er zu Boden, und nach dem unnatürlichen Winkel zu urteilen, in dem sein Arm abgeknickt ist, muss der Knochen glatt gebrochen sein.
Ich packe das Mädchen und hole es mit einem Ruck auf die Füße. »Bist du unverletzt?«
Sie zieht den Reißverschluss ihrer Jeans hoch und starrt mich an. »Wer zum Teufel sind Sie denn?«
»Das erklär ich dir später. Jetzt komm weg hier!«, blaffe ich sie an.
»Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie die beiden so schnell überwältigt?«
»Willst du es lernen?«
»Ja!«
Ich betrachte die zwei Männer, die sich stöhnend zu unseren Füßen winden. »Dann merk dir die erste Lektion: Du musst wissen, wann es Zeit ist zu fliehen.« Ich schiebe sie in Richtung Tür. »In diesem Fall wäre das genau jetzt.«
Ich sehe ihr beim Essen zu. So schmächtig sie ist, hat sie doch den Appetit einer Wölfin; sie verschlingt drei Hähnchen-Tacos und einen großen Teller Bohnenpüree und spült alles mit einem Glas Cola hinunter. Sie hat sich mexikanisches Essen gewünscht, und so sitzen wir nun in diesem Restaurant, wo Mariachi-Musik läuft und die Wände mit grellbunten Gemälden von tanzenden Señoritas geschmückt sind. Trotz ihrer chinesischen Gesichtszüge ist das Mädchen durch und durch amerikanisch, von ihrem kurz geschorenen Haar bis hin zu ihrer zerfetzten Jeans. Ein wildes, unverbildetes Geschöpf, das den letzten Rest aus dem Colaglas schlürft, um dann geräuschvoll auf den Eiswürfeln herumzukauen.
Mir kommen leise Zweifel am Sinn meines Unterfangens. Sie ist schon zu alt, um die Lehren aufzunehmen; zu verwildert, um Disziplin zu lernen. Ich sollte sie wieder auf die Straße zurückkehren lassen, wenn sie meint, dass sie dorthin gehört, und eine andere Möglichkeit finden. Aber dann fällt mein Blick auf die Narben an ihren Fingerknöcheln, und ich erinnere mich, wie sie um ein Haar im Alleingang die beiden Männer überwältigt hätte. Sie besitzt rohes Talent, und sie ist furchtlos – zwei Dinge, die man niemandem beibringen kann.
»Erinnerst du dich an mich?«, frage ich.
Das Mädchen stellt sein Glas ab und runzelt die Stirn. Ganz kurz glaube ich, einen Funken des Wiedererkennens aufblitzen zu sehen, doch dann ist er wieder verschwunden. Sie schüttelt den Kopf.
»Es ist lange her«, sage ich. »Zwölf Jahre.« Eine Ewigkeit für ein so junges Mädchen. »Du warst noch klein.«
Sie zuckt mit den Achseln. »Kein Wunder, dass ich mich nicht an Sie erinnere.« Sie greift in ihre Jackentasche, zieht eine Zigarette heraus und macht Anstalten, sie anzuzünden.
»Du vergiftest deinen Körper.«
»Es ist mein Körper«, gibt sie zurück.
»Nicht, wenn du trainieren willst.« Ich beuge mich über den Tisch und schnappe ihr die Zigarette aus dem Mund. »Wenn du lernen willst, muss deine Einstellung sich ändern. Du musst Respekt zeigen.«
Sie schnaubt. »Sie klingen wie meine Mutter.«
»Ich habe deine Mutter gekannt. In Boston.«
»Tja, aber sie ist tot.«
»Ich weiß. Letzten Monat habe ich einen Brief von ihr bekommen. Sie schrieb mir, sie sei krank und habe nur noch sehr wenig Zeit. Deswegen bin ich hier.«
Ich bin verblüfft, als ich in den Augen des Mädchens Tränen schimmern sehe, und sie wendet sich rasch ab, als sei es ihr peinlich, Schwäche zu zeigen. Aber in diesem Moment der Verletzlichkeit, ehe sie die Augen niederschlägt, ruft sie mir meine eigene Tochter ins Gedächtnis, die jünger war als dieses Mädchen, als ich sie verlor. Tränen brennen in meinen Augen, aber ich versuche nicht, sie zu verbergen. Der Kummer hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Er war das läuternde Feuer, das meine Entschlossenheit geschärft und meinen Willen gestählt hat.
Ich brauche dieses Mädchen. Und offensichtlich braucht sie mich ebenso.
»Ich habe dich wochenlang gesucht«, sage ich.
»Bei der Pflegefamilie hat’s mir gestunken. Ich komm viel besser allein klar.«
»Wenn deine Mutter dich jetzt sehen könnte, würde es ihr das Herz brechen.«
»Sie hatte nie Zeit für mich.«
»Vielleicht, weil sie in zwei Jobs schuften musste, damit du genug zu essen hattest? Weil sie wusste, dass sie ganz auf sich allein gestellt war?«
»Sie hat sich von allen immer rumschubsen lassen. Ich hab’s nicht ein Mal erlebt, dass sie sich gegen irgendwen durchgesetzt hätte. Nicht mal gegen mich.«
»Sie hatte Angst.«
»Sie hatte kein Rückgrat.«
Ich beuge mich vor, erfüllt von plötzlicher Wut auf dieses undankbare Gör. »Was deine arme Mutter gelitten hat, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Alles, was sie getan hat, hat sie nur für dich getan.« Angewidert werfe ich ihr die Zigarette zurück. Das ist nicht das Mädchen, das ich zu finden gehofft hatte. Sie mag stark und furchtlos sein, aber kein Gefühl der Kindespflicht bindet sie an ihre toten Eltern, kein Sinn für Familienehre. Ohne eine Beziehung zu unseren Ahnen sind wir nur verlorene Staubkörnchen, die haltlos im Wind treiben, an nichts und niemanden gebunden.
Ich bezahle ihr Essen und stehe auf. »Ich hoffe, dass du eines Tages zur Einsicht gelangen und verstehen wirst, was deine Mutter für dich geopfert hat.«
»Sie wollen gehen?«
»Es gibt nichts, was ich dir beibringen könnte.«
»Wie kommen Sie eigentlich darauf, mir etwas beibringen zu wollen? Wieso haben Sie mich überhaupt gesucht?«
»Ich dachte, ich würde jemand anderen vorfinden. Jemanden, den ich lehren könnte. Jemanden, der mir helfen würde.«
»Wobei helfen?«
Ich weiß nicht, wie ich ihre Frage beantworten soll. Einen Moment lang ist das einzige Geräusch die blecherne Mariachi-Musik, die aus den Lautsprechern des Restaurants tönt.
»Erinnerst du dich an deinen Vater?«, frage ich. »Erinnerst du dich daran, was mit ihm passiert ist?«
Sie starrt mich an. »Darum geht es also, nicht wahr? Deswegen haben Sie mich gesucht? Weil meine Mutter Ihnen von ihm geschrieben hat.«
»Dein Vater war ein guter Mann. Er hat dich geliebt, und du entehrst ihn. Du entehrst deine Eltern.« Ich lege ein Bündel Geldscheine vor sie auf den Tisch. »Das hier ist zu ihrem Gedächtnis. Sieh zu, dass du von der Straße wegkommst, und geh wieder zur Schule. Da musst du dich wenigstens nicht gegen fremde Männer zur Wehr setzen.« Ich drehe mich um und verlasse das Restaurant.
Sekunden später stürzt sie zur Tür hinaus und läuft mir nach. »Warten Sie!«, ruft sie. »Wohin gehen Sie?«
»Zurück nach Hause, nach Boston.«
»Ich erinnere mich doch an Sie. Ich glaube, ich weiß, was Sie wollen.«
Ich bleibe stehen und sehe sie an. »Es ist dasselbe, was auch du wollen müsstest.«
»Was muss ich tun?«
Ich mustere sie von Kopf bis Fuß, und ich sehe magere Schultern, sehe Hüften, so schmal, dass die Bluejeans kaum Halt findet. »Es geht nicht darum, was du tun musst«, antworte ich. »Es geht darum, was du sein musst.« Langsam gehe ich auf sie zu. Bis zu diesem Moment hat sie keinen Grund gesehen, mich zu fürchten. Warum auch? Ich bin nur eine Frau. Aber jetzt sieht sie etwas in meinen Augen, und es lässt sie einen Schritt zurückweichen.
»Hast du Angst?«, frage ich sie leise.
Ihr Kinn ruckt in die Höhe, und sie entgegnet mit gespielter Tapferkeit: »Nein.«
»Das solltest du aber.«
2
Sieben Jahre später
»Mein Name ist Dr. Maura Isles – ich buchstabiere: I–S–L–E–S. Ich bin Ärztin und Rechtsmedizinerin und arbeite am Rechtsmedizinischen Institut des Staates Massachusetts.«
»Bitte beschreiben Sie dem Gericht Ihre Ausbildung und Berufserfahrung, Dr. Isles«, forderte die Staatsanwältin von Suffolk County, Carmela Aguilar, Maura auf.
Maura hielt den Blick auf die Staatsanwältin gerichtet, während sie die Frage beantwortete. Es war wesentlich angenehmer, sich auf Aguilars neutrale Miene zu konzentrieren, als die hasserfüllten Blicke des Angeklagten und seiner Unterstützer zu ertragen, von denen Dutzende sich im Gerichtssaal versammelt hatten. Aguilar schien gar nicht zu registrieren, dass sie den Fall vor einem feindseligen Publikum verhandelte – oder es war ihr gleichgültig. Doch Maura spürte es nur zu deutlich. Ein großer Teil der Zuhörer waren Polizisten und deren Freunde, und was Maura zu sagen hatte, würde ihnen ganz und gar nicht gefallen.
Der Angeklagte war Wayne Brian Graff vom Boston Police Department, und mit seinem kantigen Unterkiefer und den breiten Schultern sah er aus wie das Idealbild des amerikanischen Helden. Die Sympathien im Saal lagen bei Graff, nicht beim Opfer – einem Mann, der vor sechs Monaten übel zugerichtet und mit gebrochenen Knochen auf Mauras Obduktionstisch gelandet war. Einem Mann, um den niemand getrauert hatte, dem niemand das letzte Geleit gegeben hatte. Ein Mann, der zwei Stunden vor seinem Tod die unverzeihliche Sünde begangen hatte, einen tödlichen Schuss auf einen Polizeibeamten abzufeuern.
Maura spürte die Blicke der Zuschauer, die sich wie glühend heiße Laserstrahlen in ihr Gesicht brannten, als sie ihren Werdegang schilderte.
»Ich habe an der Stanford University ein Studium der Anthropologie mit dem BA abgeschlossen«, sagte sie. »Anschließend absolvierte ich ein Medizinstudium an der University of California in San Francisco, gefolgt von einer fünfjährigen Facharztausbildung in Pathologie und Rechtsmedizin am gleichen Institut. Ich besitze Zulassungen in beiden Fachgebieten. Nach meiner Assistenzzeit absolvierte ich noch eine zweijährige Spezialausbildung in Rechtsmedizin an der University of California in Los Angeles.«
»Sie haben also die Kammerprüfung in Ihrem Spezialgebiet abgelegt?«
»Ja, Ma’am. Sowohl in Allgemeiner Pathologie als auch in Rechtsmedizin.«
»Und wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie Ihre Stelle hier in der Bostoner Rechtsmedizin antraten?«
»Ich war sieben Jahre lang am Rechtsmedizinischen Institut von San Francisco in Kalifornien beschäftigt. Zudem war ich in dieser Zeit als Dozentin an der University of California tätig. Ich bin sowohl in Massachusetts als auch in Kalifornien als Ärztin zugelassen.« Es waren mehr Angaben, als von ihr verlangt worden waren, und sie sah, wie Aguilar die Stirn runzelte, weil Maura ihre vorgefertigte Fragenliste durcheinandergebracht hatte. Maura hatte diese Informationen schon so oft vor Gericht heruntergebetet, dass sie ganz genau wusste, wonach man sie fragen würde, und ihre Antworten kamen ebenso automatisch. Wo sie studiert hatte, welche Anforderungen ihre Arbeit stellte und ob sie qualifiziert war, in diesem speziellen Fall als Zeugin auszusagen.
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, kam Aguilar endlich auf die Einzelheiten zu sprechen. »Haben Sie im vergangenen Oktober eine Obduktion am Leichnam eines gewissen Fabian Dixon vorgenommen?«
»Ja«, antwortete Maura. Eine knappe, sachliche Antwort, und dennoch spürte sie sofort, wie die Spannung im Saal anstieg.
»Erzählen Sie uns, wie es dazu kam, dass Mr. Dixon ein Fall für die Rechtsmedizin wurde.« Aguilar sah Maura dabei fest in die Augen, als wollte sie sagen: Ignorieren Sie alle anderen im Saal. Schauen Sie nur mich an, und legen Sie die Fakten dar.
Maura straffte die Schultern und begann zu sprechen, laut genug, um im ganzen Saal verstanden zu werden. »Der Verstorbene war ein vierundzwanzigjähriger Mann, der bewusstlos auf dem Rücksitz eines Streifenwagens des Boston Police Department aufgefunden worden war, und zwar rund zwanzig Minuten nach seiner Festnahme. Er wurde in die Notaufnahme des Massachusetts General Hospital gebracht, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte.«
»Und das machte ihn zu einem Fall für die Rechtsmedizin?«
»Ja, das ist richtig. Er wurde dann in die Leichenhalle unseres Instituts gebracht.«
»Schildern Sie bitte dem Gericht Ihren ersten Eindruck von Mr. Dixons Leiche.«
Maura registrierte sehr wohl, dass Aguilar den Toten beim Namen nannte, anstatt nur von der Leiche oder dem Verstorbenen zu sprechen. Auf diese Weise erinnerte sie das Gericht daran, dass das Opfer eine Identität hatte. Einen Namen, ein Gesicht und eine Biografie.
Maura antwortete in gleicher Weise. »Bei Mr. Dixon handelte es sich um einen gut genährten Mann von durchschnittlicher Größe und durchschnittlichem Gewicht, der nur mit einer Baumwollunterhose und Socken bekleidet war, als er in unser Institut eingeliefert wurde. Seine übrige Kleidung war zuvor im Zuge der Wiederbelebungsmaßnahmen in der Notaufnahme entfernt worden. An seiner Brust waren noch die EKG-Elektroden befestigt, und in seinem linken Arm steckte ein Infusionskatheter …« Sie hielt inne. Jetzt wurde es unangenehm. Obwohl sie es vermied, die Zuschauer und den Angeklagten anzuschauen, wusste sie, dass alle Augen auf sie gerichtet waren.
»Und der Zustand seiner Leiche, könnten Sie uns den auch schildern?«, half Aguilar nach.
»Die Brust, die linke Körperseite und der Oberbauch wiesen zahlreiche Blutergüsse auf. Beide Augen waren zugeschwollen, und an Lippen und Kopfhaut waren Riss- und Platzwunden zu erkennen. Die beiden oberen Schneidezähne fehlten.«
»Einspruch.« Der Anwalt des Angeklagten stand auf. »Niemand kann sagen, wann er diese Zähne verloren hatte. Das könnte schon vor Jahren passiert sein.«
»Ein Zahn war auf den Röntgenaufnahmen zu erkennen. In seinem Magen«, sagte Maura.
»Die Zeugin sollte auf Kommentare verzichten, bis ich über den Einspruch befunden habe«, warf der Richter in strengem Ton ein. »Einspruch abgewiesen! Mrs. Aguilar, fahren Sie fort.«
Die Staatsanwältin nickte, und ihre Lippen verzogen sich zu einem angedeuteten Lächeln, als sie sich wieder Maura zuwandte. »Mr. Dixons Leiche wies also schwere Prellungen und Platzwunden auf, und mindestens einer seiner Zähne war ihm vor Kurzem ausgeschlagen worden.«
»Ja«, antwortete Maura. »Das werden Sie auf den Aufnahmen aus dem Leichenschauhaus sehen können.«
»Wenn das Gericht einverstanden ist, würden wir diese Aufnahmen nun gerne zeigen«, sagte Aguilar. »Ich möchte die Zuschauer jedoch vorwarnen: Die Bilder sind kein angenehmer Anblick. Wenn irgendjemand von den Anwesenden sie lieber nicht sehen möchte, würde ich vorschlagen, dass Sie jetzt den Saal verlassen.« Sie hielt inne und sah sich um.
Niemand folgte der Empfehlung.
Als das erste Dia von Fabian Dixons lädiertem Körper auf der Leinwand erschien, schnappten mehrere Anwesende hörbar nach Luft. Maura hatte bei ihrer Schilderung von Dixons Blutergüssen eher untertrieben, da sie wusste, dass die Aufnahmen die Geschichte besser erzählen würden, als sie selbst es konnte. Einem Foto konnte niemand Parteinahme oder Verfälschung der Wahrheit vorwerfen. Und die Wahrheit, die ihnen aus diesem Dia entgegenstarrte, war für alle offensichtlich: Fabian Dixon war brutal zusammengeschlagen worden, ehe man ihn auf den Rücksitz eines Streifenwagens gesetzt hatte.
Weitere Dias erschienen auf der Leinwand, während Maura schilderte, was die Obduktion ergeben hatte. Mehrere gebrochene Rippen. Ein verschluckter Zahn im Magen. Eingeatmetes Blut in der Lunge. Und die Todesursache: ein Milzriss, der zu einer massiven Blutung in die Bauchhöhle geführt hatte.
»Und was können Sie zur Todesart sagen, Dr. Isles?«, fragte Aguilar.
Das war die entscheidende Frage, vor der sie sich die ganze Zeit gefürchtet hatte – denn sie wusste, welche Konsequenzen ihre Antwort haben würde.
»Es liegt ein Tötungsdelikt vor«, sagte Maura. Es war nicht ihre Aufgabe, den Schuldigen zu benennen. Sie beschränkte sich auf diese sachliche Feststellung, doch sie konnte nicht umhin, Wayne Graff dabei mit einem Blick zu streifen. Der beschuldigte Polizeibeamte saß regungslos da, seine Miene so undurchdringlich wie eine steinerne Maske. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte er der Stadt Boston in vorbildlicher Weise gedient. Ein Dutzend Leumundszeugen hatten sich bereit erklärt, vor Gericht auszusagen, wie Officer Graff ihnen unerschrocken zu Hilfe gekommen sei. Er sei ein Held, sagten sie, und Maura glaubte ihnen.
Doch am Abend des 31. Oktober, dem Abend, an dem Fabian Dixon einen Polizeibeamten ermordete, hatten Wayne Graff und sein Partner sich in Racheengel verwandelt. Sie hatten den Täter festgenommen, und zum Zeitpunkt seines Todes war er in ihrem Gewahrsam gewesen. Der Festgenommene war erregt und gewalttätig, als ob er unter dem Einfluss von PCP oder Kokain stünde, hatten sie in ihrer Aussage geschrieben. Sie schilderten Dixons ungewöhnlich heftigen Widerstand, seine schier übermenschlichen Kräfte. Nur mit vereinten Bemühungen war es den beiden Beamten gelungen, den Gefangenen in den Streifenwagen zu schaffen. Um ihn zu überwältigen, war Gewaltanwendung erforderlich, doch er schien keine Schmerzen zu spüren. Während dieses Kampfs gab er tierische Grunzlaute von sich und versuchte, sich die Kleider vom Leib zu reißen, obwohl die Temperaturen an diesem Abend nur um fünf Grad über null lagen. Damit hatten sie – fast schon zu präzise – den bekannten Erregungszustand eines Patienten im Kokaindelirium beschrieben, durch das schon andere vom Drogenmissbrauch verwirrte Gefangene zu Tode gekommen waren.
Monate später jedoch zeigte der Toxikologiebericht, dass Dixon lediglich Alkohol im Blut gehabt hatte. Damit stand für Maura zweifelsfrei fest, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Und einer der Täter saß nun am Tisch der Verteidigung und starrte Maura an.
»Ich habe keine weiteren Fragen«, sagte Aguilar. Sie setzte sich, und ihre zufriedene Miene ließ erkennen, dass sie überzeugt war, die besseren Argumente auf ihrer Seite zu haben.
Nun erhob sich Morris Whaley, der Anwalt der Verteidigung, zum Kreuzverhör, und Maura spürte, wie ihre Muskeln sich anspannten. Whaley machte einen durchaus freundlichen Eindruck, als er auf den Zeugenstand zuging, als ob er nur einen netten Plausch halten wollte. Wären sie sich bei einer Cocktailparty begegnet, dann hätte Maura die Gesellschaft dieses attraktiven Mannes in seinem schicken Anzug vielleicht sogar als angenehm empfunden.
»Ich denke, wir sind alle beeindruckt von Ihren Qualifikationen, Dr. Isles«, sagte er. »Ich werde also die Zeit des Gerichts nicht noch länger in Anspruch nehmen, indem ich Ihre akademischen Erfolge unter die Lupe nehme.«
Sie erwiderte nichts, starrte nur in sein lächelndes Gesicht und fragte sich, aus welcher Richtung der Angriff wohl kommen würde.
»Gewiss wird niemand hier in diesem Saal bezweifeln, dass Sie sehr hart gearbeitet haben, um dorthin zu gelangen, wo Sie heute sind«, fuhr Whaley fort. »Insbesondere in Anbetracht gewisser Schwierigkeiten, mit denen Sie in den vergangenen Monaten in Ihrem Privatleben zu kämpfen hatten.«
»Einspruch.« Aguilar seufzte entnervt und stand auf. »Das tut nichts zur Sache.«
»Das tut es sehr wohl, Euer Ehren. Es betrifft die Einschätzung des Sachverhalts durch die Zeugin.«
»Inwiefern?«, fragte der Richter nach.
»Erlebnisse in der Vergangenheit können die Interpretation des Beweismaterials durch einen Zeugen beeinflussen.«
»Von welchen Erlebnissen sprechen Sie?«
»Wenn Sie gestatten, dass ich den Sachverhalt darlege, wird das sehr bald offensichtlich werden.«
Der Richter sah Whaley streng an. »Ich gestatte vorläufig eine Befragung in dieser Richtung. Aber nur vorläufig.«
Mit finsterer Miene nahm Aguilar wieder Platz.
Whaley wandte seine Aufmerksamkeit wieder Maura zu. »Dr. Isles, erinnern Sie sich vielleicht noch, an welchem Tag Sie den Verstorbenen untersuchten?«
Maura antwortete nicht sofort, aus der Fassung gebracht durch den plötzlichen Schwenk zurück zum Thema der Obduktion. Dabei war ihr nicht entgangen, dass Whaley es vermieden hatte, den Namen des Opfers auszusprechen.
»Sie sprechen von Mr. Dixon?«, erwiderte sie, und sie sah die Verärgerung in seinen Augen.
»Ja.«
»Das Datum der Obduktion war der erste November des vergangenen Jahres.«
»Und haben Sie an diesem Tag die Todesursache ermittelt?«
»Ja. Wie ich bereits sagte, starb er an massiven inneren Blutungen infolge eines Milzrisses.«
»Und haben Sie am gleichen Tag auch die Todesart festgestellt?«
Sie zögerte. »Nein. Jedenfalls nicht endgültig …«
»Warum nicht?«
Sie schöpfte Atem, wohl wissend, dass alle Augen im Saal auf ihr ruhten. »Ich wollte die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung abwarten. Um festzustellen, ob Mr. Dixon tatsächlich unter dem Einfluss von Kokain oder anderen Drogen stand. Ich wollte nicht vorschnell urteilen.«
»Was ja wohl das Mindeste ist, angesichts der Tatsache, dass Ihr Urteil die Karriere, wenn nicht gar das Leben zweier engagierter und loyaler Gesetzeshüter zerstören könnte.«
»Ich befasse mich ausschließlich mit den Tatsachen, Mr. Whaley, wo immer sie auch hinführen mögen.«
Die Antwort gefiel ihm nicht; sie erkannte es am Zucken seiner Kiefermuskeln. Aller Anschein von Freundlichkeit war wie weggefegt – aus dem Plausch war ein erbitterter Kampf geworden.
»Sie haben die Obduktion also am ersten November durchgeführt?«, sagte er.
»Ja.«
»Was ist danach passiert?«
»Ich weiß nicht genau, was Sie meinen.«
»Haben Sie sich das Wochenende freigenommen? Haben Sie in der Woche darauf noch weitere Obduktionen vorgenommen?«
Sie starrte ihn an, und ein bohrendes Angstgefühl machte sich in ihrer Magengrube breit. Sie wusste nicht, worauf er mit der Frage hinauswollte, doch die Richtung, die das Ganze nahm, gefiel ihr nicht. »Ich habe an einem rechtsmedizinischen Kongress teilgenommen«, sagte sie.
»In Wyoming, wenn ich mich nicht irre.«
»Ja.«
»Wo Sie ein einigermaßen traumatisches Erlebnis hatten. Sie wurden von einem korrupten Polizeibeamten angegriffen.«
Sofort sprang Aguilar auf. »Einspruch! Gehört nicht zur Sache!«
»Einspruch abgewiesen«, sagte der Richter.
Whaley lächelte. Jetzt war der Weg frei für seine Fragen, vor denen Maura sich so fürchtete. »Ist das korrekt, Dr. Isles? Wurden Sie von einem Polizeibeamten angegriffen?«
»Ja«, flüsterte sie.
»Entschuldigen Sie, das habe ich nicht verstanden.«
»Ja«, wiederholte sie lauter.
»Und wie haben Sie den Angriff überlebt?«
Es war totenstill im Saal; alles wartete gespannt auf ihre Geschichte. Eine Geschichte, die sie am liebsten ganz aus ihrem Gedächtnis gelöscht hätte, denn sie verfolgte sie immer noch in ihren Albträumen. Sie erinnerte sich an Wyoming, an diese einsame Bergkuppe. Sie erinnerte sich an das Geräusch, mit dem die Autotür des Deputys ins Schloss gefallen war und sie eingeschlossen hatte, dort auf dem Rücksitz hinter dem Sicherheitsgitter. Sie erinnerte sich an ihre Panik, als sie mit den Fäusten gegen die Scheibe getrommelt hatte, in dem vergeblichen Versuch, einem Mann zu entkommen, von dem sie wusste, dass er sie umbringen wollte.
»Dr. Isles, wie haben Sie überlebt? Wer ist Ihnen zu Hilfe gekommen?«
Sie schluckte. »Ein Junge.«
»Julian Perkins, sechzehn Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin. Ein junger Mann, der diesen Polizeibeamten mit einem Schuss tödlich verletzte.«
»Er hatte keine Wahl!«
Whaley legte den Kopf schief. »Sie verteidigen einen Jungen, der einen Polizisten getötet hat?«
»Einen kriminellen Polizisten!«
»Und dann kehrten Sie nach Boston zurück. Und befanden im Fall von Mr. Dixons Tod auf ein Tötungsdelikt.«
»Weil es eines war.«
»Oder war es lediglich ein tragischer Unfall? Die unvermeidliche Konsequenz, nachdem ein gewalttätiger Gefangener sich zur Wehr gesetzt hatte und überwältigt werden musste?«
»Sie haben die Aufnahmen der Leiche gesehen. Die Polizei hat weit mehr Gewalt angewendet, als erforderlich gewesen wäre.«
»Genau wie dieser Junge in Wyoming, Julian Perkins. Er hat einen Deputy erschossen. Betrachten Sie das als angemessene Gewaltanwendung?«
»Einspruch«, sagte Aguilar. »Dr. Isles ist hier nicht die Angeklagte.«
Whaley feuerte ungerührt die nächste Frage ab, ohne den Blick von Maura zu wenden. »Was ist in Wyoming passiert, Dr. Isles? Hatten Sie vielleicht eine Erleuchtung, während Sie um Ihr Leben kämpften? Eine plötzliche Erkenntnis, dass die Polizei der Feind ist?«
»Einspruch!«
»Oder ist die Polizei schon immer der Feind gewesen? Gewisse Mitglieder Ihrer Familie scheinen so zu denken.«
Der Hammer krachte auf den Tisch. »Mr. Whaley, Sie kommen jetzt sofort zu mir an den Richtertisch.«
Maura saß geschockt da, während Staatsanwältin und Verteidiger sich mit dem Richter berieten. So weit war es jetzt also gekommen, dass ihre Familie in die Sache hineingezogen wurde. Wahrscheinlich gab es in ganz Boston keinen Cop, der nicht von Mauras Mutter Amalthea gehört hatte, die im Frauengefängnis Framingham eine lebenslange Haftstrafe verbüßte. Das Ungeheuer, das mir das Leben geschenkt hat, dachte sie. Jeder, der mich ansieht, muss sich fragen, ob dieses Böse nicht auch mein Blut vergiftet hat. Sie sah, wie der Angeklagte, Officer Graff, sie anstarrte. Sie erwiderte seinen Blick, und sie sah ein Lächeln um seine Lippen spielen. Das hast du dir selbst eingebrockt, las sie in seinen Augen. Das passiert, wenn du deine Freunde und Helfer verrätst.
»Die Sitzung ist unterbrochen«, verkündete der Richter. »Bitte finden Sie sich heute Nachmittag um zwei Uhr wieder ein.«
Während die Geschworenen den Saal verließen, sank Maura kraftlos gegen die Stuhllehne. Sie merkte nicht, dass Aguilar plötzlich neben ihr stand.
»Das war ein ganz mieser Trick«, sagte Aguilar. »Das hätte der Richter nie zulassen dürfen.«
»Er hat sich total auf mich eingeschossen.«
»Tja, er hat eben nichts anderes in der Hand. Denn die Fotos aus dem Leichenschauhaus sind einfach verdammt überzeugend.« Aguilar sah sie durchdringend an. »Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich über Sie wissen sollte, Dr. Isles?«
»Außer der Tatsache, dass meine Mutter eine verurteilte Mörderin ist und ich zum Spaß kleine Kätzchen quäle?«
»Das finde ich nicht witzig.«
»Wie Sie vorhin schon sagten: Ich stehe hier schließlich nicht vor Gericht.«
»Nein, aber sie werden versuchen, Sie in den Mittelpunkt zu stellen. Es wird darum gehen, ob Sie Polizisten hassen. Ob Sie heimliche Motive haben. Wir könnten diesen Fall verlieren, wenn die Geschworenen Zweifel an Ihrer Aufrichtigkeit haben. Also sagen Sie mir, ob es noch irgendetwas gibt, was die Gegenseite aufs Tapet bringen könnte. Irgendwelche Geheimnisse, die Sie mir gegenüber nicht erwähnt haben.«
Maura dachte an die unangenehmen Details ihres Privatlebens, die sie lieber für sich behielt. Die verbotene Affäre, die sie vor Kurzem beendet hatte. Die Vorgeschichte von Gewalt in ihrer Familie. »Jeder Mensch hat Geheimnisse«, sagte sie. »Meine tun nichts zur Sache.«
»Das wollen wir doch sehr hoffen«, sagte Aguilar.
3
Wo man auch hinschaute in Bostons Chinatown, überall waren Geister. Sie spukten im ruhigen Tai Tung Village ebenso wie in der bunten, belebten Beach Street, sie schwebten über der Ping On Street und huschten durch die dunklen Häuserschluchten am Oxford Place. Geister bevölkerten jeden Winkel in diesem Viertel. Das war es jedenfalls, was der Reiseführer Billy Foo den Touristen erzählte, und er hielt eisern an seiner Geschichte fest. Ob er selbst an Geister glaubte, spielte im Grunde keine Rolle; sein Job war es, die Leute davon zu überzeugen, dass die Seelen der Verstorbenen in diesen Straßen spukten. Die Menschen wollten an Geister glauben – und deshalb waren auch so viele bereit, fünfzehn Dollar pro Nase springen zu lassen, damit sie fröstelnd an der Ecke Beach und Oxford Street stehen und Billys blutrünstigen Mordgeschichten lauschen konnten. Heute hatte sich die ominöse Zahl von dreizehn Teilnehmern zum spätabendlichen Chinatown-Geisterspaziergang eingefunden, darunter ein verzogenes zehnjähriges Zwillingspaar, das schon vor drei Stunden ins Bett gehört hätte. Aber wenn du das Geld brauchst, weist du keinen zahlenden Gast ab, auch keine nervigen kleinen Jungs. Billy hatte einen Abschluss von der Schauspielschule und keinerlei Aussichten auf einen Job, und heute Abend konnte er die hübsche Summe von hundertfünfundneunzig Dollar einstreichen, plus Trinkgeld. Nicht schlecht für zwei Stunden Geschichtenerzählen – allerdings durfte man sich nicht zu schade sein, sich mit einem Mandarin-Gewand aus Satin und einem falschen Zopf als Bilderbuchchinese zu verkleiden.
Billy räusperte sich und hob die Arme – während der sechs Semester Schauspielunterricht hatte er gelernt, wie man die Aufmerksamkeit des Publikums gewinnt. »Wir schreiben das Jahr 1907! Es ist der zweite August, ein warmer Freitagabend.« Seine volltönende, unheilschwangere Stimme erhob sich über den störenden Verkehrslärm. Wie der Sensenmann persönlich, der sein nächstes Opfer erspäht hat, deutete er über die Straße. »Dort, an einem Platz, der als Oxford Place bekannt ist, schlägt das Herz des Bostoner Chinesenviertels. Kommen Sie nun mit mir, und lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in eine Zeit, da es in diesen Straßen von Einwanderern wimmelte. Da die schwüle Nachtluft erfüllt war vom Geruch verschwitzter Körper und dem Duft fremdländischer Gewürze. Versetzen wir uns zurück in eine Nacht, als Mord in der Luft lag!« Mit einer dramatischen Geste bedeutete er der Gruppe, ihm zum Oxford Place zu folgen, wo sich alle dichter um ihn drängten, um nur ja nichts zu verpassen. Er blickte in ihre gespannten Gesichter und dachte: Jetzt ist die Zeit, sie zu verzaubern, sie in meinen Bann zu ziehen, wie es nur ein guter Schauspieler vermag. Er breitete die Arme aus, und die Ärmel seines Mandarin-Gewands flatterten wie seidene Schwingen, als er Luft holte, um zu beginnen.
»Maaaa-miii!«, heulte einer der Rotzbengel. »Er tritt mich!«
»Hör auf damit, Michael!«, zischte die Mutter seinen Bruder an. »Aber auf der Stelle!«
»Ich hab doch gar nichts gemacht!«
»Du ärgerst deinen Bruder.«
»Aber bloß, weil er mich ärgert.«
»Wollt ihr vielleicht beide zurück ins Hotel? Wollt ihr das?«
Lieber Gott, lass sie bitte in ihr Hotel zurückgehen, dachte Billy. Doch die beiden Jungen standen nur da mit verschränkten Armen, gifteten sich mit Blicken an und dachten nicht daran, sich von Billys Vortrag in Bann ziehen zu lassen.
»Wie ich bereits sagte …«, fuhr Billy fort. Doch die Unterbrechung hatte ihn aus dem Konzept gebracht, und er konnte fast das Pffft! hören, mit dem die dramatische Spannung entwich wie die Luft aus einem angestochenen Reifen. Er biss die Zähne zusammen und fuhr fort.
»Es war eine schwüle Nacht im August. Auf diesem Platz saß eine Gruppe von Chinesen beisammen, die sich nach einem langen Arbeitstag in ihren Wäschereien und Lebensmittelläden ausruhten.« Es waren Klischees, die er hier zum Besten gab, aber sosehr es ihm zuwider war, er musste sie einsetzen, um eine Zeit heraufzubeschwören, in der die Presse regelmäßig über »verschlagene, finstere Orientalen« berichtet hatte und in der selbst das renommierte Time Magazine sich ungeniert ausgelassen hatte über »arglistig grinsende Gesichter, so gelb wie das Papier von Telegrammformularen«. Eine Zeit, in der Billy Foo als Amerikaner chinesischer Abstammung ausschließlich Arbeit als Wäscher, Koch oder Hilfsarbeiter hätte finden können.
»Hier auf diesem Platz«, fuhr Billy fort, »kommt es an diesem Abend zu einer Schlacht. Einer Schlacht zwischen zwei rivalisierenden Chinesenclans, den On Leongs und den Hip Sings. Einer Schlacht, die diesen Platz in ein Meer von Blut verwandeln sollte …
Irgendjemand zündet einen Feuerwerkskörper. Plötzlich hallen Schüsse durch die Nacht! Dutzende von Chinesen fliehen in Panik! Doch manche laufen nicht schnell genug, und als die Gewehre verstummen, liegen fünf Männer tot oder sterbend auf dem Schauplatz. Sie sind nur die jüngsten Opfer der blutigen und berüchtigten Tong-Kriege …«
»Mami, können wir jetzt gehen?«
»Psst! Du sollst dem Mann zuhören.«
»Aber der ist so laaangweilig.«
Billy hielt inne. Es zuckte ihm in den Fingern, den kleinen Rotzbengel zu würgen, doch er warf ihm nur einen vernichtenden Blick zu. Der Junge zuckte mit den Schultern, nicht im Geringsten beeindruckt.
»In nebligen Nächten wie dieser«, stieß Billy mürrisch hervor, »kann man bisweilen in der Ferne das Knallen jener Feuerwerkskörper hören. Man kann schemenhafte Gestalten sehen, die in Todesangst vorbeieilen, für immer auf der Flucht vor den Kugeln, die in jener Nacht flogen!« Billy drehte sich um und schwenkte einen Arm. »Und nun folgen Sie mir über die Beach Street. Zu einem weiteren Ort, an dem Geister hausen.«
»Mami. Mami!«
Billy ignorierte die kleine Nervensäge und führte die Gruppe über die Straße. Immer schön lächeln, immer schön weiterreden. Denk an das Trinkgeld! Nur noch eine Stunde musste er sich zusammenreißen. Zuerst würden sie zur Knapp Street gehen, der nächsten Station der Führung. Dann weiter zur Tyler Street und dem Spielsalon, wo 1991 bei einem Massaker fünf Männer ums Leben gekommen waren. In Chinatown gab es keinen Mangel an Mordschauplätzen.
Er führte die Gruppe die Knapp Street entlang. Es war nur eine schmale Gasse, schlecht beleuchtet und wenig befahren. Kaum hatten sie die Lichter und den Verkehr auf der Beach Street hinter sich gelassen, als die Temperatur schlagartig zu fallen schien. Fröstelnd hüllte Billy sich enger in sein Mandarin-Gewand. Er hatte dieses verstörende Phänomen schon früher bemerkt, jedes Mal, wenn er diesen Abschnitt der Knapp Street passierte. Selbst an warmen Sommerabenden fror er hier stets, als ob die Kälte sich vor langer Zeit in dieser Gasse festgesetzt hätte. Seine Gruppe schien es ebenfalls zu bemerken – er hörte, wie die Reißverschlüsse von Jacken hochgezogen, sah, wie Handschuhe aus Taschen geholt wurden. Schweigen legte sich über die Gruppe, und ihre Schritte hallten von den hohen Hauswänden zu beiden Seiten wider. Selbst die zwei Rotzbengel waren still, als ob sie spürten, dass hier die Luft anders war. Dass irgendetwas hier lauerte – etwas, das alles Lachen und Scherzen erstickte.
Billy blieb vor dem verlassenen Gebäude stehen. Vor dem Eingang war ein verschlossenes Eisentor angebracht, und die Erdgeschossfenster waren mit Gitterstäben gesichert. Eine verrostete Feuertreppe führte bis zum zweiten und dritten Stock empor, wo alle Fenster dicht vernagelt waren, wie um zu verhindern, dass etwas ausbrach, das sich in diesen Räumen verbarg. Die Gruppe drängte sich dichter zusammen, als wollten sie der Kälte entfliehen. Oder war es etwas anderes, das sie in dieser engen Häuserschlucht spürten, etwas, das sie zu einem engen Kreis zusammenrücken ließ, als suchten sie Schutz vor einer unbekannten Gefahr?
»Willkommen am Schauplatz eines der grausigsten Verbrechen, die sich je in Chinatown ereignet haben«, sagte Billy. »Das Schild an dem Gebäude ist längst nicht mehr vorhanden, aber vor neunzehn Jahren befand sich hinter diesen vergitterten Fenstern ein kleines chinesisches Fischrestaurant, das Red Phoenix. Es war ein bescheidenes Lokal mit nur acht Tischen, aber bekannt für seine frischen Meeresfrüchte. Es war zu später Stunde am dreißigsten März, ein feuchter und kühler Abend. Ein Abend wie dieser, an dem die sonst so belebten Straßen von Chinatown merkwürdig still waren. Im Red Phoenix waren nur zwei Angestellte bei der Arbeit: der Kellner, Jimmy Fang, und der Koch, ein illegaler Einwanderer aus China namens Wu Weimin. Drei Gäste kamen an diesem Abend zum Essen – und es sollte ihr letzter Abend werden. Denn in der Küche bahnte sich eine Katastrophe an. Wir werden nie erfahren, warum der Koch die Nerven verlor und ausrastete. Vielleicht waren es die langen, anstrengenden Arbeitstage. Oder der Kummer, als Fremder in einem fernen Land leben zu müssen.«
Billy machte eine Pause und senkte dann die Stimme zu einem schaurigen Flüstern. »Oder vielleicht war es eine fremde, unbekannte Macht, die von ihm Besitz ergriff, ein Dämon, von dem er besessen war. Ein böser Geist, der ihn zur Waffe greifen ließ. Der ihn in das Lokal stürmen ließ. Ein böser Geist, der immer noch hier in dieser dunklen Straße lauert. Wir wissen nur, dass der Koch seine Waffe anlegte und …«
Billy brach ab.
»Und was?«, fragte eine ängstliche Stimme nach.
Doch Billy war abgelenkt, sein Blick ging zum Dach hinauf – er hätte schwören können, dass sich dort soeben etwas bewegt hatte. Nur ein dunkler Schemen vor dem Hintergrund des dunklen Himmels, wie die Schwingen eines riesigen Vogels. Er spähte angestrengt nach oben, um einen weiteren Blick zu erhaschen, doch jetzt konnte er nur noch die Umrisse der Feuertreppe dicht an der Hauswand ausmachen.
»Und was ist dann passiert?«, wollte einer der Rotzbengel wissen.
Billy sah in die dreizehn Gesichter, die ihn erwartungsvoll anstarrten, und versuchte, sich zu erinnern, wo er gerade gewesen war. Aber er war noch immer ganz durcheinander vom Anblick dieses flatternden Etwas am Himmel. Plötzlich wollte er nur noch so schnell wie möglich aus dieser dunklen Gasse verschwinden, möglichst weit weg von diesem Haus. Er musste seine ganze Willenskraft aufbringen, um nicht zur Beach Street zurückzulaufen. Zum Licht. Schließlich holte er tief Luft und platzte heraus: »Der Koch hat sie erschossen. Er hat sie alle erschossen. Und dann hat er sich selbst getötet.«
Mit diesen Worten machte Billy kehrt und winkte der Gruppe, ihm rasch zu folgen, führte sie fort von diesem verfluchten Gebäude mit seinen Geistern und seinen Echos des Grauens. Die Harrison Avenue befand sich einen Block weiter, und sie lockte mit Lichtern und Menschen und Wärme. Ein Ort für die Lebenden, nicht für die Toten. Er ging so schnell, dass seine Gruppe zurückfiel, doch er wurde das Gefühl der Bedrohung nicht los, das sich wie eine Schlinge um sie zusammenzuziehen schien. Ein Gefühl, dass jemand sie beobachtete. Ihn beobachtete.
Der schrille Schrei einer Frau ließ ihn mit pochendem Herzen herumfahren. Gleich darauf brach die Gruppe plötzlich in schallendes Gelächter aus, und einer der Männer sagte: »Hm, nicht übel, dieses Requisit! Benutzen Sie das immer bei Ihren Führungen?«
»Was?«, fragte Billy.
»Haben uns echt einen tierischen Schrecken eingejagt! Das Ding sieht verdammt echt aus.«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
Der Mann deutete auf den Gegenstand, den er für einen Teil der Show hielt. »He, Junge, zeig ihm, was du gefunden hast.«
»Die hat da drüben gelegen, neben der Mülltonne«, sagte einer der Rotzbengel und hielt sein Fundstück hoch. »Uääh. Die fühlt sich auch ganz echt an. Voll krass!«
Billy trat ein paar Schritte näher und musste plötzlich feststellen, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte. Er blieb wie angewurzelt stehen und starrte das Ding an, das der Junge in der Hand hielt. Er sah schwarze Tropfen herabrinnen und die Jacke des Jungen besudeln, doch der Kleine schien es nicht zu bemerken.
Es war die Mutter des Jungen, die als Erste aufschrie. Dann begriffen auch die anderen und wichen entsetzt zurück. Der Junge aber stand nur verdutzt da und hielt seinen Fund hoch, von dem das Blut unaufhörlich auf seinen Ärmel tropfte.
4
»Ich habe erst letzten Samstag dort gegessen«, sagte Detective Barry Frost, während sie in Richtung Chinatown fuhren. »Ich war mit Liz in der Ballettvorstellung im Wang Theater. Sie steht total auf Ballett, aber ich kann damit nichts anfangen, ehrlich. Bin mittendrin eingeschlafen. Danach sind wir noch zum Essen ins Ocean City Restaurant gegangen.«
Es war zwei Uhr morgens – viel zu früh, um schon so verdammt gesprächig drauf zu sein, doch Detective Jane Rizzoli ließ ihren Partner weiter über sein jüngstes Date plaudern und konzentrierte sich aufs Fahren. Das grelle Licht der Straßenlaternen schmerzte in ihren müden Augen, und jedes Scheinwerferpaar, das ihnen entgegenkam, war ein Angriff auf ihre Netzhaut. Vor einer Stunde hatte sie noch an der Seite ihres Mannes im warmen Bett gelegen; jetzt versuchte sie, den Schlaf abzuschütteln, während sie den Wagen durch die nächtlichen Straßen steuerte. Unerklärlicherweise war der Verkehr plötzlich so dicht geworden, dass sie kaum vorankamen, und das um eine Zeit, wo jeder vernünftige Mensch längst schlafen sollte.
»Hast du schon mal da gegessen?«, fragte Frost.
»Hm?«
»Im Ocean City. Liz hat diese fantastischen Muscheln mit Knoblauch und schwarzer Bohnenpaste bestellt. Ich krieg jetzt noch Hunger, wenn ich daran denke. Kann es kaum erwarten, noch mal hinzugehen.«
»Wer ist Liz?«, fragte Jane.
»Ich hab dir doch letzte Woche von ihr erzählt. Wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt.«
»Ich dachte, deine neue Freundin heißt Muffy.«
»Maggie.« Er zuckte mit den Achseln. »Das hat nicht funktioniert.«
»Genauso wenig wie mit der davor. Wie immer sie hieß.«
»He, ich versuche immer noch rauszufinden, was ich eigentlich von einer Frau will, verstehst du? Es ist schließlich eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt auf der Suche war. Mann, ich hatte ja keine Ahnung, wie viele Mädels in dieser Stadt solo sind.«
»Frauen.«
Er seufzte. »Jaja. Das hat Alice mir auch immer wieder eingebläut. Heutzutage muss man Frauen sagen.«
Jane bremste an einer roten Ampel und sah ihn von der Seite an. »Redet ihr wieder öfter miteinander, du und Alice?«
»Worüber sollten wir denn reden?«
»Na, über zehn Jahre Ehe vielleicht.«
Er starrte mit leerem Blick aus dem Fenster. »Es gibt nichts mehr zu sagen. Für sie ist die Sache abgeschlossen.«
Aber nicht für Frost, dachte Jane. Vor acht Monaten war Alice, seine Frau, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Seitdem musste Jane sich mit schöner Regelmäßigkeit Frosts Liebesabenteuer anhören, in die er sich immer wieder mit Begeisterung stürzte und die immer wieder unglücklich endeten. Da war die üppige Blondine, die ihm erzählt hatte, sie trage keine Unterwäsche. Die beängstigend athletische Bibliothekarin mit ihrer zerlesenen Ausgabe des Kamasutra. Die Quäkerin mit den rosigen Wangen, die ihn unter den Tisch trank. Er erzählte all diese Geschichten mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und Staunen, doch mehr als alles andere war es Traurigkeit, was sie in diesen Tagen in seinen Augen sah. Dabei war er keineswegs eine schlechte Partie – schlank und durchtrainiert, dazu gut aussehend auf eine etwas glatte, farblose Art. Es war also nicht einzusehen, warum er solche Schwierigkeiten hatte, eine passende Frau zu finden.
Aber er trauert immer noch Alice nach.
Sie bogen in die Beach Street ein und näherten sich dem Herzen von Chinatown, als das flackernde Blaulicht eines Streifenwagens des Boston PD sie blendete. Jane hielt hinter dem Wagen an, und sie stiegen aus. Eine unangenehm feuchte und kühle Frühlingsnacht empfing sie. Trotz der nächtlichen Stunde hatten sich einige Schaulustige auf dem Gehsteig versammelt, und Jane hörte sowohl chinesisches als auch englisches Stimmengemurmel. Zweifellos stellten sie alle die ewig gleiche Frage: Weiß irgendjemand, was hier passiert ist?
Zusammen mit Frost ging sie die Knapp Street entlang und schlüpfte unter dem Absperrband hindurch, hinter dem ein Streifenpolizist postiert war. »Detective Rizzoli und Detective Frost, Morddezernat«, meldete sie.
»Sie liegt da drüben«, entgegnete der Officer kurz angebunden. Er deutete die Gasse hinunter auf einen Müllcontainer, an dem ein zweiter Polizist Wache hielt.
Als sie näher traten, erkannte Jane, dass es nicht der Container war, den der Cop bewachte, sondern etwas, das davor auf dem Gehsteig lag. Sie blieb abrupt stehen und starrte auf eine abgetrennte rechte Hand.
»Hoppla«, sagte Frost.
Der Cop lachte. »Genauso hab ich auch reagiert.«
»Wer hat sie gefunden?«
»Die Teilnehmer einer Führung – ›Chinatown-Geisterspaziergang‹ nennt sich das Ganze. Ein Junge aus der Gruppe hat die Hand aufgehoben, weil er sie für eine Attrappe hielt. Sie war so frisch, dass sie noch blutete. Als er merkte, dass sie echt war, ließ er sie sofort fallen, und seitdem hat niemand sie angerührt. Die haben wohl kaum damit gerechnet, bei ihrer Geistertour so was zu finden.«
»Wo sind diese Touristen jetzt?«
»Sie waren alle fix und fertig; haben darauf bestanden, in ihre Hotels zurückzugehen, aber ich habe mir Namen und Kontaktdaten geben lassen. Der Reiseführer ist ein junger Chinese hier aus dem Viertel; er sagt, Sie können ihn jederzeit gerne sprechen. Niemand hat außer der Hand irgendetwas gesehen. Die Leute haben die Notrufzentrale angerufen, und dort glaubten sie zuerst an einen schlechten Scherz. Wir konnten nicht sofort herkommen, weil wir uns erst noch mit ein paar Krawallbrüdern drüben in Charlestown rumschlagen mussten.«
Jane ging in die Hocke und leuchtete die Hand mit ihrer Taschenlampe an. Es war eine verblüffend saubere Amputation, die Schnittfläche mit getrocknetem Blut verkrustet. Es schien sich um die Hand einer Frau zu handeln, mit blassen, schlanken Fingern und verstörend elegant manikürten Nägeln. Kein Ring, keine Uhr. »Und sie hat einfach da auf dem Boden gelegen?«
»Ja. Wundert mich, dass noch keine Ratten dran waren, die riechen doch frisches Fleisch zehn Meter gegen den Wind.«
»Ich sehe keine Bissspuren. Kann noch nicht lange hier liegen.«
»Ach, übrigens, ich hab noch was anderes entdeckt.« Der Polizist richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf einen mattgrauen Gegenstand, der ein paar Meter entfernt lag.
Frost besah ihn sich aus der Nähe. »Das ist eine Heckler & Koch. Nicht billig«, sagte er. Er blickte sich zu Jane um. »Mit Schalldämpfer.«
»Hat einer der Touristen die Waffe angefasst?«, fragte Jane.
»Niemand hat die Waffe angefasst«, antwortete der Officer. »Sie haben sie gar nicht gesehen.«
»Wir haben also eine Automatikpistole mit Schalldämpfer und eine frisch abgetrennte rechte Hand«, meinte Jane. »Was wollen wir wetten, dass beide zusammengehören?«
»Das ist wirklich ein Prachtstück«, sagte Frost, der noch immer die Pistole bewunderte. »Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so etwas einfach wegwirft.«
Jane richtete sich auf und betrachtete den Müllcontainer. »Haben Sie da drin nach dem Rest der Leiche gesucht?«
»Nein, Ma’am. Ich dachte mir, eine abgetrennte Hand reicht allemal aus, um gleich die Kollegen vom Morddezernat zu alarmieren. Wollte ja nicht den Tatort kontaminieren, ehe Sie hier sind.«
Jane zog ein Paar Handschuhe aus der Tasche. Während sie sie überstreifte, schlug ihr Herz immer heftiger in banger Erwartung dessen, was sie finden würden. Gemeinsam hoben sie und Frost den Deckel an, und sofort schlug ihnen der Gestank von verdorbenen Meeresfrüchten entgegen. Sie kämpfte gegen die Übelkeit an, als sie den Blick über zerdrückte Pappkartons und einen prallvollen schwarzen Müllsack schweifen ließ. Sie und Frost tauschten einen Blick.
»Ich lass dir gern den Vortritt«, sagte er.
Sie griff in den Container, zerrte an dem Sack und wusste sofort, dass er keine Leiche enthielt. Er war nicht schwer genug. Sie rümpfte die Nase über den Gestank, während sie den Sack aufknotete und hineinschaute. Alles, was sie sah, waren Garnelen- und Krebsschalen.
Sie wichen beide zurück, und der Deckel des Containers fiel mit einem donnernden Krachen zu.
»Niemand zu Hause?«, fragte der Officer.
»Nicht da drin.« Jane sah auf die abgetrennte Hand hinunter. »Also, wo ist der Rest von ihr?«
»Vielleicht verteilt irgendjemand Leichenteile in der ganzen Stadt.«
Der Polizist lachte. »Oder vielleicht hat eins von diesen Chinarestaurants sie gekocht und zu einem leckeren Ragout verarbeitet.«
Jane sah Frost an. »Ein Glück, dass du Muscheln bestellt hast.«
»Wir haben die Umgebung schon abgesucht«, erklärte der Streifenpolizist. »Gefunden haben wir nichts.«
»Okay, aber ich finde, wir sollten trotzdem selber eine Runde um den Block machen«, meinte Jane.
Zusammen mit Frost ging sie langsam die Knapp Street entlang. Die Strahlen ihrer Taschenlampen durchschnitten die Dunkelheit, und in ihrem Schein sahen sie zerbrochene Flaschen, Papierfetzen und Zigarettenkippen. Keine Leichenteile. Die Fenster der Häuser, die links und rechts emporragten, waren dunkel, doch sie hatte das Gefühl, dass sie aus den unbeleuchteten Zimmern beobachtet, jeder ihrer Schritte in dieser menschenleeren Gasse verfolgt wurde. Sie würden die Strecke bei Tageslicht noch einmal abgehen müssen, aber es kam ihr darauf an, keine Spuren zu übersehen, die am nächsten Tag nicht mehr vorhanden oder verändert sein könnten. Und so ging sie mit Frost bis zum Ende der Straße, wo ein weiteres Polizeiband den Zugang von der Harrison Avenue absperrte. Hier gab es breite Gehsteige, Straßenbeleuchtung und Verkehr. Dennoch setzten Jane und Frost ihre Patrouille um den Block gewissenhaft fort, von der Harrison Avenue in die Beach Street, den Blick immer vor sich auf den Boden geheftet. Als sie den Rundgang abgeschlossen hatten und wieder an dem Müllcontainer ankamen, sahen sie, dass inzwischen die Spurensicherung eingetroffen war.
»Ich nehme an, Sie haben den Rest von ihr auch nicht finden können«, begrüßte der Streifenpolizist Jane und Frost.
Jane sah zu, wie die Waffe und die abgetrennte Hand in Beweismittelbeutel gepackt wurden, und sie fragte sich, wieso ein Mörder die Hand des Opfers so offen an dieser Stelle ablegte, wo sie mit Sicherheit früher oder später entdeckt würde. War der Täter in Eile gewesen? Oder hatte er gewollt, dass die Hand gefunden wurde – als eine Art Botschaft? Dann hob sie den Blick zu der Feuertreppe, die an der zur Gasse gewandten Rückseite des vierstöckigen Gebäudes hinaufführte.
»Wir müssen auf dem Dach nachsehen«, sagte sie.
Doch das unterste Leiterstück war eingerostet, und es gelang ihnen nicht, es herunterzuziehen. Also mussten sie auf dem normalen Weg zum Dach hinaufsteigen, durch das Treppenhaus. Sie verließen die enge Gasse und gingen zur Beach Street zurück, wo die Vordereingänge der Gebäude lagen. Im Erdgeschoss waren Geschäfte untergebracht: ein Chinarestaurant, eine Bäckerei und ein Asia-Markt – alle zu dieser nächtlichen Stunde geschlossen. Darüber lagen Wohnungen. Jane spähte nach oben und sah, dass die Fenster in den oberen Stockwerken alle dunkel waren.
»Wir werden jemanden wecken müssen, der uns hereinlässt«, sagte Frost.
Jane trat auf eine Gruppe Chinesen zu, die sich auf der Straße versammelt hatten, um den nächtlichen Einsatz zu beobachten. »Kennen Sie irgendwelche Mieter in diesem Haus?«, fragte sie. »Wir müssen da rein.«
Die Männer starrten sie nur verständnislos an.
»Dieses Haus«, wiederholte sie und zeigte darauf. »Wir müssen rauf aufs Dach.«
»Du, ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn du lauter redest«, meinte Frost. »Die verstehen kein Englisch.«
Jane seufzte. Stimmt, wir sind ja in Chinatown. »Wir brauchen einen Dolmetscher.«
»Beim District A-1 haben sie einen neuen Detective. Ich glaube, er ist chinesischer Abstammung.«
»Wir können nicht auf ihn warten, das dauert zu lange.« Sie stieg die Stufen zum Eingang hinauf, überflog die Namen auf der Klingelleiste und drückte aufs Geratewohl einen Knopf. Auch auf mehrfaches Klingeln kam keine Antwort. Sie probierte es bei einer anderen Wohnung, und diesmal knackte es in der Gegensprechanlage.
»Wei?«, ertönte eine weibliche Stimme.
»Hier ist die Polizei«, sagte Jane. »Können Sie uns bitte ins Haus lassen?«
»Wei?«
»Bitte machen Sie die Tür auf!«
Ein paar Minuten vergingen, dann war eine Kinderstimme zu vernehmen: »Meine Großmutter will wissen, wer Sie sind.«
»Detective Jane Rizzoli, Boston PD«, antwortete Jane. »Wir müssen rauf aufs Dach. Könntest du uns ins Haus lassen?«
Endlich ertönte der Summer, und sie traten ein.
Das Haus war mindestens hundert Jahre alt, und die Holzstufen ächzten, als Jane und Frost die Treppe hinaufstiegen. Als sie im ersten Stock anlangten, flog eine Tür auf, und Jane erhaschte einen Blick in eine enge Wohnung, aus der zwei kleine Mädchen sie neugierig anstarrten. Die jüngere war ungefähr so alt wie Janes Tochter Regina, und Jane hielt kurz inne, um ihr ein Lächeln zu schenken und »Hallo« zu murmeln.
Sofort wurde das kleinere Mädchen von einer Frau auf den Arm gehoben, und die Tür fiel mit einem Knall ins Schloss.
»Ich fürchte, Fremde sind hier nicht allzu willkommen«, bemerkte Frost.
Sie stiegen weiter. Vom dritten Obergeschoss führte eine schmale Treppe zum Dach hinauf. Die Außentür war nicht verschlossen, doch sie gab ein durchdringendes Kreischen von sich, als sie sie aufstießen.
Sie traten hinaus in die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Morgengrauen, erhellt nur vom diffusen Schein der Lichter der Stadt. Jane leuchtete mit ihrer Taschenlampe und sah einen Plastiktisch mit Stühlen, daneben Töpfe mit Kräutern. Eine Wäscheleine war schwer mit Laken behängt, die wie Gespenster im Wind tanzten. Und durch die flatternde Bettwäsche hindurch erspähte sie noch etwas anderes – etwas Dunkles, Unförmiges, das nahe der Dachkante lag.
Ohne ein Wort zu wechseln, zogen Jane und Frost automatisch Papierüberzieher aus ihren Taschen und bückten sich, um sie sich über die Schuhe zu streifen. Dann erst duckten sie sich unter den Laken hindurch und gingen weiter zur Kante. Ihre Überschuhe knisterten auf dem Untergrund aus Teerpappe.
Im ersten Moment sagte keiner etwas. Sie standen Seite an Seite, die Taschenlampen auf eine Lache von getrocknetem Blut gerichtet. Und auf das, was in der Lache lag.
»Ich schätze, wir haben den Rest von ihr gefunden«, sagte Frost.
5
Chinatown lag mitten im Herzen von Boston, begrenzt vom Finanzdistrikt im Norden und dem grünen Rasen des Common im Westen. Doch als Maura durch das Paifang-Tor mit den vier geschnitzten Löwen schritt, hatte sie das Gefühl, in eine völlig andere Stadt einzutauchen, in eine andere Welt. Zuletzt hatte sie Chinatown an einem Samstagmorgen im Oktober besucht. Damals hatte eine Gruppe von alten Männern mit ihren Spielbrettern unter dem Tor gesessen, Dame gespielt, Tee geschlürft und sich auf Chinesisch unterhalten. An jenem kalten Tag hatte sie sich hier mit Daniel zu einem Dim-Sum-Frühstück getroffen. Es sollte eine ihrer letzten gemeinsamen Mahlzeiten sein, und die Erinnerung daran traf sie jetzt wie ein Messerstich ins Herz. Jetzt war es Frühling, es versprach ein heiterer Tag zu werden, und die gleichen Männer saßen in der kühlen Morgenluft, spielten und plauderten: Doch die Melancholie verdüsterte alles, was sie sah, und verwandelte Sonnenschein in Finsternis.
Sie ging vorbei an Restaurants mit Aquarien, in denen es von silbrigen Fischen wimmelte, an staubigen Importläden, vollgestopft mit Palisandermöbeln, Jadearmbändern und Schnitzereien aus Elfenbeinimitat, bis sie schließlich auf eine immer dichter werdende Ansammlung von Schaulustigen stieß. Sie entdeckte einen uniformierten Beamten des Boston PD, der die überwiegend aus Chinesen bestehende Menge überragte, und arbeitete sich zu ihm vor.
»Entschuldigen Sie bitte, ich bin die Rechtsmedizinerin«, rief sie.
Der kühle Blick, mit dem der Polizist sie musterte, ließ keinen Zweifel daran, dass er genau wusste, wer sie war. Dr. Maura Isles, die Verräterin. Die Frau, die gegen einen der ihren ausgesagt hatte; gegen ein Mitglied der Bruderschaft, deren Aufgabe es war, zu dienen und zu schützen. Ihretwegen würde der Mann vielleicht im Gefängnis landen. Der Polizist sagte kein Wort, sondern starrte sie nur an, als hätte er keine Ahnung, was sie von ihm wollte.
Sie erwiderte den Blick mit ebensolcher Kälte. »Wo ist die Leiche?«, fragte sie.
»Da müssen Sie Detective Rizzoli fragen.«
Er war offenbar entschlossen, es ihr nicht zu leicht zu machen. »Und wo ist sie?«
Bevor er antworten konnte, hörte sie jemanden rufen: »Dr. Isles?« Ein junger, asiatisch aussehender Mann in Anzug und Krawatte kam über die Straße auf sie zu. »Sie warten oben auf dem Dach auf Sie.«
»Welcher Eingang ist es?«
»Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach oben.«
»Sind Sie neu beim Morddezernat? Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet.«