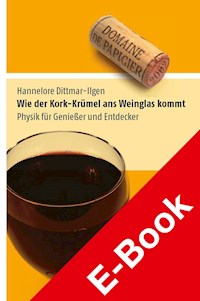3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie kommen diese grazilen Spitzen zustande und warum spucken in der Schüssel Fische herum? Ich hoffe, ich kann Euch diese Fragen beantworten, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Betrachter meiner Fotos durch den Kopf gegangen sind. Und noch mehr: Ich möchte Euch neben einigen Erklärungen auch die wissenschaftlichen, speziell die physikalischen, Hintergründe aufzeigen, die dem erstaunlichen Foto zugrunde liegen. Folgt mir bei meiner "Fotoexkursion", für die Ihr keine Formeln und auch nur wenig Vorwissen benötigt. Und greift ab und zu mal zu Experimentiermaterial und probiert das eine oder andere aus. Denn hier ist nichts profimäßig inszeniert, auch meine Fotos nicht. Nahezu alles kann mit wenig Material und Geschick nachvollzogen werden. Viel Vergnügen wünscht die Physikhexe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Grazile Spitzen, spuckende Fische und verrückte Kreisel
75 erstaunliche Phänomene
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenEine ganz besondere Fotoexkursion
Wie kommen diese grazilen Spitzen zustande und warum spucken in der Schüssel Fische herum? Ich hoffe, ich kann Euch diese Fragen beantworten, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Betrachter meiner Fotos, die oft zufällig entstanden sind, durch den Kopf gegangen sind. Und noch mehr: Ich möchte Euch neben einigen Erklärungen auch die wissenschaftlichen, speziell die physikalischen, Hintergründe erläutern, die dem erstaunlichen Foto zugrunde liegen.
Folgt mir bei meiner "Fotoexkusion", für die Ihr keine Formeln und auch nur wenig Vorwissen benötigt. Und greift ab und zu mal zu Experimentiermaterial und probiert das eine oder andere aus. Denn hier ist nichts profimäßig inszeniert oder gar mit Photoshop zurecht gemacht, auch meine Fotos nicht. Ich bin einfach Ideen, spontanten Einfällen und oft auch Momentaufnahmen gefolgt. Ihr müsst das Buch übrigens nicht von vorne bis hinten lesen, denn die einzelnen Kapitel hängen nicht voneinander ab. Schlagt einfach irgendwo auf und fangt Sie an. Oder Ihr lasst Euch von einem meiner Fotos "verführen".
Viel Vergnügen wünscht die Physikhexe
Noch schnell eine Bemerkung, sozusagen das Kleingedruckte: Alle "Fotos" habe ich selbst gemacht und das Hintergrundwissen sorgfältig recherchiert und aufgeschrieben. Aber auch mir unterläuft einmal ein Fehler. Zudem kenne ich natürlich Eure heimischen Verhältnisse beim Experimentieren nicht. Daher kann ich keine Haftung übernehmen – oft genügt jedoch gesunder Menschenverstand, um einen „Patzer“ zu erkennen.
Grazile Spitzen bilden sich aus
Abb. 1: Wie kommt nur dieses Spitzenmuster zustande?
Die bräunliche Flüssigkeit in diesem Glasschälchen ist wirklich überraschend, denn in einem (starken) Magnetfeld kann sie zauberhafte Spitzen ausbilden. Dabei handelt sich um eine magnetische Flüssigkeit – kurz auch Ferrofluid genannt. Für ihre erstaunlichen Fähigkeiten sorgen winzige suspendierte Magnetteilchen.
Die Idee, den an Festkörper gebundenen Magnetismus zu verflüssigen, ist übrigens schon sehr alt. Eine erste Überlieferung geht auf das Jahr 1779 zurück, in dem ein gewisser Gowan Knight versuchte, eine stabile Suspension aus Eisenfeilspänen und Wasser herzustellen. Allerdings hatte er mit seinen Experimenten wenig Erfolg – die magnetischen Teilchen ballten sich untrennbar aneinander. Als Geburtsstätte heutiger magnetischer Flüssigkeiten gilt die NASA (die auch ein Patent hat). Im Jahr 1962 entwickelte dort Stephen Pawell das erste stabile Ferrofluid als Dichtungsmöglichkeit für Treibstoffpumpen. Es bestand aus Kerosin, in dem fein verteilte Partikel aus Magnetit (einem Eisenoxid, auch Magneteisenstein genannt) schwebten. Damit die Teilchen nicht verklumpen oder aus der Suspension ausfallen konnten, fügte Papell Ölsäure hinzu. Die langen Moleküle dieser organischen Säure kleiden die Magnetitteilchen im wahrsten Sinne des Wortes in einem molekularen Käfig oder Mantel ein. Diese Schicht wirkt wie ein elastisches Kissen und hält die Magnetteilchen auf Abstand.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Verfahren, Ferrofluide herzustellen. Bei allen müssen die beiden Probleme, nämlich dass sich die ferromagnetischen Teilchen in der Flüssigkeit möglichst gleichmäßig verteilen und nicht zusammenballen, gelöst werden. Die Kleinheit der magnetischen Teilchen sorgt quasi von selbst dafür, dass diese in der Trägerflüssigkeit schweben – denkt an kleinste Trubstoffe in Wasser, die nicht absinken können, weil sie ständig von Wassermolekülen herumgestoßen werden. Und eine oberflächenaktive Substanz hüllt mit ihren Molekülen die Teilchen ein, sodass sie nicht miteinander reagieren können. Daher verfügen Ferrofluide immer über mindestens drei Komponenten: magnetische Mikrokristalle oder Nanoteilchen, eine oberflächenaktive Substanz als Stabilisator und eine Trägerflüssigkeit. Bei der Trägerflüssigkeit haben wir eine große Auswahl, beispielsweise Wasser oder Kohlenwasserstoffe bzw. Öle, so dass sich prinzipiell jede Flüssigkeit in ein Ferrofluid verwandeln lassen kann.
Die besonderen Eigenschaften der magnetischen Flüssigkeit werden allerdings nur in Gegenwart von Magnetfeldern sichtbar. Das Ferrofluid, mit dem ich experimentiert habe, war ein Geschenk von meinem Sohn; man kann es in kleinen Glasflaschen kaufen. Die Flüssigkeit enthält sehr kleine Teilchen aus ferromagnetischem Material, in der Regel sind dies Magnetit-Teilchen mit einer Größe von nur ca. 10 Nanometer (0,00001 mm). Als Chemiker hat mein Sohn einige Milliliter der Flüssigkeit in eine abgeschmolzene (also jetzt fest verschlossene) Glasampulle abgefüllt. Mit ihr lässt sich schön zeigen, wie die magnetische Anziehung der Schwerkraft in Foto Nr. 2 trotzt. Eindrucksvoller ist es, wenn wir einen Draht durch die Flüssigkeit schieben und durch diesen einen kleinen Strom fließen lassen. Allerdings hat mich das "Herumschmieren" mit dem Ferrofluid von diesem Versuch abgehalten.
Abb. 2: Magnetische Flüssigkeiten haben Bergsteigerqualitäten
Als nächstes können wir das Ferrofluid in eine flache Schale gießen und auf einen Permanentmagneten stellen. Für diesen Versuch habe ich einen zylinderförmigen Supermagneten benutzt, auf dem ich das Schälchen kurzerhand platziert habe. Das Ergebnis seht Ihr in Foto 3. Solche Magnete bestehen aus Neodym, das stärkste bekannte Material für Permanentmagnete. Dieser Magnetwerkstoff ist eine Legierung aus Neodym, Eisen und Bor (NdFeB). In meinem Fall floss das zunächst im Schälchen ausgebreitete Ferrofluid zu einem äußeren Ring zusammen – hier befindet sich augenscheinlich der Bereich der größten Feldstärke.
Abb. 3: Das Ferrofluid sammelt sich an den Stellen größter Magnetfeldstärke
Aber wie entsteht das bizarre Gebirge aus dem ersten Foto? Für diesen Versuch habe ich das Schälchen auf einige Zuckerstückchen als Abstandshalter zu dem starken Supermagneten gestellt. Tatsächlich ist noch nicht abschließend geklärt, wie die erstaunlichen Spitzenmuster entstehen, die man in gewöhnlichen Flüssigkeiten noch nie beobachtet hat. Aber es gibt Hinweise. Die regelmäßig verteilten Flüssigkeitskegelchen stellen einen Gleichgewichtszustand zwischen Oberflächenkräften, Erdanziehungskraft und magnetischen Kräften dar. Ist der Abstand zum Supermagneten nämlich größer, so kommen auch Kräfte in der Flüssigkeit ins Spiel, die zum Beispiel für die Tropfenbildung verantwortlich sind. Nähern wir das Schälchen dem Magneten, so ist zu beobachten, dass an einem gewissen Punkt die Oberfläche des Ferrofluids plötzlich aufbricht und sich die Stacheln bilden. Dabei unterdrücken diejenigen Spitzen, die zufällig etwas schneller wachsen als andere ihre Nachbarn und dehnen sich auf deren Kosten aus. Alles ist – abhängig vom Abstand und kleinen Instabilitäten am Anfang – fein austariert. Das Muster ist stabil, bildet sich jedoch in leicht veränderter Form erneut, wenn wir das Schälchen hochnehmen und wieder absetzen. Eine ideale Spielwiese!
Genutzt werden magnetische Flüssigkeiten heute immer noch zu Dichtungszwecken, jedoch auch im medizinischen Bereich. Bei der magnetothermischen Therapie zur Behandlung von Tumorerkrankungen werden nämlich derartige Nanopartikel ins befallene Gewebe injiziert und mit einem externen Magnetfeld gezielt erwärmt. Und toxische oder radioaktive Stoffe können selbst in geringster Konzentration aus verunreinigten Lösungen oder Abwässern durch Adsorption auf magnetischen Nanoteilchen entfernt werden.
Es leuchtet im Verborgenen
Abb. 4: Was leuchtet denn hier im Felsdunkel?
Ich will Euch gar nicht auf die Folter spannen, es ist Leuchtmoos. Man kann es im Eingangsbereich von Höhlen oder in dunklen Felsspalten entdecken, wo nur selten mal ein Sonnenstrahl hinfällt - so wie auf diesem Foto. Aber woher kommt die Energie für das Leuchten? Ein chemischer Lumineszenzeffekt (wie bei den Glühwürmchen) oder Phosphoreszenz (wie bei den leuchtenden Zeigern einer Uhr) ist es jedenfalls nicht, denn in absoluter Dunkelheit ist dieses besondere Moos auch dunkel. Und versperren wir dem Moos durch unseren eigenen Schatten das bisschen Licht, das es noch erreicht, verschwindet das Leuchten fast vollständig.
Auch Moose sind Pflanzen und benötigen Lichtenergie für ihre Photosynthese. Bei dieser Pflanze macht sich die Natur das Sammelprinzip von wassergefüllten Kugeln zunutze. Dabei ist es nicht die Pflanze selbst, die dort hellgrün leuchtet, sondern die Vorkeime, die mithilfe eines optischen Systems das wenige Licht auf ihre für die Photosynthese zuständigen Blattgrünkörper, die Chloroplasten, konzentriert. Es handelt sich um eine mit Wasser gefüllte Ausbuchtung, die das Restlicht sammelt. Man könnte sie getrost als Wasserlinse bezeichnen.
Da das Chlorophyll hauptsächlich – wie bei anderen Pflanzen auch – die roten und blauen Lichtanteile absorbiert, wird der grüne Anteil von der Zellrückwand wieder abgestrahlt – so entsteht das grüne Leuchten des Leuchtmooses. Auch wenn es sich beim Leuchten um einen rein physikalischen Effekt handelt, stellt dies eine evolutionäre Anpassung an sehr dunkle Standorte dar. In Island "bevölkert" das Leuchtmoos ganze Täler und kann durch seine guten Lichtsammeleigenschaften nicht nur die dunklen Winter, sondern auch viele trübe Tage überstehen. Es bildet einen wunderschönen Kontrast zum schwarzen Untergrund.
Abb. 5: Leuchtmoose in Landmannalaugar
Bei starkem Sonnenschein sollten wir nicht gießen! Diese Gärtnerregel beruht nicht nur darauf, dass große Teile des wohltuenden Nass gleich wieder verdunsten. Der Lichtsammeleffekt einzelner Tropfen (hier ist sie wieder, die Wasserlinse!), die auf die Blätter gelangen, kann zu Verbrennungen der Blattoberfläche führen. Sicher habt Ihr schon einmal solche braunen Flecke auf großen Blättern beobachtet.
Übrigens: Auch die von den Schustern genutzte, mit Wasser gefüllte Kugel (treffenderweise "Schusterkugel "genannt) sammelt das wenige Licht beispielsweise einer Kerze, wenn wir diese an einen geeigneten Ort neben die Wasserkugelo stellen. Im Lichtsammelpunkt lies es sich dann im Hellen gut arbeiten. Mehr davon in meinem Buch "Warum platzen Seifenblasen?".
Abb. 6: Eine wassergefüllte Schusterkugel erlaubt das Arbeiten bei wenig Licht
"Fische" spucken aus dem Wasser
Abb. 7: Hier "spucken" die Fische
Bei dieser eigentümlichen Schüssel mit den beiden metallenen Griffen handelt es sich um eine Drachenschüssel. Sie stammt angeblich aus China, wo sie vor mehr als 2000 Jahren erfunden wurde. Dort gibt es auch Exemplare mit Fischverzierungen im Innenteil. Durch geschicktes Reiben mit leicht feuchten Händen auf den beiden Griffen können wir Oberflächenwellen in Form kleiner Kräuselwellen in der Schüssel anregen. Treiben wir es gar auf die Spitze, so werden die Wellen schnell heftiger und schließlich spitzen kleine Wassertröpfchen oder gar ganze Fontänen in die Höhe – dann spucken die Fische nämlich! Das Foto entstand auf der Insel Juist, wo jeder sich am Erzeugen der Spuckerei üben kann.
Aber wer hat schon so eine interessante Schüssel? Wir nehmen für eigene Experimente ein dünnes, bauchiges (Wein)-Glas, befüllen es mit Wasser und reiben mit feuchten Händen vorsichtig (und langsam) über den Glasrand. Die Sache bedarf jedoch – genau wie bei der Schüssel – etwas Übung. Also verzweifelt nicht, wenn es nicht sofort klappt. Auch hier kann man dann auf der Oberfläche interessante Kräuselwellen beobachten. Und sogar einen Ton hören, denn die Wellenbewegung des Glases überträgt sich als Schallwelle auf die umliegende Luft. Allerdings muss ich Euch vor etwas warnen: Einige der benutzten Gläser bekommen beim anschließenden Spülen im heißen Wasser Sprünge!
Ein Tröpfchennebel
Abb. 8: Nebeltröpfchen steigen auf
Ich weiß, dieses Foto ist nicht ganz so gut gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe etliche Male versucht, ein Foto beim Öffnen einer Sektflasche zu machen, aber es erfordert so einiges fotografisches Können (und schließlich können wir nicht dauern Sekt trinken). Ich hoffe jedoch, man erkennt das, worauf es mir ankommt. Öffnen wir nämlich Sekt- oder auch Sprudelflaschen mit einem schnellen Ruck, macht sich ein Phänomen sichtbar: Wir können einen dünnen Nebelschleier über der Flüssigkeitsoberfläche beobachten.
Sobald nämlich die gut gekühlte Flasche aufgemacht wird, dehnt sich das unter Druck stehende Gas (ein Gemisch aus Luft und Kohlendioxid) darin rasch aus, seine Temperatur sinkt. Kalte Luft bzw. Gas kann aber weniger Wasserdampf speichern, ein Teil der vorhandenen Luftfeuchtigkeit kondensiert zu feinen Nebeltröpfchen. Auch der entgegen gesetzte Effekt ist gut bekannt: Komprimiert man Gase schnell, erhitzen sie sich. Die Luftpumpe ist das beste Beispiel.
Das versteht sich doch von selbst, werden Sie jetzt sagen. Die unter hohem Druck stehende Flüssigkeit gelangt am Ventil „plötzlich ins Freie“, der Überdruck „entlädt“ sich, das Gas entspannt sich. Die Teilchen nehmen innerhalb kürzester Zeit große Geschwindigkeiten an und das Gas kühlt dabei ab. Sie haben recht! Bis hierher ist der rasante Abkühlungseffekt eigentlich alltäglich, nichts Besonderes, auch bei den CO2-Patronen der Wassersprudler lässt er sich gut erfühlen.
Physiker nennen diesen Vorgang übrigens irreversible, adiabatische Expansion. Dabei bedeutet „adiabatisch“, dass kein Energieaustausch mit der Umgebung geschieht. „Irreversibel“ werden Prozesse genannt, die von selbst nicht umgekehrt ablaufen: Das Gas wird sich nicht freiwillig wieder in seinen Behälter zurückziehen, es sei denn, wir zwingen es unter (großem) Arbeitsaufwand dazu. Fast alle schnellen Vorgänge sind irreversibel und adiabatisch. Bei der ungestümen Entspannung des Gases können die Teilchen keine Energie mit der Umgebung austauschen, dafür geht das alles viel zu schnell.
Aber welche physikalischen Ursachen stecken hinter diesem Phänomen? Um der Sache auf die Schliche zu kommen, werden wir den Versuch leicht abändern. Zunächst scheint es so, dass im genannten Flüssiggas-Beispiel sich durch die überaus rasante Expansion des Gases beim Öffnen des Ventils die Abkühlung einstellte. Was aber passiert, wenn man die Sache „gemach“ angeht, das heißt, wenn der Teilchenaustritt sehr langsam geschieht?
Dieses Experiment haben die beiden englischen Physiker James Prescott Joule und William Thomson (1892 zum Lord Kelvin geadelt) im Jahr 1853 durchgeführt und der Effekt wurde nach ihnen benannt. Sie bauten in ein thermisch gut isoliertes Rohr eine so genannte Drosselstelle ein. Im historischen Experiment wurde eine poröse Trennwand aus Glaspulver benutzt, für einen Schauversuch oder eigene Experimente ist ein Wattebausch ausreichend. Diese Drosselstelle lässt eine schnelle, freie Expansion mit ungehinderter Strahl- und Wirbelbildung, wie sie bei einem Ventil auftritt, nicht zu. Entspannt nun ein unter Druck stehendes Gas (langsam!) über diese Stelle hinweg, so lässt sich für die meisten Gase eine Abkühlung nachweisen. Der Effekt scheint zunächst äußerst geringfügig: Pro Atmosphäre Druckunterschied beträgt der Temperaturabfall bei Kohlendioxid (CO2) gerade mal ¾ °C, bei Luft ¼ °C. Bei großen Druckdifferenzen (100 atm oder mehr!) stellen sich jedoch deutliche Temperaturverminderungen ein. Ich will Euch jedoch nicht verschweigen, dass bei einigen wenigen Gasen wie Wasserstoff oder Helium bei Zimmertemperatur eine Erwärmung auftritt.
Wie ist dieser erstaunliche Befund zu erklären? Bei dem Versuch haben sich die einzelnen Gasmoleküle durch die poröse Wand oder den Wattebausch gezwängt, sie haben gewissermaßen durch Diffusion den größeren Raum vereinnahmt, ohne dabei ihre eigene Geschwindigkeit merklich zu verändern. Eine (merkliche) Temperaturänderung sollte bei diesem langsamen Prozess eigentlich nicht auftreten. Unsere Überlegungen gelten allerdings nur für ein Modellgas, Physiker nennen es ideales Gas. In einem solchen Gas merken die einzelnen Moleküle nichts voneinander, sie spüren keinerlei Anziehungs- oder Abstoßungskräfte. Jedes Teilchen verhält sich so, als gäbe es die anderen in seiner Umgebung gar nicht. Alle stark verdünnten Gase, auch verdünnte Luft, kommen diesem Modellgas schon ziemlich nahe. Und in der Tat konnten Joule und Thomson in ihrem Experiment für solche Gase keine oder nur eine äußerst geringe Änderung der Temperatur messen.
Im Alltag begegnen uns solche idealen Gase allerdings recht selten. In realen Gasen, vor allem, wenn sie komprimiert sind, ist jedes Molekül zahlreichen Kräften seiner Nachbarn ausgesetzt. Die Bilanz dieser Kräfte bestimmt nun, was passiert, wenn sich das Gas ausdehnt. Wirken zwischen den Gasteilchen überwiegend anziehende Molekularkräfte, so müssen diese überwunden werden, wenn sich die einzelnen Gasteilchen voneinander entfernen. Das Gas benötigt bei seiner Expansion also Energie. Doch woher soll es diese Energie nehmen, wenn es thermisch isoliert ist oder der Vorgang relativ schnell abläuft? Die einzelnen Teilchen müssen einen Teil ihrer Bewegungsenergie „opfern“, sie bewegen sich langsamer und haben daher eine geringere Temperatur.
Der Joule-Thomson-Effekt spielt eine wesentliche Rolle bei der Verflüssigung von Gasen und ist somit zur Erzeugung tiefer Temperaturen von großer praktischer Bedeutung. Er wird in nahezu allen technischen Verfahren zur Verflüssigung von tief siedenden Gasen, insbesondere von Luft, Wasserstoff und Helium benutzt. Die Tieftemperaturforschung hat unter anderem zur Entdeckung vieler neuer Phänomene wie zum Beispiel der Supraleitung und der Suprafluidität geführt. Viele technische Anwendungen benötigen tiefe Temperaturen, beispielsweise supraleitende und daher sehr effiziente Spulen, die wir nicht nur in großen Beschleunigeranlagen, sondern auch in medizinischen Untersuchungsgeräten wie dem Magnetresonanztomographen finden.
Hier wächst pure Chemie!
Abb. 9: Mein chemischer Garten
Sehr seltsame Pflanzen wurden hier gezogen! Das Fotot zeigt das kleine chemische Gärtchen, das mein Sohn und ich in einem Glas angelegt haben. Dabei werden in eine wässrige Lösung aus Wasserglas verschiedene Schwermetallsalze gegeben. Im Laufe der Zeit „wachsen“ dann aus den Kristallkrümelchen teilweise skurrile und an einen Garten erinnernde Formen mit unterschiedlichen Strängen, Einschnürungen und Verästelungen.