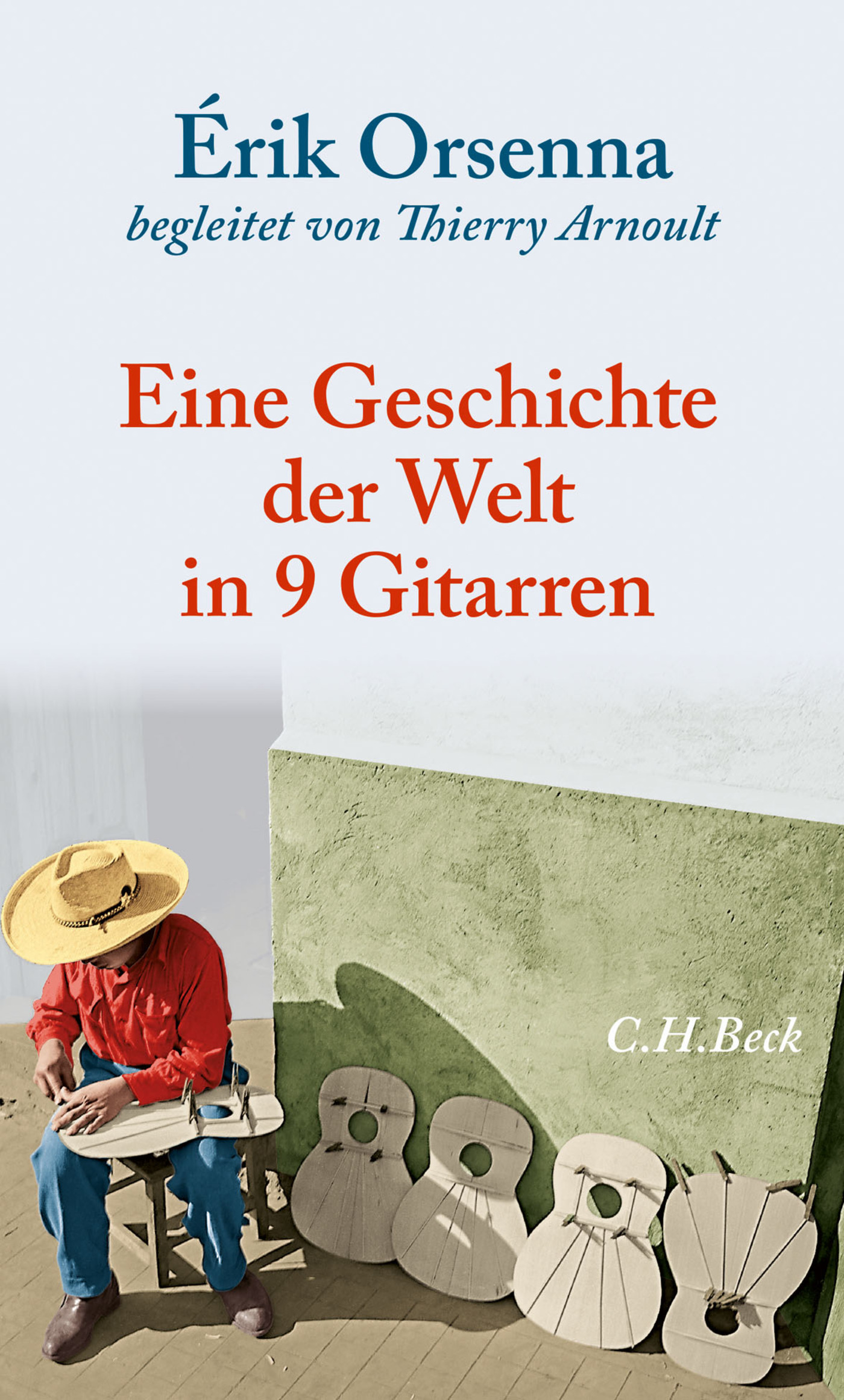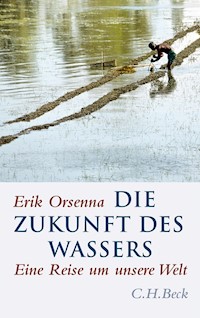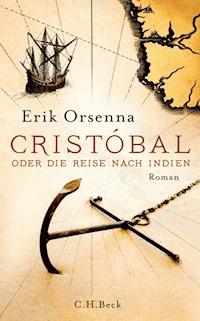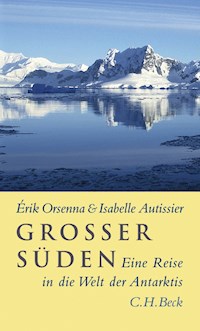
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem poetischen Reisebericht schildern Érik Orsenna und Isabelle Autissier ihre einsame Fahrt in die Antarktis, das Reich extremer Gefahren und außerordentlicher Schönheiten. Ihre Fahrt ist zugleich eine Reise durch die Naturgeschichte des weißen Kontinents und eine Begegnung mit den Menschen der Vergangenheit, die die Antarktis entdeckt, erobert und erschlossen haben.
Im Januar 2006 macht sich Érik Orsenna zusammen mit der weltberühmten Seglerin Isabelle Autissier auf den Weg in den Großen Süden - auf einem Segelboot. Sie verzichten auf Sicherheit und Bequemlichkeit und lernen die Angst kennen, wenn sie auf rettende Winde warten, gegen eisige Stürme ankämpfen oder von Eisbergen umgeben sind, die ihr kleines Schiff mühelos zermalmen können. Was sie gewinnen, sind die Einsamkeit und der Blick der großen Entdecker, deren Spuren sie verfolgen und deren Geschichten sie erzählen. Der Friede, den sie finden, ist auch ein politischer, denn das Land am Südpol gehört niemandem und ist allein dem Frieden und der Forschung gewidmet. So besuchen die Reisenden auch Forscher aus den verschiedensten Ländern und lernen ihre einzigartigen Untersuchungen über das Leben auf unserem Planeten, seine Bedingungen und seine Gefährdungen kennen. Gleichzeitig erzählen Orsenna und Autissier hier die Biographie des weißen Kontinents: wie er entstand, wie das einst üppige Leben von ihm verschwand, auf welch erstaunliche Weisen sich Tiere und Pflanzen den extremen Bedingungen anpaßten, wie die Antarktis den übrigen Planeten am Leben erhält – und wodurch sie bedroht ist. Sie berichten von der Ausbeutung des Kontinents in der Vergangenheit und den Bemühungen um seine Rettung in der Gegenwart. So verbindet ihr Buch politische Wachheit mit dem Sinn für die fremdartige Schönheit des Kontinents.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Érik OrsennaIsabelle Autissier
GROSSERSÜDEN
Eine Reise in die Welt der Antarktis
Aus dem Französischen vonHolger Fock und Sabine Müller
C.H.Beck
Zum Buch
Im Januar 2006 macht sich Érik Orsenna zusammen mit der weltberühmten Seglerin Isabelle Autissier auf den Weg in die Antarktis – auf einem Segelboot. Sie verzichten auf Sicherheit und Bequemlichkeit und lernen die Angst kennen, wenn sie auf rettende Winde warten, gegen eisige Stürme ankämpfen oder von Eisbergen umgeben sind, die ihr kleines Schiff mühelos zermalmen können. Diese einsame Fahrt in den Großen Süden, das Reich extremer Gefahren und außerordentlicher Schönheiten, schildern Orsenna und Autissier in ihrem poetischen Reisebericht. Ihre Fahrt ist zugleich eine Reise durch die Naturgeschichte des weißen Kontinents und eine Begegnung mit den Menschen der Vergangenheit, die die Antarktis entdeckt, erobert und erschlossen haben. Orsenna und Autissier erzählen, wie der Kontinent entstand, wie das einst üppige Leben von ihm verschwand, wie sich Tiere und Pflanzen den extremen Bedingungen anpassten, wie die Antarktis den übrigen Planeten am Leben erhält – und wodurch sie bedroht ist. Sie berichten von der Ausbeutung des Kontinents in der Vergangenheit und den Bemühungen um seine Rettung in der Gegenwart. So ist ihr Buch ein politisches Plädoyer und zugleich der Bericht über ein Land von fremdartiger und berückender Schönheit.
Über die Autoren
Érik Orsenna, geb. 1947, ist Schriftsteller, Mitglied der Académie Française und Direktor des Centre international de la mer. Für L’Exposition coloniale wurde er 1988 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, für Weiße Plantagen erhielt er 2007 die Corine. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: Portrait eines glücklichen Menschen. Der Gärtner von Versailles (52009), Lob des Golfstroms (22007) und Weiße Plantagen. Eine Reise durch unsere globalisierte Welt (22007).
Isabelle Autissier, geb. 1956, ist Seglerin und hat als erste Frau in einer Regatta die Welt alleine umsegelt. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen und neue Rekorde aufgestellt. Nach einem beinahe tödlichen Unglück im Südpazifik hat sie 1999 ihre Karriere als Einhandseglerin beendet, nimmt jedoch weiterhin an Regatten auf dem gesamten Globus teil.
Inhalt
Aus dem Tagebuch von IsabelleWarum in die Antarktis?
Aus dem Tagebuch von ÉrikWarum in die Antarktis?
Erster TeilWo beginnt der Große Süden?
I. Río Gallegos
II. Ushuaia
III. Puerto Williams
IV. Aus dem Tagebuch von IsabelleEin Schiff, eine Mannschaft
V. Wortschatz
VI. Die Drake-Straße
VII. Aus dem Tagebuch von IsabelleAutonomie
VIII. Aus dem Tagebuch von ÉrikWindgrenzen. Gespräch mit Pierre Lasnier
IX. Wassergrenzen I: Die antarktische Konvergenz
X. Wassergrenzen II: Der Zirkumpolarstrom
XI. Das Signal der Vögel, das Echo der Gespenster
XII. Aus dem Tagebuch von ÉrikEs lebe die internationale Gemeinschaft!
Zweiter TeilDas Weddell-Meer
I. Das Volk der Eisberge
II. Bahía Esperanza
III. Nordenskjöld
IV. Aus dem Tagebuch von ÉrikPorträt der Angst
V. Tiere I
Dritter TeilDie Südlichen Shetland-Inseln
I. Elephant Island
II. Deception
III. Der unauffindbare Ankerplatz
IV. Melchior
V. Aus dem Tagebuch von IsabelleSchweres Wetter
VI. Tiere II
Vierter TeilDie Antarktische Halbinsel
I. Antarktis-Tourismus
II. Ponytailed girl I
III. D. Island
IV. Aus dem Tagebuch von ÉrikWas ist ein Seefahrer?
V. Auf der Spur des großen Phantoms
VI. Noch einmal Charcot und dasandere Ponytailed girl
VII. Die Vernadsky-Station
VIII. Gezeiten
IX. Botanik
X. Aus dem Tagebuch von ÉrikWarum in die Antarktis? (Fortsetzung)
XI. Kartografieren, benennen
XII. Aus dem Tagebuch von IsabelleAnkerplätze in der Antarktis
XIII. Kurs auf Marguerite Bay
Rückfahrt
I. Aus dem Tagebuch von ÉrikKleine Chronik einer gewöhnlichenDrake-Passage
II. Puerto Toro
III. Das Auge von Toulouse
Anmerkungen
Bibliografie
Aus dem Tagebuch von Isabelle
Warum in die Antarktis?
Lange Zeit hing über meinem Kinderbett eine riesige Karte des Atlantiks im sogenannten Adlerformat, dem größten Format. Ganz unten schlängelte sich direkt vor meinen Augen die Küstenlinie eines Kontinents: Antarktika. Aber nicht diese Linie fesselte meine Aufmerksamkeit, mich zogen vielmehr jene Inseln an, die als Gipfel des Mittelatlantischen Rückens aus dem Ozean herausragen: Sankt Helena, Ascension, Tristan Da Cunha und natürlich Kap Hoorn.
Viele Jahre später beflügelte eine eher gefährliche Begegnung meine Fantasie. An einem klaren Morgen segelte ich in den «Roaring Forties», zwischen dem 40. und dem 50. südlichen Breitengrad. Das Boot glitt ausnahmsweise ruhig durchs Wasser, ich hatte keine Brecher, kein schlechtes Wetter. In Gedanken versunken, saß ich am Ruder, als eine dunkle Masse am Horizont meinen Blick auf sich zog.
Hier eine Insel? Unmöglich! Ich befinde mich nördlich der Kerguelen. Mehrere tausend Kilometer See trennen mich von der nächsten Landmasse. Ein Blick auf die Karte, dann ins Fernglas – einen Augenblick lang schwanke ich, ob ich wirklich dort bin, wo ich meine …
Es ist ein riesiger, einzelner Eisberg. Vor mir ragt ein gewaltiges Eisgebilde auf, das schon monate-, wenn nicht sogar jahrelang im Meer treibt. Ich umsegle es in respektvollem Abstand. Der Eisberg ist über einen Kilometer breit, die matte Sonne tanzt über seine mal bläulichen, mal grauen, mal glitzernden Facetten. An seinem Fuß grollt das Meer. Zum Sterben verdammt, liegt der Koloss da, unerschütterlich. Er ist von strahlender Schönheit, aber auch von einer eigenartigen Melancholie.
An jenem Morgen wurde mir klar, dass es weiter im Süden, jenseits des 40. und des 50. Breitengrades, die mir bis dahin wie das Ende der Welt vorgekommen waren, noch etwas gab. Dieses Land schien eine rätselhafte Macht zu besitzen, konnte es doch ein so widersprüchliches Gebilde hervorbringen, Inbegriff von Kraft und Zerbrechlichkeit zugleich.
Am Anfang war also eine Empfindung. Sie hat mich seither nicht mehr verlassen.
Später, noch immer am Ruder, rief ich mir die Bilder in Erinnerung, die sich mir als Jugendlicher bei der Lektüre bestimmter Bücher eingeprägt hatten. Mir fielen Berichte über unglaubliche Abenteuer und irrwitzigen Heldenmut ein, aber auch über eine einzigartige Verzauberung. Alle, die in die Antarktis gereist waren, mussten ihrem Leben offenbar eine außerirdische Dimension hinzufügen, um dieser Welt der Superlative gerecht zu werden.
Als ich wieder an Land war, besorgte ich mir sofort Bücher, um mir Gewissheit zu verschaffen.
Drei Dinge fielen mir auf.
Wenn ich der Quelle dieses Gefühles nachgehen wollte, das mich vor meinem ersten Eisberg überwältigt hatte, würde ich, so die einhellige Meinung, in eine großartige Welt von atemberaubender Schönheit gelangen, eine Welt, in der jede Sekunde des Lebens erkämpft werden musste.
Verglichen mit dem Südpolarmeer waren die «Roaring Forties», mit deren Strapazen und Herausforderungen ich Erfahrung hatte, eine leichte Übung, eine Art Grundkurs, dem gegenüber sich die antarktischen Gewässer wie eine Doktorarbeit ausnehmen würden.
Auf diesem Kontinent herrschten so extreme Bedingungen, dass er nicht lediglich die Steigerung gewöhnlicher Vorgänge sein konnte. Dort waren neue Phänomene am Werk, die Lebewesen entwickelten andere Überlebensstrategien, die Wissenschaft sah sich mit Fragen konfrontiert, die sich noch nie gestellt hatten.
Durch all das bekam ich riesige Lust, dorthin zu fahren.
Doch alles zu seiner Zeit – ich sollte noch weitere zehn Jahre mit Freude an der Pinne eines Rennboots sitzen, ehe sich die Gelegenheit zu einem Törn in die Antarktis bot.
Im Januar 2002 machte ich am Steg des Afasyn Yachtclubs in Ushuaia fest, wo ich mich mit meinen Mitseglerinnen traf, einer Schwedin, einer Engländerin, einer Kanadierin und zwei weiteren Französinnen. Dort entdeckte ich am Ponton ein Schiff namens Ada, und wenig später stachen wir in See Richtung Antarktis.
In jenem Jahr war die Antarktis trübe, verhangen und windig, das Eis hatte alles in seinem Griff. Doch unsere Frauencrew hielt sich wacker. Wenn uns der katabatische Wind den Schnee mit 60 Knoten waagrecht ins Gesicht fegte, warteten wir brav, zweifach vertäut, bei Tarot und Whisky. Ansonsten schipperten wir umher, schnitten mit dem Bug in die dünne Eisschicht, versuchten zu verstehen, woraus dieses Universum geschaffen war; wir waren neugierig und wurden immer wieder überrascht.
Jeder von uns gingen viele Lichter auf, aber eigenartigerweise waren sie sehr verschieden. Jedoch für einen kurzen Augenblick hatte jede das Gefühl, im Einklang mit einer vorgeschichtlichen Natur zu leben, das Gefühl, der Kern des Lebens offenbare sich jedem, der über seine raueste Erscheinungsform hinausgelangt.
Ich spürte gleich, dass mir diese Wochen nicht genügen würden. Wie sollten ein paar Tage auch ausreichen, um etwas zu erkunden, das einem wie ein ganzes Universum vorkommt?
Die Antarktis ist keine vorübergehende Laune, man kann sie nicht auf die Schnelle durchzappen. Um ihre Gesetze zu begreifen, braucht man viel Zeit. Alles drängte mich dorthin zurück.
Ich wollte meinen Blick durch den Blick anderer erweitern. Es galt, Wissenschaft und Forschung zu Rate zu ziehen, denn nur sie können diese wundersame Wirklichkeit enträtseln. Doch zugleich schien mir, man könne die Antarktis ebenso besingen, sie tanzen, filmen, über sie schreiben, sie malen, auf die Bühne bringen. Ich träumte von einer Art Arche, auf der sich Neugierige aus allen Bereichen gegenseitig befruchten, auf der Kunst und Wissenschaft zusammentreffen; denn der Mensch braucht beide Beine, um vorwärtszukommen und Entdeckungen zu machen.
Um das zu erreichen, musste ich die Sache allerdings einfacher angehen. Ich musste handeln, ein Projekt in Angriff nehmen, und wäre es noch so klein, und durfte nicht nur träumen. So bald wie möglich kaufte ich die Ada. Jetzt fehlten mir noch ein paar zuverlässige Mitsegler, die meinen Traum teilten.
Érik war der Erste.
Aus dem Tagebuch von Érik
Warum in die Antarktis?
Ich erinnere mich, wie mein Vater mir von recht merkwürdigen Forschern erzählte, die sich vorgenommen hatten, die Eismassen des Südpols zu durchqueren, um … nach den Eiern von Kaiserpinguinen zu suchen. Sie wollten beweisen, dass es eine Verbindung zwischen den Schuppen von Reptilien und den Federn von Vögeln gebe! Wenn ich erst einmal groß wäre, so nahm ich mir damals vor, würde ich ebenfalls alle Gefahren auf mich nehmen, um die Welt zu erklären.
Später stieß ich wieder auf die Spur dieser kühnen Männer. Der Anführer ihrer Expedition, Cherry-Garrard, hat von der schrecklichen Reise im Winter 1911 berichtet: einhundertfünfzig Kilometer Wegstrecke, sechs Wochen Fußmarsch (mit Bergsteigen) durch eine Region, in der das Thermometer unter minus sechzig Grad fiel. Sie fanden sechs Eier, von denen auf dem einhundertfünfzig Kilometer langen Rückweg drei zerbrachen … Und was die Verbindung von Schuppen und Vogelfedern anging, so konnte kein Beweis dafür erbracht werden.
Aber Cherry-Garrards Ergebnis stand unwiderruflich fest: «Die Reise zum Südpol ist die extremste und einsamste aller Forschungsreisen.»
*
Ich erinnere mich an eine der zahllosen Geschichten, die mir meine Mutter erzählte.
Es war einmal eine Nymphe, eine Göttin des Waldes, mit Namen Kallisto. Zeus, der viel in der Welt umherwanderte, begegnete ihr und verliebte sich in sie. Aus ihrer Verbindung entsprang ein Kind: Arkas. Um sich zu rächen, verwandelte Hera, Zeus’ Gattin, Kallisto und Arkas in Bären. Und so heißt der Bär auf Griechisch «arktos». Aber Heras Zorn war damit noch nicht gestillt. Zeus, der sich um das Leben seiner Nymphe und ihres gemeinsamen Sohnes sorgte, sandte die beiden deshalb in den Himmel, damit sie sich dort versteckten. Seitdem drehen sie sich als Großer und Kleiner Bär um den Polarstern.
Die Arktis ist daher die Heimat der Bären. Und anti-arktos, die Antarktis, wörtlich: der Gegensatz zur Arktis, ist auch «das Land ohne Bären»: Denn sie kommen auf diesem Kontinent nicht vor.
*
Ich war bereits zweimal nach Feuerland gefahren. Mit der Balthazar, der soliden Slup von Siv und Bertrand Dubois, war ich im Beagle-Kanal mit großer Begeisterung auf Darwins Spuren unterwegs gewesen, und auf der Insel Lennox hatte ich mich lange mit einem Goldsucher unterhalten. Als wir kurze Zeit später um Kap Hoorn segelten, getrieben von einer steifen Westbrise von fünfundvierzig Knoten, sah ich in Richtung Eismeer und fragte mich: Würde ich es eines Tages wagen, noch weiter nach Süden zu segeln? Würde ich einmal die Passage wagen?
Ich gehöre nicht zu den Waghalsigen und zittere öfter, als mir lieb ist. Doch eine Krankheit sitzt in mir: die Neugier. Sie siegt jedes Mal über meine Ängste. Zusammen mit meiner Abneigung gegen das Gefühl, etwas bedauern zu müssen, drängt sie mich immer wieder zu neuen Abenteuern.
Unaufhörlich denke ich an die Augenblicke, die meinem Tod vorangehen werden. Ich weiß, wie meine allerletzte Frage lauten wird: Habe ich die Welt, die ich jetzt verlassen muss, gut genug erkundet?
Als Isabelle mich fragte: «Willst du mit mir in die Antarktis segeln?», stand die Antwort schon seit meiner Kindheit fest.
Erster Teil
Wo beginnt der Große Süden?
I.Río Gallegos
Seit zwei Stunden hat sich die Landschaft beim Blick aus dem Flugzeug nicht verändert: endlose, schwindelerregend flache Heide, manchmal wie von einer sehr langen Woge angehoben. Abgesehen von lichtem Gehölz, das die wenigen Gebäude umgibt, ist weit und breit kein Baum zu sehen.
Die Vegetation, die vom hiesigen Wind, dem pampero, gepeitscht wird, ist so spärlich, dass mit einem Hektar Land gerade mal ein Schaf ernährt werden kann. Die landwirtschaftliche Nutzung lohnt sich erst ab einer Million Schafe. So mancher Grundbesitz erstreckt sich daher über eine Million Hektar, in der Mitte ein Hof. Hier können die Nachbarn nie lästig werden. Das Tor zum Großen Süden ist vermutlich der Anfang der Einsamkeit.
Die kleine Stadt Río Gallegos ist benannt nach dem Fluss, an dem sie liegt: ein schlammiger, hellbrauner Wasserstrang, der von den ockerfarbenen Ausbuchtungen der Lehmböschung gesäumt ist und sich durch eine ebenso braune, aber etwas dunklere Erde gräbt. Nichts, was einen bezaubern könnte.
Auch beim Flug über die Stadt kommt keine Begeisterung auf: hingewürfelte Quader, alle im selben Weiß. Nach etwas anderem braucht man gar nicht erst zu suchen. Río Gallegos verdient nicht die Ehre, das Tor zum Großen Süden zu sein. Es beansprucht sie auch nicht für sich. Ebenso wenig wie die Zwillingsstadt auf der anderen Seite der Magellan-Straße, Río Grande. Beide begnügen sie sich damit, von den Öl- und Gasvorkommen zu leben – und es lebt sich gut davon –, die man in der näheren Umgebung entdeckt hat.
Eine Sache macht mich stutzig. Bei vielen Autos sind die Wagentüren mit kräftigen Stricken an den Autositzen festgebunden. Fragt man nach dem Grund für diesen seltsamen Brauch, lacht der Ortsansässige:
«Sie ahnen nicht, was für ein Wind hier bläst!»
Und er fügt hinzu:
«Und auch nicht, was eine weggerissene Autotür kostet!»
Das Südpolarmeer gilt allgemein als die Heimat des Windes. Sie hat irgendwo südlich von Buenos Aires («die guten Lüfte») begonnen. Wir nähern uns also dem Kern der Sache, und diese trotzige und bescheidene kleine Stadt bereitet uns auf das Schlimmste vor.
II.Ushuaia
Angesichts seiner gewaltigen Ausdehnung (mit 2.770.000 Quadratkilometern ist es mehr als fünfmal so groß wie Frankreich) könnte man glauben, Argentinien habe genügend Fläche.
Irrtum. Es will noch größer werden. Davon zeugen die Denkmäler, die die Straße zum Yachtclub säumen.
Rechts wird mit salbungsvollen Worten die argentinische Polizei geehrt. Der Urheber des Kunstwerks, ein gewisser Carlos A. Ansaldo, legte Wert darauf, seine edlen Absichten auf einer Stele zu erläutern: Die Bögen aus Stahlbeton symbolisieren den Fluss der vaterländischen Energie. Sie sind nach Südwesten ausgerichtet, genauer gesagt, auf den «Grenzpunkt 26», der die Grenze zu Chile markiert, «den äußersten Punkt unseres Landes, über den wir die uneingeschränkte Souveränität wahren». Die Büste eines Generals, offensichtlich ein ruhmreicher Polizist, verbürgt diese Allegorie. Kleine, mit Lupinen bepflanzte Schalen verklären die Szene zum bukolischen Idyll.
Auf der anderen Straßenseite wollte die Stadt das «Heldenepos der Malwinen» würdigen. 1982 überfiel Argentinien den Archipel der Falkland-Inseln, den es seit langem für sich beansprucht. Die Engländer eroberten ihren Besitz zurück. Über tausend Besatzer starben. Damit die Ereignisse nicht in Vergessenheit gerieten, wurde eine große, mit vielen Löchern versehene Mauer errichtet: Die Löcher haben die Form der Falkland-Inseln, des fernen Kriegsziels. «Volveremos», «Wir kommen wieder», verkünden die programmatischen Verse, die jeder unter den Löchern lesen kann. Noch weiter unten sind die Namen der gefallenen Kriegshelden eingraviert.
*