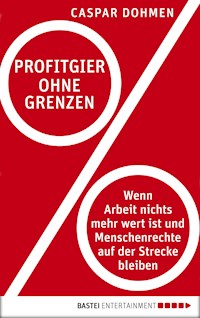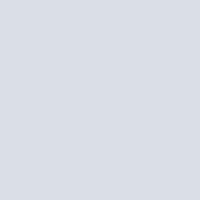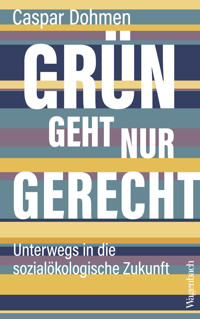
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer nachhaltiges Wirtschaften im Großen fordert und ökologische Ziele verfolgt, wird schnell als Phantast abgetan, oder schlimmer: als Ideologe ohne soziales Gewissen. Dabei ist ein Leben im Einklang mit der Natur und entsprechend der sozialen Bedürfnisse durchaus möglich. Bäuerinnen, die Natur aufbauen statt zerstören, Mieter, die ihr Leben lang sorgenfrei wohnen, Unternehmerinnen, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben – all dies ist mancherorts längst Realität. Aber warum werden die Wünsche etwa nach bezahlbaren und gesunden Lebensumständen, guter Verkehrsanbindung und ressourcenschonender Produktion nicht überall erfüllt? Bislang existieren diese Ansätze nur wie Inseln des Wegweisenden, die sich winzig ausnehmen gegenüber Ozeanen des Rückwärtsgewandten. Der Volkswirt Caspar Dohmen zeigt, welche innovativen Ansätze eine umfassende soziale wie ökologische Wende möglich machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warum gelingt im Großen nicht, was im Kleinen funktioniert? Die große Mehrheit der Menschen kann nur dann für ein zukunftsfähiges Wirtschaften gewonnen werden, wenn es dabei gerecht zugeht. Der Wirtschaftsjournalist Caspar Dohmen macht ebenso verblüffende wie praktikable Vorschläge, mit denen gleich heute begonnen werden könnte – und sollte.
Caspar Dohmen
GRÜN GEHT NUR GERECHT
Unterwegs in die sozialökologische Zukunft
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
EINLEITUNG
ERLEBEN
Wie Menschen Transformationen erleben und auch Gruppen mit schlechter finanzieller Ausstattung in der politischen Arena berücksichtigt werden
ESSEN
Wo Unternehmen ökologisch und sozial zukunftsfähig wirtschaften und an welche Grenzen sie dabei stoßen
WOHNEN
Wie auch Menschen mit geringem Einkommen sorgenfrei die sozialökologische Transformation erleben können und was das mit Eigentum zu tun hat
FAHREN
Warum die deutsche Autoindustrie zukunftsfähige Ideen verwarf und was das über den Wandel des Kapitalismus aussagt
VERWANDELN
Was man vom Ruhrgebiet über die soziale Seite der Transformation lernen kann und warum dortige Akteure gute Chancen haben, an einer in Kreisläufen organisierten zukunftsfähigen Wirtschaft mitzuwirken
REGIEREN
Welche Konzepte Regierungen beim Schutz von Umwelt und Natur anwenden und welche Ökonomen dabei Gehör finden beziehungsweise finden sollten
VERSORGEN
Warum bei der Energiewende kollektive individuellen Lösungen vorzuziehen sind und welche Bedeutung eine funktionierende Daseinsvorsorge für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft hat
VERGEMEINSCHAFTEN
Warum ein soziales Miteinander und eine gemeinschaftliche Herangehensweise der Schlüssel für die sozialökologische Transformation sind und was das für Wirtschaft, Politik und Demokratie bedeutet
DANK
ANMERKUNGEN
Impressum
EINLEITUNG
Was Historiker künftig über unsere Zeit denken werden, hängt maßgeblich vom Umgang mit dem Planeten ab. Vielleicht werden sie sich später wundern, wie rasant die Menschheit wider besseres Wissen und trotz vorhandener Lösungen zu großen Teilen ausstarb, weil die Mehrheit den Status quo notwendigen Veränderungen vorzog. Möglicherweise werden künftige Historiker die jetzige Epoche aber auch als eine Zeit beschreiben, in der die Mehrheit die existenziellen Herausforderungen annahm und Wirtschaft und Gesellschaft umkrempelte, um der Spezies Mensch ihre Existenzgrundlage auf der Erde zu sichern und gleichzeitig ein gutes Leben für möglichst alle zu ermöglichen.
Noch verbraucht die Menschheit wesentlich mehr Natur, als nachwachsen kann, heizt das Klima auf, beutet Menschen aus und vernichtet Arten in rasanter Geschwindigkeit. Dies liegt an der Art des Wirtschaftens, die seit der Industrialisierung auf der Nutzung der fossilen Brennstoffe und dem gigantischen Verbrauch von Ressourcen beruht. Die Zivilisation überlebt auf Dauer nur innerhalb der planetaren Grenzen.
Für eine zukunftsfähige Wirtschaft bräuchte es eine große Transformation, wofür sich satte 72 Prozent der Weltbevölkerung tatsächlich aussprechen.1
Es gibt wegweisende Ideen und bewundernswerte Beispiele eines zukunftsfähigen Wirtschaftens. Aber bislang existieren diese Ansätze nur wie Inseln des Wegweisenden, die sich winzig ausnehmen gegenüber Ozeanen des Rückwärtsgewandten. Damit diese Inseln wachsen und sich weiter vernetzen können, bräuchte es einen umfassenden Paradigmenwechsel, weg von einer zerstörenden hin zu einer regenerativen Wirtschaftsweise.
Dafür gibt es physikalische, technologische und wirtschaftliche Hürden, aber vor allem gewaltige mentale und soziale Hindernisse. Eine regenerative Ökonomie erscheint vielen so utopisch wie Menschen im Mittelalter wohl eine parlamentarische Demokratie, der Mondflug oder gleiche Rechte für alle. Doch warum sollte nicht gelingen, was der Menschheit immer wieder gelang: vermeintlich Utopisches umsetzen, gesellschaftlich und wirtschaftlich vorankommen. Im Falle der Sklaverei und des Kolonialismus wurde die zutiefst inhumane Ausbeutung eines Teils durch einen anderen Teil der Menschheit, die die Machthabenden als ökonomisch erachteten, auch nach langen Kämpfen beendet.
Einiges spricht dafür, dass die kommunistische Partei in China die Bevölkerung zu einem nachhaltigeren Wirtschaften und Leben zwingen könnte. Die Mittel dazu hält der Staat in seinen Händen: ein soziales Punktesystem und einen umfangreichen Überwachungsapparat. Libertäre Tech-Feudalisten in den USA arbeiten an ihrer Vision eines durch Künstliche Intelligenz von einer Oligarchie gesteuerten Staates. In wahrhaft demokratischen Gesellschaften kann der Umstieg auf eine regenerative Ökonomie nur aus freien Stücken gelingen – dafür sind erhebliche politische Überzeugungsarbeit und eine echte Veränderungsbereitschaft in Wirtschaft und Politik notwendig.
Menschen müssen überzeugt sein, das Richtige zu tun oder das Richtige zu unterstützen. Maßgeblich für den Erfolg des Transformationsprozesses ist es, ob Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse im Allgemeinen und die notwendigen Veränderungen im Speziellen als gerecht empfinden. Nur dann werden sie in ausreichender Zahl ihr Verhalten ändern. Und nur dann werden sie bereit sein, als freie Menschen ihre Gesellschaft zu verteidigen. Unter welchen Umständen sie dies tun könnten, beziehungsweise was sie daran hindert – damit beschäftige ich mich in diesem Buch. Inspiriert haben mich Begegnungen mit Menschen, die durch ihr Tun und ihre Ideen am Aufbau einer lebenswerten und zukunftsfähigen Gesellschaft arbeiten, als Bauer in Italien oder Brasilien, Sozialunternehmer in Ägypten, Genossenschaftlerin in Berlin, Unternehmer im Bergischen Land, Berater der Bundesregierung, Stadtplaner in Hamburg, vorausblickender Ökonom, Demokratieaktivist, Banker in Bochum, Betriebsrat in der Lausitz, Wissenschaftler in Jena, Sozialarbeiterin in Leicester oder Hausmeister einer Berliner Kultureinrichtung und viele mehr.
ERLEBEN
Dresden, Dezember 2024: Auf Einladung einer Entwicklungsorganisation und der Technischen Universität spreche ich im Bürgerlabor über gesellschaftliche Transformation. Die Anwesenden wissen um die Notwendigkeit, dass die Menschheit ihre Wirtschafts- und Lebensweisen verändern muss, wenn sie die Auswirkungen der diversen Krisen in einem erträglichen Maß halten will: Klimakrise, Zerstörung der Biodiversität, Degradierung der Böden. Einige Zuhörende sind ratlos, wie sie mit Mitmenschen darüber ins Gespräch kommen können, selbst mit jenen, die ihnen nahestehen. Ein junger Mann sagt, dass er oft das Totschlagargument »Ich kann mir das nicht leisten« höre, auch von Menschen, die zweimal im Jahr eine Fernreise machten.
So ergeht es vielen Fürsprechern einer Transformation. Sechs Jahre, nachdem die Klimabewegung an einem Tag mehr als 300.000 Menschen in Deutschland auf die Straße und die Bundesregierung zum Handeln brachte, blitzen sie heute bei vielen Zeitgenossen ab. Dabei hält ein Großteil der Bürger Klimaschutz weiterhin für ein wichtiges Thema, wie Umfragen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergeben. Gleichzeitig haben sie Angst, dass die Schere zwischen Reich und Arm durch die Transformation weiter auseinandergeht.
Angst vor Veränderung
An dem Abend in Dresden erzählt der Mitarbeiter einer Bildungsorganisation, wie glücklich er sei, wenn er junge Menschen im ländlichen Sachsen treffe, mit denen er sich offen über Klimakrise, Artensterben und die Notwendigkeit einer Transformation austauschen könne, denn es seien äußerst seltene Momente. Woher kommen der Pessimismus und Widerwille eines beträchtlichen Teils der Menschen gegenüber der Transformation? Schließlich garantiert nur sie den Erhalt der Natur, eine Begrenzung der Klimaerwärmung und eine Aufbereitung von Böden, alles Dinge, die für das Leben grundlegend sind. Dennoch scheint die Angst vor den notwendigen Veränderungen bei manchen größer zu sein als die Hoffnung auf ein besseres Leben für die gesamte Menschheit inklusive künftiger Generationen. Das hängt mit den vielfältigen Krisen der vergangenen 20 Jahre zusammen: Auf die Finanzkrise (2008) folgten Griechenland- und Eurokrise (2010), die Pandemie und gerissene Lieferketten (2020), die verheerende Flut an der Ahr (2021), der Angriff Russlands auf die Ukraine (2022) und der erneute Amtsantritt des Populisten Donald Trump (2025). Andererseits kennen Menschen in vielen Regionen der Welt seit ihrer Geburt ein ständiges krisenhaftes Geschehen. Auf Reisen in Afrika, Asien und Lateinamerika war ich oft überrascht von der allgemeinen Lebensfreude trotz aller gegenwärtigen Gefahren, wirtschaftlicher Umbrüche und eines Lebens am Rande des Existenzminimums.
Unterschiedliche Transformationserfahrungen
Für heutige Westdeutsche ist eine große Transformation hingegen neu. In den letzten 70 Jahren erlebten sie zwar diverse wirtschaftliche Krisen, wie die Ölkrisen, aber diese gingen vergleichsweise rasch vorüber. Dauerhafte Strukturumbrüche mit gravierenden Folgen beschränkten sich auf einzelne Regionen und Bevölkerungsgruppen, etwa beim Niedergang der Werften in Norddeutschland, der Textilfabriken am Niederrhein oder bei der Schließung der Zechen im Ruhrgebiet und Saarland. Außerdem erstreckte sich diese regionale Transformation oft über längere Zeiträume. Im Falle der Kohlezechen im Ruhrgebiet dauert es beispielsweise mehr als ein halbes Jahrhundert, was Zeit zur Anpassung ließ. Zudem federte die Politik die Folgen für die Beschäftigten großzügig ab. Vor allem aber gediehen andere Wirtschaftszweige, die neue Chancen boten. Anders verlief es in Ostdeutschland nach der Wende, wo die Transformation abrupt verlief. Viele Betriebe überlebten den Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft nicht, und viele Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.
In ihren Familien- und Freundeskreisen hätten viele traumatische Erfahrungen mit der damaligen Transformation gemacht, höre ich an dem Abend in Dresden. Sicher gebe es diejenigen, die während der Wende aktiv die Demokratiebewegung in der DDR vorangebracht und sich in der friedlichen Revolution 1989 als wirkmächtig erlebt hätten und positiv auf ihre Erfahrungen mit der Transformation zurückblicken könnten. Für die meisten Menschen in der DDR habe dies jedoch nicht gegolten, für sie sei damals eine Welt zusammengebrochen, und sie hätten sich überfordert gefühlt von der neuen Situation. Diese Unsicherheit und das Unbehagen ist etwa in den Blicken der Arbeitenden einer Belegschaftsversammlung des volkseigenen Betriebs Varna bei der Bekanntgabe der Schließung ihres Produktionsstandortes zu erkennen. Der Ostkreuz-Fotograf Harald Hausmann hatte die Belegschaft 1992 fotografisch festgehalten.
Der Systemwettbewerb zwischen West und Ost hatte nur einen Gewinner. Dabei hatte die DDR sogar im Westen als ein wirtschaftlich vergleichsweise erfolgreicher Staat gegolten. Nach der Wende aber dominierte allein das Narrativ eines Unrechtsstaates, was angesichts der Überwachung großer Teile der Bevölkerung durch die Staatssicherheit und die Inhaftierung politischer Gegner natürlich seine Berechtigung hatte. Aber es gab auch eine andere Seite, so sorgte der Staat für Arbeit, Wohnen und Gesundheitsversorgung, weswegen die Menschen in großer sozialer Sicherheit lebten. Von manchen Errungenschaften hätte das gesamte wiedervereinigte Deutschland profitieren können, wie etwa Kitas oder Polikliniken. In den mehr als 600 Polikliniken, die staatliche Einrichtungen waren, versorgten festangestellte Ärzte Patienten ambulant. Das Konzept stammte noch aus der Kaiserzeit, aber die DDR hatte das System ausgebaut. Tür an Tür praktizierten Allgemeinmediziner und Fachärzte, die sich die Nutzung teurer Apparate teilen konnten, und Patienten hatten keine langen Wartezeiten.
Not macht erfinderisch
Die Umwelt litt unter der Art der industriellen Produktion während des Bestehens der DDR hingegen sehr. Die Situation war mancherorts dramatisch schlecht, etwa infolge des Abbaus von Uran in Wismar oder der Belastungen im Chemiedreieck Bitterfeld. Rund 80 Milliarden Euro investierte der deutsche Staat nach der Wende in die Sanierung von derartigen Altlasten, gleichzeitig vergab man die Chance auf eine andere Wirtschaftsweise. In der DDR waren die Menschen gezwungenermaßen sparsam mit Ressourcen umgegangen. Schon Anfang der 1950er hatte die DDR das volkseigene Kombinat Sekundärrohstofferfassung (SERO) und ein dichtes Netz an Annahmestellen geschaffen. Wer bestimmte Altwaren einsammelte und abgab, bekam dafür sogar Geld, etwa für einsatzfähige Gläser, Altpapier oder Thermoplastabfälle. Es existierten auch Sammelbrigaden. Bei diversen Materialien hatte die DDR verglichen mit anderen Industrieländern hohe Wiederverwertungsquoten, ohne dass es dafür eines aufwendigen Systems wie in Westdeutschland mit dem Grünen Punkt bedurft hätte.2 Die Ressourcen waren knapp, und Not macht bekanntlich erfinderisch. Erfüllung konnten Menschen anders als im Westen kaum im Konsum finden, denn das Warenangebot war äußerst begrenzt. Doch genau dies hatte einen Wert und war gleichzeitig gut für die Umwelt, obwohl das gar nicht direkt intendiert gewesen war. Hieran im Sinne einer ressourcenschonenderen Wirtschaft anzuknüpfen hätte sich gelohnt, geschah aber nicht. Stattdessen sahen viele Menschen ihre Erfahrungen und ihren Lebensstil nach der Wende entwertet und mussten um ihre Existenz kämpfen.
Alte Wunden brechen auf
2021, Chemnitz: Wie gehen Gewerkschaften mit der Klimakrise um? Auf der Suche nach Antworten fahre ich in die sächsische Industriestadt in der Lausitz. Seine Mutter habe bei der großen Kündigungswelle nach der Wiedervereinigung ihren Job verloren, erzählt der Elektrotechniker und Gewerkschafter Lars Kaczmarek im Gewerkschaftshaus der IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE). Bezüglich der Transformation sei er hin- und hergerissen. Er gehörte zu den wenigen Gewerkschaftern in der Region, die öffentlich mit Klimaaktivisten von Fridays for Future diskutierte. Es seien gute Gespräche, aber er könne auch die Sorgen der Menschen vor einem erneuten Einschnitt in der Lausitz verstehen, das Herz der Energieversorgung in der DDR. Er habe den Niedergang nach der Wende erlebt, nach dem Abitur hätten sich fast alle seine Mitschüler verabschiedet und seien nach München, Berlin, Leipzig oder ins Ausland gegangen, »Also ich kann sagen, 90 Prozent sind gegangen, und das ist etwas, was mir sehr weh tut.«3
Er blieb und begann 2008 eine Ausbildung beim schwedischen Konzern Vattenfall, der mittlerweile in der Lausitz die Braunkohle abbaut und verstromt, ein sicherer Job mit überdurchschnittlicher Bezahlung. Er legte sich ins Zeug, qualifizierte sich, engagierte sich in der Gewerkschaft. Dass die Tage der Braunkohle wegen der Klimakrise gezählt sind, sei ihm erst klar geworden, als die »Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung« 2018 ihre Arbeit aufgenommen habe. Das Ergebnis war eindeutig: Spätestens 2038 würden die Belegschaften in den Tagebauen der Lausitz und dem Rheinischen Revier zum letzten Mal Braunkohle abbaggern. Die anstehenden Veränderungen seien gewaltig, sagt Lars Kaczmarek: »Energiewende heißt ja wirklich, alle Bereiche anzufassen«, also Energieerzeugung, Bau, Verkehr, Frachtbetrieb, Fliegen und alles, was damit zusammenhängt.
Als Erstes trifft die Transformation die Menschen als Arbeitnehmer, allen voran in der Automobilindustrie. Hier könnten in Gesamtdeutschland 190.000 Stellen bis zum Jahr 2035 wegfallen.4 Natürlich gibt es auch andere Jobs, aber wer will einen gut bezahlten Job bei VW in Zwickau mit dem eines Pflegers im Altersheim tauschen? Dafür müsste sich einiges an den Arbeitsbedingungen von Pflegenden ändern. Vor der Transformation haben viele Menschen Angst, vor allem jene mit weniger Geld, die schon seit der Inflation den Gürtel enger schnallen müssen. Mit Blick auf die Transformation wünschten sich viele Bürger durchaus einen gestaltenden Staat, sagt Jan Eichhorn, Gründer und Partner des Think Tanks Dipart: »Aber viele trauen dem Staat nicht zu, dass er die Transformation gestalten kann.«5
Dauerhaft dürfte es Wohlstand im rohstoffarmen Deutschland nur geben, wenn sich das Land zu neuen Ufern aufmacht. So könnte der Aufbau einer echten Kreislaufwirtschaft große Chancen für die Industrie bieten, ebenso wie viele andere Projekte. Damit es gelingt, müssen sich Menschen für den Wandel an vielen Stellen ins Zeug legen. Mitmachen dürften die meisten bei der Transformation nur, wenn sie davon ausgehen, dass sie auch morgen ein erfülltes Leben führen werden. Hieran haben viele Menschen berechtigte Zweifel, angesichts einer Menge negativer Erfahrungen, die sie bei Transformationen in den vergangenen 30 bis 40 Jahren entweder selbst gemacht oder beobachtet haben.
Wirtschaftserholung ist kein Automatismus
Mit den Folgen von Transformation hat der Staat die Betroffenen häufig alleine gelassen, seien es Menschen in Ostdeutschland, Nordengland oder im Rust Belt in den USA. Aber eine regionale Wirtschaft erholt sich nicht automatisch von einem Umbruch, wie es marktliberale Wirtschaftsberater und Politiker immer versprochen haben. Wäre ihre Rechnung aufgegangen, hätte ein Mehr an Liberalisierung und Globalisierung am Ende ein Mehr an Wohlstand für alle geschaffen. Aber das war nicht der Fall, weil in der Praxis die Gewinner der Transformation eben nicht die Verlierer entschädigten. Auch die Umweltpolitik führte bislang häufig zu einer Umverteilung von unten nach oben, und das wird in der anstehenden Transformation wieder geschehen, wenn es gesellschaftlich nicht anders gelöst wird.
»Ich fürchte, der Niedergang von Industrien ist der Preis wirtschaftlicher Entwicklung«, sagt Ifo-Chef Clemens Fuest, einer der einflussreichsten wirtschaftspolitischen Berater in Deutschland. Mit Blick auf den Niedergang von bestimmten Regionen ergänzt er: »Die Deindustrialisierung in manchen Regionen durch den China-Schock zeigt, dass es in der Tat keine Garantie dafür gibt, dass sich solche Regionen erholen.«6
Dank des Mindestlohns ist die Zahl der Menschen im Niedriglohnsektor in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar um mehr als eine Million gesunken. Trotzdem verdienten laut Statistischem Bundesamt im April 2023 rund 6,4 Millionen abhängig Beschäftigte weniger als 13,04 Euro brutto pro Stunde, also rund jeder sechste Beschäftigte. Deutschland gehört immer noch zu den Ländern in der EU mit einem hohen Anteil von Beschäftigten im Niedriglohnsektor.7
Infolge des Eintritts von Schwellenländern wie China in die internationale Arbeitsteilung verschärfte sich die weltweite Konkurrenz unter den Standorten. Um die heimischen Unternehmen zu stärken, senkten Industrieländer seit den 1990er Jahren die Unternehmenssteuern. Deutschland kappte stufenweise den Körperschaftssteuersatz, damals 40 Prozent für thesaurierte Gewinne und 30 Prozent für ausgeschüttete Gewinne bis 2008 auf einheitlich 15 Prozent. Um wettbewerbsfähiger zu werden, senkten Staaten zudem die Sozialleistungen, was vor allem Menschen zu spüren bekamen, die von der Transformation betroffen waren.
Schlechte Erinnerungen
Regierungen bürdeten ihren Bürgern mit marktliberalen Wirtschaftsreformen ab den 1990er Jahren mehr Risiken auf. Gleichzeitig verabschiedete sich die öffentliche Hand teils aus der Daseinsvorsorge, als sie Wohnungen, Pflege- oder Kinderheime oder Eisenbahnen privatisierte. Den Zuschlag bei diesen Privatisierungen bekamen häufig Investoren, die nicht an bezahlbarem Wohnen, guter sozialer Arbeit und einem funktionsfähigen Zugverkehr interessiert waren, sondern aus Grundstücken und Infrastrukturen Rendite für ihre Anleger ziehen wollten. Westliche Wohlfahrtsstaaten änderten ihre Sozialpolitik. Den Anfang machte der demokratische US-Präsident Bill Clinton 1996. Mit dem Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act beendete seine Regierung das seit dem New Deal der 1930er Jahre bestehende Sozialhilfesystem. Der Staat limitierte den Bezug von Sozialhilfe für jeden Bürger auf maximal fünf Jahre und setzte den Schwerpunkt auf Arbeitsvermittlung statt reiner finanzieller Unterstützung.
Auf dieses Prinzip vertraute bald auch die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder. Anfang der 2000er Jahre steckte Deutschland in einer schweren Wirtschaftskrise mit mehr als fünf Millionen Arbeitslosen. Es gab neue Konkurrenz für deutsche Firmen, insbesondere aus Schwellenländern wie China. 2002 entwickelte eine Kommission unter Leitung des damaligen VW-Personalvorstands Peter Hartz Vorschläge für eine effizientere Arbeitsmarktpolitik, die sich später in der Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung wiederfanden, besser bekannt als Hartz-Reformen.
Eines der Hauptargumente sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gewesen, sagt rückblickend der SPD-Politiker Klaus Barthel, der die Hartz-Reform ablehnte. Aber Wettbewerbsfähigkeit sei damals so definiert worden, dass wir unter den Bedingungen der Globalisierung »nicht besser sein müssen als andere, sondern vor allen Dingen billiger.«8 Zu den Anhängern der Reformen, die auch von der damaligen Opposition aus CDU/ CSU und FDP mitgetragen wurden, zählte Peter Clever, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber. »Man brauchte diese Reform, weil wir waren ja wirklich auf dem Weg permanent steigender Arbeitslosigkeit. Und übrigens: Jeder Konjunkturaufschwung endete mit einer höheren Sockelarbeitslosigkeit als der vorhergehende.«9 Von 1973 bis 2001 erhöhte sich deutlich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland, »sprunghaft in Rezessionen« wie 1973, 1980 bis 1982, 1993 und 1996. In den Aufschwungphasen »stagnierte die Arbeitslosigkeit zunächst auf hohem Niveau und sank anschließend nur leicht ab. Anfang der 2000er Jahre lag sie bei über drei Millionen Arbeitslosen.«10
Eng gespanntes Sicherheitsnetz
Für die Betroffenen in Deutschland waren diese Reformen schmerzhaft. Wer früher seine Arbeit verloren hatte, war in großem Ausmaß vor einem Abstieg geschützt gewesen. Das Sicherheitsnetz war eng gespannt: Zunächst erhielten die Menschen Arbeitslosengeld, danach Arbeitslosenhilfe – sie betrug für einen Alleinstehenden 53 Prozent des letzten Nettolohns. Man konnte sie grundsätzlich unbegrenzt beziehen, in gewissem Umfang nebenher arbeiten und den Hauptteil seines Vermögens behalten, sofern vorhanden. Damit machte die Politik durch die Hartz-Reformen Schluss. Fordern statt Fördern war nun auch in Deutschland die Devise für den Umgang des Staates mit seinen Bürgern. Es galt fortan ein geringes Schonvermögen, neben einem Grundfreibetrag von 150 Euro pro Lebensjahr, mindestens aber 3.100 Euro, ein zusätzlicher Altersvorsorge-Freibetrag von 750 Euro je Lebensjahr. Wer vorher Jahrzehnte gearbeitet und gespart hatte, musste dies als Ungerechtigkeit empfinden. Wer Hartz IV vermeiden wollte, musste jede Arbeit annehmen, auch wenn sie unterhalb der eigenen Qualifikation lag.
Arbeitslose weichkochen
2017, Berlin: Wie haben sich die Hartz-IV-Reformen auf das Leben von Menschen ausgewirkt? Auf der Suche nach Antworten begebe ich mich nach Berlin-Pankow. Ein kleiner Bus mit dem rot-blauen Schriftzug »Beratung« steht im Schatten der dortigen Bundesagentur für Arbeit, einem sechsstöckigen Betonklotz. Es ist ein windiger und kalter Apriltag. Zwei Sozialarbeiter und ein Fahrer bilden das Team des mobilen Beratungszentrums des Berliner Arbeitslosenzentrums, der ältesten Initiative dieser Art in Deutschland. »Irren ist amtlich – Beratung kann helfen« steht auf einem ihrer Flyer. Der Sozialarbeiter Markus Wahle unterstützt seit mehr als zwei Jahrzehnten Menschen dabei, ihre Rechte im Jobcenter durchzusetzen. Mit dem Bus klappert sein Team für jeweils zwei Tage alle Arbeitsagenturen in Berlin ab.
Wahle hat Betroffene vor und nach den Hartz-Reformen erlebt und erhebliche Verhaltensänderungen festgestellt. »Das hat zwei Jahre gedauert, dann sind die Leute klein gekocht gewesen.« Der Umgangston in den Jobcentern sei teils rüde, ständig werde versucht, den Leuten vorzumachen, dass sie selber schuld seien an ihrer Arbeitslosigkeit. Dabei seien für Langzeitarbeitslose generell die Aussichten äußerst gering, noch einmal eine Arbeitsstelle zu finden. Und die Chancen verschlechterten sich, wenn der Betroffene keine oder nur eine geringe Qualifikation habe, krank oder älter als 55 Jahre alt sei. »Von Vermittlungshemmnissen wird dann im Arbeitsagentur-Jargon gesprochen«, sagt der Berater. Von solchen Hemmnissen gebe es eine lange Liste. Die statistische Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen, halbiere sich mit jedem Vermittlungshemmnis. Teilweise läge die Chance auf einen Arbeitsplatz bei einer Größenordnung von zwei bis vier Prozent. »Ihnen wird aber ständig erzählt, sie müssten mehr Bewerbungen schreiben.«11
Nicht nur Hartz-IV-Empfänger waren von den Reformen betroffen. Sie hätten allgemein »zu Einschüchterung geführt, zusammen mit den anderen Formen von Prekarität, von Leiharbeit, von Werkvertrag, von Befristung, sodass vielen der Mut gefehlt hat, sich im Betrieb für ihre Rechte einzusetzen«, sagt der SPD-Wirtschaftspolitiker Klaus Barthel rückblickend. Dies zeigt sich bei einem Streik von Arbeitern bei Amazon in Bad Hersfeld. Seit 2013 haben Beschäftigte dort mehrfach die Arbeit niedergelegt, um in ihrem Unternehmen einen Tarifvertrag durchzusetzen. Doch selbst unter den Streikbereiten ist bisweilen Angst spürbar. Nach Reden mit großem Pathos und viel Beifall geht es darum, wer als Streikposten mitmacht. »Bitte gebt mal Handzeichen«, sagt ein Betriebsrat von der Bühne. Kein Arm geht hoch. »Das kann doch nicht sein, Leute, wir kämpfen doch alle, da müssen wir mitziehen!« Wer diese Szene erlebt und sich mit den Streikenden über ihre Angst vor Hartz IV unterhalten hat, ahnt, welche Spuren diese Reformen in Deutschland hinterlassen haben. Von einem Schaden für die Demokratie sprach Annelie Buntenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund: »Hartz IV hat sich eingebrannt in viele Köpfe als Angst vor dem Absturz«. Für viele sei der aufrechte Gang im Betrieb zur Mutprobe geworden. »Das ist nicht die Demokratie, die wir wollen und die wir brauchen.« Und dann stellte die Gewerkschafterin eine zentrale Frage: »Welches Recht auf eine Freiheit von Existenzangst gibt es eigentlich?«12
Wirtschaftliche Sorgen bis in die Mittelschicht
Die fetten Jahre Deutschlands in den 2010er Jahren, als die Exportwirtschaft florierte und die Waren »Made in Germany« sich fast von selbst verkauften, gingen an den Menschen mit geringerem Einkommen weitgehend vorbei. Auf dem Arbeitsmarkt des Exportweltmeisters hatte sich vielmehr einer der größten Niedriglohnsektoren in der EU gebildet.13 Arme seien während dieser Zeit gegenüber anderen Einkommensgruppen sogar noch weiter zurückgefallen, heißt es im Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Schon vor der Inflationswelle hätten mehr als 40 Prozent der Armen und über 20 Prozent der Menschen in der Gruppe mit prekärem Einkommen keinerlei finanzielle Rücklagen gehabt, um kurzfristige finanzielle Notlagen zu überbrücken. Rund zehn Prozent der Armen waren zudem finanziell nicht in der Lage, abgetragene Kleidung zu ersetzen.14
Über die Pandemie und den Inflationsschub zwischen 2020 und 2023 hätten sich die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage noch einmal deutlich verschärft, und zwar nicht nur unter den Ärmeren, sondern »bis weit in die Mittelschicht hinein«. Seit 2020 ist die Kaufkraft um ein Fünftel gesunken. Die Inflation betrifft Haushalte stärker, je geringer ihre Einkommen sind, denn sie treibt besonders die Preise von Gütern des Grundbedarfs wie Lebensmittel und Energie in die Höhe. Dafür geben einkommensschwache Haushalte vergleichsweise viel aus. Seit dem Jahr 2020 sind die Mieten gehörig gestiegen. Mit materiellen Einschränkungen und Zukunftssorgen gehe vor allem bei ärmeren Menschen eine erhebliche Distanz zu wichtigen staatlichen und politischen Institutionen einher, zeigt der WSI-Verteilungsbericht: »Weniger als die Hälfte der Armen und der Menschen mit prekären Einkommen findet, dass die Demokratie in Deutschland im Großen und Ganzen gut funktioniert. Sie sehen für sich auch nicht die Möglichkeit, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Rund ein Fünftel vertraut dem Rechtssystem allenfalls in geringem Maße.«15
Inzwischen steigen die Preise zwar langsamer, aber viele haben weiterhin Ängste. In einer Umfrage in der deutschen Bevölkerung gaben im Oktober 2024 die meisten nicht Migration, Krieg oder Klimakrise als Hauptsorge an, sondern steigende Lebenshaltungskosten.16
Wie Parteien einen Menschen verloren
2021, Berlin: Warum geht jemand grundsätzlich nicht wählen? Für einen Podcast zu dem Thema interviewe ich Piotr Grzebinski. Er lebt derzeit in einem Wohnheim und freut sich riesig, dass er eine Arbeit in der Schlesischen 27 gefunden hat, einem internationalen Jugend-, Kunst- und Kulturhaus mit offenen Werkstätten im Berliner Bezirk Kreuzberg.17 Nachdem er 1978 aus Polen abgehauen war, weil er als überzeugter Pazifist nicht schießen lernen wollte, war er zunächst obdachlos. Sein Vater hatte ihn nach Deutschland eingeladen, ihn dann aber doch nicht aufgenommen. Dank seines Selbstbehauptungswillens schaffte er den Sprung von der Straße, heiratete, bekam zwei Kinder, schuftete hart auf Baustellen. Nach der Scheidung rutschte er wieder ab.
»Ich habe meinen Glauben an die Politiker schon seit Jahren verloren«, sagt er. Das letzte Mal gewählt habe er irgendwann in den 1990er Jahren. Dabei denkt und handelt der mittlerweile 54-Jährige politisch, geht etwa regelmäßig demonstrieren. Was die Umgangsweise im heutigen Wirtschaftssystem mit der Natur anbelangt, ist er desillusioniert. Die Gier nach Geld sei entscheidend. Da fälle jemand einen Baum, dass der »frische Luft macht, ist ihm scheißegal. Hauptsache, er kriegt Geld für den Baum«. Er hat eine Vorstellung davon, was politisch notwendig wäre, vor allem ein »radikales Umsteuern« unserer Gesellschaft im Verhältnis zur Natur. Er wolle, dass seine Kinder auch ihren Kindern noch »die Welt zeigen können«. Deswegen isst er kaum noch Fleisch, kauft möglichst unverpackte Produkte, hält Glück durch Besitz für einen Trugschluss und würde am liebsten auf einer einsamen Insel leben.18
Fragt man ihn, warum er nicht mehr wähle, spricht er über seine Enttäuschung von Politikern, was schon bei der Sprache anfange. Sie redeten oft in einer Art und Weise über Sachverhalte, die er nicht verstehe. Am Deutsch liegt es nicht. Grzebinsiki spricht es gut, hat es auf den Berliner Straßen von anderen Obdachlosen gelernt. Es sei wahnsinnig, wie schnell sich seit den 1970er Jahren alles entwickelt habe. »Das ist Wahnsinn, aber wir müssen auch bremsen, weil das führt zu keiner wunderschönen Welt, sondern das wird ein Müllhaufen da draußen. Und wir sind schuld.«19
Abwendung von demokratischen Institutionen
2018. Leipzig: Warum wählen manche Arbeitende rechtsextreme Betriebsräte? Um bei Betriebsratswahlen dabei zu sein, mache ich mich auf in ein Werk von Porsche. Davor drehen auf einer Rennstrecke Privatleute Runden in einem blauen, gelben oder roten Porsche. Sie flitzen knapp hintereinander durch enge Kurven und über einen Hügel – immer wieder. Rettungssanitäter stehen bereit. Daneben liegt ein grau-schwarzer Gebäudekomplex – die Montagehalle. Innen ist sie blitzblank. Arbeiter bauen die Luxusautos fast lautlos am Band zusammen. Transportfahrzeuge gleiten über den Boden und bringen Nachschub an Ersatzteilen. Mittendrin ist das Büro des Betriebsrates, dessen Vorsitzender ist Knut Lofski: »Wir arbeiten rund um die Uhr. Drei-Schicht-Betrieb: Montage, Karosseriebau, Lackiererei.«20
Lofski hat seinen Kfz-Meister in der DDR gemacht, nach der Wende einige Jahre in Frankfurt am Main gearbeitet und dann bei Porsche begonnen, als das Werk hier entstand. Er gehörte zu der kleinen Gruppe Beschäftigter, die sich schnell für die Bildung eines Betriebsrates einsetzten. Von Anfang an war er dort Mitglied, bald der Vorsitzende. Ein Job bei Porsche sei wie ein Sechser im Lotto, findet er. »Die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen, die kann man suchen in Deutschland, das muss man fairerweise sagen: klimatisierte Räume, die Montage sauber, Handschuhe an, tolle Arbeitskleidung.«21
Jüngst erhielten die Mitarbeiter ihren Jahresbonus, wer lange dabei ist, sogar knapp 10.000 Euro. Einige Mitarbeiter votierten trotzdem nicht für die IG Metall für den Betriebsrat, sondern für die Organisation Zentrum Automobil mit Verbindungen zum rechten AfD-Flügel um Björn Höcke.22 Immer wieder erzähle deren Vorsitzender Oliver Hilburger die gleiche Geschichte, wie ökologisch und ökonomisch unsinnig ein Wechsel zur Elektromobilität sei, und rede über »eine Verstrickung von Großkonzernen und linken Gewerkschaften«.
Zu Hochzeiten kam das Zentrum Automobil auf etwa 20 Betriebsräte bei Autobauern wie Mercedes, BMW und Porsche.23 Mittlerweile haben sie einige Mandate verloren, aber die Affinität von Arbeitern für die AfD ist dennoch gestiegen. Auch viele Facharbeiter mit gutem Einkommen entscheiden sich für diese Partei. Bei der Bundestagswahl 2025 wählten 38 Prozent der Arbeiter und 34 Prozent der Arbeitslosen die AfD. Die Union kreuzten 22 Prozent der Arbeiter auf dem Wahlzettel an, die SPD 12 Prozent, die Linke 8 Prozent, die Grünen und BSW je 5 Prozent und die FDP 4 Prozent.24
AfD-Wähler zeichnen sich durch ein hohes Maß an Misstrauen gegenüber staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen aus, gleichzeitig berichten sie überdurchschnittlich häufig von großen Belastungen und Sorgen. Diese beträfen ihre eigene wirtschaftliche Situation, die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes oder ihrer Altersvorsorge, aber auch die soziale Ungleichheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Um zumindest Teile der AfD-Wählerschaft für das demokratische Spektrum zurückzugewinnen, brauche es »gute Politik, die Probleme und empfundene Ungerechtigkeiten angeht und löst«, so WSI-Forscher Andreas Hövermann. »Wenn aber öffentliche Infrastruktur häufig nicht funktioniert oder bezahlbarer Wohnraum in vielen Regionen ausgesprochen knapp ist und hier tatsächliche Konkurrenzsituationen mit zugewanderten Personen entstehen, wenn unzureichend Geld zur Verfügung gestellt wird, um ankommende Menschen erfolgreich zu integrieren, ist all das Wasser auf die Mühlen der politischen Akteure, die weiteres Misstrauen in demokratische Institutionen schüren und einheimische gegen geflüchtete Menschen aufbringen wollen.«25
An der falschen Stelle sparen
Jahrzehntelang betonten die Verfechter einer neoliberalen Politik die Möglichkeiten des Einzelnen und nicht die der Gesellschaft. Nach dieser Devise wurden zahlreiche Institutionen umgestaltet. Viele Menschen erleben dies in ihrem beruflichen Alltag, statt Solidarität und Kooperation gibt es einen brutalen Wettbewerb, in dem sich die Stärkeren behaupten und Schwächere unter die Räder kommen. Systematisch werden Menschen aus ärmeren Schichten seit der neoliberalen Politikwende Aufstiegsmöglichkeiten verbaut.
Deutlich wird dies in der britischen Stadt Leicester mit ihren 370.000 Einwohnern. Das Viertel Highfield erstreckt sich im Rücken des Bahnhofs. Seit dem 19. Jahrhundert kamen hier einige Migrantenwellen an, viele infolge der Weltkriege. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Industriestadt eine Menge Arbeit und Aufstiegschancen durch Hilfsangebote. Ab den 1960er Jahren trafen viele mit asiatischer Herkunft ein, die aber zunächst aus ehemaligen britischen Kolonien in Afrika wie Kenia und Uganda kamen, wo sie nicht mehr gern gesehen waren, danach auch direkt aus Südostasien. Leicester gehört zu den Städten in England, in denen mehr als die Hälfte der Bürger nicht weiß ist. Soziologen sprechen von einer »super-diversen« Stadt.26
Infolge der Finanzkrise von 2008 hat sich die wirtschaftliche Situation der Stadt deutlich verschlechtert. Nach der teuren Bankenrettung schlug die Regierung einen strikten Sparkurs ein. Als Teil ihrer Austeritätspolitik kürzte sie Zuweisungen um die Hälfte, die Kommunen für Angebote jenseits der Sozialtransfers erhielten.
Im Highfield Center gibt es Hilfsangebote für die Bewohner des Viertels: Kleinkindbetreuung, Sportangebote für Jugendliche, Englischkurse für Erwachsene. Der Leiter Priya Thamotheram erzählt, dass das Nachbarschaftszentrum aufgrund des Sparkurses ab 2013 eine halbe Million Pfund weniger jährlich bekommen habe, weshalb man das Angebot habe reduzieren müssen. Statt 25 Angeboten für Jugendliche an sieben Tagen die Woche, einige davon draußen auf der Straße und in Parks, seien es jetzt nur noch zwei Termine pro Woche. Die Wirtschaftslage ist schlecht, die Arbeitslosigkeit hoch. Menschen stünden vor der Wahl »Heating or Eating«, also Geld entweder für Essen oder für Heizen auszugeben, weil es für beides nicht reicht.
Als Dominoeffekt nahmen Frust und Kriminalität zu. Im Oktober 2022 kam es im Viertel zu Unruhen zwischen Gruppen junger Hindu- und muslimischer Männer. Solche Dinge seien auch in der Vergangenheit schon passiert, erzählt Thamotheram. In seinem Büro hängt eine Weltkarte, worauf er ein Schwarz-Weiß-Foto gepinnt hat. Es zeigt einen Fernsehreporter, der ihn 1985 interviewt. Auch damals gab es schon Unruhen in der Stadt, weil sich Menschen sozial benachteiligt sahen. Man habe eingegriffen und die Behörden darauf hingewiesen, dass es mehr brauche, als zusätzliche Polizeikräfte einzusetzen.
»Die Tatsache, dass diese Art von Dienstleistungen, die es vor 20 Jahren gab, nicht mehr verfügbar sind, macht es für junge Menschen viel schwieriger, sich ihren Weg durchs Leben zu bahnen, und sie werden viel schneller in antisoziale Verhaltensweisen verwickelt«, erklärt Thamotheram. Die Einschnitte spürten die Sozialarbeiter besonders schmerzhaft bei einem besonderen Programm, das den Sparmaßnahmen zum Opfer fiel. Das Highfield Center hatte an der Universität 13 Jahre lang einen Kurs organisiert, in dem Jugendliche etwas über den Kolonialismus und Neokolonialismus erfahren konnten. Sie sollten die Hintergründe für ihr Leben in der Community verstehen. Rund 500 Jugendliche hätten teilgenommen, einige davon später ihren Master gemacht und sogar fünf einen Doktortitel erworben. Wenn sie sich für den Kurs einschrieben, betraten sie eine »ganz andere Welt, eine neue Realität«, sagt Thamotheram. Für die Nutzung der Unibibliothek und anderer Services habe man je Teilnehmer eine Gebühr von 150 Pfund gezahlt. Aber dann habe die Labour-Regierung unter Tony Blair Stipendien gestrichen und Studiengebühren eingeführt, die durch die Tories später noch erhöht wurden. Die Universität habe von dem Zentrum nun je Teilnehmer eine jährliche Gebühr von 6.000 Pfund gefordert. Statt 20 bis 25 junge Menschen saßen so nur noch zwei in dem Kurs, bevor das Angebot ganz gestrichen wurde.