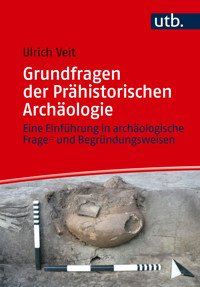
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie im Zusammenspiel zwischen einem einzigartigen Bestand an materiellen Überresten, einem differenzierten Methodenapparat und einem sich stetig verändernden Erkenntnisinteresse archäologisches Wissen entsteht. Mit Fokus auf die Prähistorische Archäologie, ihre wechselhafte Geschichte sowie ihre in mancher Hinsicht prekäre Zukunft beleuchtet der Band die sich wandelnden Ziele, Voraussetzungen, Theorien und Konzepte archäologischen Forschens sowie die damit verbundenen kulturellen Praxen und entwickelt eine Zukunftsperspektive für das Fach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 870
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ulrich Veit
Grundfragen der Prähistorischen Archäologie
Eine Einführung in archäologische Frage- und Begründungsweisen
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Ulrich Veit lehrt Ur- und Frühgeschichte an der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Gräber-, Siedlungs- und Sozialarchäologie im europäischen Raum. Außerdem beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit Fragen der archäologischen Theoriebildung und Methodologie sowie mit wissenschaftsgeschichtlichen Themen.
Umschlagabbildung: In situ-Aufnahme eines freigelegten Urnengrabs der späten Bronzezeit/frühen Eisenzeit aus Cuxhaven-Berensch (Niedersachsen).
Foto: © Professur für Ur- und Frühgeschichte, Universität Leipzig.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564081
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6408
ISBN 978-3-8252-6408-6 (Print)
ISBN 978-3-8463-6408-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Das vorliegende Buch ist keine klassische Facheinführung, die Studienanfängerinnen und Studienanfänger an den Methoden- und Wissenskanon eines bestimmten Studienfaches heranführt. Im Mittelpunkt meiner Darstellung stehen vielmehr die theoretischen und methodologischen Grundlagen der Archäologie, die ich am Beispiel der Prähistorischen Archäologie herausarbeiten möchte. Dazu stelle ich die Theorien und Konzepte zur Debatte, die die archäologische Forschung anleiten und spüre zugleich ihrer Genealogie nach. Neben den einschlägigen programmatischen Stellungnahmen und ausgewählten Fallstudien müssen dabei aber auch die vielfältigen Praxen archäologischen Forschens einschließlich ihres akademischen wie gesellschaftlichen Kontexts in den Blick genommen werden. Denn ohne diese Praxen würde es auch die einschlägigen Theorien und Konzepte nicht geben.
Ziel dieses Buchs ist eine kritische Bilanz und Revision des Projekts einer ›Prähistorischen Archäologie‹ (bzw. ›Ur- und Frühgeschichte‹), das vor rund zweihundert Jahren entstand und vor rund hundert Jahren erste akademische Würden errang. Seither hat dieses Fach eine dynamische Entwicklung durchlaufen, in deren Rahmen sich nicht nur beständig neue Perspektiven auftaten, sondern immer wieder auch vermeintliche disziplinäre Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt wurden. Dies gilt insbesondere für die letzten drei bis vier Jahrzehnte, die zu einer vorher unbekannten Unübersichtlichkeit geführt haben. Hier werde ich versuchen, rückblickend etwas Ordnung in die unterschiedlichen Diskursstränge und fachlichen Auseinandersetzungen zu bringen. Ebenso wichtig scheint es mir aber, die fachlichen und philosophischen Grundlagen, von denen diese Debatten ausgingen, im Auge zu behalten. Denn nur so wird deutlich, welchen Weg das Fach gegangen ist und warum es heute dort steht, wo es steht. In diesem Sinne liegt der Fokus der Studie – anders als wir es gewohnt sind – eher auf der longue durée als auf dem dernier crie der archäologischen Theorie- und Methodendebatte. Dies bestimmt auch die Auswahl der Referenzen. Neben aktuellen Beiträgen verweise ich selektiv auch auf wichtige Arbeiten aus älteren Forschungsperioden, die neu zu lesen und zu bewerten mir lohnenswert erscheint.
Die Ideen, die ich hier präsentiere sind nicht neu, sondern das Ergebnis einer längeren Beschäftigung mit dem Thema. Ein wesentlicher Impuls für die Entstehung dieses Buches war die Absicht, einmal zusammenfassend die Grundzüge jener Fachtheorie zu präzisieren, deren Konturen ich in verschiedenen, weit verstreut publizierten Vorarbeiten angerissen habe. Bei der konkreten Textarbeit zeigte sich allerdings, dass es dazu nicht ausreichen würde, die existierenden Vorarbeiten aus mittlerweile rund vierzig Jahren lediglich nebeneinander zu stellen. Vielmehr erwies es sich als nötig, die vorhandenen Bausteine neu zusammenzufügen, das Themenspektrum zu ergänzen und die Darstellung soweit wie möglich an den aktuellen Diskussionsstand anzupassen. Denn auch wenn mein Kernanliegen das Gleiche geblieben ist, wie jenes, das ich im Untertitel meines ersten Beitrags zu diesem Thema im Jahre 1984 formuliert habe (»Ansätze zu einer theoretischen Grundlegung der Vorgeschichte«), so hat sich zwischenzeitlich nicht nur meine Perspektive auf das Fach verändert, sondern ebenso das Fach selbst und die Welt, in der es steht.
Insofern schien es mir folgerichtig, die Veränderungen selbst zum Gegenstand meines Nachdenkens zu machen, allerdings ohne dabei den historischen Kern des Projekts ›Prähistorische Archäologie‹ ganz aus den Augen zu verlieren. Zugleich war es mir wichtig aufzuzeigen, dass die verhandelten archäologischen Frage- und Begründungsweisen Vorläufer und Entsprechungen in zahlreichen anderen Wissenschaftsbereichen, auch jenseits der Kulturwissenschaften, besitzen, die uns heute als Brücken zur inter- bzw. transdisziplinären Verständigung dienen können.
Wenn der Hauptitel dieses Buches an Karl Hermann Jacob-Friesens bemerkenswerten Band »Grundfragen der Ur- und Frühgeschichtssforschung« aus dem Jahre 1928 anschließt, so ist dies zwar kein Zufall, dahinter verbirgt sich indes keine programatische Aussage. Dazu sind die beiden Arbeiten und die Umstände unter denen sie entstanden, viel zu unterschiedlich (s. die Einführung zu Kap. 3). Neben dem Bezug zur Stadt Leipzig, in der Jacob-Friesen (1886–1960) seine Karriere begann, teile ich mit ihm aber immerhin die Grundhaltung, die in seinem vielzitierten Motto zum Ausdruck kommt: »Voraussetzung für Wissenschaftlichkeit ist nicht Glaube, sondern Zweifel« (ebd. 1).
Um eine Überschaubarkeit der Darstellung zu gewährleisten habe ich Zahl und Umfang der Kapitel dieses Buches – und damit zugleich seine inhaltliche Spanne – bewusst begrenzt. Dazu gehört zunächst, dass ich auf die detaillierte Behandlung einzelner Forschungsmethoden und -techniken vollständig verzichtet habe. Dies scheint mir auch deshalb gerechtfertigt, da diese Methoden in verschiedenen speziellen Einführungen von ausgewiesenen Experten bereits kompetent dargestellt worden sind.
Angesichts der Gefahr, sich zu sehr im Detail zu verlieren, musste auch der Umfang der behandelten Phänomene begrenzt werden. So habe ich beispielsweise auf eine breite Darstellung der unterschiedlichen archäologischen Quellengattungen, wie sie in anderen Facheinführungen zu finden ist, verzichtet. Stattdessen versuche ich lediglich exemplarisch aufzuzeigen, worin der mögliche Nutzen und die Probleme entsprechender Systematisierungen liegen (Kap. 9). Und ähnlich selektiv bin ich bei vielen anderen der hier behandelten Themen (z. B. Stratifizierung, Typologie, Periodisierung, Chorologie, archäologische Arbeitsfelder und Praxisformen) vorgegangen. Die ausgewählten Beispiele dienen dabei immer v. a. dazu, allgemeinere Zusammenhänge, im Sinne der leitenden Prinzipien hinter den unterschiedlichen Deutungsansätzen archäologischer Quellen, zu veranschaulichen. Ich bin ich mir allerdings bewusst, dass sich damit sicherlich nicht alle wesentlichen Aspekte abdecken lassen. Und auch sonst bleibt die Darstellung – als Konsequenz der unleugbaren Begrenztheit der eigenen Perspektive und der Vorläufigkeit des Nachdenkens über viele der behandelten Fragen – zwangsweise in vielen Abschnitten skizzenhaft und unvollständig. Trotzdem hoffe ich, den Leserinnen und Lesern mittels dieser neuen Form der Präsentation der (Prähistorischen) Archäologie einige Anregungen zum Überdenken und zur Weiterentwicklung ihrer eigenen Position geben zu können.
Ich danke den zahlreichen Personen, mit denen ich mich in den letzten Jahrzehnten in der einen oder anderen Weise über die behandelten Fragen austauschen konnte, den Fachkolleginnen und -kollegen im In- und Ausland ebenso wie den zahlreichen Studierenden, die meine Lehrveranstaltungen besucht haben. Von ähnlich großer Bedeutung wie hilfreiche Bestätigungen und Ermunterungen dürfte für meine Meinungsbildung Widerspruch gewesen sein. Insofern schulde ich auch jenen Kolleginnen und Kollegen meinen Dank, deren Arbeiten mich zum Widerspruch und zur argumentativen Auseinandersetzung mit den betreffenden Positionen angeregt haben. Dies gilt noch mehr für diejenigen, die meine Einwände aufgegriffen haben und mit mir in einen offenen fachlichen Streit um das bessere Argument eingetreten sind. Die betreffenden Diskussionen lassen sich über die im Folgenden zitierten Publikationen leicht nachvollziehen.
Um niemanden das Gefühl der Zurücksetzung zu vermitteln verzichte ich darauf an dieser Stelle allzu viele Namen zu nennen. Stattdessen möchte ich zunächst an meinen akademischen Lehrer Karl J. Narr (1921–2009) erinnern, der meinen Einstieg ins Fach kritisch begleitet und mich dabei auch über die Promotionsbetreuung hinaus intellektuell wie praktisch großzügig unterstützt hat. Danken möchte außerdem Manfred K. H. Eggert, der mir 1993 die Möglichkeit eröffnete meine Vorstellungen zu Theorie und Methode der Prähistorischen Archäologie als wissenschaftlicher Assistent und später als Hochschuldozent in Tübingen weiter zu entwickeln. Mit ihm konnte ich intensiv über viele der hier behandelten Grundfragen nachdenken und diskutieren. Trotz mancher – generationell bedingter – inhaltlicher Differenzen über Ziele und Möglichkeiten unseres gemeinsamen Faches, erscheinen mir meine Tübinger Jahre rückblickend betrachtet, nicht zuletzt auch in publizistischer Hinsicht, als eine sehr produktive Periode.
Sie dauerte – auch aufgrund der großzügigen Unterstützung durch Manfred Korfmann (1942–2005) – letztlich bis 2011, als ich in Leipzig ein neues, ebenso anregendes wie herausforderndes akademisches Umfeld fand. Den zahlreichen festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Professur für Ur- und Frühgeschichte der Universität Leipzig möchte ich ebenso wie die Kollegen und Kolleginnen aus den Nachbarfächern für die vertrauensvolle, persönlich angenehme und konstruktive Zusammenarbeit danken. Dieses Umfeld hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich – ungeachtet aller anderen von mir gesuchten wie nicht gesuchten Herausforderungen – den Freiraum hatte, um dieses Buch zu schreiben. Besonders hervorheben möchte an dieser Stelle meine langjährige Mitarbeiterin Melanie Augstein (jetzt Wilhelmshaven), die die Arbeit und das Miteinander an der Professur über einen langen Zeitraum ganz wesentlich mitgeprägt hat.
Mein besonderer Dank im Zusammenhang mit diesem Buchprojekt gebührt Matthias Halle, Matthias Meinecke, Mario Schmidt und Jonas Veit für die sorgfältige redaktionelle Kontrolle und kritische Durchsicht von Teilen des Manuskripts sowie für wertvolle inhaltliche Hinweise und Anregungen. Dem Verlag Narr Franke Attempto danke ich für die Aufnahme des Buches in sein Programm und meinem Lektor Stefan Selbmann für die kompetente und engagierte Betreuung des Projekts.
Nicht verschwiegen sei schließlich der bedeutende Beitrag, den meine Frau Diana am Zustandekommen dieses Buches hat – auch ohne dass sie auf dessen Gestaltung unmittelbar Einfluss genommen hätte. Ihr sei die Arbeit daher gewidmet.
Der besseren Lesbarkeit wegen habe ich mich entschlossen in diesem Buch das generische Maskulinum der älteren Texte, auf denen es aufbaut, beizubehalten. Die Umsetzung der – nahezu jährlich wechselnden – Vorschläge hier größere Gerechtigkeit walten zu lassen, hätte mich schlichtweg überfordert. Gleichwohl sind jeweils alle Geschlechter mitgedacht. Dass die frühe Prähistorische Archäologie, wie die gesamte akademische Welt, lange Zeit v. a. durch Männer – und zweifellos zu einem gewissen Maß auch durch Männerphantasien – geprägt worden ist, gehört zu ihren nachträglich nicht mehr zu verändernden Ausgangsbedingungen, an der auch kritische jüngere Kolleginnen und Kollegen nicht vorbeikommen. Ich bin mir indes durchaus bewusst, dass diese Tatsache eine besondere Herausforderung für die Archäologiegeschichte ebenso wie für eine Theorie der Archäologie bildet.
Leipzig, den 31.8.2024 Ulrich Veit
Erster Teil: Ausgangssituation und Schlüsselbegriffe
1Zur Einführung
»Field Archaeologists dig up rubbish, Theoretical Archaeologists write it down.«
(Paul BahnBahn, Paul 1989, 15)
In ihren Kindertagen hat man die Prähistorische ArchäologiePrähistorische Archäologie (bzw. ›Vorgeschichte‹, ›UrgeschichteUrgeschichte‹ oder ›Ur- und Frühgeschichte‹) als eine »hervorragend nationale Wissenschaft« (Gustaf KossinnaKossinna, Gustaf 1914) angepriesen, später hat man etwas weniger euphorisch, aber doch nicht ohne StolzStolz, Christian, von einer »hervorragend antiquarischen Wissenschaft« (Walter TorbrüggeTorbrügge, Walter 1959) gesprochen. Keine dieser Beschreibungen vermochte mich jemals so richtig zu überzeugen. Wenig einwenden ließe sich m. E. indes – zumindest im Sinne einer Zustandsbeschreibung – gegen die Formulierung: »eine hervorragend praktische Wissenschaft«. Das ›Ausgraben‹ und das damit gedanklich eng verbundene ›Entdecken untergegangener Kulturen‹ stehen auch heute noch, nicht nur in der archäologisch interessierten ÖffentlichkeitÖffentlichkeit(sarbeit), sondern gleichermaßen im Fach selbst, hoch im Kurs. Insofern gerät derjenige, der mit dem Begriff der ›Theorie‹ operiert und Regeln und Begründungen für weitergehende Deutungen archäologischen Materials fordert, schnell in die Rolle des Spielverderbers (Veit 2017). Genügt es nicht, einfach den ausgegrabenen Funden und den Fragen, die sich daraus für uns ergeben, zielgerichtet nachzugehen? Setzen uns nicht die Funde selbst auf eine SpurSpur(en), der es dann nur konsequent zu folgen gilt, ohne dass man dabei groß über die ›Spielregeln‹ dieses Tuns nachdenken müsste?
Hinter solchen und ähnlichen Forderungen verbirgt sich ein Fachverständnis, das im Kern auf eine Wiedergewinnung einer verloren gegangenen vergangenen ›Realität‹ abzielt. Dabei wird unterstellt, dass einem solchen Anliegen im Grunde einzig der fragmentarische Charakter der Überlieferung im Wege stehe. Entsprechend gilt es als probates Mittel um voranzukommen, über konkrete FeldforschungFeldforschung, archäologische weitere Einzelteile des riesigen Puzzles1, das die Summe der archäologischen Überreste darstellt, zu beschaffen [Abb. 1]. Sind diese Teile erst einmal gefunden, so werden sie sich – so zumindest die Hoffnung – von selbst zu einem Bild zusammenfügen. Zugleich werden dadurch kulturelle Vorurteile, die bis dahin zu einer Verzerrung unseres Bildes der Vergangenheit geführt haben, erkennbar und somit gegenstandslos.
›Archäologie ist ein großes Puzzle‹: Die Puzzle-Metapher scheint für alle Archäologiefächer gleichermaßen relevant, sie lässt sich jedoch am besten mit Blick auf die Klassische Archäologie visualisieren. Auf steinernen Ruinenfeldern der Klassischen Antike lassen sich die Einzelteile des Puzzles klar erkennen und das Auge des Beobachters scheint geradezu aufgefordert mit der Arbeit des Zusammensetzens direkt zu beginnen (Tempel des Serapeion, Ephesos, Türkei). Viele Altertumsinteressierte geben sich aber auch nur der Ruinenromantik hin und machen sich auf diese Weise die Vergänglichkeit alles Irdischen bewusst. Frühneuzeitliche Herrscher haben dazu bekanntermaßen ihre Gärten mit künstlichen Ruinen bestückt (Berlin, Schlossgarten Glienicker). Zum Phänomen ›Ruine‹ allg.: Schnapp 2014.
Vor dem Hintergrund der jüngeren Grundsatzdebatten in der Prähistorischen Archäologie wird eine solche Vorstellung eines harten Kerns unantastbarer Fakten, die sich jeder ideologischen Vereinnahmung widersetzten, heute immer häufiger als naiv und anachronistisch empfunden (Veit 2020a). An ihre Stelle ist stattdessen ein Verständnis getreten, das die prähistorische Vergangenheit primär als ein modernes Konstrukt betrachtet, d. h. als das Ergebnis eines – reflektiert wie unreflektiert – durch unsere aktuellen sozialen und kulturellen Erfahrungen geleiteten Nachfragens. Diese Position aufgreifend wird auch in der vorliegenden Studie die Existenz einer Vergangenheit, im Sinne einer unseren Erkundungen vorausliegenden ›Realität‹, in Frage gestellt und für eine ›konstruktivistische‹ Position votiert.
Dies ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass damit zugleich die Prinzipien der archäologischen Quellenforschung und QuellenkritikQuellenkritik ihre Berechtigung verlören und wir dementsprechend nur noch ›ideologische‹ Auseinandersetzungen um Gegenwartsprobleme zu führen hätten. Aus einer solchen Festlegung folgt lediglich, dass wir die Ergebnisse unserer Erkundungen nicht länger nur quellenkritisch, sondern viel grundsätzlicher, nämlich ebenfalls ›ideologie-‹ bzw. besser: ›erkenntniskritisch‹ reflektieren müssen. Und das gilt nicht nur für ganz konkrete Forschungszusammenhänge, sondern für das Fach insgesamt. Insofern plädiere ich dafür, neben die (Prähistorische) Archäologie selbst eine Art von ›MetaarchäologieMetaarchäologie‹ als Instanz kritischer Selbstreflexion treten zu lassen, die – ähnlich wie Johann Gustav DroysensDroysen, Johann Gustav berühmte HistorikHistorik (1972; 1977) – ein systematisches Nachdenken über Standpunkt, Ziele, Grundlagen, Methoden und Aussagemöglichkeiten des Faches institutionalisiert.
Aufbauend auf einer überschaubaren Zahl eigener sowie zahlloser fremder Vorarbeiten, möchte ich mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Debatte über die aktuelle Bedeutung und zukünftige Rolle der Prähistorischen Archäologie leisten. Dabei geht es jedoch ausdrücklich nicht eine abstrakte, von der bewegten Fachgeschichte losgelöste ›Theorie‹ der Prähistorischen Archäologie. Ziel ist vielmehr eine kritische Evaluation der im Fach verfügbaren abstrakten Konzepte und methodischen Prinzipien (›kognitive Identität‹) aus gut zwei Jahrhunderten. Dies schließt auch die vielfältigen Bemühungen um die Herausbildung und Aufrechterhaltung einer spezifischen ›historischen‹ und ›sozialen Identität‹ des neuen Faches mit ein (Veit 1995; 2001). Gleichwohl unterscheidet sich mein Projekt – auch wenn es konsequent auf deren wichtige Ergebnisse Bezug nimmt – sowohl von einer traditionellen affirmativen ›ArchäologiegeschichteArchäologiegeschichte‹ als auch von distanzierteren wissenschaftsgeschichtlichen Ansätzen im Fach (Veit 2011a). Sein eigentlicher Fokus ist ein systematischer und kein genuin wissenschaftshistorischer.2 Denn es scheint mir wichtig, WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte und Theorie konsequent auseinanderzuhalten. Mit Marc-Antoine KaeserKaeser, Marc-Antoine (2006, 308, s.a. Wiegert 1995, 183) bin ich daher der Überzeugung, dass die größte Gefahr für eine (interne) Wissenschaftsgeschichte der Archäologie in einem »PräsentismusPräsentismus« liegt, der die Vergangenheit strategischen Zielen der Gegenwartsforschung unterwirft und dadurch zugleich in Teilen negiert.
Eine solche Haltung ist indes für viele der wissenschaftsgeschichtlichen Erkundungen, die seit etwa 1990 im Rahmen der jüngeren TheoriedebatteTheoriedebatte in der deutschsprachigen Archäologie entstanden, charakteristisch. So spricht beispielweise Alexander Gramsch (2006, 15) von einer »Schwesternschaft von Theorie und WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte« und postuliert ein dialektisches Verhältnis zwischen beiden Bereichen. Wissenschaftsgeschichte ist für ihn
»kein Selbstzweck, sondern auf die heutige archäologische Praxis ausgerichtet; sie soll ein besseres Verständnis für die Ausrichtung der aktuellen Forschung ermöglichen und zur eventuellen Veränderung befähigen. Fachgeschichte muss deshalb die Mechanismen der Wissensproduktion in Relation zum jeweiligen sozialen und politischen Kontext erfassen. Umgekehrt muss aus einem neuen theoretischen Verständnis auch ein neues Verständnis für die historischen Grundlagen der Archäologie entstehen« (ebd.).3
Dies scheint mir nur insoweit zutreffend, als sich jedes neue wissenschaftliche Fach bzw. Wissenschaftsparadigma in der Tat zugleich eine, ihr eigenes Tun begründende Geschichte konstruiert.4 Andererseits sollte sich eine kritische WissenschaftWissenschaft, kritischesgeschichte – gerade auch wenn sie von Archäologen selbst betrieben wird – nicht zu sehr vom jeweils vorherrschenden ParadigmaParadigma abhängig machen. Ihre Aufgabe sehe ich eher darin, frühere Selbststilisierungen des Faches aufzudecken und an ihren spezifischen zeithistorischen Kontext rückzubinden. Umgekehrt ergeben sich die konkreten paradigmatischen Festlegungen für die Fachgegenwart nicht zwangsweise aus dem jeweils als richtig erkannten Verlauf der Fachgeschichte, sondern aus den Fragen der Gegenwart. In diesem Sinne ist die hier entwickelte Perspektive zwar nicht unbeeinflusst von meinen fachhistorischen Erkundungen, aber doch keine direkte Konsequenz dieser. Sie ruht eher auf allgemeinen erkenntnistheoretischen Prinzipen, deren Wirksamkeit ich durch Beispiele aus der WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte illustriere.5
1.1Ausgangsfragen und Grundpositionen
Ein solches Unternehmen verspricht nicht nur Einsichten in die Verfasstheit der Prähistorischen Archäologie, sondern auch solche, die das archäologische Projekt insgesamt betreffen. Allerdings mahnt uns der Blick auf die WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte, mit dem Begriff der Archäologie als einem Kollektivsingular vorsichtig zu hantieren. Die Geschichte der Archäologie besteht aus verschiedenen, teilweise nur recht locker miteinander verbundenen Geschichten. Und entsprechend vielgliedrig stellt sich die Situation dieses Fächerverbundes gerade an den deutschen Universitäten dar (s. z. B. EggertEggert, Manfred K. H. 2006). Die verschiedenen Archäologiefächer scheinen heute weniger durch eine gemeinsame Geschichte verbunden als vielmehr durch ähnliche gesellschaftliche und akademische Prägungen und insbesondere durch gemeinsame Herausforderungen in einer sich schnell wandelnden Welt.
Anders als einige Kollegen (U. FischerFischer, Ulrich 1987; EggertEggert, Manfred K. H. 2001/2012) bin ich nicht der Ansicht, das Wissen der Prähistorischen Archäologie (bzw. der Archäologie insgesamt) sei in einer grundsätzlich anderen Art und Weise konstruiert als z. B. jenes der Ethnologie oder der Geschichtswissenschaft – mit der Konsequenz, dass die Prähistorische Archäologie deshalb einer ganz eigenen EpistemologieEpistemologie bedürfe. Vielmehr werde ich im Folgenden darzulegen versuchen, dass die prähistorisch-archäologische Forschung grundsätzlich vor denselben Problemen steht wie andere KulturwissenschaftenKulturwissenschaft(en). Hier wie dort setzen die Deutungen bei Alltagserfahrungen an, die in der Folge systematisiert und systematisch geprüft werden.
Dies lässt sich auch daran ablesen, dass die meisten Grundprinzipien, die heute archäologische Argumentationsweisen bestimmen, über andere, ältere akademische Disziplinen (von der Geologie bis zur Germanistik) in die Prähistorie hinein vermittelt wurden. Schon aus diesem Grund kann von einer Eigenständigkeit nur bedingt die Rede sein. Wie eng auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Fächer miteinander verknüpft sind, hat nicht zuletzt auch Carlo GinzburgsGinzburg, Carlo (1988) brillante wissenschaftsgeschichtliche Studie zum IndizienparadigmaIndizienparadigma gezeigt.1
Die Zurückweisung der Vorstellung einer strengen Eigenlogik archäologischen Argumentierens gegenüber der Argumentation in anderen Wissenschaften bedeutet andererseits aber nicht, die Eigenständigkeit des Faches Ur- und Frühgeschichte in Abrede zu stellen. Diese Eigenständigkeit muss m. E. nur über andere Kriterien als über eine eigenständige EpistemologieEpistemologie, etwa über ein spezifisches Forschungsfeld, definiert werden.2
Insofern als hier der Versuch unternommen wird, die großen Linien der Debatte um die konzeptionellen Grundlagen der Forschungen im Bereich Prähistorische Archäologie zusammenzuführen, besitzt diese Schrift zweifellos einen einführenden Charakter. Indes war es nicht mein Ziel, eine Facheinführung im engeren Sinne vorzulegen. Facheinführungen präsentieren ihren Gegenstand, ein bestimmtes akademisches Fach, gewöhnlich als eine historisch gewachsene und systematisch gegliederte Einheit mit klaren Erkenntnisansprüchen und einem erprobten Methodenkanon. Gefordert ist vom Verfasser solcher Schriften außerdem ein mehr oder minder enger Bezug auf den aktuellen Fachkonsens und – damit verbunden – eine weitgehende Ausblendung oder Relativierung von Fachkontroversen.3
Absicht der vorliegenden Studie ist es hingegen, Einschränkungen dieser Art soweit wie möglich zu vermeiden.4 Die Prähistorische Archäologie wird hier daher nicht als etwas fest Gefügtes präsentiert werden, sondern als ein offenes und unabgeschlossenes Projekt, dessen Ziele verhandelbar und vor dem Hintergrund von aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft auch verhandlungsbedürftig sind. Dabei lassen sich vergangene Konstellationen archäologischer Wissensproduktion als eine Kontrastfolie zur Beurteilung der Gegenwart des Faches benutzen.
Teil meines Anliegens ist auch, Innenansichten des Faches mit externen Perspektiven auf das Fach zu konfrontieren. Dies bedeutet etwa, den fachintern produzierten Einsichten der ArchäologiegeschichteArchäologiegeschichte jene einer disziplinübergreifenden WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung gegenüberzustellen.5 Eine externe Perspektive einzunehmen ist für jemanden, der sich tagtäglich selbst im Fach bewegt, natürlich eine Herausforderung – und die Gefahr, dabei der eigenen Betriebsblindheit zu erliegen, ist nicht zu leugnen. Trotzdem halte ich es für legitim und produktiv, die unterschiedlichen Fachpraxen und -politiken auch einmal aus einer ethnographischen Perspektive zu betrachten.
Der Begriff ›PraxisPraxis‹ umschreibt dabei weder allein den Anwendungssektor archäologischen Wissens (DenkmalpflegeDenkmalschutz, Denkmalpflege, MuseumMuseum) noch den letztlich v. a. auf dem Gesichts- und TastsinnSehen, GesichtssinnTastsinn (›Sehen‹, ›Begreifen‹) beruhenden primären Umgang mit SachquellenSachquelle(n) (Ausgrabung, Dokumentation, KlassifikationKlassifikation, Fundstatistik). Entscheidender scheint mir in diesem Rahmen die Frage, wie entsprechende Beobachtungen am archäologischen Material von uns unter Rückgriff auf unsere (mehr oder minder reflektierten) eigenen sozialen und kulturellen Erfahrungen ›auf den Begriff‹ gebracht und letztlich zu auf die Gegenwart zielenden historischen (oder: ethnographischen) ›Erzählungen‹ verarbeitet werden. Insgesamt reichen die Praktiken, die in den Blick zu nehmen sind, vom Entdecken und Ausgraben über das Sammeln, Ordnen, Interpretieren und Modellieren, Experimentieren und Simulieren bis zum ErzählenErzählen und Exponieren [Abb. 2].6 Zusammenfassend spreche ich diesbezüglich auch von archäologischen Frage- und Begründungsweisen.
Zusammenstellung relevanter Praktiken im Berufsfeld ›Archäologie‹ – Hintergrundmotiv: Der prähistorische Steinkreis von Stonehenge, Wessex, England.
Es geht in diesem Buch also nicht um die Darstellung spezieller ›Methoden‹ und ›Techniken‹ im Bereich der archäologischen Ausgrabung und Materialanalyse (Luftbildarchäologie, Feuchtbodenarchäologie, Stratigraphie, Seriation, 14C-Analyse, Paläogenetik usw.) und ihre jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten. Angesichts der breiten Diversifizierung dieses Feldes würde das den Rahmen eines solchen Bands sprengen. Gefasst werden soll vielmehr das Gemeinsame unterschiedlicher methodischer und interpretativer Zugänge und die unterschiedlichen Formen des Archäologischen, die daraus hervorgegangen sind.
Die einzelnen Kapitel orientieren sich dabei an zentralen Leitbegriffen und Konzepten des Faches. Dabei gebe ich jeweils zunächst eine knappe, allgemeinverständlich gehaltene Bestimmung des behandelten Gegenstands anhand ausgewählter Literatur. Darauf aufbauend werden die Komplikationen und Widersprüche thematisiert, die sich – auch mit Blick auf die Nachbarwissenschaften – aus der konkreten Fachterminologie und -praxis ergeben und Vorschläge für eine Lösung der erkannten Probleme formuliert.
Aus dem Gesagten dürfte bereits klargeworden sein, dass sich das vorliegende Buch weniger an Erstsemester als an schon etwas weiter fortgeschrittene Studierende und professionelle Archäologinnen und Archäologen wendet. Angesprochen werden Personen, die mit den Gegenständen und Methoden der Prähistorischen Archäologie bereits in einem gewissen Umfang vertraut sind, die aber – vor dem Hintergrund konkreter Fragen im Rahmen ihrer eigenen Forschungen auf diesem Gebiet – tiefer in deren erkenntnis- und kulturtheoretische Zusammenhänge eindringen wollen. Anders gewendet könnte man auch sagen, die Schrift wende sich speziell an diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die einen Sinn für Abstraktion besitzen, die es für sinnvoll und nötig erachten, die eigene Arbeit (selbst-)kritisch zu hinterfragen und die bereit sind, Alternativen zum Status quo zu erwägen.
Darüber hinaus würde es mich freuen, wenn das Buch auch im Kreise benachbarter altertumswissenschaftlicher und historischer Fächer, die vor ganz ähnlichen Problemen wie die Prähistorische Archäologie stehen, auf Interesse stoßen würde. Wäre der Begriff ›Theorie‹ durch die Debatten der jüngeren Vergangenheit nicht so verschlissen (s. Veit 2020a), könnte man sagen, das Buch wende sich primär an theoretisch interessierte Archäologen und Kulturwissenschaftler.
1.2Anknüpfungspunkte und Abgrenzungen
Versuche einer bei Fragen der TheorieTheorie ansetzenden Einführung in die (Prähistorische) Archäologie sind, zumal in monographischer Form, bisher selten unternommen worden. Kennzeichnend für Facheinführungen ist stattdessen gerade im deutschsprachigen Raum die Verbindung einer speziellen Form der Fachgeschichte (mit Berufung auf bestimmte Forscherinnen und Forscher, die Grundlegendes geleistet haben) mit einer Darstellung der zentralen Methoden zur Quellenerschließung. Die sich hinter entsprechenden Forschungspraxen verbergende »Ratio«1 blieb indes oft unausgesprochen, was ihr den Nimbus der Selbstverständlichkeit und Unanfechtbarkeit verlieh.
Was mit dieser Formulierung gemeint ist, mag ein kurzer Blick auf Hans Jürgen EggersEggers, Hans Jürgen überaus einflussreiche »Einführung in die Vorgeschichte« aus dem Jahre 1959 illustrieren. Gegenstand, Fachgeschichte und MethodikMethodik des Faches sind hier meisterlich miteinander verwoben – und zwar in einer Art und Weise, die angesichts der Ausdifferenzierung und Vervielfältigung unseres historischen und methodischen Wissens so heute nicht mehr möglich wäre.2 Mit diesem Ausdifferenzierungsprozess, der mit David L. ClarkeClarke, David L. (1973) auch als »loss of innocenceloss of innocence« beschrieben werden kann, ist die relative paradigmatische Geschlossenheit des Faches verloren gegangen, die ihrerseits eine Theoriediskussion im modernen Sinne erst hervorgebracht hat (s. Veit 2020a).
EggersEggers, Hans Jürgen Arbeit hingegen entstand noch in einer Zeit, als eine ›kulturhistorische Deutung‹ archäologischer Quellen3 unangefochten das Zentrum der prähistorischen Forschung bildete und in der zudem quellenunabhängige naturwissenschaftliche Datierungen des Materials noch nicht in größerem Maße verfügbar waren. Dies gab seiner Argumentation eine spezifische Ausrichtung und lässt sie aus heutiger Sicht überholt wirken.
Obgleich sich die Rahmenbedingungen in den genannten Punkten bereits deutlich verändert hatten, übernahm Manfred K. H. EggertEggert, Manfred K. H. (2001/2012) in seiner erstmalig rund vierzig Jahre nach EggersEggers, Hans Jürgen Buch veröffentlichen Facheinführung noch weitestgehend Eggers’ Gliederungskonzept und beschränkte sich darauf, die von ihm präsentierten methodischen Konzepte kritisch zu hinterfragen. Die schleichende Entwertung einiger der bei Eggers behandelten methodischen Prinzipien (TypologieTypologie, Horizontalstratigraphie, historisch-vergleichende Methode) durch neue naturwissenschaftliche und mathematische Verfahren, wird aus der MethodenkritikMethodenkritik von Eggert zwar deutlich, er hat es seinerzeit aber noch nicht für nötig erachtet, den fachwissenschaftlichen Methodenkanon grundsätzlicher in Frage zu stellen.4
Dementsprechend spielen in EggertsEggert, Manfred K. H. Einführung beispielsweise weiterführende siedlungs- und sozialarchäologische Ansätze und ihre spezielle MethodikMethodik (z. B. JankuhnJankuhn, Herbert 1977; SteuerSteuer, Heiko 1982), die seit den 1970er Jahren den klassischen kulturhistorischen Ansatz zunehmend abgelöst haben, keine nennenswerte Rolle. Und auch jene theoretischen Aufbrüche, welche in der englischsprachigen Forschung das kulturhistorische ParadigmaParadigma nacheinander auszuhebeln und das Fach auf diese Weise neu zu begründen versucht haben, scheinen in Eggerts Darstellung nur ganz am Rande auf. Ihre Bedeutung wird sogar ganz bewusst heruntergespielt, sieht Eggert (2001/2012, 5) darin doch nur luftige Überbauphänomene, die seine Arbeit an einer (vermeintlich) festen Basis nicht erschüttern könnten.
Dies wird auch in zahlreichen Exkursen zur archäologischen EpistemologieEpistemologie, die das Referat anerkannter Konzepte und Methoden prähistorisch-archäologischer Forschung immer wieder unterbrechen, deutlich. Hier lässt EggertEggert, Manfred K. H. letztlich nur ein Prinzip, jenes des ›Analogieschlusses‹, gelten: »Der Stellenwert von Analogien in der Archäologie lässt sich dahingehend präzisieren, dass archäologisches Interpretieren und analogisches Deuten letztlich synonym sind« (ebd. 347). Darin – und in der Exklusivität in der Eggert dieses Prinzip auf die Prähistorische Archäologie bezieht – liegt vermutlich der entscheidende Unterschied zum vorliegenden Band. Er würdigt neben der AbduktionAbduktion auch eine lange Reihe anderer Erkenntnisprinzipen und zeigt zugleich Möglichkeiten ihrer Verknüpfung auf (Kap. 13ff.).5
Das meiste des hier zu EggertsEggert, Manfred K. H. »Prähistorischer Archäologie« Gesagte gilt gleichermaßen für die deutlich kompaktere und stärker auf studentische Bedürfnisse zugeschnittene Einführung, die Eggert gemeinsam mit Stefanie SamidaSamida, Stefanie im Jahr 2009 nachgeschoben hat. Neben prähistorisch-archäologischem Methodenwissen wird darin in gewissem Umfang auch Wissen über die verschiedenen Arbeitsfelder des Faches, d. h. die einzelnen prähistorischen Epochen, vermittelt. Entsprechend bleibt für die Behandlung von Grundfragen und über die FachgrenzenFächergrenzen hinausweisenden Perspektiven jedoch nur wenig Raum. Lediglich ein kurzer, »Kulturwissenschaftliche Leitkonzepte« überschriebener Abschnitt ist Aspekten gewidmet, die die traditionelle archäologische Kulturgeschichtsschreibung, die Leitschnur der Darstellung bildet6, transzendieren.7 Anders als EggertEggert, Manfred K. H. und SamidaSamida, Stefanie verzichtet Martin TrachselTrachsel, Martin (2008) in seiner Einführung auf Fallstudien und konzentriert sich stattdessen auf eine breiter angelegte Fachsystematik.8
Ausführlicher und strukturierter als die zuletzt genannten Arbeiten behandelt eine aktuelle Einführung in die Archäologie des Mittelalters und der NeuzeitArchäologie des Mittelalters (und der Neuzeit) (ScholkmannScholkmann, Barbara et al. 2016) grundlegende Fragen archäologischer Erkenntnistheorie. Dabei knüpft diese Schrift unmittelbar an die theoretischen und methodischen Debatten v. a. der deutschsprachigen Ur- und Frühgeschichtsforschung an. Insbesondere in den Kapiteln »QuellenkritikQuellenkritik« sowie »Quelleninterpretation und Theorie« (ebd. 101–148) entwerfen die Verfasser eine Gesamtperspektive auf den archäologischen Prozess von der QuellensystematikQuellensystematik bis zur narrativen Umsetzung von Forschungsergebnissen, die strukturelle Ähnlichkeiten zum hier verfolgten Ansatz aufweist.9 Die einzelnen Abschnitte sind allerdings zu kurz, um die aufgeworfenen Grundsatzfragen systematisch – und d. h. auch unter Herleitung der philosophisch-kulturwissenschaftlichen Grundlagen archäologischen Forschens – zu entwickeln.
Der wichtigste Unterschied zu meinem Projekt (neben der anderen fachlichen Zuordnung) ist jedoch ein inhaltlicher. Während ich hier einem konstruktivistischen Ansatz folge, propagieren Barbara ScholkmannScholkmann, Barbara et al. im Kern eine positivistische Agenda, die in der Tradition EggersEggers, Hans Jürgen’ auf die Wiedergewinnung einer vergangenen »Realität« abhebt (ebd. 101–103 et passim). Die notwendigen Konsequenzen der von den Autoren durchaus zur Kenntnis genommenen kulturwissenschaftlichen Wende werden nicht gezogen. Stattdessen dominiert die SpiegelmetaphorikSpiegelmetapher der klassischen Urgeschichtsforschung, bei der es vor allem darum geht, überlieferungsbedingte Verzerrungen unseres Bildes der Vergangenheit analytisch rückgängig zu machen.10
Diese Perspektive erhält im Bereich der sog. ›Historischen Archäologie(n)Historische Archäologie(n)‹ eine besondere Färbung durch die dort vorherrschende Vorstellung, SachquellenSachquelle(n), archäologische Quellen, böten ein wesentliches Korrektiv einer allein auf SchriftquellenSchriftquellen fixierten Geschichtswissenschaft (s.a. AndrénAndrén, Anders 1997). Der damit konstruierte Gegensatz von historischer These und archäologischer Antithese löst sich indes heute in einer stärker kultur- und medienwissenschaftlichen Betrachtungsweise zunehmend auf – und damit auch alte Grenzziehungen zwischen Archäologie und Geschichtswissenschaft (s. zuletzt Veling 2024).
Neben Einführungen deutschsprachiger Autoren steht mit dem Band »Basiswissen Archäologie: Theorien, Methoden, Praxis« von Colin RenfrewRenfrew, Colin und Paul BahnBahn, Paul (2009) Studierenden der Ur- und Frühgeschichte zusätzlich ein aus dem Englischen übersetzter Band zur Verfügung. Er überzeugt – wie die englische Originalausgabe – vor allem durch seine klare Struktur, die sich an einer Liste von W‑Fragen (Was? Wo? Wann? Wie? Warum?) orientiert.11 Nützlich für Studienanfänger ist sicherlich auch der von Renfrew und Bahn parallel herausgegebene Band zu archäologischen Schlüsselbegriffen (Renfrew/Bahn 2005), zu dem es zwar keine ÜbersetzungÜbersetzung, jedoch ein deutschsprachiges Pendant gibt (MöldersMölders, Doreen/WolframWolfram, Sabine 2014).12
Anders als im deutschen Sprachraum gibt es im englischsprachigen Raum inzwischen allerdings auch schon eine ganze Reihe von speziellen Einführungen in Fragen der archäologischen TheoriebildungTheoriebildung (z. B. Dark 1995; HodderHodder, Ian 1999; Johnson 1999/2010; Harris/CipollaCipolla, Craig N. 2017). Sie wenden sich speziell an Fachstudierende, die im Rahmen von Bachelor- und Master-Programmen entsprechende Theoriekurse zu absolvieren haben. Trotz ihrer engen Orientierung an der englischsprachigen Debatte sowie der nahezu vollständigen Auslassung kontinentaler, speziell deutschsprachiger Theoriebeiträge sind diese Arbeiten durchaus auch hierzulande lesenswert. Insbesondere der Band »Archaeological Theory in the New Millenium« von Oliver J. HarrisHarris, Oliver J. und Craig N. Cipolla, der im Sinne des ontological turnontological turn Elemente einer nichtdualistischen postmodernen Archäologie versammelt, zeigt jedoch zugleich, wie sehr sich die Debatten in beiden Sprachräumen selbst auf der Ebene der Facheinführungen zwischenzeitlich bereits entkoppelt haben.
Jedenfalls fehlt es – abgesehen von einigen Pionierstudien zu einzelnen Aspekten – bislang an einem deutschsprachigen Pendant zu diesem Band. Die einzige auf Deutsch publizierte Einführung in die archäologische Theorie ist das bereits 1997 erschienene Buch »Theorien in der Archäologie« des Vorderasiatischen Archäologen Reinhard BernbeckBernbeck, Reinhard. Die darin präsentierten Konzepte und Fallbeispiele sind dem Kernbestand an Schlüsseltexten, den die amerikanische New ArchaeologyNew Archaeology während der 1960 bis 1980er Jahre erarbeitet hat, entnommen. Darüber hinaus gibt Bernbeck einen Ausblick auf einige jüngere ideologiekritischeIdeologiekritik Ansätze (PostprozessualeArchäologie, Postprozessuale Archäologie, Marxismus und Feminismus), die den Blick auf die gesellschaftlich-politische Dimension des Faches frei machen.13 Sie spielt auch in der jüngeren deutschsprachigen Debatte eine immer größere Rolle, allerdings weniger in der Fachforschung selbst als im expandierenden Bereich einer archäologischen Wissenschafts- bzw. Wissensgeschichte.14
In diesen Bereich gehört, ungeachtet seines systematischen Anspruchs, auch EggertsEggert, Manfred K. H. »Archäologie: Grundzüge einer Historischen KulturwissenschaftHistorische KulturwissenschaftKulturwissenschaft(en)« aus dem Jahre 2006. Der Verfasser skizziert darin detailliert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen an den deutschsprachigen Universitäten etablierten Archäologie-Fächer. Darüber hinaus versucht er, die disziplinären Grundlinien einer noch zu schaffenden übergreifenden Disziplin ›Archäologie‹ aufzuzeigen und diese gegenüber anderen Disziplinen wie etwa der Geschichtswissenschaft abzugrenzen.
EggertEggert, Manfred K. H. geht hier sogar so weit, der Archäologie einen von jenem der Historie grundsätzlich abweichenden »›ontologischen‹ Status« zu bescheinigen.15 ›Archäologie‹ und ›GeschichteGeschichtswissenschaft‹ repräsentierten für ihn zwei ›natürlich‹ voneinander geschiedene und deshalb nicht unmittelbar aufeinander zu beziehende Bereiche. Damit wendet er sich bewusst gegen Stimmen, die Prähistorische ArchäologiePrähistorische Archäologie lediglich als eine – wenngleich in methodischer Hinsicht durchaus spezielle – Ausprägung von Geschichtswissenschaft präsentieren.16 Eine solche Position verkennt allerdings, dass, selbst wenn man die Prähistorische Archäologie strikt von der Historie abtrennen würde, innerhalb des dann übrig gebliebenen engeren Bereichs der Geschichtswissenschaft tiefgreifende ›ontologische‹ (besser vielleicht: ›epistemologische‹) Unterschiede bestehen blieben. Denn auch Geschichte ist nicht gleich Geschichte. Arnold EschEsch, Arnold (1985, 564) hat diesbezüglich beispielsweise auf den »Quantensprung der SchriftlichkeitSchriftlichkeit«, den die Erfindung des Buchdrucks markiert, verwiesen. Dieser verändere nicht einfach den Quellenbestand und unsere Kenntnis von der Geschichte, »nein: die Geschichte selbst wird eine andere« (ebd.). Aber, und dies ist mir wichtig, sie bleibt – zumindest terminologisch und in einem weiteren Sinne auch epistemologisch (VeyneVeyne, Paul 1990) – gleichwohl ›Geschichte‹.17 Insofern wäre m. E. eher umgekehrt zu fragen, wie es zu rechtfertigen ist, dass nicht alle ›Quantensprünge der Schriftlichkeit‹ auch in der Fächersystematik zum Ausdruck kommen. Wissend um diese ›Quantensprünge‹ – und ihren unsteten Verlauf – sehe ich jedenfalls kein grundsätzliches Problem darin, die Prähistorische Archäologie unter dem Dach einer quellenmäßig breit aufgestellten und methodisch pluralistisch angelegten Geschichtswissenschaft zu führen.
Auch EggertsEggert, Manfred K. H. Vorstellung einer alle archäologischen Fächer integrierenden, übergeordneten Fachdisziplin ›Archäologie‹ widerspricht dem von mir bevorzugten Ansatz. Anders als dieser verfolge ich hier nicht das Ziel, den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Einzelarchäologien herauszuarbeiten und zugleich Allgemeingültigkeit beanspruchende Demarkationslinien zwischen den verschiedenen Archäologiefächern (im Sinne der Definition von Unterformen zu einem Haupttypus) zu ziehen. Ein Blick in die Fachgeschichte zeigt nicht nur, dass FächergrenzenFächergrenzen permanent neu ausgehandelt werden, sondern auch, dass oftmals gerade von solchen ›Grenzstreitigkeiten‹ wesentliche neue Impulse ausgehen. Wichtiger als eine normative Festschreibung bestehender Fachgrenzen ist nach meiner Auffassung die Beantwortung der Frage, in welcher Weise konkrete archäologische Forschung in Theorie und Praxis auf generelle epistemologische und kulturtheoretische Positionen Bezug nimmt. In diesem Sinne geht es mir im Folgenden auch darum, die im Fach zirkulierenden Vorstellungen über Ziele, Werkzeuge und den Nutzen prähistorisch-archäologischer Erkenntnisgewinnung kritisch auf ihre kulturwissenschaftlichen Grundlagen zurück zu beziehen.18
1.3Zum Aufbau dieser Arbeit
Insofern als ich im Rahmen der vorliegenden Studie ebenso an inner- wie überfachliche Debatten sowie an nationale wie internationale Forschungstraditionen anknüpfe, ist der Argumentationsgang notwendigerweise verschlungen. Einige Kapitel verfolgen außerdem Themen, die vom Hauptstrang der Argumentation etwas abweichen. Daher ist es jederzeit möglich, einzelne Abschnitte zu überspringen, sind die einzelnen Kapitel doch so angelegt, dass sie auch isoliert rezipiert werden können. Regelmäßige interne Verweise stellen Verknüpfungen zu anderen Teilen des Buches her, so dass es möglich sein sollte, sich eigene Wege durch den Text zu bahnen. Trotzdem habe ich mich um eine nachvollziehbare Systematik bemüht. Grundlegend ist dabei eine Vierteilung des Bandes.
Im ersten Teil werden Ausgangsbedingungen und Grundlagen prähistorisch-archäologischer Forschung und Verständigung diskutiert. Dazu wird zunächst – mit Bezug auf drei Schlüsselbegriffe (Prähistorische Archäologie, Theorie, KulturEpistemologie) – die historische und systematische Ausgangssituation für die weiterführenden Erörterungen zu Theorie und Praxis archäologischer Frage- und Begründungsweisen dargelegt (Kap. 2–4). Darauf aufbauend geht es um die spezifischen Potentiale und Grenzen archäologisch gegründeter Vergangenheitserschließung sowie um die tieferen epistemologischen Grundlagen der Prähistorischen Archäologie (Kap. 5 und 6).
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden zunächst Grundfragen archäologischer BegriffsbildungBegriffsbildung, archäologische erörtert sowie das Konzept des »archäologischen Prozesses« im Sinne einer Abfolge von Stufen der primären Erschließung des »archäologischen Materials« vorgestellt (Kap. 7 und 8). Es folgen diese Fragen vertiefende Abschnitte zu den Themen »KlassifikationKlassifikation und MaterialordnungMaterialordnung«, »TypologieTypologie und AltersbestimmungAltersbestimmung, relative/absolute«, »ChronologieChronologie und PeriodisierungPeriodisierung, Periodensystem« sowie »Raum- und KulturanalyseRaumanalyse« (Kap. 9–12).
Der dritte Teil der Studie ist unterschiedlichen Modi archäologischen Fragens und Begründens, wie dem »AnalogieschlussAnalogieschluss«, der »ModellbildungModell(-bildung)«, dem »SpurenlesenSpurenlesen« und der »Entschlüsselungkultureller KodeEntschlüsselung, Dekodierung materieller Texte« gewidmet (Kap. 13 und 14). Im Anschluss daran geht es um das Verhältnis von »ErzählenErzählen« und »ErklärenErklären, Erklärung« in der Archäologie sowie um die Verflechtungen von Archäologie und Gesellschaft und die sich daraus ergebenden praktischen Aufgaben des Faches (Kap. 15 und 16). Das abschließende Kapitel des dritten Teils setzt bei der Frage nach der Bedeutung fächerübergreifer Kooperationen für die Entwicklung der Prähistorischen Archäologie an und beleuchtet davon ausgehend exemplarisch das wechselhafte Verhältnis von Archäologie und NaturwissenschaftArchäologie und NaturwissenschaftNaturwissenschaft(en) (Kap. 17).
Der abschließende vierte Teil diese Studie (»Bilanz und Ausblick«) umfasst zwei Kapitel. Im ersten beschreibe und bewerte ich vor dem Hintergrund der konkreten FachentwicklungFachentwicklung nochmals zusammenfassend die aktuelle Situation der Prähistorische Archäologie »zwischen HumanismusHumanismus und PosthumanismusPosthumanismus« (Kap. 18). Das abschließende Kapitel diskutiert unter Bezugnahme auf die aktuelle Grundsatzdebatte die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Kritik in der (Prähistorischen) Archäologie. Es endet mit einem persönlichen Fazit zur Zukunft des Faches.
Beginnen möchte ich aber zunächst mit einer Vorstellung der Prähistorischen Archäologie in ihrer historisch gewachsenen Gestalt, die auf aktuelle Diskussionszusammenhänge und Problemlagen des Faches hinführen soll. Im Anschluss daran werde ich versuchen, den historischen wie systematischen Ort der Theorie im Rahmen unserer Bemühungen um eine archäologisch gegründete (Ur-)Geschichtsforschung näher zu bestimmen.
2Über Selbstverständnis und Ziele der Prähistorischen Archäologie
»The essential of the archaeologist, as we interpret his function today, is that he is an historian, and his aim is the writing of history by the methodological study of all objects – beautiful or ugly, important or trivial – that survive from the prehistoric past.«
(Glyn DanielDaniel, Glyn 1975, 10)
»The past is a cultural construction no different from heaven.«
(Mark P. LeoneLeone, Mark P. 1978, 30)
Bevor ich näher auf grundsätzlichere Fragen zu Erkenntnis- und Argumentationsweisen der Prähistorischen Archäologie eingehe, ist es zunächst sinnvoll, diese Fachwissenschaft in ihrer Spezifik und geschichtlich gewachsenen Gestalt kurz vorzustellen. Gewöhnlich werden in diesem Zusammenhang drei Aspekte unterschieden: ein Gegenstands-, ein Quellen- und ein Methodenaspekt. Ausgehend von diesen Begriffen möchte ich an dieser Stelle in einem ersten Zugriff versuchen, Eigenart und Struktur jener Fachwissenschaft namens ›Prähistorische Archäologie‹ knapp zu umreißen. Das bedeutet zugleich, das etwas näher zu fassen, was in der jüngeren Wissenschaftsforschung als die ›kognitive IdentitätIdentität, kognitive, historische, soziale‹ eines Faches bezeichnet wird (s. Veit 1995 mit Bezug auf LepeniesLepenies, Wolf 1981). Dieser Begriff zielt auf die Spezifik und Kohärenz fachwissenschaftlicher Orientierungen, ParadigmenParadigma, Problemstellungen und Forschungswerkzeuge. Eng damit verbunden ist das Konzept der ›sozialen Identität‹, das sich auf die institutionelle Struktur des Faches und die Herausbildung eines spezifischen Fachhabitus bezieht. Das Konzept der ›historischen Identität‹ schließlich richtet den Blick auf die Personen und Leistungen in der Vergangenheit, auf die sich die Mitglieder der betreffenden Gemeinschaft von Forschenden berufen, in denen sie also ihre aktuelle Arbeit begründet sehen.
Angesichts der komplexen Geschichte der Urgeschichtsforschung wäre es allerdings naiv, würde man als Ergebnis einer solchen Erkundung ein klar konturiertes Gebilde erwarten. Vielmehr geht es im entsprechenden Zusammenhang immer auch um eine Auslotung jener Identitätskonflikte, von denen in der Einleitung bereits kurz die Rede war. Sie sind als Motoren für die weitere FachentwicklungFachentwicklung von kaum zu unterschätzender Bedeutung. Gleichwohl hat es in der Vergangenheit immer wieder Versuche gegeben, die Vielfalt der betreffenden Erkenntnisbemühungen zugunsten eines einheitlichen Fachkonzepts zu beschneiden. Dabei werden dann notwendigerweise immer wieder auch bestimmte ältere Traditionsbestände abgeschnitten. Diese können jedoch unter veränderten Rahmenbedingungen später wiederentdeckt und rehabilitiert werden.
2.1DisziplinaritätenDisziplinarität
Was also macht im Kern jene Fachwissenschaft aus, die von mir hier als ›Prähistorische ArchäologiePrähistorische Archäologie‹ bezeichnet wird, die man aber mit gleichem Recht auch ›Prähistorie‹, ›VorgeschichteVorgeschichte‹, ›Ur- und Frühgeschichte‹ oder ›Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie‹ nennen könnte? All diese Begriffe wurden und werden – meist ohne Rücksicht auf die jeweils darin enthaltenen Bedeutungsnuancen – weitgehend synonym gebraucht (Fetten 1998; Hoika 1998).1 Über ihren Einsatz bestimmen oft mehr fachhistorische bzw. wissenschaftspolitische Aspekte als inhaltliche Erwägungen. So neigen etablierte Fachinstitutionen eher dazu, an überkommenen Bezeichnungen festzuhalten, während Neugründungen eher zu neuen Begriffsbildungen führen. Ein gutes Beispiel für die Wandelbarkeit entsprechender Konventionen ist die seit Längerem zu beobachtende Tendenz, den Begriff ›Ur- und Frühgeschichte‹ durch ›Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie‹ zu ersetzen. Mehr als inhaltliche Erwägungen dürfte dabei die Möglichkeit, von der positiven Aura des Begriffs ›Archäologie‹ zu profitieren, eine Rolle spielen. Aber es gibt daneben durchaus auch inhaltliche Argumente, die für solche Anpassungen sprechen. In diesem Fall ist es die Idee einer archäologischen EinheitswissenschaftArchäologie als Einheitswissenschaft, die zugleich mit einer stärkeren Abgrenzung der Prähistorie zur Geschichtswissenschaft einhergeht.2
Lange galt der ›prähistorische Mensch‹ als zentraler Gegenstand der Prähistorischen Archäologie. Dies gilt mit Einschränkungen auch noch heute, allerdings ist inzwischen klar, dass dieser nicht mehr – wie noch im 19. Jahrhundert – als genereller Typus, sondern nur im Plural, d. h. in seinen jeweiligen Vergesellschaftungsformen und Umwelten untersucht werden kann. Entsprechend interessiert sich das Fach für alle menschlichen Gemeinschaften bzw. ›Kulturen‹, die – wie man früher sagte – im ›Zustand der SchriftlosigkeitSchriftlosigkeit‹ lebten. Dies betrifft sowohl Zeiträume, in denen es noch überhaupt keine Schrift (und entsprechend auch keine schriftliche ÜberlieferungÜberlieferung, schriftliche) gab, als auch Epochen, in denen Schriftkulturen und solche mit ausschließlich oraler Überlieferung nebeneinander – vielfach auch miteinander – existierten (FrühgeschichteFrühgeschichte). Insofern kann man zusammenfassend sagen, die Ur- und Frühgeschichte bzw. Prähistorie befasse sich in universalem Maßstab mit Ursprüngen und Randbereichen menschlicher ZivilisationZivilisation.3
Dieser universalgeschichtliche Aspekt kommt in der Praxis allerdings selten zum Tragen. Ihm gegenüber steht die relative räumliche Begrenztheit eines Großteils der archäologischen Forschung, die sich aus der raumzeitlichen Differenziertheit der Quellen ergibt, die ihrerseits eine weitgehende regionale (und auch epochale) Spezialisierung nötig macht. Auch die vielgliedrige nationalstaatliche bzw. föderale Struktur der meisten Fachinstitutionen, nicht zuletzt der BodendenkmalpflegeBodendenkmalpflege, fördert eher ein Arbeiten im kleineren räumlichen Maßstab, d. h. auf regionaler oder nationaler Ebene. Damit möchte ich den durchaus gut etablierten internationalen Austausch im Fach nicht kleinreden. Aber diese Zusammenarbeit zeichnet sich v. a. dadurch aus, dass attraktive, aber räumlich begrenzte Forschungsfelder (in Mitteleuropa, im Mittelmeerraum oder im Vorderen Orient, darüber hinaus besonders in Staaten ohne ausgeprägte eigene Archäologietradition) parallel durch Forschergruppen aus unterschiedlichen Nationen untersucht werden. Universalgeschichtliche Synthesen und breitere kulturvergleichende Studien – jenseits populärwissenschaftlicher Zusammenstellungen und so genannter ›Buchbindersynthesen‹ sind hingegen eher die Ausnahme (Müller-KarpeMüller-Karpe, Hermann 1966–1974) und scheinen inzwischen – zusammen mit dem Konzept einer ›UniversalgeschichteUniversalgeschichte‹ insgesamt – auch etwas aus der Mode gekommen.4 Verbreiteter sind Arbeiten mit einem klaren regionalen und chronologischen Bezug. Und auch hier geht die Tendenz heute eher weg von der traditionellen Ursprungs- und Beziehungsforschung hin zu einer differenzierten Kontext- und Prozessanalyse.
Dies ändert indes nichts an der Tatsache, dass sich das Fach – in Ermangelung von Zeitzeugen bzw. protokollierten Zeitzeugenberichten – auf die ›Befragung‹ dinglicher ÜberresteÜberreste konzentrieren muss. Im Fokus stehen zwangsweise ›SachaltertümerSachaltertümer‹, d. h. mehr oder minder zufällig auf uns gekommene materielle ›Überreste‹, zumal (aber nicht ausschließlich) solche, die die SpurenSpur(en) menschlicher Gestaltung oder zumindest menschlichen Handelns bekunden (›materielle Kultur‹, s. auch u. Kap. 4 und 8). ›TraditionTradition(en)en‹ in Form eines begründenden und legitimierenden Wissens um die Vergangenheit (mündliche Traditionen, GeschichtsschreibungGeschichtsschreibung bzw. das ›Kulturelle GedächtnisKulturelles Gedächtnis‹ im Sinne von JanAssmann, Jan und Aleida AssmannAssmann, Aleida: J. Assmann 1992; A. AssmannAssmann, Aleida 2007) sind dem Fach nicht (mehr) zugänglich, auch wenn sie durchaus direkte Auswirkungen auf die materielle Überlieferung gehabt haben dürften. Insofern ist das Ergebnis der fachwissenschaftlichen Bemühungen eine eng an Objektbeobachtungen gebundene, deshalb aber nicht zwangsläufig zugleich auch ›objektive‹ Geschichtsschreibung (Veit 2011b). Dies zeigt sich auch daran, dass seit der Entstehung des Faches »erfundene TraditionenTradition, erfundene« (Hobsbawm/Ranger 1983) – wie z. B. die Idee eines (indo-)germanischen Urvolks – im Fachdiskurs immer wieder eine bedeutsame Rolle gespielt haben.
Eng mit dem Quellenaspekt verbunden ist der Methodenaspekt. Unter einer ›Methode‹ wird in den historischen Wissenschaften gewöhnlich eine mehr oder weniger komplexe, regelhafte Verfahrensweise zur Gewinnung, Aufbereitung und Analyse von historischen Quellen verstanden. Man unterscheidet dabei zwischen qualitativen und quantitativen Methoden: Bildwerke oder exzeptionelle Einzelfunde, wie beispielsweise die berühmte »Himmelsscheibe« von Nebra (s. MellerMeller, Harald/Bertemes 2010), erfordern jenseits archäometrischer Forschungen im engeren Sinne eher den Einsatz qualitativer Methoden; dort wo große Zahlen ähnlicher Funde oder Befunde verfügbar sind, bieten sich hingegen eher quantitative Methoden an. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Wissens werden darüber hinaus in Zukunft auch big databig data-Anwendungen für das Fach an Bedeutung gewinnen (KristiansenKristiansen, Kristian 2014).
In der Außenwahrnehmung wird die MethodendebatteMethode in der Prähistorischen Archäologie allerdings häufig auf den Bereich ›Ausgrabung/archäologische Feldarbeit‹ verengt. Genau besehen bildet die ›GrabungsmethodikGrabungsmethodik‹ jedoch nur einen kleinen Teil der methodischen Kompetenzen, über die ein Prähistorischer Archäologe verfügen sollte [Abb. 3]. Er ist zugleich (oder auch in der Hauptsache) als Materialkenner und -analytiker, als KonservatorKonservator sowie als Chronist und GeschichtsschreiberGeschichtsschreibung gefordert. Auf all diesen Feldern kommen spezielle Methoden und Techniken zum Einsatz, die heutzutage selbst voluminöse methodenorientierte Facheinführungen nicht mehr systematisch behandeln können (s. EggertEggert, Manfred K. H. 2001/2012; 2024).
Archäologische Feldarbeit im Rahmen einer Lehrgrabung: Grabungen am ›Burrenhof‹ bei Grabenstätten im Bereich eines Gräberfelds der vorrömischen Eisenzeit (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Universität Tübingen).
Dies gilt noch mehr für die zahlreichen naturwissenschaftlichen Methoden und Techniken5, die die Fachpraxis in immer stärkerem Maße mitprägen. Ihre Anwendung und die Beurteilung der Qualität der erzielten Ergebnisse setzen häufig nicht nur eine teure apparative Ausstattung, sondern auch breite naturwissenschaftliche Kompetenzen voraus. Deshalb werden solche Forschungen heute in der Regel von Personen mit einer entsprechenden Spezialisierung bzw. in größeren Fächerverbünden durchgeführt (s. Kap. 17). Der besondere epistemologische Status dieser Forschungen zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass in solchen Zusammenhängen, anders als in der traditionellen Archäologie, nicht mehr durchgängig von ›Quellen‹ und ›Quellenrecherche‹, sondern vermehrt von ›Daten‹ und ›DatenerhebungDatenerhebung‹ die Rede ist. Die Daten bilden dann die Grundlage, mit der im Idealfall bestimmte forschungsleitende Hypothesen formuliert und getestet werden können (s. Kap. 13).
Dieser Sachverhalt macht auch deutlich, dass hier unterschiedliche wissenschaftliche Kulturen (LepeniesLepenies, Wolf 1985; Kreuzer 1987) aufeinandertreffen, was zu massiven Verständigungsproblemen zwischen den verschiedenen Fraktionen führen kann. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass sich in der Prähistorischen Archäologie die Zusammenarbeit zwischen Archäologen, die sich selbst primär meist als ›Geisteswissenschaftler‹ verstehen, und Naturwissenschaftlern (bzw. naturwissenschaftlichen Archäologen) auf der praktischen Ebene bis heute vielerorts vergleichsweise problemlos vollzieht. Dies hängt damit zusammen, dass Bemühungen beider Parteien oft auf dieselbe ›wissenschaftliche‹ bzw. ›objektive Geschichte‹ abzielen, die es letztlich nicht geben kann (s. Kap. 3).
Dass es in der Vergangenheit dennoch immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen sog. ›traditionellen‹ und sog. ›naturwissenschaftlichen‹ Ansätzen im Fach gekommen ist, hat hingegen andere Gründe. Es hängt damit zusammen, dass mit neuen Methoden erzielte Ergebnisse etablierte alte GeschichtsbilderGeschichtsbild(er) (und damit zugleich akademische Lebenswerke) infrage gestellt und so heftige Gegenreaktionen unter deren Anhängern provoziert haben.6 Dabei ist ein vermeintlich unüberbrückbarer Gegensatz zwischen beiden Richtungen konstruiert worden. Allerdings sind auch die heute häufig als ›geisteswissenschaftlich‹ etikettierten, traditionellen Methoden des Faches (etwa die ›StratigraphieStratigraphie‹ oder die ›TypologieTypologie‹) im Kern keineswegs ›geisteswissenschaftlich‹, sondern in der Mehrzahl ebenfalls ›naturwissenschaftlich‹ (genauer: ›naturgeschichtlich‹) gegründet (s. Kap. 9.3, 10, 17). Insofern ist es m. E. falsch, in diesem Zusammenhang von der Konfrontation unterschiedlicher DisziplinaritätenDisziplinarität zu sprechen (s. Kap. 4).7
2.2Zielkonflikte
Fassen wir die bisherige Argumentation zusammen, so lässt sich festhalten, dass die Prähistorische ArchäologiePrähistorische Archäologie durch dreierlei charakterisiert ist: Die zeitliche (und kulturelle) Entrücktheit ihres Gegenstands (die Ursprünge und RänderRandbereiche (der Zivilisation) menschlicher ZivilisationZivilisation), die sinnlich erfahrbare Konkretheit ihrer QuelleQuellen (materielle, in der Regel keine Schrift tragende Überreste vergangener Zeiten) sowie die Technizität ihrer Erkenntnisgewinnung (z. B. der AusgrabungAusgrabung als primär technischem Prozess der Entbergung der Vergangenheit). In diesem Sinne kann man sie zweifellos als eine Wissenschaft der Gegensätze beschreiben [Abb. 4].
Titelseite des Buchs »Das germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Rheinhessen« der Mainzer Kunstmaler und Altertumsforscher Wilhelm und Ludwig Lindenschmit aus dem Jahre 1848. – Das Titelbild vereinigt Grabungswerkzeug und Funde unter einer deutschen Eiche und veranschaulicht auf diese Weise den Gegensatz von ›Imagination‹ und ›Methode‹ in der Archäologie (Exemplar der Bibliothek des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen, das laut Stempelaufdruck ursprünglich aus einer württembergischen Adelsbibliothek stammt).
Der in dieser Charakterisierung mitenthaltene Gegensatz zwischen ›ImaginationImagination‹ und ›Methode‹ (bzw. zwischen Romantik und AufklärungAufklärung) lässt sich exemplarisch übrigens bereits am Werk zweier Gründergestalten des Faches, nämlich Heinrich SchliemannSchliemann, Heinrich (1822–1890) und Rudolf VirchowVirchow, Rudolf (1821–1902) veranschaulichen. Der eine, Schliemann, versuchte – auf der Basis des positivistischen Denkens seiner Zeit – Wege zu finden, um historische und mythische Überlieferungen mittels Ausgrabungen zu bestätigen, der andere, Virchow, wollte die Quellen gerade von solchen mythischen bzw. historischen ›Anhaftungen‹ befreien und für sich sprechen lassen (Veit 2006d). In dieser Tradition geht es der prähistorischen Forschung noch heute sowohl um die Bewahrung und Vergegenwärtigung der (lokalen, regionalen, menschlichen) Tradition wie um eine möglichst vorbehaltlose historische Aufklärung durch radikale Entmystifizierung der Quellen.1
Ein weiterer für das Fach konstitutiver Gegensatz wird durch das Begriffspaar ›Provinzialität‹ und ›Universalität‹ umschrieben. ›Provinzialität‹ verweist hier zunächst auf die zentrale Bedeutung einer von gebildeten LaienLaienforschung getragenen Forschungspraxis für die Herausbildung eines Faches, das die heimischen Altertümer ins Zentrum seines Erkenntnisinteresses stellte. Urgeschichtsforschung war so gesehen lange Zeit ›HeimatforschungHeimatforschung‹ im besten Sinne – und ist dies teilweise auch heute noch. In der territorial streng gegliederten archäologischen DenkmalpflegeDenkmalschutz, Denkmalpflege2 ist ›Provinzialität‹3 in gewisser Weise sogar zum gesetzlichen Auftrag erhoben worden. Denn wenn auch sicherlich nicht das grundsätzliche Interesse der Amtsträger, so enden doch die Zuständigkeiten – nicht nur was Fragen der Erhaltung betrifft, sondern auch solche der Forschung und Vermittlung – auch heute noch häufig an der Landesgrenze [Abb. 5].
Portal des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt. Der Bau des Architekten Wilhelm Kreis wurde 1918 eingeweiht und war der erste in Deutschland der Vorgeschichte gewidmete Museumsbau (Findeisen 1984; Brülls 2016). Als Vorbild diente dem Architekten erstaunlicherweise die römerzeitliche Porta Nigra in Trier. Der Bau dokumentiert die wachsende gesellschaftliche Bedeutung des Faches im frühen 20. Jahrhundert, die zu dessen institutionellem Ausbau in den 1920er und 1930er Jahren führte.
Demgegenüber steht auf theoretischer Ebene ein universeller Anspruch des Faches (EggertEggert, Manfred K. H. 2001/2012, 8), der indes selten auch wirklich eingelöst wird. Dabei ist gerade dieser Anspruch letztlich Garant dafür, dass das Fach wie kein zweites langfristige und großräumige Veränderungen in den Blick nehmen kann, etwa die erste Besiedlung der Ökumene, die Implementierung und Ausbreitung einer produzierenden Wirtschaftsweise (mit ihren Sekundärfolgen) oder – in jüngeren Zeiten – die PeripherienPeripherie(n) und RänderRandbereiche (der Zivilisation) der frühen HochkulturenHochkultur (s. z. B. ParzingerParzinger, Hermann 2014). Hierin liegt ein wesentliches Potential der Prähistorischen Archäologie zur Erweiterung unseres historischen Wissens über die Grenzen eines traditionellen, nationalstaatlich bzw. geschichtsraumspezifisch begrenzten Geschichtsbildes hinaus [Abb. 6].
Das ›Forschungsmuseum Schöningen‹ (Lkr. Helmstedt, Niedersachsen), das im Jahre 2013 unter noch unter dem Namen ›paläon‹ eröffnet wurde, repräsentiert eine neue Generation von Archäologiemuseen. Im Zentrum des stehen die einzigartigen, 300.000 Jahre alten Speere, die im Bereich des angrenzenden Tagebaus gefunden wurden. Sie werden dem Homo heidelbergensis zugerechnet, der hier u.a. Pferde jagte. – Verantwortlich für das Museumsgebäude zeichnete das Züricher Architekturbüro ›Holzer Kobler Architekturen‹. Passend zum Thema bemüht das futuristisch wirkende Gebäude die Metapher der geologischen Schichtabfolge.
Daneben gibt es in jüngerer Zeit aber auch immer wieder Stimmen, die von prähistorisch-archäologischen Untersuchungen einen ganz praktischen Nutzen erwarten – etwa ein besseres Verständnis gegenwärtiger Verhältnisse und zukünftiger Entwicklungen im Bereich des Umwelt- und Klimawandels (z. B. Schauer 1999; Daim 2011) oder der »Technikfolgen-Beobachtung« (Zimmermann/Siegmund 2002). Zuletzt stand sogar die »Pandemiebewältigung« als Aufgabe von Archäologie und Altertumswissenschaft im Raum (Käppel et al. 2020). Solche Ansprüche des Faches auf unmittelbare gesellschaftliche RelevanzRelevanz (soziale, gesellschaftliche) sind bisher allerdings ebenso wenig eingelöst worden, wie die ältere Vorstellung, mittels archäologischer MethodikMethodik ließen sich territoriale Ansprüche moderner Nationalstaaten rechtfertigen.4
Daher erscheint es angemessener in der Gewinnung methodisch abgesicherten Wissens über die prähistorische Vergangenheit zunächst einmal vor allem eine intellektuelle Bereicherung unserer modernen Kultur zu sehen, wie dies in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits Vere Gordon ChildeChilde, V. Gordon (1992–1957) vorgeschlagen hat.5 Dabei war sich schon Childe bewusst, dass es sich dabei keineswegs um ein wertfreies Wissen handelt. Vielmehr zeigt die Fachgeschichte eindrücklich, wie immer wieder versucht wurde, auch mit vermeintlich peripheren Wissensbeständen Politik zu treiben. In diesem Sinne haben sich Identitätskonstrukte, die auf prähistorischen Befunden aufsetzen, wiederholt als äußerst problematisch erwiesen. Dies gilt nicht nur für ältere Versuche, das Fach als eine »hervorragend nationale Wissenschaft« (KossinnaKossinna, Gustaf 1914) zu positionieren, sondern ebenso für jüngere Bemühungen, die archäologische Überlieferung zu einem Vehikel zur Konstruktion einer neuen europäischen Identität zu machen.6
Diese Mahnung ist jedoch nicht dahingehend zu verstehen, dass sich der Prähistorische Archäologe nicht für das zu interessieren habe, was um ihn herum heute vorgeht, und man ihn darin bestärken müsse, er solle seinen Interessen und Neigungen im ›ElfenbeinturmElfenbeinturm‹ eines kleinen Faches nachgehen.7 Seine Fragen an die Überlieferung sind und bleiben immer auch diejenigen seiner Gegenwart. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass die Antworten, die es auf aktuelle Herausforderungen gibt, denen der Politik entsprechen oder dieser gefallen müssen (Veit 2022a).
Spezialisierungen im Fach ›Prähistorische Archäologie‹
zeitlich
räumlich
thematisch
Jägerische Archäologie
(ältere Steinzeiten)
Mittel- und Nordeuropa
Archäometrie / Naturwiss. Archäologie
Archäologie des Neolithikums
West- und Südwesteuropa
Archäobiologie (Archäozoologie und -botanik)
Archäologie der
Metallzeiten
Ost- und Südosteuropa
Physische Anthropologie / Archäogenetik
[Provinzialrömische Archäologie]
Mittelmeerraum:
Klassische Archäologie
Archäoinformatik
Archäologie des frühen Mittelalters
Vorderer Orient: Vorderasiatische Archäologie
Experimentelle Achäologie / Ethnoarchäologie
[Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit]
Sonstige Teile der Alten Welt
Theoretische Archäologie
Industriearchäologie,
Zeitgeschichtliche A.
Neue Welt (Amerikanische Archäologie)
Archäologiegeschichte
Fachliche Ausdifferenzierung der Prähistorischen Archäologie. – Kursiv: Bereiche, die heute im Rahmen eigenständiger Fachwissenschaften gelehrt werden.
Diese kurzen Hinweise mögen genügen, um anzudeuten, dass die Prähistorische ArchäologiePrähistorische Archäologie in ihrer heutigen Gestalt kein formal klar strukturiertes Gebäude darstellt. Viel eher gleicht sie einem komplexen architektonischen Gebilde mit vielfältigen An- und Umbauten. Dazu gehören neben wenigen ›Kathedralen des Wissens‹ auch aufgelassene, ruinöse Bereiche, die einer Wiederentdeckung und -verwendung harren, ebenso wie Räume im Rohbau, die für Versprechen stehen, die erst noch eingelöst werden müssen. Diese Situation ist sicher zum Teil auch der Preis für eine beispiellose Expansion und Ausdifferenzierung, die das Fach im letzten Jahrhundert nicht nur entlang der Dimensionen Raum und Zeit, sondern auch in thematischer Hinsicht erlebt hat [Tab. 1]. Dabei sind im Bereich der heute häufig so genannten »Historischen ArchäologienHistorische Archäologie(n)« (U. MüllerMüller, Ulrich 2017) unter Übernahme des Feldforschungsparadigmas der Prähistorischen Archäologie ganz neue Fächer entstanden.8 Eine solche erfolgreiche Tochtergründung ist beispielsweise die ›Archäologie des Mittelalters und der NeuzeitArchäologie des Mittelalters (und der Neuzeit)‹, die sich – befeuert durch die konsequente Ausweitung des Denkmalbegriffs und die sich daraus ergebenden öffentlichen Verantwortlichkeiten – in den letzten 30 Jahren sehr dynamisch entwickelt hat (ScholkmannScholkmann, Barbara et al. 2016).
Dies gilt auch für den oben schon angesprochenen Bereich ›ArchäometrieArchäometrie/Naturwissenschaftliche ArchäologieNaturwissenschaftliche Archäologie‹, der sehr direkt von den erweiterten ingenieurtechnischen Möglichkeiten profitiert. Es gilt aber auch für die ›ArchäogenetikArchäogenetik‹ (KrauseKrause, Johannes 2020) oder die ›ArchäoinformatikArchäoinformatik/Digitale Archäologie/Digitale Archäologie‹ (Shennan 1997). Dagegen besitzen andere thematische Bereiche wie ›Experimentelle Archäologie‹Experimentelle Archäologie (Fansa 1990; 1997), ›EthnoarchäologieEthnoarchäologie‹ (Struwe/Weniger 1993) oder auch die ›Theoretische ArchäologieArchäologie, Theoretische‹ (z. B. EggertEggert, Manfred K. H./Veit 2013; Hofmann/StockhammerStockhammer, Philipp W. 2017) gerade in Mitteleuropa noch deutliches Entwicklungspotential (s. Kap. 3, 18, 19).
Umgekehrt zeigt der Bereich der ›ArchäologiegeschichteArchäologiegeschichte‹, im Zusammenhang mit einem gesteigerten Bedürfnis nach einer historischen Verankerung des eigenen Tuns, gegenwärtig Zeichen einer gewissen Konjunktur, die vor vierzig Jahren, als ich mich dafür zu interessieren begann, noch nicht abschätzbar war.9 Dazu haben neue Bereiche, wie die sich parallel entwickelnde ›Genderarchäologie‹Genderarchäologie, beigetragen, die ebenfalls in starkem Umfang wissenschaftsgeschichtlich ausgerichtet war und ist.10 Allerdings führt die angedeutete Ausdifferenzierung zwangsweise auch zu einer immer größeren Spezialisierung und damit zu einer Trennung zwischen primärer Forschung und einer – wie auch immer motivierten – Fachgeschichte als dem Gedächtnis dieser Forschung. So wird eine Rückkopplung zwischen beiden Bereichen zusehends schwieriger.
Diese neue Art von Selbstreflexion hat aber immerhin dazu beigetragen, die aktuelle Fachpraxis kritisch zu überdenken, verweist sie doch auch auf die große Zahl von leitenden Hinsichten, unter denen man sich mit der Ur- und Frühgeschichte beschäftigen kann. Das Spektrum reicht von einer von Neugierde getriebenen kulturellen Praxis der Freizeitgestaltung bis hin zur Archäologie als »eine[r] allgemeine[n] KulturtechnikKulturtechnik zur Rettung von verlorenen Zeiten, eine[r] Maschine zur Bändigung der Furie des Verschwindens« (EbelingEbeling, Knut 2004, 27). Entsprechend vielfältig sind die Rollen, in die (Prähistorische) Archäologen im Laufe der Fachgeschichte geschlüpft sind. Dazu gehören jene
des Sammlers und Kenners, der sich mit Gleichgesinnten über die Gegenstände der gemeinsamen Begierde austauscht und der in der Lage ist, ein Publikum mit objektbezogenen Geschichten gelehrt zu unterhalten,
des Entdeckers, Ausgräbers und Helden in der Tradition SchliemannsSchliemann, Heinrich, der nicht nur entbehrungsreich ins Feld zieht, um dem Boden seine letzten Geheimnisse zu entlocken, sondern der über seine Arbeiten auch öffentlichkeitswirksam Bericht erstattet, wobei Forschungsanstrengungen und Forschungsgegenstand teilweise eins werden,
eines sich auf Sachquellen





























