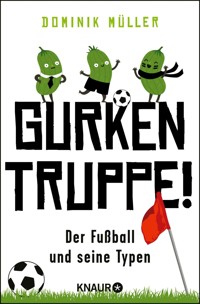
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das perfekte Geschenk für alle Fußballfans! Mit mehr als einer Prise Humor fasst Dominik Müller die Welt des Fußballs in 60 ihrer typischsten Vertreter zusammen. Da wären zum Beispiel: FANTYP: Der Flitzer Wenn ein Mann nackt durch den Stadtpark rennt, wird er von den meisten Menschen als kranker Perversling betrachtet. Und dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Wenn ein Mann nackt über das Spielfeld eines Fußballstadions rennt, wird er zum Publikumsliebling. TRAINERTYP: Der Feuerwehrmann Sechs Niederlagen in Folge! Panik im Verein: Irgendwer muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Gleichzeitig legen Trainer, in deren Wikipedia- Eintrag der Begriff »Feuerwehrmann« vorkommt, ihr Handy auf den Wohnzimmertisch, knien nieder und flüstern: »Ruft mich an! Ruft mich an!« SPIELERTYP: Der Superstar Hatte Jesus Christus Fans? Nein. Also hat der Superstar auch keine. Er hat Jünger. Ihm wird gehuldigt, weil er spielt wie ein Fußballgott – auch wenn man ihn niemals so nennt, weil das zu profan wäre. Mit scharfem Witz und der Erfahrung von 15 Jahren Dauerkartenbesitz leuchtet Dominik Müller das skurrile Biotop zwischen Kreisliga und Champions League aus. Ein Buch für alle, die den Fußball lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dominik Müller
GURKENTRUPPE
Der Fußball und seine Typen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das perfekte Geschenk für alle Fußballfans:
Voller Humor und mit einer Portion Ironie fasst Dominik Müller die Welt des Fußballs in 60 ihrer typischsten Vertreter zusammen. Denn zwischen Bolzplatz und Hochglanzarena, zwischen Profisport und Amateurfußball, haben sich die unterschiedlichsten Biotope gebildet. Vom Superstar des Champions-League-Siegers über den »Harten Hund« beim abstiegsbedrohten Zweitligaclub bis hin zur Bratwurstverkäuferin am Spielfeldrand der Kreisliga.
Mit mehr als einer Prise Humor werden neben Spieler- und Trainertypen auch die gängigen Sorten an Fußballfans, Vereinsfunktionären und schillernden Randfiguren des besten Sports der Welt vorgestellt. Ein Buch für alle, die den Fußball lieben.
Inhaltsübersicht
Spieler
Superstar
Exot
Der Nicht-so-Intellektuelle
Publikumsliebling
Sündenbock
Leitwolf
Thekenkicker
Freizeitliga-Meister
Wochenend-Berserker
Routinier
Bezirksligastar
Bolzplatzjunge
Trainer
Feuerwehrmann
Genie
Harter Knochen
HB-Männchen
Frauenfußballtrainerin
Gentleman
Ehrgeizling
C-Jugend-Schleifer
Sozialarbeiter
Fans
Der Brite
Ultrà
Flitzer
Sitzplatzjahreskarteninhaber
Allesfahrer
Sammler
Fernsehfan
Zocker
Traditionalist
Fanclubvorsitzender
Kutte
Auswärtsbus-Saufkopf
Groundhopper
Historiker
WM-Fan
Edel-Fan
In-die-Kamera-Winker
Kiebitz
Fanbaby
Funktionäre
Verbandsfunktionär
Maskottchen
Stadionsprecher
Doc
Dorf-Vereinspräsident
Platzwart
Wasserträger
Randfiguren
Investor
Spielervermittler
Sportreporter
Schiri
Balljungen
TV-Experte
Bepo
Fanprojektler
Vereinsliedsänger
Spielerfrau
Vereinsheimwirt
Fußballvater
Physio
Fußballbuchautor
Spieler
Ein Tor zu schießen macht die Welt nicht besser. Aber bei der Nobelpreisverleihung wird trotzdem weniger gejubelt. Ein Tor zu schießen, einen Elfer zu halten, einen Pokal zu gewinnen – dafür spielen elf Millionen Menschen in Deutschland Fußball. »Der Druck entlädt sich beim Torschuss – ein Wahnsinns-Feeling.« So hat es Jürgen Klinsmann beschrieben. Und es macht im Kern keinen Unterschied, ob es dabei um die Weltmeisterschaft geht, das Günni-Machutzke-Kleinfeldturnier oder den Triumph über die anderen sieben beim Stadtpark-Kick. Klar bekommen die Gewinner des Günni-Machutzke-Kleinfeldturniers in der Regel keine besonders gut dotierten Werbeverträge. Genau genommen überhaupt keine. Denn das Freibier vom Trikotsponsor Bistro Absturzsicherung kann man kaum als Werbevertrag in diesem Sinn gelten lassen. Ihnen zahlt auch keiner Titelprämien in der Höhe eines Durchschnitts-Jahresgehalts. Aber darauf kommt es eben nicht an. Fußball an sich bewegt Menschen. Und das, obwohl er komplett überflüssig ist.
In Artikel 2 der Statuten des Fußballweltverbands Fifa steht, dass dessen Zweck die fortlaufende Verbesserung und weltweite Verbreitung des Fußballs ist, wobei der völkerverbindende, erzieherische, kulturelle und humanitäre Stellenwert berücksichtigt werden soll. Davor kommt nur, dass der Sitz der Fifa die Schweiz ist, was womöglich aus Gründen Vorrang hat, die mit Steuern und Nummernkonten zu tun haben. Sepp Blatter persönlich hat einmal verkündet: »Fußball vereinigt die Völker und kann mit seiner positiven Energie einen großen Beitrag in einer bösartigen und verrückten Welt leisten.« Mit den Zuständen in einer bösartigen und verrückten Welt müsste sich der langjährige Fifa-Pate bestens auskennen. Trotzdem ist anzunehmen, dass die Erlösung der Menschheit von allem Bösen letztlich nicht in der Fifa-Straße in Zürich-Höttingen ihren Ursprung haben wird. Noch nicht mal im weitesten Sinn.
Selbst Pep Guardiola wird wahrscheinlich kein Spielsystem erfinden, das die Klimaerwärmung stoppt. Auch wenn Christiano Ronaldo und Lionel Messi sich zusammentäten, um in der träumerischsten aller Traumkombinationen die Mutter aller Tore zu erschaffen, würde das die Ernährung der Weltbevölkerung nicht sicherstellen. Und wenn Zenit St. Petersburg die Champions League gewinnen würde, käme kein strategischer Berater im Kreml auf die Idee zu sagen: »Herr Präsident, lassen wir unsere Nachbarländer doch einfach in Ruhe und feiern ein bisschen. Und wenn wir wieder nüchtern sind, versuchen wir mal das mit dieser Demokratie.«
Fußball ist nur Zerstreuung. Aber eine verdammt gute. Natürlich geht es auch um die alte Masche Brot und Spiele. Oder warum sonst werden strittige Gesetze gerne während großer Fußballturniere durch den Bundestag geschleust? Zur WM 2006 wurde die Erhöhung der Mehrwertsteuer beschlossen, zur WM 2010 die Erhöhung des Krankenkassenbeitrags, und während des EM-Halbfinales 2012 entschieden 26 anwesende Abgeordnete ein Meldegesetz, das Ämtern ermöglichte, Daten der Bürger an Firmen und Adresshändler durchzureichen. Wenigstens dieses Gesetz wurde noch korrigiert, nachdem die EM vorüber war und jemand bemerkt hatte, was im kleinen Kreis angerichtet worden war. Immerhin wird beim Fußball nicht wie einst im Kolosseum auf Leben und Tod gekämpft – außer zwischen den → Fußballvätern der E-Jugendspieler. So gesehen ist Fußball eine der großen zivilisatorischen Errungenschaften der vergangenen 2000 Jahre.
In Deutschland finden jeden Tag durchschnittlich über 4000 Fußballspiele statt. Und das sind nur die, über die der Deutsche Fußballbund mit seinen Regionalverbänden und dort organisierten Vereinen die Kontrolle hat. Dazu kommen ungezählte Partien von Freizeitkickern. Während die Zahl der Vereinsmannschaften sinkt, haben Freizeitligen mit weniger starren Strukturen seit Jahren Zulauf. Hobbyteams werben Fußballbegeisterte mit einer »Spielgarantie«. Leute, die sich einer Mannschaft anschließen, um Fußball zu spielen, dürfen das dort also auch hemmungslos tun – selbst wenn ihre Leistung den erfolgreichen Abschluss des Günni-Machutzke-Kleinfeldturniers gefährdet. So was können sich gestandene Kreisklassenclubs natürlich nicht leisten, weil sie unter enormem Leistungsdruck stehen. Es hängt schließlich wahnsinnig viel davon ab, ob die Sportgemeinschaft Klein-Lullendorf den Klassenerhalt schafft. Für die ganze Region. Dafür hat das Bundesinnenministerium eigens eine Studie erstellen lassen. Also nicht nur für Klein-Lullendorf, sondern im großen Maßstab.
Demnach gibt jeder Fußballspieler in Deutschland im Schnitt 536 Euro pro Jahr für die Ausübung seines Sports aus. Das sind insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Und dabei haben die Spaßbremsen im Ministerium wahrscheinlich die Kneipenumsätze nach den Spielen gar nicht mitgezählt. Schließlich haben sie für Sportnahrungsmittel nur 15 Euro im Jahr veranschlagt. Das reicht nicht mal für die stilvolle Würdigung eines glorreichen Auswärtssieges beim Erzrivalen. Vielleicht wollten sie aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Es gibt in der Berechnung noch die Ausgaben für Körperpflege, die mit horrenden 49 Euro im Jahr angegeben werden. Wer die übliche Geruchswelt einer Umkleidekabine kennt, weiß, dass da etwas nicht stimmen kann. Aber Körperpflege ist ja ein weites Feld …
Obwohl es also manches zu hinterfragen gibt, spielen Millionen Menschen Fußball. Und wahrscheinlich auch gerne. Einige sogar extrem gerne. In Frankreich wurde vor einigen Jahren der Weltrekord im Dauerfußball aufgestellt, wobei 72 Stunden ohne Unterbrechung durchgespielt wurde. Das überboten der VfL Wallhalben und der SC Winterbach aus Rheinland-Pfalz im Juni 2015 mit einem 75-Stunden-Match. Etwa gleichzeitig schraubten britische Fußballer die Marke auf 105 Stunden hoch, was fast viereinhalb Tagen Kicken am Stück entspricht. Das ließen die Wallhalbener nicht auf sich sitzen und legten im Juni 2016 mit einer 111-Stunden-Partie gegen den SV Hamburger Berg eins drauf. Die Regeln zum Spielerwechsel wurden für diesen Anlass großzügiger ausgelegt. Von jeweils 18 Spielern im Kader mussten nur mindestens acht auf dem Platz stehen, was man wohl wörtlich verstehen kann. Denn ein allzu großes Laufpensum ist bei der Spieldauer nicht drin. Und spätestens nach drei Tagen war der Ausgang der Partie nur noch so offen wie die Bundesliga-Meisterschaft mit dem FC Bayern in Normalform. Hamburger Berg gewann am Ende mit über 150 Toren Vorsprung 722:568.
Daran lässt sich gut erkennen, wozu Fußballspieler fähig sind, wenn es darauf ankommt. Sie schaffen es, aus einer grundsätzlich überflüssigen Betätigung ein vollkommen sinnloses Ereignis zu machen. Und am Ende haben trotzdem alle Spaß daran. Gut, der Torwart von Wallhalben vielleicht nach dem 700. Gegentor nicht mehr. Und das 568. Tor seines Mannschaftskameraden hat wahrscheinlich auch kein Klinsmannsches Wahnsinns-Feeling mehr in ihm ausgelöst. Aber es werden sich bestimmt bald irgendwo wieder ein paar Fußballer dranmachen, einen neuen Weltrekord aufzustellen, während andere wegen der möglicherweise ungünstigen Langzeitwirkung auf die Saison-Performance so einen Klamauk prinzipiell ablehnen. Wenn elf Millionen Menschen in Deutschland und 265 Millionen weltweit (laut Fifa-Zählung von 2006) kicken, ist an der Floskel vom Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft wohl etwas dran. Und wenn man sich die gängigen Spielertypen anschaut, macht einen das bei manchen optimistischer für den Lauf der Welt als bei anderen.
Superstar
Biotop: Gala für den Weltfußballer des Jahres
Population: Es kann nur einen geben
Hatte Jesus Christus Fans? Nein. Also hat der Superstar auch keine. Er hat Jünger. Ihm wird gehuldigt, weil er spielt wie ein Fußballgott – auch wenn man ihn niemals so nennt, weil das zu profan wäre. Das Fernsehen zeigt seine Dribblings in Super-Zeitlupe. Das Best-of-Video mit seinen schönsten Toren dauert zwei Stunden – allein für die letzte Saison. Feuilletonisten schreiben Essays über die durch ihn verkörperte Perfektion des Fußballspiels, die noch jeden Gegner der Welt übermannt hat. Er spielt für einen Verein, der vor jeder Saison zu den Favoriten auf den Champions-League-Sieg zählt, und in der Nationalmannschaft, wenn er Lust hat. Er hat schließlich noch andere Termine.
Der Superstar eröffnet nebenberuflich Hotelketten oder hat eine eigene Männerparfümlinie am Markt. Er löst mindestens einmal in seiner Karriere einen weltweiten Mode-, Frisuren- oder Tattootrend aus und wird gerne zum Sexiest Man Alive gewählt. Richtig Spaß macht es ihm, sich neue Jubelposen auszudenken. Nach seinem letzten Hattrick hat er eine kleine Star-Wars-Szene nachgespielt. Das Lichtschwert und der Darth-Vader-Helm waren dafür vom Mannschaftsarzt vorher in der Nähe der Eckfahne deponiert worden. Manchmal geben ihm die Schiri-Spaßbremsen dann eine gelbe Karte. Den Preis zahlt er eben.
Um seinen Marktwert zu optimieren, muss er immer wieder Affären mit Unterwäschemodels, Sängerinnen und Hollywood-Stars anfangen. Das ist anstrengend. Aber so läuft’s Business. Seine PR-Agenturen streuen auch Gerüchte, er sei schwul, weil damit eine überdurchschnittlich kaufkräftige Zielgruppe adressiert wird. Sagt einer seiner persönlichen Marketing-Manager. Von ihm hängen immerhin so viele Arbeitsplätze ab wie von einem mittelständischen Unternehmen.
Seit dem Kindergarten gibt es nur Fußball für ihn. Sein Vater hat das Talent früh erkannt und ihn konsequent trainiert. Der Blödsinn mit den Steinsäcken, die man ihm als Fünfjährigem an die Beine gebunden habe, ist zwar nur für seine Autobiographie erfunden worden. Aber leicht war es damals trotzdem nicht. Und die Allgemeinbildung ist vielleicht etwas kurz gekommen. Das rächt sich, wenn er für 50 Millionen Twitter-Follower das Weltgeschehen kommentiert. Woher soll er denn wissen, dass die Berliner Mauer nicht zwischen Nord- und Südkorea verläuft und Austria und Australia zwei unterschiedliche Länder sind? Aber scheiß drauf! Er ist der Geilste. Und wenn er Bildung braucht, kauft er sich eben einen Bildungsberater.
Genug Geld hat er ja. Darum kümmert sich sein Finanzmanager. Während Fußballprofis früher noch die Goldfische im Haifischbecken der Anlagebetrüger waren und sich mit dubiosen Bauherrenmodellen ruinierten, hat der heutige Superstar den Ex-Vorstand einer Investmentbank als Berater an seiner Seite. Der kümmert sich ums Geld. Zahlen liegen dem Superstar nämlich überhaupt nicht. Für ihn hat nur eine Zahl Bedeutung: seine Rückennummer.
Der Finanzmanager hatte auch die Idee mit der Stiftung. Spart unendlich viel Steuern. Und die PR-Fritzen fanden das auch super. Allerdings schleifen sie ihn jetzt zu noch mehr Terminen. Dauernd macht er irgendwo »Charity«. Er fragt sich langsam, ob es wirklich so viel Armut auf der Welt gibt. In Interviews jedenfalls muss er immer wieder erzählen über seine Kindheit im Armenviertel. Na ja, ganz so arm war das Viertel eigentlich nicht. Aber es gibt eine gute Story her, wenn er das erzählt, sagen die PR-Fritzen. Das gefällt den Journalisten. Da wollen die gar nicht so genau wissen, wie es wirklich war.
Einmal im Jahr hat der Superstar einen Termin, der ihm sehr viel bedeutet: die Gala für den Weltfußballer des Jahres. Fußball ist ein Mannschaftssport. Man kann noch so viele Zaubertore schießen und noch so viele Gegner auf dem Spielfeld austanzen – als Einzelner wird man nicht so wahrgenommen wie als Formel-1-Rennfahrer oder Tennisspieler. Außer einmal im Jahr in der Schweiz bei der Gala. Da muss er sich mit keinem die Bühne teilen. Und das Schönste: Abgestimmt haben Trainer und Kapitäne von Nationalmannschaften. Die niederen Stände huldigen ihrem Superstar – unbezahlbar! Es dürfen zwar auch ein paar Journalisten abstimmen. Und irgendwie ist die Fifa an der Auswahl beteiligt. Aber das sind Nebensächlichkeiten, wenn der große Moment bevorsteht. Wie bei jeder Gala, auf der ein goldglitzernder Preis überreicht wird, sind die Geehrten auf der Bühne wahnsinnig überwältigt und gerührt – alle, außer dem Superstar. Er ist ja schon vorher frei von jedem Zweifel, dass er den Preis bekommen wird. Sonst würde er sich nicht so eine idiotische Fliege an den Hemdkragen fummeln lassen, als ginge er auf diesen Opernball in Salzburg oder Berlin oder wo der immer stattfindet.
Der Superstar hat nur ein Problem: das Karriereende. Irgendwann wird es kommen – auch wenn er sich das nicht vorstellen kann. Er könnte dann von den Unsummen, die er bis dahin verdient hat, herrlich leben, könnte als Trainer oder Fernsehkommentator arbeiten und dank seiner Kontakte und Popularität viel Gutes tun: Impfprogramme für die Dritte Welt finanzieren, Krankheiten erforschen und Schulen bauen lassen. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass ein solches »Soft Landing« einem Superstar nicht oft gelingt. Wenn der Fußball, um den sich seit seiner Kindheit alles gedreht hat, weg ist. Wenn nur die Vermarktungs-Entourage und die Promi-Disco-Luder bleiben. Wenn er auf der Gala für den Weltfußballer des Jahres nur noch als Gast in der vierten Reihe sitzen darf. Dann hat der Superstar ein Problem. Ob er dann eine ausreichend gefestigte Persönlichkeit besitzt, um sich nicht dem Drogen- und Alkoholdunst hinzugeben? Um diese Frage hat sich noch kein Berater gekümmert.
Exot
Biotop: Winterpause
Population: So selten wie Rohdiamanten
In der Sommerpause kursierten schon Gerüchte. Der Verein habe einen möglichen Neuzugang im Blick. Etwas ganz Besonderes. Nicht wieder nur einen vom Zweitligisten um die Ecke, sondern ein richtig großes Ding. Sportdirektor und Manager sollen inkognito ins Flugzeug gestiegen sein, um die letzten Gespräche zu führen. So richtig, mit Sonnenbrille und Schlapphut. Kurz vor Ende der Transferphase ist der Deal dann in trockenen Tüchern und der Verein stellt seinen Hammer-Neuzugang in einer eigenen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vor: den Exoten.
Die Scouts des Vereins haben ihn bei einem brasilianischen Zweitligisten oder in der U-21-Auswahl von Togo entdeckt. Sein Name setzt sich aus fünf bis sieben Bestandteilen zusammen, die überwiegend Vokale enthalten. Weil die durchschnittliche deutsche Zunge dafür zu ungelenk ist, wird er mit einem kurzen Spitznamen benannt, der übersetzt angeblich so was heißt wie »Füchschen« oder »Wüstenrennmaus« oder irgendein anderes Tier, dessen Name auch als Kamasutra-Stellung durchgehen würde.
Auf der Vorstellungs-Pressekonferenz gibt der Exot den deutschen Satz »Isch bin glücklick, dass hier bin« zum Besten. Weil er dazu so überwältigend charmant grinst, schreiben dann alle, dass er sogar schon angefangen hat, Deutsch zu lernen. Auch wenn er keine Frage versteht, das einzige andere deutsche Wort, das er spricht, »Prost« heißt und selbst sein Englisch kaum jemand entschlüsseln kann. Dafür präsentiert er Arm in Arm mit Trainer und Sportdirektor sein Trikot, auf das sein niedlicher Spitzname geflockt ist. Über einer Rückennummer, die weit jenseits der 11 liegt und angeblich tiefere Bedeutung im Leben des Exoten hat. Die Journalisten telefonieren Leute aus der Fußballwelt seines Heimatlandes durch, um mehr über ihn zu erfahren. Leider ergeben die Recherchen nichts, weil ihn niemand kennt. Das beweist natürlich nur, welch sensationeller Coup dem Verein gelungen ist. Denn seine Scouts haben einen Topspieler entdeckt, dessen Supertalent bislang nicht einmal Insider bemerkt hatten. Man muss einen künftigen Star eben erkennen, wenn man ihn sieht.
Bis zum Saisonstart heizt der Verein den Hype noch an. Die Mannschaft könne mit dieser Verstärkung ganz neue Ziele ins Visier nehmen, lässt man verlauten. Der Trainer habe große Hoffnungen. Da sei einiges möglich. Solchen Impulsen können Fans niemals widerstehen. Wenn es einen Anlass gibt, sich Illusionen zu machen, sei er auch noch so vage, dann sind sie dabei. In Internetforen diskutieren sie darüber, bis zu welchem Jahr ihr Verein Real Madrid als Rekordgewinner der Champions League abgelöst haben könnte.
Schließlich beginnt die Saison, ach was, die neue Ära. Wenn der Exot sein erstes Tor geschossen hat, erreicht die Euphorie ihren Höhepunkt. Früher schrieben die Zeitungen dann von einer »schwarzen Perle«. Das tun sie heute nicht mehr, weil die Empörung über so eine zutiefst rassistische Formulierung die Server von Twitter und Facebook explodieren lassen würde. Stattdessen machen sie in ihren Schlagzeilen Wortspiele mit dem Spitznamen des Exoten. Der Vereinsmanager berechnet überschlagsweise, was sich alles mit der Rekordablöse anstellen lässt, die er einstreichen will, wenn er den Exoten vor Ende von dessen Vierjahres-Vertrags an einen der ganz großen Clubs verkauft – nach England oder Spanien. Unmittelbar danach setzt die Ernüchterung ein.
Drei Spiele lang macht der Exot kein Tor, noch nicht mal ein verwandelter Elfmeter rettet seine Bilanz. Er strahlt nicht mehr so wie damals bei der Vorstellungs-Pressekonferenz. Stattdessen beklagt er das Wetter: immer so kalt und so viel Regen. Da geht die Spielfreude, nein, die Lebensfreude doch zwangsläufig verloren. Das Essen, das schmeckt einfach nicht. Und Deutsch ist eine so furchtbar schwere Sprache. Er hat halt Heimweh. Der Bibelkreis in der Mannschaft hilft ihm schon ein bisschen, aber es ist nicht wie zu Hause. Zunächst hat er noch einen Exotenbonus. Aber irgendwann, nachdem er mit zehn Kilo Übergewicht und zwei Wochen Verspätung aus dem Heimaturlaub in der Winterpause zurückgekommen ist, wenn aus Euphorie Ernüchterung und schließlich Enttäuschung geworden ist, wenn man herausgefunden hat, dass sein Spitzname in Wahrheit »trächtiger Nasenbär« bedeutet, dann wird der Exot an einen italienischen Zweitligisten ausgeliehen.
Dort geht es ihm auch nicht viel besser. Aber bis zum Ende der Vertragslaufzeit spart sich der Verein wenigstens noch ein bisschen Geld. Das kann man gut gebrauchen. Schließlich muss man unbedingt in einen neuen Spieler investieren. Die Scouts haben da schon einen Jungen im Blick. Kennt noch keiner. Aber, mein lieber Mann: ein Rohdiamant! Braucht noch ein wenig Schliff. Dann kann er der ganz große Kracher werden. Einer, mit dem man eine neue Ära beginnen kann.
Der Nicht-so-Intellektuelle
Biotop: Elfmeterpunkt, wenn das Stadion brennt
Population: Einfach da
Es gibt Spieler, die sich vom verbreiteten Bild eines Fußballprofis absetzen. Sie drücken sich in Interviews gewählt aus, haben eine differenzierte Meinung zum Weltgeschehen, absolvieren nebenbei ein Fernstudium und lesen sogar Bücher. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, abgesehen davon, dass dieser Typ einem beträchtlichen Teil der Fußballfans nicht das Gefühl gibt, einer von ihnen zu sein. Eben darin liegt dagegen die Stärke des Nicht-so-Intellektuellen. Er ist ein Fußballer für die Basis. Und die Basis liebt ihn.
Ein Trainer, der sich als → Genie sieht, tut sich mit dem Nicht-so-Intellektuellen schwer. Denn der ist für seine taktischen Winkelzüge kaum empfänglich. Dessen Welt besteht aus einfachen Fußballweisheiten der Kategorie »Mach das Ding rein«. Das gelingt ihm ziemlich häufig. Deshalb ist der Nicht-so-Intellektuelle ein etablierter Spieler. Seine Stärke ist, dass er einfach funktioniert. Wenn die Mannschaft in der Nachspielzeit eines Halbfinales einen Elfmeter bekommt, spüren verkopfte Spieler das Kniezittern, ihre Gedanken taumeln über den hauchdünnen Grat zwischen Triumph und Niederlage, zwischen ewigem Elysion und griechischer Tragödie. Der einzige Gedanke des Nicht-so-Intellektuellen ist: »Mach das Ding rein.« Und das macht er dann auch.
Seine gnadenlose Unbefangenheit prädestiniert ihn ebenso für heikle Pressekonferenzen. Vor besonders wichtigen Spielen strahlt er eine Gelassenheit aus, die jeden Gegner nervös machen muss. Wenn es um Themen wie Doping, Wettbetrug oder eine Schlägerei zwischen Spielern geht, äußert er sich entwaffnend naiv. Er holt auch noch so hochgejazzte Themen auf den Boden zurück. Sollte sich zum Beispiel einmal die Öffentlichkeit damit beschäftigen, dass sich ein renommierter Trainer vor laufender Kamera im Schritt gekratzt hat, dann wäre der Nicht-so-Intellektuelle genau der Richtige, um den Journalisten klarzumachen, dass so was doch jeder mal tut. Aber das ist rein hypothetisch. Denn welcher → Sportreporter würde sich – zum Beispiel bei einer Europameisterschaft – jemals mit einem solch lächerlichen Thema befassen?
Der Nicht-so-Intellektuelle hat wenige Interessen neben dem Fußball. Trotzdem fällt ihm zu fast allem etwas ein, wenn er gefragt wird. Oder wenn er Lust hat, was auf Facebook zu machen. Nicht, dass er zu allem etwas wüsste. Aber es macht ihm nichts aus, sich zu allem zu äußern. Und sein Talent liegt darin, das so zu tun, dass es ihm meist keiner übelnimmt. Im Gegenteil: Seine schlichten Weisheiten werden zu Kultsprüchen in Zitatesammlungen. Auch dafür lieben ihn viele Fans. Er ist einer aus dem Volk. Er spricht so. Und man kann sich vorstellen, dass er sich auch so verhält. In einem Auswärtsfanbus würde er wahrscheinlich nicht auffallen. Und man traut ihm zu, dass er mitfahren würde. Berührungsängste kennt er nicht. Selfie ist sein zweiter Vorname.
Mitunter versuchen schlichte Gemüter, ihr Image künstlich aufzupolieren. Sie fangen an, eine Brille zu tragen, weil ein Berater gesagt hat, das ließe sie nachdenklicher aussehen. Und sie lassen in Interviews einfließen, wie beeindruckt sie kürzlich vom Besuch der Ausstellung zeitgenössischer Kunst im örtlichen Museum gewesen seien. Auf solche Ideen käme der Nicht-so-Intellektuelle niemals. Dafür ist er viel zu authentisch. Er kümmert sich lieber darum, gegen Ende seiner Fußballkarriere einen Song aufzunehmen mit einer Karnevalsband oder einem Musiker, der im Hauptberuf Kneipenwirt ist. Am besten einen Ballermann-Hit. Er hat schon eine Hammer-Idee für den Titel: »Mach das Ding rein«.
Publikumsliebling
Biotop: Autogrammstunde
Population: Seltenes Exemplar
Verglichen mit Menschen in anderen Berufen, genießen Fußballprofis ein sensationelles Maß an Wertschätzung. Solange sie nicht so viel Mist bauen, dass sie zum → Sündenbock werden, können sie sich vor Sympathiebekundungen kaum retten. Bei der Arbeit werden Lobeshymnen auf sie gesungen. Für sie ist im Restaurant immer ein Tisch frei. Menschen lassen sich auf der Straße mit ihnen fotografieren, klopfen ihnen auf die Schulter und erzählen ihnen, welch prima Kerle sie insgesamt sind. Die Zuneigung mag manchmal lästig sein und meistens oberflächlich – aber immerhin. Vor dem Personaleingang von Aldi warten keine Groupies, um den Marktleiter um Autogramme zu bitten. Selbst dann nicht, wenn er den Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche um sensationelle 7,34 Prozent gesteigert hat. Im Einwohnermeldeamt stimmt keiner Gesänge an, weil die Sachbearbeiterin an einem Tag die Antragsformulare für 27 Reisepässe und unglaubliche zwölf Geburtsurkunden ausgestellt hat – fehlerfrei! Und an der Metzgertheke macht keiner La Ola, weil der Schinken perfekt geschnitten ist. Von der Anerkennung, die Fußballprofis zuteilwird, können andere nur träumen. Und doch gibt es Spieler, die noch besser ankommen als alle anderen in der Mannschaft: die Publikumslieblinge.
Wenn der Publikumsliebling nach einer Verletzungspause eingewechselt wird, stehen die Zuschauer auf und beklatschen seine ersten Schritte auf dem Rasen. Schon beim Aufwärmen wird sein Name skandiert. Seine Rückennummer wird am häufigsten auf Fantrikots geflockt. Wenn eine Wohltätigkeitsversteigerung stattfindet, bringen seine Devotionalien den Höchstpreis. Und bei Panini achten sie darauf, dass sein Klebebild nur halb so oft in den Tütchen steckt wie das der anderen. Nein, tun sie nicht. Aber es fühlt sich so an. Das Faszinierende am Publikumsliebling ist: Er ist nicht unbedingt der beste Spieler.
Dabei ist sein Geheimnis nicht leicht zu ergründen. Der Prototyp ist ein bodenständiges Urgestein. Seit der Jugend spielt er im Verein, spricht den regionalen Dialekt, hat als Kind in der Vereinsbettwäsche geschlafen und engagiert sich für eine örtliche Behindertenwerkstatt. Zum ewigen Idol wird er, wenn er seine Karriere beendet, ohne zu einem anderen Verein gewechselt zu sein. Ein ausverkauftes Abschiedsspiel und ein Anschlussjob im Verein sind ihm sicher. Irgendwas mit Marketing oder Nachwuchsförderung geht eigentlich immer. Da findet sich schon ein Posten, in dem das Wort »Koordinator« vorkommt. Und zur Not wird er Fanbeauftragter. Klassische Publikumslieblinge dieser Prägung waren Mike Büskens bei Schalke, Lars Ricken bei Borussia Dortmund, Uwe Bindewald bei Eintracht Frankfurt oder Juri Schlünz bei Hansa Rostock. Betonung auf: waren. Dieses Modell stirbt langsam aus. Karriereberater empfehlen selbst Büromenschen, mindestens alle fünf Jahre den Job zu wechseln, um wirklich voranzukommen. Wie soll da ein Fußballer länger bei einem Verein bleiben können? Schließlich ist er von Beratern mit klaren Zielvorstellungen und dringlichen Empfehlungen umzingelt.
Erstaunlicherweise funktioniert als Publikumsliebling aber auch das Gegenteil des Tiefverwurzelten: ein Spieler aus dem Ausland ohne Bezug zum Verein, den man kaum versteht und der auf dem Platz keine makellose Leistung abliefert. Wie einst der Brasilianer Ronny Heberson Furtado de Araújo bei Hertha BSC oder Leonardo Manzi beim FC St. Pauli. Sind tolle Namen. Aber sonst?
Diese Publikumslieblinge verkörpern den Charme des augenzwinkernden Lausbuben, dem man auch mal etwas durchgehen lässt, weil er eigentlich ein guter Kerl ist. Und weil er gute Laune macht. Vielleicht kann man davon etwas lernen – bei Aldi, im Einwohnermeldeamt und an der Metzgertheke.
Sündenbock
Biotop: Dusche (ab Minute 70)
Population: Allein, allein
Der Sündenbock zählt zur Gattung der Opfer innerhalb der Familie der Gemobbten, die zur Ordnung der armen Schweine gehört. Er tummelt sich da neben dem pickligen dicken Jungen auf dem Schulhof und der Brillenschlange mit der komischen Frisur im Büro. Allerdings können sich diese beiden keinen Ferrari leisten – im Gegensatz zum Sündenbock. Zumindest, wenn er in der Bundesliga spielt. Denn auch das beste Team braucht einen, der an allem schuld ist. Dieser Spieler muss damit leben, dass für ihn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wörtlich ausgelegt wird. Laut § 3, Abs. 1 AGG, nämlich besteht Mobbing aus unerwünschten Verhaltensweisen, die »bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird«. Die Stadionbesucher sind rührend darum besorgt, dass beim Sündenbock nichts, aber auch gar nichts davon ausgelassen wird.
Dass ein Spieler für die eigene Mannschaft und die eigenen Fans zum Sündenbock wird, kommt nicht oft vor. Dafür reicht nicht ein schlechter Tag. Da muss man schon Weltmeister in der Disziplin »schlechter Tag« sein. Aber es passiert immer wieder mal.
Dann ist im Stadion bei jedem Ballkontakt des Sündenbocks ein kaltes Raunen zu hören, weil tausende Münder düstere Sätze murmeln wie »Jetzt verstolpert er ihn gleich wieder« oder »Spiel doch gleich zum Gegner!«. Wenn der Sündenbock dann zum ersten Mal einen Ball verliert, wird das Raunen zu einem Grummeln wie von einem entfernten Gewitter, die ersten Pfiffe gellen durchs Stadion. Beim nächsten ungenauen Pass ist ein kollektives Aufjaulen zu vernehmen, die Pfiffe werden lauter. Zur Halbzeit wird die Mannschaft mit dünnem Applaus bedacht, der in den Sekunden, bevor der Sündenbock im Kabinengang verschwindet, von einem jähen Pfeifkonzert unterbrochen wird. Und spätestens in der zweiten Halbzeit ist es so weit, dass jeder Ballkontakt des Sündenbocks von schrillem Pfeifen überlagert wird. Die einzige Aktion, mit der der Sündenbock Applaus auslöst, ist seine Auswechslung. Es ist nicht leicht, ein Wort für die Emotion zu finden, die der Sündenbock bei den Fans hervorruft. Es ist so etwas wie Hassliebe. Nur ohne Liebe.
Mit solch offener Ablehnung müssen sonst nur Neuzugänge von Erzrivalen fertigwerden. Und das in der Regel nur während der ersten Monate beim neuen Verein, weil man sich ja an alles irgendwann gewöhnt. Beim FC Bayern war das mit Jens Jeremies so, der 1998 vom TSV 1860 gekommen war. Und 2011 wollten viele Fans »koan Neuer«, weil der bei seinem Heimatverein Schalke den Ultras nahegestanden haben soll. Ein Spieler, der so einen Schritt wagt, hat zumindest eine Zeitlang wenige Freunde. Denn beim Ex-Verein hat er enttäuschte Liebe hinterlassen. In Fankreisen fehlt grundlegend das Verständnis dafür, dass der Bankberater nicht danach fragt, in welcher Vereinsbettwäsche man als Kind geschlafen hat. Und der Ferrari-Verkäufer auch nicht. Und der Immobilienmakler auf Mallorca erst recht nicht. Noch nicht einmal der Bundestrainer.
Der Vater aller Sündenböcke – also nicht Brasiliens Stürmer Fred, sondern der aus der Bibel – hat gemütlich gegrast, als Aaron ihm die Hände auflegte und nicht weniger als »alle Sünden der Israeliten, alle ihre Frevel und alle ihre Fehler« auflud. Steht zumindest im Alten Testament. Als wäre das nicht schlimm genug, haben sie ihn dann noch in die Wüste geschickt. Dabei hatte der keine WM im eigenen Land verbockt. Er hatte auch nicht 1:7 gegen Deutschland verloren. So schuldlos ist der Sündenbock im Fußball im Normalfall nicht. Aber in die Wüste geschickt wird er auch. Wenn er mit Schimpf und Schande aus der Mannschaft fliegt, bleiben nicht mehr viele Optionen, um etwas für die Altersvorsorge zu tun. Dann heißen die Alternativen Katar oder Weißrussland – wo der Sündenbock natürlich nur anheuert, weil er die Kultur so faszinierend findet. Und die Sprache. Und das Essen. Ja, und die neue Herausforderung. So insgesamt.
Retten kann den Sündenbock nur ein radikaler Stimmungswandel. Aber der kommt bei Fußballfans ungefähr so oft vor wie beim biblischen Aaron. Also nicht. Selbst wenn ein Teil der Fans sich auf die Seite des Sündenbocks schlägt, reicht das nicht aus. In der Saison 1991/92 flog der FC Bayern im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC Homburg raus. Und in der Bundesliga hatte die Mannschaft nach zehn Spieltagen nur viermal gewonnen. Sündenbock war Trainer Jupp Heynckes. Zumindest bei den Haupttribünenbesuchern, die sich von Woche zu Woche mehr mit »Heynckes raus«-Rufen in Rage schrien. Dagegen waren die Stehplatzfans in der Südkurve noch vom naiven Gedanken unverbrüchlicher Vereinstreue geprägt. Sie konterten das Heynckes-Mobbing mit »Sitzplätze raus«-Rufen und plärrten den Nörglern »Scheißhaupttribüne« entgegen. Schließlich kam es bei einem Heimspiel hinter der Tribüne zu Schlägereien zwischen Heynckes-Unterstützern und -Gegnern, zwischen Steh- und Sitzplätzen. Uli Hoeneß ließ Heynckes mit Hinweis auf den »Druck der Öffentlichkeit« fallen. Später erklärte er, dies sei die größte sportliche Fehlentscheidung seiner Karriere gewesen. Im Fall von Heynckes gelang einem Sündenbock die Wiederauferstehung. Kennt man auch aus der Bibel. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Leitwolf
Biotop: In der Kampfgrätsche
Population: Ich – sonst keiner
Das griechische Alphabet hat ein grundlegendes Problem. Es unterstellt, dass Alpha der erste Buchstabe ist. Dabei kann das unmöglich sein. Denn dann könnte ja nichts über einem Alphatier stehen. Aber natürlich steht einer drüber. Über allem – erst recht über allen Alphatierchen, die sich im Fußball tummeln: der Leitwolf.





























