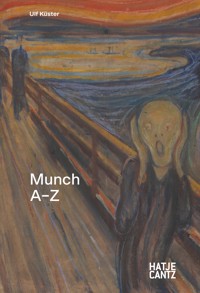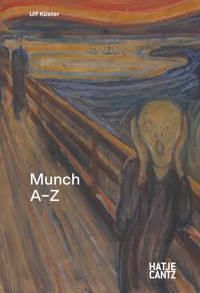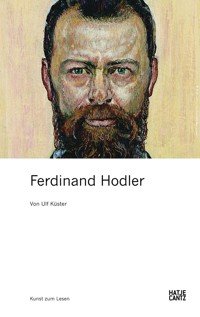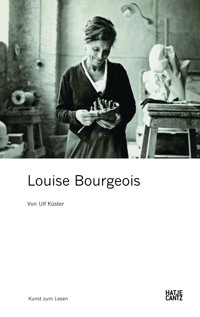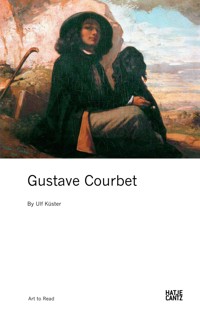
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hatje Cantz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: E-Books
- Sprache: Deutsch
Gustave Courbet (1819–1877) gilt als Vorkämpfer der sozial engagierten Malerei, er ist der wichtigste Vertreter des Realismus. Diese der schonungslosen Darstellung der Wahrheit verpflichtete Kunstrichtung stellte die von der Akademie geprägte, idealisierende Malerei infrage und schockierte die Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Courbet wurde zu einer Leitfigur der aufrührerischen Künstlerboheme und pflegte regen Austausch mit tonangebenden Dichtern und Künstlern. Er war aber keineswegs nur Bürgerschreck, sondern vor allem ein großer Revolutionär der Landschaftsmalerei. Das Buch führt anhand von sieben Essays zu ausgewählten Aspekten in das Leben und Werk des Künstlers ein, dessen Gemälde auch diejenigen begeistern, die sich nicht täglich mit Kunst beschäftigen. Courbets ungeheuer reichhaltiges Schaffen und sein aufregendes Leben lohnen es, immer wieder neu entdeckt zu werden. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3878-1) Zur Ausstellung erscheint auch ein Katalog (deutsche Ausgabe ISBN 978-3-7757-3862-0, englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3863-7) und eine Buchausgabe (deutsche Ausgabe ISBN 978-3-7757-3867-5, englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3878-1). Ausstellung: Fondation Beyeler, Riehen/Basel 7.9.2014–18.1.2015
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gustave Courbet
Von Ulf Küster
PrologDie Hängematte
An meine erste Begegnung mit einem Gemälde von Gustave Courbet kann ich mich gut erinnern. Das war 1971 bei einem Besuch der Sammlung Oskar Reinhart »Am Römerholz« in Winterthur. Ich war fünf Jahre alt, ging, wie üblich, an der Hand meines Vaters, und ich weiß noch genau, dass ich mich bei Courbets Bild von dem Mädchen, das schlafend in der Hängematte liegt, über die seltsamen gelben Socken wunderte. Sind das vielleicht Strumpfschuhe? Heute, nach unzähligen weiteren Besuchen dieses großartigen Museums, wundere ich mich noch immer: diese merkwürdige Fußbekleidung, die aussieht, als gehöre sie zu einer von Ludwig Richter gemalten biedermeierlichen Märchenfigur. Natürlich sind die Füße unbefleckt, als habe die Schöne den Boden nicht berührt, bevor sie sich hinlegte.
Gustave Courbet, Le hamac (Die Hängematte), 1844, Öl auf Leinwand, 70,5 × 97 cm, Sammlung Oskar Reinhart »Am Römerholz«, Winterthur
Gustave Courbets Le hamac (Die Hängematte) von 1844 ist ein Meisterwerk, ein Traumbild in jeder Hinsicht. Was ist zu sehen? Ein Traum Courbets oder der Traum der Schlafenden? Im Wald, auf einer Lichtung, halb im Sonnenschein, ist über einen Weg, der im Hintergrund wieder zu einer Lichtung führt, eine Hängematte gespannt. Darauf liegt ein Mädchen und schläft. In ihrem offenen blonden Haar trägt sie einen Kranz. Ihr muss sehr warm sein, denn sie hat ihren blau-seidenen Schal abgelegt und ihr gelb gefüttertes Mieder geöffnet; unter einer durchsichtigen Gaze sind ihre Brüste zu sehen. Ihre Beine hängen aus der Hängematte heraus, die Füße sind überkreuzt, der Rock ist hochgerutscht und gibt den Blick auf weiß bestrumpfte Waden frei. Mit der rechten Hand hält sie sich am Rand der Hängematte fest, die Linke hat sie – eine typische Schlafhaltung – über ihren Kopf gelegt, ihr Kinn ist auf den Brustansatz gesenkt und ihr Gesichtsausdruck hat etwas Wollüstig-Unschuldiges. Überhaupt wirkt die ganze Person jungfräulich und zugleich ein wenig verrucht. Gewiss ist der Traum, den sie gerade träumt, sehr angenehm. Schade nur, dass er bald vorbei sein wird, denn sie wird im nächsten Augenblick aus der Hängematte fallen, ihre Haare, die wie ein Wasserfall aussehen, zeichnen ihren Fall vor. Und dann ist da auch gar kein Weg, sondern ein seichtes, aber dunkles Wasser, in das sie fallen und das sie aus ihren Träumen reißen wird.
Ich denke bei diesem Bild gerne an zwei Strophen aus »Frühlingstraum«, einem 1823 veröffentlichten Gedicht aus Wilhelm Müllers Winterreise, das Franz Schubert vertont hat; es geht um den harten Wechsel von der Traumwelt zur Wirklichkeit, was bei Müller für den Unterschied zwischen der Idee der Freiheit und der Realität der Unterdrückung während der Restauration und des Vormärz steht:
Ich träumte von Lieb’ um Liebe,Von einer schönen Maid,Von Herzen und von Küssen,Von Wonne und Seligkeit.
Und als die Hähne krähten,Da ward mein Herze wach;Nun sitz’ ich hier alleineUnd denke dem Traume nach.
Ist Courbets Hängematte ein Werk, das den Übergang von einer idealisierten Welt zu der rauen Wirklichkeit darstellt? Geht es bei diesem Bild des Schlafs, kurz bevor dieser abrupt beendet wird, um das Ende der Epoche, die man als »Romantik« bezeichnen könnte? Dass dieses Bild ganz unvermutete verborgene Botschaften enthalten könnte, beschäftigt mich bis heute. Der Kranz, den die junge Frau im Haar trägt, ist kein Efeukranz, wie immer wieder behauptet wird.1 Es handelt sich um einen Kranz aus Schmerwurz, eine Heilpflanze mit herzförmigen Blättern und roten Früchten, die traditionell bei der Behandlung von Prellungen eingesetzt wird, worauf ihr französischer Name unmissverständlich hinweist: »herbe aux femmes battues« (Kraut der geschlagenen Frauen).2 Andere volkstümliche Namen sind »racine vierge« (Jungfernwurzel) oder »sceau de Notre Dame«, was man mit »Siegel unserer Frau« übersetzen könnte. Beide Namen sind ein Hinweis auf eine andere Funktion: Die Pflanze scheint zur Empfängnisverhütung eingesetzt worden zu sein.3 Sollte Courbet davon gewusst haben, was wahrscheinlich ist, dann würde das böse Erwachen, das hier auf den Schlaf folgen wird, eine ganz andere Bedeutung haben.
Im Jahr vor der Vollendung des Gemäldes hat Courbet sich in einem Selbstbildnis dargestellt, das 1844 für die jährlich stattfindende allgemeine Kunstausstellung in Paris, dem Salon, ausgewählt wurde – eine Premiere für ihn. Dieses Portrait de l’artiste, genannt Courbet au chien noir (Porträt des Künstlers, genannt Courbet mit schwarzem Hund, Abb. Cover) zeigt ihn als modisch gekleideten Romantiker in karierten Hosen, adrettem Überrock und mit Hut, der wie ein dunkler Heiligenschein auf seiner Lockenpracht sitzt. Er ist auf einer Wanderung bei der Rast: Die Pfeife in der Hand, Wanderstab und Skizzenbuch hinter sich an einen Felsen gelehnt. Er scheint sich der Melancholie hinzugeben, und sein Blick, sehr von oben herab, betont die Distanz zwischen ihm und den Betrachtern des Bildes, als würden diese nie in der Lage sein, ihn zu verstehen. Und der Blick des Hundes, der neben dem Maler sitzt, scheint zu bedeuten: Ich bin der Einzige, der treu zu Dir hält. Auffallend ist der frei und wahrscheinlich mit dem Palettmesser gemalte, unvollendet gelassene Hintergrund. Das Bild zeigt die Stimmung, in der sich Courbet seine Traumfrauen auf Waldlichtungen imaginierte, nicht ohne sich gleichzeitig an die Konsequenzen sexuellen Überschwangs zu erinnern.
Eugène Delacroix, La mort d’Ophélie (Ophelias Tod), 1844, Öl auf Leinwand, 55 × 64 cm, Sammlung Oskar Reinhart »Am Römerholz«, Winterthur
Ebenfalls in der Sammlung Reinhart befindet sich ein Gemälde von Eugène Delacroix, das 1844, also im selben Jahr wie Courbets Hängematte, entstanden ist: La mort d’Ophélie (Ophelias Tod). Delacroix (1798–1863) war über zwanzig Jahre älter als Courbet (1819–1877) und der wichtigste Künstler der französischen Romantik. Auch hier ist das Thema eine junge Frau und das Wasser: Bei Delacroix ist sie allerdings schon ins Wasser gefallen, und das auch im übertragenen Sinne. Delacroix’ Ophelia erscheint im Vergleich zur Schlafenden von Courbet als Vollweib, das für mich mit ihrer bis zur Hüfte unverhüllten Nacktheit immer viel erotischer als das Mädchen in der Hängematte war. Das Gemälde von Delacroix ist, wie oft bei ihm, eine malerisch entwickelte Illustration einer Szene, von der in Hamlet, der Tragödie William Shakespeares, berichtet wird: Das Bild wirkt eindeutiger als das verschlüsselte und viel raffiniertere Gemälde Courbets.
Wie Ophelia allerdings in so flachem Wasser ertrinken kann, ist mir ein Rätsel und erinnert mich an die in seinem Tagebuch notierte Kritik Delacroix’ an Courbets 1853 ausgestelltem Gemälde Baigneuses (Badende, Musée Fabre, Montpellier): Das Wasser auf diesem Bild sei viel zu seicht, um darin zu baden.4 Courbet hat möglicherweise auf das in mehreren Versionen existierende Ophelia-Motiv von Delacroix reagiert, denn es gibt von ihm ein Gemälde einer in einem Bach badenden Frau in ganz ähnlicher Haltung, die allerdings unbekleidet ist und durchaus nicht im Begriff zu sein scheint, aus dem Leben zu scheiden (Mohammed Mahmoud Khalil Museum, Kairo). Courbet hat dieses Motiv in seinem Bild Trois baigneuses (Drei Badende, 1865–1868) wiederverwendet, indem er es um 90 Grad drehte und aus der im Wasser liegenden eine senkrecht ins Wasser gleitende Frau machte. Ein ungewöhnliches Verfahren.5
Gustave Courbet, Trois baigneuses (Drei Badende), 1865–1868, Öl auf Papier auf Leinwand, 126 × 96 cm, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Delacroix und Courbet haben sich gegenseitig wohl genau beobachtet. Die Reaktionen der beiden aufeinander – mehr oder weniger versteckt – sind ein Leitmotiv dieses Buches, das eine Einführung in sieben Essays zu ausgewählten Aspekten in Gustave Courbets Leben und Werk ist.Es erscheint zu einer ihm gewidmeten Ausstellung in der Fondation Beyeler. Courbets Spiel mit den Erwartungen des Betrachters, seine Behandlung der Farbe, seine versteckten Bezüge zur klassischen Ikonografie der Kunstgeschichte und die Betonung seiner Individualität als Künstler machen ihn zu einer Schlüsselfigur im Übergang von Tradition zu Moderne. Er ist ein Künstler, dessen Werk auch denjenigen begeistert, der sich nicht täglich mit Kunst beschäftigt. Und vielleicht trägt dieses Büchlein dazu bei, Lust darauf zu machen, Courbets ungeheuer reichhaltiges Werk und sein interessantes Leben immer wieder von Neuem zu entdecken.
Ornans – Flagey
Mai 2013: Auf dem Weg in die Heimat Gustave Courbets, im französischen Teil des Jura. Es regnet in Strömen, ein passendes Wetter für diese ländliche und abgeschiedene Gegend, in der Wasser allgegenwärtig zu sein scheint. Hochebenen wechseln sich ab mit tief eingeschnittenen Tälern, in denen sich Flüsse winden, die aus Grotten in gewaltigen Wasserfällen aus der Tiefe der Erde hervorbrechen. Es ist, als bewege man sich auf einem riesigen Schwamm. Das Gebiet ist Teil der Franche-Comté, der Freigrafschaft, mit der Hauptstadt Besançon, die erst 1678 Teil Frankreichs wurde; vorher stand sie unter dem Einfluss der Habsburger und der Schweizer, gehörte sogar von der Mitte des 16. Jahrhunderts an zum Besitz der spanischen Linie der Habsburger. Auf den spanischen Einfluss ist man dort noch heute stolz; vor allem gehört eine gewisse Unabhängigkeit von Paris zum guten Ton. Das dürfte auch zu Gustave Courbets Zeiten der Fall gewesen sein.
Am 10. Juni 1819 wurde er geboren, offiziell in Ornans, einem umtriebigen Städtchen, 25 Kilometer von Besançon entfernt. Der einen Tag später erfolgte Geburtseintrag im dortigen Bürgermeisteramt nennt keinen genauen Geburtsort, gibt aber an, dass der Vater in Flagey bei Ornans wohnhaft sei.6Vielleicht stimmt die Geschichte, dass Courbets Mutter auf dem Weg von Flagey zu ihren Eltern in Ornans Wehen bekommen und Gustave unter einer Eiche am Wegesrand geboren habe.7 Obwohl sein Geburtsort nicht ganz klar ist, wird er von Ornans als großer Sohn der Stadt beansprucht und ist heute überall präsent: Schilder weisen auf die Plätze hin, von denen aus er seine berühmten Bilder gemalt hat. Im Zentrum, direkt am Flüsschen Loue, das den Ort durchfließt, sein angebliches Geburtshaus und das ihm gewidmete Museum, das, besonders gefördert von der Regionalregierung, nicht nur einen spektakulären Anbau erhalten hat, sondern auch ambitionierte Ausstellungen veranstaltet.
In Ornans scheint jeder noch jeden zu kennen, und Courbet ist der Stolz der Gemeinde, was auch zu seinen Lebzeiten sicher so gewesen ist, obwohl (oder gerade weil) ältere Leute aus Ornans noch heute von ihren Großeltern erzählen, die wiederum von ihren Großeltern hörten, Courbet habe oft skandalöse Damen aus Paris mitgebracht, die ihm in seiner Heimat Modell standen. Courbet kehrte nämlich immer wieder nach Ornans zurück, wo er Grundbesitz und ein Atelier hatte, in dem er viele seiner Bilder malte, teilweise unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Man sollte seine emotionale Bindung an das Land seiner Herkunft nicht unterschätzen. Viele seiner Freunde in Paris stammten aus der Franche-Comté oder kamen sogar aus Ornans, wie der mit ihm verwandte Schriftsteller Max Buchon, ein Jugendfreund und Schulkamerad. Sehnsuchtsvoll malte er noch in seinen Exiljahren in der Schweiz Erinnerungsbilder seiner Heimat mit den hohen Felsen, den Wasserläufen und den Obstgärten, die er seit seiner Jugend durchwandert hatte und deren Grotten er erforschte, wobei er in einer sogar seinen Namenszug hinterlassen haben soll.8 Als vor wenigen Jahren sein 1864 gemaltes und besonders schönes Bild der sogenannten Eiche von Flagey