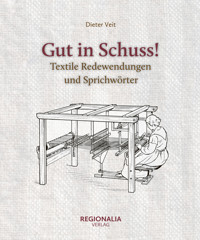
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Regionalia Verlag | Kraterleuchten
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Herstellung von Textilien war seit der Antike und bis ins 20. Jh. in jeder Familie allgegenwärtig. Die Frauen spannen zuhause Garn und nähten und trafen sich dazu mit anderen zum gemeinsamen Plausch. Viele Männer verdienten ihr Geld als Weber, im Handwerk oder in der Industrie. Entsprechend fanden viele textile Begriffe den Weg in unsere Alltagssprache. Es wurde »herumgesponnen« und wenn der »rote Faden« verloren ging, dann hatte man sich »verzettelt«. Wer an der Farbe sparte, der sollte besser »klotzen, nicht kleckern«, vielleicht war er auch ein »Schönfärber«. Und wer »den Bogen raus hatte«, der beherrschte sein Handwerk. War er gar »gut betucht«, so war er »aus dem Schneider« und konnte andere für sich arbeiten lassen. Die Herkunft und Bedeutung dieser und vieler weiterer Redewendungen und Sprichwörter werden anschaulich und mit vielen Bildern erklärt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gut in Schuss!
Textile Redewendungen und Sprichwörter
Dieter Veit
Impressum
Dieter Veit
Gut in Schuss!
Textile Redewendungen und Sprichwörter
1. Auflage 2024
Regionalia Verlag,
ein Imprint der Kraterleuchten GmbH,
Gartenstraße 3, 54550 Daun
Verlagsleitung: Sven Nieder
Alle Rechte vorbehalten
Korrektorat: Tim Becker
Gestaltung, Satz: Kerstin Fiebig
Umschlag: Kerstin Fiebig
ISBN E-Book 978-3-95540-426-0
ISBN Print 978-3-95540-404-8
www.regionalia-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Fasern
Ins Blaue fahren
Flachsblond
Herumflachsen
Durchhecheln
Verheddern
Die Junk-E-mail
Ein schwarzes Schaf
Schäferstündchen
Ungeschoren bleiben
In die Wolle kriegen
Am seidenen Faden hängen
Halbseiden
Spinnen
Die spinnt doch
Eine Intrige spinnen
Der rote Faden
Alter Knacker
Sich verhaspeln
Eine Geschichte zu Ende spinnen
Den Dreh raus
Seemannsgarn spinnen
Der Geduldsfaden reißt
Kamel durch ein Nadelöhr
Ein Geschäft einfädeln
Thread
Umgarnen
Lebensfaden
Leitfaden
Bindfäden und Katzen
Fäden und Mäuse
An einem Strang ziehen
Verwirrung stiften
Knoten und Netze
Der gelöste Knoten
Gordischer Knoten
Kontakte knüpfen
Das Netz
Weben
Schlichten
Verzetteln
Etwas anzetteln
Über einen Kamm schären
Den Bogen raushaben
Gut in Schuss
Shuttle-Bus
Gut betucht
Edler Zwirn
Kleider machen Leute
In trockenen Tüchern
Am Hungertuch nagen
Auf Tuchfühlung gehen
Fadenscheinig
Schleierhaft
Webfehler
Ein Loch stopfen
Unter den Teppich kehren
Stricken
Einfach gestrickt
Mit der heißen Nadel gestrickt
Sich in etwas verstricken
Den Faden verlieren
Die Fäden in der Hand halten und im Hintergrund die Fäden ziehen
Veredlung
Blau machen und Blau sein, Ein blaues Wunder erleben
In der Wolle gefärbt
Klotzen, nicht kleckern
Etwas kaschieren
Schönfärberei
Giftgrün
Schmutzige Wäsche waschen
Mehrere Eisen im Feuer
Konfektion
Textilien in der Alltagssprache
Textile Wörter in der Alltagssprache
Textile Nachnamen
Märchen
Arachne und Athene
Faden der Ariadne (Minotaurus)
Odysseus
Rumpelstilzchen
Dornröschen
Faust
Die drei Spinnerinnen
Spindel, Weberschiffchen und Nadel
Weitere Märchen
Herkunft der Wörter für Kleidung und anderer textiler Begriffe
Anorak
Baumwolle
Bluse
Faden
Faser
Flechten
Frack
Garn
Gürtel
Hemd
Hose
Hut
Jacke
Jeans
Kappe
Kittel
Kleid
Knopf
Krawatte
Mütze
Nähen
Pullover, Pullunder
Pyjama
Rock
Sakko
Schal
Schlips
Schürze
Socke
Spinnen
Spleißen
Stoff
Strick und Stricken
Strumpf
Teppich
Tuch
Weben
Weste
Zwirn
Bildnachweis
Quellen und weiterführende Literatur
Redewendungen A–Z
Vorwort
Textilien begleiten uns ein Leben lang. Von der ersten Windel bis zum Leichentuch nutzen wir Textilien, um uns zu schützen, zu schmücken und als technische Hilfsmittel.
Bis zur Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert wurde vor allem zuhause gesponnen, gewebt und genäht, oft gemeinschaftlich und in größeren Gruppen. So fanden zahlreiche Ausdrücke, Begriffe und Redewendungen ihren Weg in unsere Alltagssprache und prägen sie bis heute. In diesem Buch wird geklotzt und nicht gekleckert und der rote Faden ist hoffentlich gut in der Gliederung zu erkennen. Wenn Sie nicht den Faden verlierenund sich auch nicht verzetteln, dann haben Sie am Ende den Bogen raus, wenn es um die korrekte Anwendung textiler Begriffe geht. Und falls Sie sich mit einem Schönfärber in die Wolle kriegen, weil er einen Streit anzetteltund Ihnen nicht den roten Teppich ausrollt, dann reißt Ihnen zukünftig hoffentlich nicht gleich der Geduldsfaden.
Weil Textilien seit Tausenden von Jahren allgegenwärtig sind und zunächst vor allem zuhause und von jeder Familie selbst hergestellt wurden, spielen sie in der darstellenden Kunst schon immer eine herausragende Rolle. Einige der ältesten bildlichen Darstellungen, die wir kennen, zeigen die Produktion von Garnen und Geweben und auch in vielen Märchen spielt das Spinnen und Weben eine wichtige Rolle. Auch damit werden wir uns hier beschäftigen.
Abb. 1.1 _ Spinnen und Weben in Altertum, Mittelalter und früher Neuzeit (Rama, 2016; Pharos, 1017b)
Fasern
Abb. 2.1 _ Gewinnung von Wolle im 15. Jahrhundert
Bis in die frühe Neuzeit wurden in Europa große Mengen Flachs verarbeitet. Flachspflanzen sind anspruchslos und konnten daher überall angebaut werden, wo wenig Anderes wuchs. Es war allerdings mühselig, die Flachsfasern aus den Stängeln zu gewinnen und auch das Spinnen dauerte lange. Daher verbrachten vor allem Frauen und Kinder vom Herbst bis zum Frühjahr viel Zeit mit der Garnerzeugung und so beziehen sich viele Redewendungen auf die einzelnen Stufen der Flachsverarbeitung.
Ins Blaue fahren
Wer einen Ausflug ins Blauemacht, der besucht Flachsfelder, die blau blühen (Abb. 2.2). Flachsfelder gab es bis ins 20. Jahrhundert überall in Nord- und Westeuropa und entsprechend viele »Ausflugsziele«. Blau machenist etwas anderes (siehe Kap. 7).
Abb. 2.2 _ Blühendes Flachsfeld
Flachsblond
Dies bezieht sich auf die Farbe von Flachsfasern nach dem so genannten »Hechelprozess«, bei dem die Fasern aus den Stängeln gelöst werden. Sie ist eine Bezeichnung für eine Haarfarbe zwischen gelblich und bräunlich (Abb. 2.3). »Blond« bedeutet auf Französisch einfach »hell«. Echte blonde Haare sind außerhalb von Skandinavien selten und fallen daher auf. Deswegen werden wohl auch »Blondinenwitze« erzählt und keine »Brünettenwitze«.
Abb. 2.3 _ Helle Flachsfasern und flachsblonde junge Frau
Herumflachsen
Spinnen in Heimarbeit war im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit meistens Frauenarbeit. Es war eine Tätigkeit, die »nebenbei« durchgeführt werden konnte. Man traf sich deshalb, um gemeinsam zu spinnen und Neuigkeiten auszutauschen. Wenn beim Spinnen von Flachs, das der dominierende Faserrohstoff war, eine fröhliche Stimmung herrschte, so wurde herumgeflachst (Abb. 2.4).
Abb. 2.4 _ Spinnende und herumflachsende Frauen (Velázquez, 1644)
Anscheinend ging es beim gemeinschaftlichen Spinnen oft recht lustig zu, sodass die Behörden in manchen Regionen Spinnstubenordnungen erließen, die das Zusammenleben regelten, um auch die kirchliche Obrigkeit zu beruhigen. In Kurhessen wurden 1726 Spinnstuben sogar ganz verboten. Dies sollte »unzüchtige Umtriebe« unterbinden, wenn die jungen Burschen die ebenso jungen Mädchen nach dem Flachsen abholten und nach Hause brachten oder – noch verwerflicher – sich mit ihnen in den Spinnstuben zum Tanz u.a. trafen (Abb. 2.5).
Abb. 2.5 _ Spinnstube (Reinsberg-Düringsfeld, 1863)
Kinder, die im Herbst geboren wurden, also 9 Monate nach dem Flachsbrechen in den Spinnstuben, wurden »Brechelkinder« genannt. J.W. von Goethe formulierte ihre Entstehung 1795 in seinem Gedicht »Die Spinnerin« gewohnt poetisch wie folgt:
Als ich still und ruhig spann,
Ohne nur zu stocken,
Trat ein schöner junger Mann
Nahe mir zum Rocken.
Lobte, was zu loben war,
Sollte das was schaden?
Mein dem Flachse gleiches Haar
Und den gleichen Faden.
Ruhig war er nicht dabei,
Ließ es nicht beim alten;
Und der Faden riß entzwei,
Den ich lang’ erhalten.
Und des Flachses Steingewicht
Gab noch viele Zahlen;
Aber ach, ich konnte nicht
Mehr mit ihnen prahlen.
Als ich sie zum Weber trug,
Fühlt’ ich was sich regen,
Und mein armes Herze schlug
Mit geschwindern Schlägen.
Nun, beim heißen Sonnenstich,
Bring’ ich’s auf die Bleiche,
Und mit Mühe bück’ ich mich
Nach dem nächsten Teiche.
Was ich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt — wie kann es anders sein? —
Endlich an die Sonnen.
Durchhecheln
Beim Hecheln werden die Flachsfasern von den letzten Resten der Pflanze befreit. Das ist mühsam und so wurde gerne über andere gelästert. Wenn jemand durchgehechelt wurde, dann redete man schlecht über ihn.
Abb. 2.6 _ Gewinnung der Flachsfasern durch Brechen (re.) und Hecheln (li.) im 18. Jahrhundert (Basedow, 1774)
Verheddern
Bei der Flachs- und Hanffasergewinnung wird der Abfall, der beim letzten Auskämmprozess übrigbleibt, als »Hede« bezeichnet. Wenn sich also etwas verheddert, dann hat es sich in diesem Kamm verfangen und wird anschließend entfernt.
Die Junk-E-mail
Der schlechteste Flachs der Antike wuchs nach dem griechischen Geschichtsschreiber Strabon in der Nähe von Amporias in Spanien und war fast unbrauchbar. Es galt als Abart des Schilfs (lat. »iuncus«). Das Endprodukt wurde als junkarisches Leinen bezeichnet und entwickelte sich über ein Slangwort der Seeleute für schadhafte Taue und Seile zu engl. »junk« (»Müll«). E-Mails, die keiner haben will, werden daher so bezeichnet.
Ein schwarzes Schaf
Abb. 2.7 _ Schwarz-braunes Schaf inmitten weißer Schafe (Solana, 2008)
Die erste Erwähnung dieses Ausdrucks findet sich in der Bibel (Genesis 30, 32), wo es sinngemäß heißt: »Ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe«. Als schwarzes Schaf(Abb. 2.7) werden Menschen bezeichnet, die in irgendeiner Weise negativ aufgefallen sind. Es bezieht sich darauf, dass schwarze Wolle nicht gefärbt werden kann und daher in Mischungen mit weißer Wolle eine Färbung mit hellen Farbtönen unmöglich macht. Selbst eine einzelne schwarze Faser ist im gefärbten Textil noch zu erkennen.
Nach einer NDR-Dokumentation von 2005 kann es allerdings vorteilhaft sein, in einer Herde einige schwarze Schafe zu haben, weil sich die weißen Tiere dann an die Anwesenheit schwarzer Tiere gewöhnen und nicht in Panik geraten, wenn sich nachts Wildschweine in der Nähe befinden.
Schäferstündchen
Wenn ein Wanderschäfer auf Transhumanz durch die Lande zog und Rast machte, dann konnte es vorkommen, dass er in seinem Schäferkarren (Abb. 2.8) von Mitgliedern der ortsansässigen weiblichen Bevölkerung besucht wurde. Ging die Begegnung zeitlich über die übliche Begrüßung hinaus und lernte man sich näher kennen, so sprach man von einem Schäferstündchen.
Abb. 2.8 _ Schäferkarren (Martinvl, 2016)
Ungeschoren bleiben
Dauert das Schäferstündchen länger, kann es passieren, dass der Schäfer nicht zum Scheren kommt und entsprechend bleiben seine Schafe ungeschoren, was umgangssprachlich dasselbe ist wie »unbehelligt bleiben«, also in Ruhe gelassen werden.





























