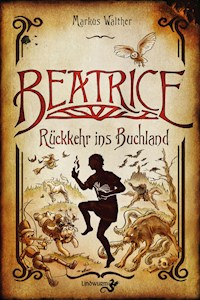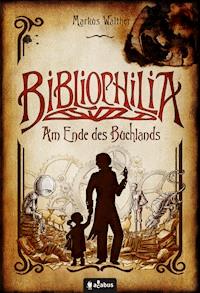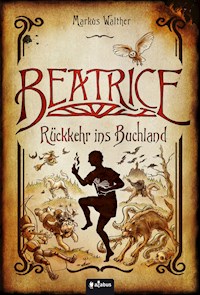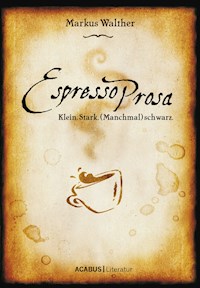Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schläfst du schon oder liest du noch? Mit seinen "Kürzestgeschichten" schafft Markus Walther wahres Kopfkino: Gedankenspielereien mit Vampiren, Massenmördern, Trekkies, Kuriositäten und dem Mann von nebenan – jeder hat seine Leiche im Keller. Die ganzen Abgründe des menschlichen Miteinanders passen in die Form einer Kurzgeschichte. Gewürzt mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor, sind diese Kurzgeschichten eine unterhaltsame Bettlektüre, bei der du garantiert nicht einschlafen wirst! Markus Walthers erster Kürzestgeschichten-Band im neuen (Nacht-)Gewand! Bei dieser Ausgabe des ACABUS Verlags handelt es sich um eine traumhafte und komplett überarbeitete Neuauflage der Gute und Böse Nachtgeschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Walther
Gute und böse Nachtgeschichten
Walther, Markus: Gute und böse Nachtgeschichten,
Hamburg, ACABUS Verlag 2014
Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe
PDF‐eBook: ISBN 978‐3‐86282‐256‐0
ePub‐eBook: ISBN 978‐3‐86282‐257‐7
Print: ISBN 978‐3‐86282‐255‐3
Lektorat: Alina Bauer, ACABUS Verlag
Cover: © Petra Rudolf
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d‐nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2014
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus‐verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Der ACABUS Verlag freut sich, nach den Erfolgen von „Espresso Prosa“ und „Kleine Scheißhausgeschichten“, nun die überarbeitete und ergänzte neue Auflage seines Erstlingswerks „Gute und böse Nachtgeschichten“ zu veröffentlichen. Nach zwei Romanen begibt sich Markus Walther mit diesem Werk wieder zurück auf die Spuren seiner Anfänge – Kürzestgeschichten. Viel Spaß beim Lesen!
Ein paar Worte vorab
Die Frage
Der Augenblick
Der Vampir
Trekkies
Evergreen
Der letzte Trieb
Saat
Das Aufgebot
Der Zeitstopper
Ein Zauberlehrling
Aufbruch
Die Junggesellenbude
Der Großartige
Clone
Das Himmelfahrtskommando
Der letzte Tag
Ein paar Worte dazwischen
Die Besseren sterben jung
Drachenblut
Flugmanöver
Spielzeug
Irrlicht
Ein Luftangriff
Zombies
Der erste März 2094
Kindermär
Geraubtes Herz
Der Dissident
Der Schreiberling
Die Zeitkapsel
Der Kuss des Fremden
Stimmen aus dem Geisterland
Noch ein paar Worte dazwischen
Ein Kinderspiel
Die Beschattung
Fortschritt
Sein größter Fan
Agenten
Das vorletzte Kapitel
Reanimation
Psychedelika
Der Nachtwächter
Der Wolf
Der Tag, an dem die Zeit endete
Die Geschichte vom Geldbaum
Blind Date
Ein Atheist
Schneegeister
Und nochmal ein paar Worte dazwischen
Trödel
Cydonia – das Vermächtnis
Die Hand
Die zwölf Tode
Die andere Welt
Voyeur
Schlaraffia
Nachtwache
Geschenkte Tage
Die Verhältnismäßigkeit der Dinge
Chaos in Profanien
Ein paar zusätzliche Worte dazwischen
Der andere Weg
Der Schriftstehler
Marits Inferno
Der Kuss
Fingerübungen
Katerstimmung
Sie
Die Zigarre
Chemie
Kleiner Kunstfehler
Späte Erkenntnis
Im Hinterzimmer
Der Broker
Gammelfleisch
Der Himmel
Seher
Kalte Liebe
Nachruf
Die Prägung
Worte. Dazwischen. Ein paar
Pessimismus
Der Sprung
Utopia
Du
Fassaden
Ausverkauf
Leben
Schlafsucht
Future Wars
Novemberschnee
Der Zirkel
Walkers John
Der Gefangene
Das Tal Tara
Amok
Das Ungeheuer
Ein paar letzte Zwischenworte
Der Pipistinkende Riecherling
Der Stein der Weisen
Post mortem
Der Umzug
Teenager
Die Selbsthilfegruppe
Der Kalligraph
Der Zwergenfluch
Die Wolkenfabrik
Wie die kleine Fliege starb
Idee 2.0
Der Zorn der Götter
Goethes Schlag
Kleine Nachtschicht
Phobius
Remix
Tabula Rasa
Ein paar Worte danach
Der Autor
Ein paar Worte vorab
Liegen Sie schon im Bett? Oder haben Sie es sich in Ihrem Sessel bequem gemacht? Egal, Hauptsache der Tag ist gelaufen.
Vielleicht ist Ihr Kopf noch zu beschäftigt, um direkt einschlafen zu können, und der Ärger und Stress des Tages halten Sie in ihrem Bann. Darf ich Sie auf andere Gedanken bringen? Es dauert auch nicht lange.
Lesen Sie heute eine Seite. Oder vielleicht auch zwei; das genügt schon. Sie werden überrascht sein, wie viel zwischen die Zeilen passt. Ein Tag, ein Jahr, manchmal ein ganzes Leben oder auch nur ein Augenblick.
Ich gebe zu, dass ich Ihnen nicht versprechen kann, dass Sie gleich besser einschlafen werden. So ein kurzer Text, wie er Sie auf den nächsten Seiten erwartet, kann nicht viel in Ihnen bewegen. Oder vielleicht gerade, weil er etwas in Ihnen bewegt hat, können Sie nicht mehr schlafen. Dann hätte ich mein Handwerk gut verrichtet.
Ihr
Markus Walther
Die Frage
Ein Sonnenstrahl zwängte sich durch die zugezogenen Gardinen und ließ Staubkörner, die träge in der Luft tanzten, sichtbar werden. Wolfgang blickte schlaftrunken auf die Uhr. Gleich zehn. Sonntagmorgen. Es schien ein wunderschöner Tag zu werden, genau passend zur letzten Nacht. Seine Hand wanderte zur anderen Betthälfte. Es war so schön, ihre Haut zu spüren. Davon würde er wohl nie genug bekommen.
„Morgen, Schatz“, murmelte sie.
Schade, seine Berührungen hatten sie geweckt. Er hätte sie gerne noch etwas liegen lassen. Sie rieb sich die Augen und rekelte sich genussvoll.
„Frühstück, Schatz?“, fragte er vergnügt, obwohl sich in diesem Augenblick leise eine andere Frage in sein Bewusstsein drängte.
„Gern“, antwortete sie.
Wolfgang schwang sich aus dem Bett und ging barfuß in die Küche. Auf dem Weg dorthin fand er seine Shorts irgendwo auf dem Parkettboden und zog sie an. Als er in der Küche ein reichhaltiges Frühstück zusammenstellte und auf einem Tablett dekorierte, überlegte er, wie er ihr diese Frage am passendsten stellen konnte. Er hasste solche Peinlichkeiten. Die Frage zum falschen Moment gestellt, wäre ein unwiderruflicher Fehler.
Er hörte durch die Tür, dass sie inzwischen ins Bad gegangen war. Der Kaffee würde noch ein paar Augenblicke brauchen. Deshalb war er fast versucht, ihr ins Bad zu folgen, um da weiterzumachen, wo sie in der Nacht aufgehört hatten. Doch er entschied sich anders: Erst musste diese Frage aus der Welt geschafft werden, die sich mittlerweile, einer dunklen Gewitterwolke gleich, über seinem Kopf mehr und mehr verdichtete.
Sie kam zurück ins Schlafzimmer, als er das Tablett mühsam zum Bett balancierte. Nachdem sie unter die Bettdecke gekrochen waren, begannen sie ein gemütliches Frühstück. Der Kaffee war ihm gut gelungen, dachte er sich. Trotzdem würde es ihm nicht helfen, die Frage auszusprechen.
„Schatz“, sagte sie, „gibst du mir mal die Marmelade?“
Wolfgang gab sie ihr. Aberwitzig, dass ihre Frage so simpel war und so einfach ausgesprochen, während seine Frage, die noch immer unausgesprochen blieb, sich so viel schwerer formulieren ließ.
Er könnte sich ohrfeigen, dass er diese Frage nicht schon gestern gestellt hatte. Gestern wäre diese Frage noch das Selbstverständlichste der Welt gewesen.
„Sag mal, Schatz …“, setzte er an. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass das wohl der falscheste Zeitpunkt war. Trotzdem sprach sein Mund einfach weiter: „Sag mal … Gestern hab’ ich deinen Namen im ‚Tanzpalast‘ nicht richtig verstanden, Schatz …
Wie heißt du eigentlich?“
Der Augenblick
Die Scheinwerfer des Wagens trennten die Dunkelheit über dem Asphalt der Straße in zwei scheinbar unendliche Hälften. Nur das Laub, das wüst mal aus der einen und mal aus der anderen Richtung geweht wurde, ließ erahnen, wie heftig der Sturm tobte.
Die Boxen wummerten den infernalischen Technosoundtrack in Florians Ohren und übertönten das satte Knurren der sechzehn Ventile. Die Fahrbahn glitt unter ihm dahin, und er schien zu fliegen.
Berauscht von der Geschwindigkeit trat er das Gaspedal bis auf den Boden durch und ließ sich von der einsetzenden Beschleunigung tiefer in seinen Sitz pressen.
Ein Blitz zuckte vom Himmel und ließ es sich nicht nehmen, dem videoclipähnlichen Szenario ein paar satte Special Effects hinzuzufügen.
Funkenstiebend berührte das gleißende Licht den nahen Horizont hinter der Kuppe. Ein Baum kippte langsam und doch mit einer theatralischen Endgültigkeit quer über die vor ihm liegende Fahrbahn.
Die Reifen quietschten nicht auf dem regennassen Boden. Es surrte nur. Florians Blick fiel auf die digitale Anzeige der Uhr im Armaturenbrett.
„23:59:59“. Eine Sekunde vor zwölf. Wie kristallklar er das wahrnahm!
Die Motorhaube prallte gegen den Baumstamm, der Airbag wirbelte ihm entgegen und empfing seinen Kopf, während der Motorblock die Fußpedale in seine Beine bohrte. Die Lenksäule drückte sich hoch und zog ihm den platzenden Airbag unter seinem Kopf fort. Gleichzeitig zerquetschten ihm die Armaturen den Unterleib. Wie rasiermesserscharfe Frisbees regneten die leeren CD-Hüllen von der Rückbank nach vorne und zerbrachen an seinem Hinterkopf, während das Chassis sich berstend zusammenfaltete. Schon presste die Rückbank, angeschoben von der Klappe des Kofferraums, gegen die Rückenlehne des Fahrersitzes. Dieser riss aus seiner Verankerung und ruckte mit seinem Insassen gegen die bereits blinde Windschutzscheibe.
Prasselnde Trümmerstücke. Ansonsten Ruhe. „00:00:00“
Der Vampir
Als Miranda den kalten Hauch im Nacken spürte, wachte sie auf. Instinktiv zuckte sie zusammen und rollte sich zur Seite. Das rettete ihr das Leben. Der Vampir, der neben ihrem Bett hockte und schon genussvoll die Augen geschlossen hatte, biss ins Leere. In seinem Gesicht zeichnete sich Enttäuschung ab, als er langsam die Augen öffnete, denn sein Opfer lag nun am anderen Ende des Bettes und wandte ihm den Rücken zu. Schlaftrunken versuchte sie, das Land der Träume wieder zu erhaschen. Um sein Werk zu vollenden, musste der Vampir ihren toten Ehegatten erstmal vom Bett rollen. Besonders schmackhaft war das Blut des Mannes nicht gewesen: Der Gute musste den Abend in einer Kneipe verbracht haben …
Mit einem dumpfen Plumps landete der Leichnam auf dem Boden. „Fettsack“, dachte der Vampir. Behutsam stieg er auf die Matratze und begann seine Annäherung an Miranda. Sanft legte er seine Hand auf ihre Schulter. Fast zärtlich strich er mit der anderen Hand ihr Haar beiseite.
„Lass das, Schatz“, säuselte sie im Halbschlaf, „nicht jetzt!“
Weiße Zähne blitzten im Licht des Vollmonds. Der Vampir sog den Duft des Triumphs nochmals tief in sich ein, bereit, das weibliche Fleisch zu kosten. Doch dann verschwand das Lächeln von seinem Gesicht. Ein Kampf wurde tief in seiner Mimik ausgefochten. Das Zentrum dieses Kampfes war seine Nase. Sämtliche Haare in ihr schienen sich aufzurichten und einen ungeheuer juckenden Tanz aufzuführen. Der Vampir spürte schon, wie sich das Kribbeln mehr und mehr steigerte, um sich in einem heftigen Niesen zu entladen. Er nahm sich vor, morgen Nacht einen Arzt aufzusuchen. Gegen seine Parfümallergie musste er unbedingt etwas unternehmen. Jetzt war es so weit; er konnte sich nicht mehr zurückhalten.
Als er nieste, wachte Miranda endgültig auf. Sie fuhr wie eine Feder aus den Selbigen hoch. Das blasse Licht der Nacht ließ sie genug erkennen, um zu sehen, dass nicht ihr Mann neben ihr hockte. Und sie erkannte auch die Reißzähne links und rechts im Mundwinkel des Vampirs. Ein ohrenbetäubender Schrei entfuhr ihr. Und dann begann sie damit, ihn wie eine Furie mit dem Kopfkissen zu bearbeiten. Auf Gegenwehr nicht eingestellt, hob der Vampir schützend seine Arme vor den Kopf. Sein linker Zahn verfing sich trotzdem im Bezug des Kissens und brach schmerzvoll ab. Das gab auch noch Arbeit für den Zahnarzt! Die Attacke endete genauso unverhofft, wie sie begonnen hatte. Miranda hatte panisch die Flucht ergriffen. Der Vampir nahm die Verfolgung auf. Er hatte gesehen, wie sie in die Küche gerannt war. Sie suchte bestimmt nach einem Messer. Das würde ihr nicht mehr helfen: Vampire konnte man so nicht töten.
Überrascht stellte er fest, dass sie nicht mit einer scharfen Klinge bewaffnet war, sondern mit einer Gewürzdose. Als er das Etikett erblickte, wich er zurück: Knoblauchsalz! Heute blieb ihm auch nichts erspart. Eigentlich war ihm der Appetit sowieso vergangen. Warum also nicht den Rückzug antreten? Ein Lächeln versuchend, drehte er sich um, um sich möglichst theatralisch in eine Fledermaus zu verwandeln. Dabei fiel sein Blick ungeschickterweise auf das Kruzifix über der Tür.
Als Miranda seine Asche auffegte und in den Hausmülleimer warf, lag das Bewusstsein des Vampirs im dritten Staubkorn oben rechts. Er dachte darüber nach, dass, wenn er sich in der nächsten Nacht wieder materialisieren würde, er lieber mal eine ruhige Kugel schieben und im Ortskrankenhaus ein paar Blutkonserven klauen würde.
Trekkies
Das Licht braucht Zeit, um sich fortzubewegen. Seine Wellen benötigen über acht Minuten, um die Distanz zwischen Sonne und Erde zu überbrücken. Es dauert mehrere Jahre, bis ein Sonnenstrahl das nächste Sonnensystem erreicht.
Auch die Erde strahlt, spätestens seitdem der Mensch die Radiowellen nutzbar gemacht hat. Ungefähr 50 Lichtjahre entfernt treffen erst jetzt die ersten Rundfunksendungen auf unzählige Planeten.
Der Himmel verdunkelte sich plötzlich. Donnergrollen prophezeite ein nahendes Unheil. Über den dünnen Smognebeln der Großstadt formten sich die Umrisse des alten Sternenschiffs. Eine Stimme, lauter als das Dröhnen der Motoren, schallte durch die Straßen, in denen verwirrte und verängstigte Menschen das Weite suchten.
„Erdenbürger! Unser Volk hat einen Teil eurer interstellaren Botschaften erhalten und entschlüsseln können. Vor zwanzig Jahren eurer Zeitrechnung haben wir uns auf den Weg gemacht, eure Heimat zu besuchen. Nun möchten wir mit euren Führern sprechen.“
Etwas ratlos saßen sich die Minister gegenüber. Der runde Tisch hatte zwar noch vier freie Plätze für die Delegation der Außerirdischen, doch die Stühle waren für die eigenwillige Form der Fremden nicht geeignet. Ihre Anatomie war mit dem menschlichen Schema nicht zu vergleichen. Etwa drei Meter hohe Amöben kamen als Vergleich wohl am nächsten. Sie standen oder saßen – so genau konnte man das nicht erkennen – hinter den ihnen angebotenen Plätzen und wenn sie sprachen, erinnerte es aufdringlich an Durchfallblähungen: Nicht nur die Geräusche, sondern auch der penetrante Geruch ließen die Politiker nervös auf ihren Sitzen hin und her rutschen. Eine kleine Maschine, welche die Fremden mitgebracht hatten, übersetzte gottlob alles, was sie sagten.
„Erdenbürger. Nach Jahren der Entbehrung in der Schwerelosigkeit des Alls haben unsere Navigatoren eure sagenumwobene Welt gefunden. Unsere Wissenschaftler haben die Botschaft, die ihr uns zugesandt habt, inzwischen immer wieder analysiert. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass eure Zivilisation der unseren ebenbürtig ist. Wir freuen uns deshalb, dass eure Welt nicht von uns vernichtet wird.
Es wurden Selektionskriterien von unserem Volk aufgestellt, um einer eventuellen Überbevölkerung des Alls entgegenzuwirken. Erfüllt ein Volk nicht diese Standards, wird es terminiert.
Ihr seid unserer würdig. Wir bieten euch einen Friedensvertrag an, im Interesse des gegenseitigen Wissensaustauschs. Speziell möchten wir mehr über die Technologie des Materietransportsystems, das ihr umgangssprachlich ‚Beamen‘ nennt, erfahren. Außerdem möchten wir einen Teil der von euch umschriebenen Produkte erwerben.“
Ein kurzes Schweigen folgte. Schließlich schüttelte einer der Minister fassungslos den Kopf. „Umschriebene Produkte? Beamen? Soll das heißen, dass unter all den Fernsehsendungen, die ausgestrahlt wurden, ihr nur eine Stunde ‚Star Trek‘ inklusive Werbeunterbrechung empfangen habt?“
„Werbeunterbrechung? Was ist das? Wir haben zwanzig Minuten eurer Botschaft empfangen können, bevor unser Heimatplanet wieder durch einen seiner Monde verdeckt wurde. Unseren Wissenschaftlern reichte dies für ein positives Urteil. Sind die uns übermittelten Daten denn nicht korrekt?
Ist die Einschätzung eurer Zivilisationsstufe nicht richtig?“
Evergreen
Eine Postwurfsendung lag einsam im Briefkasten, als Müller ihn aufschloss. Normalerweise warf er diese lästigen Zettel immer ungelesen weg. Er hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, den Hinweis „Keine Reklame“ über dem Einwurfschlitz anzubringen.
Dieser Zettel jedoch hielt seinen Blick durch seine außergewöhnliche Farbe gefangen. Das Papier war neongrün und leuchtete unangenehm im Sonnenlicht. Schwarze Buchstaben, fett und schnörkellos, waren quer über die ganze Vorderseite gedruckt: „Evergreen“. Auf der Rückseite stand: „Evergreen. Die Neuheit aus den Staaten. Gezüchtet aus den widerstandsfähigsten Gräsern der Welt, wird diese Saat auch die Rasenfläche Ihres Gartens revolutionieren!“
Müllers Interesse war geweckt, denn als begeisterter Hobbygärtner musste er fast jedes Wochenende den Kampf gegen Unkräuter und Moos in seinem Schrebergarten aufnehmen. Die Werbetexte versprachen, dass der Samen einfach über die alte Rasenfläche ausgestreut werden müsste und dann ganz von allein alle anderen Gewächse verdrängen würde.
Nur eine Woche nachdem er Evergreen bestellt hatte, wurde das Paket mit dem Saatgut geliefert. Eine weitere Woche verging, bis das Saatgut aufging. Dann wuchs es ziemlich schnell. Und dicht. Der Monat war noch nicht vorbei, da war nicht mal mehr Löwenzahn zwischen den Halmen. Als der Sommer endete und Müller aus seinem Urlaub zurückkam, hatte sich das Gras über seine Beete ausgebreitet. Vereinzelt wuchs es auch in den Nischen der Bäume und Sträucher.
Der Winter war mild und verregnet. Evergreen wuchs inzwischen auch in den angrenzenden Gärten, ohne dass jemand eine Aussaat vorgenommen hatte.
Heute, wenn Müllers Kinder aus dem Fenster schauen, sehen sie eine immergrüne Landschaft vor sich. In den Gärten, auf den Straßen und auf den Dächern wachsen kräftige Halme, die keine andere Pflanze neben sich dulden. Mutter Müller hat neulich ein paar Halme aus dem Kühlschrank gekratzt.
Den Kampf im Hausflur hat sie aber schon lange aufgegeben.
Der letzte Trieb
Blauer Stahl blitzt im grellen Sonnenlicht. Die Rotorblätter des Helikopters drehen sich träge in der schwülen Mittagshitze. Die Landekufen sind im heißen Teer eingesunken. Ein kaum merklicher, doch allgegenwärtiger Gestank liegt in der Luft. Miles nimmt ihn nicht mehr wahr. Seine Geruchsnerven sind seit langer Zeit schon wie betäubt. Er setzt sich seine Sonnenbrille auf und springt aus der Maschine. Sein Augenmerk ist auf die Menschenmasse am Ende der Straßenschlucht gerichtet. Im Zentrum der Leute steht ein Baum.
Der Baum.
Der letzte Baum.
Heute wird er sterben. Ein einsames grünes Blatt hängt oben in der Krone. Und heute wird es fallen, obwohl der Herbst noch Monate entfernt ist. Bis zuletzt hat man gehofft, dass ein weiterer Trieb aus der Rinde hervorbrechen würde. Jetzt ist alle Hoffnung verloren.
Miles ist Künstler. Ein Künstler der Fotografie. Bewaffnet mit seiner Kamera will er den Moment einfangen, in dem sich das Blatt vom Baum löst. Dies soll ein Mahnmal für die folgenden Generationen werden.
Er drängelt sich durch die Menge der Schaulustigen, bis nach vorne zu den Reportern. Fast zwanzig Fernsehkameras wollen diesen Augenblick dokumentieren. Aber Berichterstattung kann keine Kunst sein. Nur Miles ist es möglich, die ganze Tragik dieses Moments in einem einzigen Bild auszudrücken.
Die Wurzeln winden sich im Boden und tasten den Asphalt von seiner Unterseite ab. Sie halten den Stamm, der, umsäumt von einer zerfurchten Rinde, in den Himmel emporragt.
Miles kniet unter den kahlen Ästen und visiert durch die Linse den obersten Zweig an. Sein Finger hängt verkrampft am Auslöser. Die Zeit vergeht.
Das Blatt welkt.
Krümmt sich.
Dann: ein leichter Luftzug. Das Blatt löst sich und gleitet dem Boden entgegen. Miles verbraucht den ganzen Film für diese wenigen Sekunden des Sterbens.
Während Miles noch am selben Abend in der Dunkelkammer arbeitet, erwacht in einem anderen Zweig des Baumes ein Trieb. Ein winziges Blatt wird daraus entstehen.
Vielleicht sogar eine Blüte.
Saat
Der Krieg war vorbei und das Dritte Reich besiegt. Die Alliierten kamen auch in dieses Dorf, um zu sehen, was sie als Reparation mitnehmen konnten. Doch die Hallen des einzigen Werks standen nun schon lange leer. An den Stellen, an denen die Webstühle und Nähmaschinen gearbeitet hatten, verrieten nur noch ein paar helle Flecken im Muster des Bodenbelags, dass hier einst rege Betriebsamkeit geherrscht hatte.
Der ehemalige Direktor der Näherei stand mit einem Spaten in der Hand auf dem großen Acker neben dem Werk und erklärte dem Übersetzer der Soldaten geduldig, dass sie zu spät waren. Die Wehrmacht hatte während der letzten Gefechte nicht nur die Jungen aus dem Dorf geholt, sondern auch die Maschinen. Die meisten Jungen waren, Gott sei es gedankt, inzwischen zurück, aber die Maschinen sind wohl eingeschmolzen worden.
Als einer der Soldaten argwöhnisch den Spaten betrachtete, erklärte der Direktor eilig, dass er versuchen wolle, auf diesem Stück Land eine neue Zukunft zu beginnen. Seine Kenntnisse als Bauer wären zwar bescheiden, doch in diese Aussaat steckte er all seine Hoffnung.
Ein paar Wochen vergingen und die Soldaten waren unlängst weitergezogen, als der Direktor zurück auf das Feld ging. Fast alle Dorfbewohner folgten ihm – Frauen, Kinder und die wenigen Männer, die zurückgekehrt waren. Sie gruben mit Schaufeln, Spaten, Hacken oder nur mit den bloßen Händen, um die „Saat“ wieder aus dem Boden auszugraben.
Zuerst kamen die kleineren Nähmaschinen zum Vorschein, dann die Webstühle. Mühsam schafften sie die Maschinen an ihre Plätze im Werk, säuberten und reparierten sie. Bald schon bewegte sich die erste Nadel im Takt eines Motors.
Die Saat war aufgegangen.
Das Aufgebot
Das historische Rathaus zu Köln am Rande der Altstadt reckt sich verheißungsvoll in die Sonnenstrahlen des Herbsttages. Für den Augenblick scheint alles perfekt zu sein. Nicht nur, dass ich die Liebe meines Lebens gefunden habe. Wir haben uns auch endlich entschlossen zu heiraten. Gibt es einen besseren Grund, auf dem Rathausplatz zu stehen?
Hier soll es also passieren. Im nächsten Sommer werden wir mit der ganzen Familie den Rathausturm betreten und uns vor dem Standesbeamten das Jawort geben. Heute müssen wir jedoch erstmal in das Gebäude gegenüber. Weitaus weniger imposant drückt sich der schmucklose Eckbau, der die Verwaltung beherbergt, an die angrenzenden Fassaden.
Im dunklen Innenraum, rechts von der Tür, liegt der Empfang. Hand in Hand gehen wir dorthin. Bestimmt lächeln wir auch, im Glauben, dass jeder unsere Vorfreude mit uns teilen wird. Wir treten vor den Schalter und blicken einem kleinen Mann in die Augen, dem man ansehen kann, dass ihm glückliche Menschen suspekt sind. Den Gruß nicht erwidernd, schaut er mich fragend an. Ich begreife diesen Blick und antworte darauf: „Wir möchten heiraten. Wo müssen wir uns anmelden?“
Nach einer abschätzenden Musterung belehrt uns der Beamte mürrisch: „Sie möchten ein Aufgebot bestellen.“
„Klugscheißer“, denke ich bei mir. Doch als ich keine weiterführende Information von dem Kerl erhalte, sage ich brav: „Wir möchten ein Aufgebot bestellen. Wo müssen wir uns anmelden?“
„Erster Stock, Zimmer 112.“
Dort angelangt und nach nur kurzer, fast einstündiger Wartezeit im Treppenhaus, dürfen wir eintreten.
„Wir möchten heiraten“, erkläre ich, „nächsten Sommer. Am besten im Ju…“
„Sie möchten ein Aufgebot bestellen“, unterbricht mich die junge Frau hinter dem Schreibtisch, während sie ohne aufzublicken unsere mitgebrachten Unterlagen durchsieht. „Da fehlen Ihnen aber noch ein paar Papiere. Ist aber kein Problem: Sie bekommen alles bei uns im Hause. Hier ist Ihre Laufkarte. Zunächst müssen Sie zum Zimmer 023 fürs Archiv. Dort erhalten Sie …“
Ein Schwall an Informationen umspült mein Bewusstsein. Drei verschiedene Zimmer müssen wir aufsuchen, in denen man uns einen Zahlschein aushändigt, damit an der Kasse die Bearbeitungsgebühr bezahlt werden kann. Mit der Quittung darf dann das gewünschte Formblatt abgeholt werden.
Dass mich die Wartezeiten etwas mitnehmen, merke ich daran, dass ich jedes Mal den gleichen Fehler mache. Ich leite unser Anliegen mit den Worten ein: „Wir möchten heiraten.“ Und immer folgt prompt die Antwort: „Nein, Sie möchten ein Aufgebot bestellen.“
Endlich sitzen wir im Flur vor dem Büro des Standesbeamten. Die Augen geschlossen, mit müden und trägen Gedanken, warten wir die obligatorische halbe Stunde und ich versuche mir meinen ersten Satz, den ich gleich sagen werde, zu verinnerlichen.
Die Tür öffnet sich. Freundlich – ja, wirklich – werden wir hereingebeten. Erwartungsvoll blickt uns der Standesbeamte an und ich sage, wie ich es in diesen Gemäuern gelernt habe: „Guten Tag. Wir möchten unser Aufgebot bestellen.“
Gewinnend lächelt uns unser Gegenüber an. Wie selbstverständlich, so als würde er es tagtäglich sagen, formen seine Lippen die Worte: „Ach, Sie möchten heiraten?!“
Der Zeitstopper
Der Kuriositätenladen am unteren Ende der Straße hatte am letzten Montag seine Pforten geöffnet. Ein kleines Geschäft mit einer rot-weiß gestreiften Markise und einem eigenwillig dekorierten Schaufenster. Der Ladenbesitzer schien das Klischee zu pflegen.
Neugierig überschritt Elmar die Türschwelle. Mit seinen 36 Jahren fühlte er sich keineswegs erwachsen und er war ständig auf der Suche nach neuen Spielereien für sein Hobby, die Zauberei.
Der Laden war wie er es erwartet hatte: Muffig und schlecht beleuchtet, und Elmar fragte sich, wie es möglich war, dass über allen Exponaten eine dünne Staubschicht lag, obwohl die Sachen erst vor wenigen Tagen in die Regale einsortiert worden waren.
„Kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Der Verkäufer passte nicht ganz in das Bild. Er war jung, freundlich und gut gekleidet. Elmar hatte eigentlich so ziemlich das absolute Gegenteil erwartet. „Schauen Sie nach etwas Bestimmtem oder stöbern Sie nur? Ich könnte Ihnen ein paar Raritäten aus dem Ersten Weltkrieg zeigen. Oder lieber Antiquitäten aus der Renaissance?“
„Zauberei!“
„Wie bitte?“
„Ich suche Zaubertricks oder Utensilien, die ich dafür brauchen kann“, sagte Elmar.
Der Verkäufer legte seine überraschte Haltung sofort wieder ab. „Freilich“, antwortete er, „wenn Sie mir bitte folgen würden …“
Sie gingen in ein Nebenzimmer. Der Raum war mit unzähligen kleinen blinkenden Lämpchen, die eine Discokugel anstrahlten, ausgestattet.
Die Regale entlang der Wände waren mit silbernem Glanzpapier ausgelegt. Auf ihnen waren verschiedene Gegenstände sorgfältig, fast liebevoll, arrangiert. In der hintersten Ecke stand eine Schaufensterpuppe, die das Kostüm eines Zauberers trug. In ihrer rechten Hand, die sie vor sich ausstreckte, ruhte ein kleiner silberner Würfel.
„Was ist das?“, fragte Elmar und griff nach dem Würfel, der überraschend schwer in seiner Hand lag.
Der Verkäufer legte ein unverbindliches Lächeln auf, als er sagte: „Das ist ein Zeitstopper. Gehört eigentlich nicht unbedingt in die Abteilung Zaubertricks.“
Elmar fand einen kleinen Knopf auf einer der Seiten des Würfels. Sein Zeigefinger glitt spielerisch darüber hinweg, ohne den Knopf zu drücken.
„Bitte seien Sie vorsichtig“, empfahl der Verkäufer eindringlich. „Das Gerät ist kein Spielzeug.“ Nach den richtigen Worten suchend, unterbrach er sich kurz. Dann versuchte er eine Erklärung. „Wissen Sie, der Zeitstopper war mal in Besitz eines unbedeutenden Zauberers. Nicht besonders talentiert, aber mit diesem Hilfsmittel hat er es ganz gut geschafft, ein Publikum zu unterhalten: Er stellte immer einen leeren Zylinder auf die Bühne, hielt mit dem Gerät die Zeit an, holte ein paar Gegenstände, wie Armbanduhren, Schals und Brieftaschen aus den Zuschauerreihen, legte alles in den Zylinder und ließ dann die Zeit wieder weiterlaufen. Dann ‚zauberte‘ er alles aus dem Hut hervor und alle staunten, wie er das gemacht hatte …“
Ungläubig hörte Elmar zu. Er fühlte sich nach Strich und Faden verarscht. Zum Glück aber gab es einen Test, den Wahrheitsgehalt dieser unfassbaren Geschichte zu prüfen: Elmar drückte den Knopf, als der Verkäufer sagte: „Leider ist das Gerät defekt: Man kann es nicht mehr …“
Unvermittelt schwieg der Verkäufer und stoppte mitten in seiner Bewegung. Elmar schaute sich irritiert um. Die Welt schien regungslos und stumm geworden zu sein.
Der Verkäufer fluchte leise. Der Kunde war vor seinen Augen mit einem Windstoß verschwunden, just in dem Moment, als er sagte, dass man das Gerät nicht mehr abschalten könne …
Ein Zauberlehrling
Der Raum war kalt und nüchtern eingerichtet. Metall, Chrom und schwarz lackiertes Holz waren die Materialien, mit denen der Innenarchitekt das Büro ausgekleidet hatte. Macht und Reichtum wurden jedem Gast vermittelt. Der monströse Sessel hinter dem Schreibtisch war leer. Der Meister hatte sein Reich verlassen, zumindest für die Nacht.
Morgen würde er wieder hier einmarschieren, mit seinen Gefolgsleuten im Schlepptau. Doch bevor sie zur Tagesordnung kommen würden, um die Intrigen für den Tag abzusprechen, könnte die kleine Überraschung, die Heinz für sie vorbereitet hatte, sie aus der Bahn werfen. So hatte er es sich vorgenommen.
Einzig dieser dämliche Tresor hinderte ihn an seiner Rache. Kein herkömmlicher Zahlenstab, in den man eine Kombination eingeben musste, und auch kein Drehknopf verwehrten ihm den Zugriff. Der Chef hatte an nichts gespart. Selbst zum Bewegen der Finger war er offensichtlich zu faul. Eine neumodische Sprachabfrage! Ein Mikrofon war neben dem Türknauf angebracht. Nur ein gesprochenes Wort konnte den Mechanismus in Gang setzen.
Heinz war jedoch nicht unvorbereitet. Vierzig Jahre lang hatte er in dieser Firma gearbeitet! Mit einem feuchten Händedruck hatte man ihn gestern entlassen. Außerdem wollte man ihm noch die Schuld dafür unterjubeln, dass die Bücher nicht stimmten. Ein paar kleine Manipulationen, die dem Finanzamt aufgefallen waren, konnte man am besten jemandem zuschieben, der bald nichts mehr mit der Firma zu tun hatte. „Nicht mit mir“, dachte Heinz. Auch als kleiner Buchhalter hatte er sich nie etwas gefallen lassen.
Er musste zwar immer draußen warten, wenn der Chef an den Tresor ging, doch die Sekretärin hatte mal leichtfertig gesagt: „Jetzt gibt er wieder das Zauberwort ein!“ Zauberwörter gab es nicht so viele und die Akten, die im Tresor waren, würden Heinz von seiner Schuld befreien und die Firma schwer belasten. Einfacher konnte es doch nicht sein.
Nachdem er wie ein gewöhnlicher Einbrecher hier eingedrungen war, rätselte er vor dem Mikrofon nach dem richtigen Wort. „Hokuspokus!“ Nichts geschah. „Abrakadabra.“ Wieder nichts. Ihm fiel auf, dass er zu unprofessionell an die Sache herangegangen war. Wütend auf sich selbst trat er gegen den Schreibtisch, doch außer einem schmerzenden Zeh änderte sich seine Lage nicht. „Sesam öffne dich!“ Okay, das war blöd. „Simsalabim“ war ihm auch einen Versuch wert. Mal in anderen Bahnen denken. Wie wär’s mit: „Magie!“ Oder „Zauberei!“ Das Mikrofon blieb unerbittlich. Vielleicht stimmte seine Tonlage nicht oder die Silben mussten deutlicher betont werden. So eine dumme Maschine hatte unter Umständen Probleme mit seinem Dialekt.
Unzählige Versuche später, draußen dämmerte bereits der Morgen, schlug seine Wut mehr und mehr in Verzweiflung um. Den Tränen nahe schlug er auf die Eisenplatte des Tresors ein und brüllte: „Nun geh’ doch endlich auf, du Scheißteil!“
Er sank auf dem Boden zusammen und winselte: „Bitte!“
Der Riegel klickte in der Wand und der Tresor sprang auf.
Aufbruch
In grauer Monotonie prasselt der Regen gegen die Scheibe des Schlafzimmerfensters. Mike ist von seinem Traum wach geworden. Nun versucht er sich zu erinnern. Etwas windet sich in ihm, in seinen Gedanken. Es will ausbrechen und ihm von der Wichtigkeit dieses Traumes erzählen. Seine Frau liegt neben ihm. Sie atmet ruhig und gleichmäßig. Sie schläft noch. Vorsichtig steht er auf und geht ins Bad. Ein Schluck Wasser wird ihm vielleicht helfen, etwas klarer zu werden. Sein Blick fällt in den Spiegel und er mag nicht, was er da sieht. Ist er wirklich schon so alt?