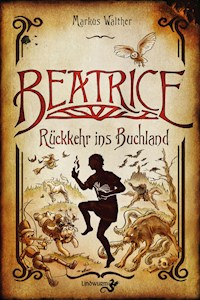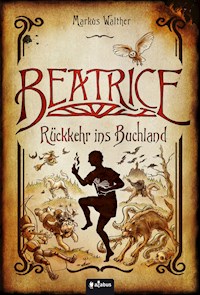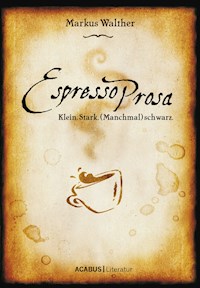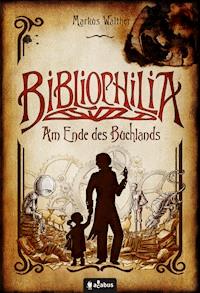
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Buchland
- Sprache: Deutsch
Das Buchland ist tot, das Antiquariat verlassen. Nach dem verheerenden Brand ist Beatrice ihre eigenen Wege gegangen und widmet sich ganz dem neuen Familienleben. Doch die Vergangenheit holt sie wieder ein, als ein geheimnisvoller Uhrmacher namens Nemo in die Nachbarschaft zieht. Gemeinsam mit ihm und der Homunkula Chaya muss sie sich ein letztes Mal in der unendlichen Bibliothek behaupten, auf einer Reise zwischen Realität und Phantasie. "Es waren Tage ohne Worte. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte musste sich fortsetzen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walther, Markus: Bibliophilia. Am Ende des Buchlands, Hamburg, acabus Verlag 2017
1. Auflage
ISBN: 978-3-86282-531-8
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-534-9
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-533-2
Lektorat: ds, acabus Verlag
Cover: © Petra Rudolf
verbrannte Buchseiten: © Markus Walther
Mauszeiger: © fotolia.com; #115685371_MicroOne
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© acabus Verlag, Hamburg 2017
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Printed in Europe
Für Michi. Hdl!
Vor dem Anfang stand die Idee.
Epilog
Nach dem Ende kam nur der Epilog. Es waren Tage ohne Worte. Sie waren grau, wie unbedrucktes Altpapier. Leise und nichtssagend verstrich die Zeit. Blass, trübe blieb das Licht. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte musste sich fortsetzen. Sie wollte erzählt werden; wollte sich in die Geister, in die Köpfe pflanzen. Aber die Welt verharrte in Stille. Da kam kein „Es war einmal“. Niemand flüsterte: „Es begann alles mit …“ Nein, es waren Tage ohne Worte. Wie auch immer man sie verfasst hatte, es war ohne Worte geschehen.
Die Kreuzbögen des Gewölbes hingen wie ein schwerer, schwarzer Himmel über einer endlosen, leeren Landschaft. Der Blinde ging in die Hocke und packte in das für ihn nicht wahrnehmbare Grau. Dabei ignorierte er den Geruch längst vergangener Flammen. Seine rastlosen Finger tasteten in der Asche, bis sie endlich gegen etwas Greifbares stießen. Er fasste zu, hob ein angesengtes Blatt hervor. Leise, kaum hörbar, rieselten Ruß und Staub davon herab.
In diesem Moment bedauerte Markus, dass er das Papier nicht betrachten konnte. Stand darauf etwas geschrieben? Oder war es vielleicht nur der unbedruckte Schmutztitel?
Mit der flachen Hand strich er sachte über die Seite, spürte, wie sie allmählich weicher wurde. Ein Geräusch erklang, als hätte ein Toningenieur das Knistern eines Feuers rückwärts abgespielt. Ein billiger Effekt, den man sich im Film schon lange nicht mehr anzuwenden getraute. Markus lächelte. „Ja.“
Es wurde kälter. Keine Eiseskälte. Reversible Flammen züngelten über seine Haut, die den alten Ruß heranfliegen ließen und die verkokelten Ecken des Papiers in ihren Urzustand zurückversetzten. Für den Augenblick vergaß die Luft, dass sie nach Zerfall roch. Der Duft von frischer Rinde, Harz und Holz wehte vorbei. Doch da war auch etwas anderes: Druckerschwärze und Tinte.
Dann endete es.
„Ein Blatt“, sagte Markus. Seine Stimme wirkte unangemessen laut. Außerdem schwang Unzufriedenheit darin mit. „Das ist zu wenig.“
Eine Antwort bekam er nicht.
„Ein Hauch Magie muss diesem Land noch innewohnen. Ein Sandkorn für die Phantasie.“ Es klang fast flehentlich, was Markus über die Lippen kam. „So darf es nicht enden. Mit Schlacke, Trümmern und Ruinen ist keine gute Story vorbei. Es hängt noch zu viel in der Luft.“
Eine Bö fegte entlang der Dünen aus Asche, trug ein Rascheln und Knistern an seine Ohren. Er streckte die Arme aus, öffnete die Hände. Da spürte er, wie sich Seiten zwischen Daumen und Zeigefinger schoben, drängten. Es waren Dutzende.
„Das ist ein Anfang.“
Das Wohnzimmer war dunkel. Nur das bläuliche Licht des Monitors erhellte einen kleinen Bereich vor dem Esstisch. Beatrice starrte auf den Textcursor, der monoton auf der Mattscheibe blinkte. An. Aus. An. Aus. Diese Arbeit verrichtete er ein wenig zu schnell. Der Sekundenzeiger der Wanduhr kam bei diesem Tempo kaum mit. Die Zeit verstrich ungenutzt. Die Maske des Programms füllte sich nicht mit Zeichen.
Von der Straße drang das Knattern eines Mofas hoch. Irgendwo im Haus schlug eine Tür zu. Nebenan, im Schlafzimmer, schnarchte Ingo. Und im Kinderzimmer …
… war alles leise.
Natürlich. Ein sauberer Po, ein voller Bauch, das Bäuerchen und ein paar Streicheleinheiten – mehr brauchte eine kleine Erdenbürgerin nicht, um glücklich und zufrieden zu sein.
Das Babyfon aus himmelblauem Plastik neben der Computertastatur kam zu der gleichen Ansicht. Solange das Kind im Zimmer schwieg, solange schwieg auch der Apparat. Alles in bester Ordnung.
Ruhigen Gewissens durfte eine Mama also sitzen bleiben. Es blieb Muße, etwas anderes zu tun. Keine Fläschchen machen, keine Windeln wechseln. Vielleicht war nun die Gelegenheit, in fremde Welten zu tauchen.
Beatrice erwischte sich dabei, dass sie hinüber zur angelehnten Kinderzimmertür schaute. Ein Nachtlicht zauberte Sterne auf die Tapete. Sie drehten sich langsam um das Bettchen. Darüber bewegte sich das Mobile in der Wärme der Heizungsluft. Tauben und Schwäne tanzten an Nylonfäden. In rosafarbenen Regalen warteten Teddybären und Spieluhren geduldig auf ihren nächsten Einsatz. Idylle auf zehn Quadratmetern.
Nichts konnte hier passieren. Das Böse war draußen. Ausgesperrt. Es lauerte im Fernseher, auf der Straße, in fernen Ländern. Nicht hier. Mama war da.
An. Aus. An. Aus. Der Cursor wirkte ungeduldig. Beatrice wusste, dass sie nun etwas schreiben musste. Nur was? Trotzig tippte sie „Es war einmal …“ Natürlich waren das genau die falschen Worte. Kein Zweifel. Sie löschte die drei Worte und gab dann „Es begann alles mit …“ ein. Wie abgedroschen. Bevor sie abermals die „Backspace“-Taste drücken konnte, knackte das Babyfon. Das rote Lämpchen daran blinkte ungestüm.
Ihr Mittelfinger verharrte über der Taste mit dem rückwärtsgewandten Pfeil. Das Babyfon verstummte. Das LED erlosch. Und wieder wanderte Beas Blick hinüber zur Kinderzimmertür. Vielleicht hatte sich die kleine Maus nur gedreht. Das Rascheln einer Bettdecke reichte, um den Sensor des Babyfons zu aktivieren.
Auf dem Bildschirm standen noch immer die vier Worte. Doch sie verloren ihren Sinn, ihre Bedeutung. Wie diese Geschichte beginnen würde, war plötzlich ganz egal. Bea musste einfach aufstehen. Schon trugen sie ihre Füße den kurzen Flur entlang. Nur eben nach dem Rechten sehen. Nur nachschauen, ob es ihrem Mädchen gut ging.
War da ein Schatten an dem Bett? Hockte da ein Alb über dem unschuldigen Gesichtchen?
Bea schaltete das Licht ein. Sie vertrieb die Dunkelheit. Dann trat sie an das Gitter, schaute hinab auf das Kind.
Blass und verletzlich.
Haut so weiß wie Porzellan.
Und ebenso kalt.
Angst packte mit kalten Klauen nach Beas Nacken. Das Grauen umfasste ihren Hals mit festem Griff, schnürte ihr die Kehle zu. Eine Gewissheit machte sich bei diesem Anblick in ihrem Herzen breit. Unbarmherzig. Brutal.
„Mein Kind!“, wollte sie schreien. „Mein Baby!“
Alles hätte das Schicksal von ihr einfordern dürfen. Nur nicht ihre …
„Rachel“, stieß Bea hervor. „Rachel.“
Sie fand sich in Ingos Umarmung wieder.
„Schhht“, machte er, „du hast nur schlecht geträumt.“
„Rachel ist nicht tot?“
Ingo zögerte.
„Sophia“, Ingo betonte den Namen ihrer Tochter, um seine Frau ins Hier und Jetzt zu holen, „geht es gut. Ich war gerade noch bei ihr. Sie schläft.“
„Sophia?“ Beatrice schluckte trocken. Die Welt ordnete sich. Puzzlestücke wurden neu eingepasst. Ja, Sophia. Nicht Rachel. Rachel war vergangen. Vor Jahren. Im Bettchen hinter dem Schutzgitter lag ihr Schatz, ihr Goldstückchen, ihr kleines Nugget! „Sophia“, rief Beatrice, warf die Bettdecke zurück und sprang auf. Fast wäre sie über ihre Hausschuhe gestolpert, als sie in das Kinderzimmer hastete. Schon beugte sie sich über ihr Kind, hob es heraus und umarmte es innigst, presste es zu fest an sich. Das wurde augenblicklich mit einem Schluchzen quittiert.
„Was tust du?“ Ingo war nachgekommen. Vorsichtig nahm er Bea das Kleinkind aus den Armen. Sophia weinte nun herzzerreißend.
„Ich … ich …“, stammelte Beatrice, die jetzt erst wirklich zu Bewusstsein kam. „Entschuldige, Sophia.“ Sie spürte eine Träne ihre Wange herunterlaufen. „Mama hat nur schlecht geträumt.“ Sanft küsste sie der Kleinen die Stirn.
„Rachel?“, fragte Ingo, der Sophia nun tröstend im Arm wiegte. „Du hast wieder von Rachel geträumt?“ Der Hauch eines Vorwurfs lag darin.
„Für meine Träume kann ich nichts“, erwiderte Bea trotzig. Mit der Hand schob sie sich eine strubbelige Haarmähne hinter die Ohren.
„Nein“, gab Ingo zu. Er ging ins Wohnzimmer und seine Frau folgte ihm widerstrebend. Sie ließen sich auf dem zerschlissenen Sofa nieder. „Deshalb mache ich mir ja auch Sorgen um dich.“ Er zog die Knie leicht an und bettete Sophia auf seine Oberschenkel. Das passte nicht ganz. Seit dem letzten Wachstumsschub musste Sophia die Beinchen seitlich herunterhängen lassen. Sie war mit ihren beinahe zwei Jahren kein Baby mehr.
„Jetzt hilft wohl nur Familienkuscheln.“ Ingo hob den Arm, damit sich Bea an seine Brust anschmiegen konnte.
„Familie“, nuschelte Bea. Sie schnupperte. Der angenehme Geruch von Männerdeo und Calendula-Öl vermischte sich mit dem von Kinderschwitze. Das beruhigte irgendwie. „Wer hätte gedacht, dass …“
Zärtlich strich Ingo ihr über den Kopf. „Du solltest noch etwas schlafen. Wenn ich gleich zur Arbeit gehe, hast du mit unserer Maus wieder einen Fulltime-Job.“
„Gleich?“
„In einer Stunde geht mein Wecker.“
„Da lohnt es sich ja kaum, nochmal einzuschlafen“, reklamierte Bea träge.
„Och“, sagte Ingo, „Sophia ist da anderer Meinung.“
Beatrice nahm noch wahr, dass ihr Kind bereits friedlich schlummerte, dann fielen ihr selbst auch die Augen zu.
Ingo erlaubte sich ein müdes Lächeln. Er lehnte seinen Kopf an die Wand, wagte es aber ansonsten nicht, sich zu bewegen. Eine unachtsame Regung könnte seine beiden Damen wecken. Um nichts in der Welt wollte er das verantworten.
Die Sonnenstrahlen tanzten durch das maigrüne Blätterdach und zauberten ein wildes Schattenspiel auf den Sand des Spielplatzes. Die Luft war mild, doch es roch schon ganz leicht nach Sommer. Beatrice genoss diese wenigen Tage, die sich zwischen die Jahreszeiten schoben. Sie freute sich auf eine Stunde im Freien, denn ihr ungewohntes Hausfrauen- und Mutterdasein war so vollkommen anders als ihr früheres Leben.
Beas Alltag hatte mit Sophias Geburt neue Qualitäten bekommen. Es drehte sich alles nur um das Kind. Die Geschehnisse von einst waren rasch in den Hintergrund gedrängt worden. Die Bücher, Quirinus und der Keller des Antiquariats blieben nun Teil einer zurückliegenden Zeit. Das Land der Bücher lag weit weg an einem Ort des Vergessens und Verdrängens. Beatrice brauchte weder Literatur noch aufgeschriebene Abenteuer oder Instantphantasien, um zu wissen, was wichtig war. Eskapismus gehörte der Vergangenheit an.
Auf der Schaukel hinter dem verrosteten Klettergerüst saß eine junge Frau. Ihr langes Haar wehte im Wind, während ihre Fahrt vor und zurück ging. Dabei lachte sie laut und überschwänglich. Es klang etwas zu kindlich, doch die beiden Halbstarken, die auf dem angrenzenden Geländer hockten, schien das kaum zu stören. Sie gafften die Frau ungeniert an und tuschelten miteinander. Sie reckten auffällig die Hälse, um vielleicht einen Blick unter den flatternden Rock zu erhaschen.
„Das könnte interessant werden“, flüsterte Bea.
Sophias Stimmchen antwortete leise „Ga“ und sie streckte ihrer Mama ein kleines Fäustchen entgegen. Beatrice beugte sich über den Buggy und strich ihrem Kind zärtlich über die Stirn. „Was meinst du? Sollen wir da zuschauen?“
„Ga!“
„Finde ich auch“, sagte Bea und richtete sich wieder auf.
Der größere und wahrscheinlich ältere der beiden Typen spielte demonstrativ mit seinem Autoschlüssel. Er erklärte seinem Freund wohl, was ihm gerade Anzügliches durch den Kopf ging. Dabei ließ er gleich mehrmals den Mittelfinger langsam durch den Schlüsselring gleiten. Dann geckerten sie wie Ziegenböcke und klopften sich gegenseitig auf die Schulter.
„Sophia, Mama hat dir doch mal vom Herrn Plana erzählt“, flüsterte Beatrice. „Herr Plana würde die Jungs da vorne vielleicht als ‚volljährige Kinder‘ bezeichnen. Oder so.“
Sophia zog die Stirn kraus. Der Anblick von Milchbartstoppeln, Baseballcap, zerrissener Jeans und einem halben Dutzend Ohrenpiercings machte sie scheinbar nachdenklich. Dennoch rang sie sich zu einem weiteren Wörtchen durch: „Ga!“
„Stimmt. Man kann sie auch Asis nennen.“
Die junge Frau auf der Schaukel bemerkte die beiden Männer nicht. Entrückt genoss sie die wilde Fahrt.
Der Kerl mit dem Schlüssel sprang auf und schlenderte betont lässig zu ihr hin. Als er seitlich neben ihrer Flugbahn stand, packte er grob nach einer der Ketten. Die Frau wurde herum geschleudert, rutschte von der Sitzfläche und fiel bäuchlings in den weichen Sand.
„Ups!“, sagte der Mann breit grinsend, „das tut mir jetzt aber leid.“ Breitbeinig baute er sich neben ihr auf und streckte ihr die Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen. „Ich bin Darius.“ In seiner Stimme schwang etwas mit, das nichts Gutes verhieß.
„Und ich bin …“, sagte die junge Frau, während sie sich langsam auf den Rücken drehte, „… nicht interessiert.“ Alle Fröhlichkeit war aus ihren Zügen verschwunden. Ihre großen, runden Augen zeigten aber auch keine Angst. „Verpiss dich!“
„Ey“, machte Darius beschwichtigend. „Ich will dir doch nur helfen. Bin ein netter Typ. Ehrlich.“ Dabei beging er den Fehler, ein Stück näher zu kommen. Unter ihm wirbelte plötzlich ein Schatten. Im nächsten Augenblick lag er auf dem Boden und hielt sich mit beiden Händen den Schritt.
„Ups“, sagte die junge Frau, „das tut mir jetzt aber leid.“
Darius’ Freund saß noch immer auf dem Geländer. Angesichts der unerwarteten Situation beschloss er, dort zu bleiben. Insbesondere nachdem er gerade die nachtschwarze Regenbogenhaut um die ebenso schwarzen Pupillen des vermeintlichen Opfers gesehen hatte.
„An Minderjährigen vergreift man sich nicht“, erklärte die junge Frau entspannt.
Darius stöhnte. „Minderjährig? Du?“
Beatrice gab ihren Beobachtungsposten auf und gesellte sich dazu. „Sie ist drei. Chaya ist fast drei Jahre alt.“
Beatrice und ihre ungleich jüngere Freundin hatten dem Spielplatz und dessen unangenehmen Besuchern den Rücken gekehrt. Sophia kaute nun zufrieden an einem angemümmelten Brötchen. Mit ihren kleinen Zähnchen hatte sie noch etwas Mühe, doch das tat ihrer guten Laune keinen Abbruch. Hin und wieder ließ sie sich mit weiterem Gebrabbel vernehmen, während ihre Mama sich mit Chaya unterhielt.
„Hast du inzwischen deinen Ausweis?“
Chaya schüttelte den Kopf. Ein freudloses Lachen kam ihr über die Lippen. „Nein. Aber die Leute auf dem Amt haben mittlerweile eingeräumt, dass ich existiere. Sie sind sich darüber einig geworden, dass ich um die zwanzig Jahre alt bin. Auf mehr wollen sie sich nicht festlegen.“
Beatrice fragte sich immer noch, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, Chaya zu drängen „offiziell“ zu werden. Doch spätestens zur Wohnungssuche brauchte ihre Begleiterin einen Personalausweis. „Du hast es ihnen aber auch nicht leicht gemacht.“ Das war natürlich eine bodenlose Untertreibung. Ohne Herkunftsbelege, ohne Urkunden und nur mit dem Satz: „Ich heiße Chaya und brauche Papiere“, durfte man sich keine unbürokratische Erledigung der Angelegenheit erhoffen.
„Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich eine Homunkula bin“, sagte Chaya, „Fabelwesen haben so ihre Probleme mit den Behörden. Es sollte speziell ein Amt für magische Wesen geben.“
Daraufhin schwiegen die beiden ein Weilchen. Sie hingen ihren Gedankenspielen nach, die sich gerade ziemlich ähnlich waren. Sie stellten sich einen großen Saal in einem nüchternen Profanbau vor. Der Chic vom 80er Jahre-Bauhaus, karge Büroschalter und vertrocknete Ficus Benjamini, ein paar Grünlilien auf der Fensterbank – so konnte die Bearbeitungsstelle für übernatürliche Angelegenheiten ausgestattet sein. An dem einen Ende der Büroschalter saßen Bedienstete in billigen Anzügen, auf der anderen Seite warteten Vampire neben Hexen und Orks darauf, dass ihre Nummer aufgerufen würde. Aus den kleinen Lautsprechern in der Deckenverkleidung erklänge blechern die Musik von Will Smith. Beatrice ergänzte die Szenerie noch um einen Hausmeister, der gerade bunte Einhornkotze aufwischte.
„Bis ich amtlich erfasst bin“, erklärte Chaya, „darf ich weiter in Arnos Kino wohnen.“
„Das ist nett von ihm“, sagte Beatrice. Der Filmvorführer hatte sich als unschätzbare Hilfe in den zurückliegenden Monaten erwiesen. Er hatte Chaya eine Bleibe eingerichtet und sie mit dem Nötigsten versorgt. Er hatte nie zu viele Fragen gestellt und Bea war sich sicher, dass er mehr wusste, als er zugab. Das Buchland war ihm nicht fremd.
Doch Gespräche über diese eine spezielle Nacht, die im Keller seines Kinos geendet hatte, blockte er rhetorisch geschickt ab. Auch Beatrice mied die Thematik. Aus irgendeinem Grund war sie froh über diese stillschweigende Vereinbarung.
„Was macht deine Ausbildung bei Arno?“
„Läuft gut. Ich mag es, im Kino zu arbeiten.“
„Darfst du in seinen Keller?“ Sie selbst war seither nicht mehr in das Kino gegangen. Wenn sie sich dem Gebäude nur näherte, schien sich ihre Haut an die Schmerzen von einst zu erinnern. Unbewusst rieb sie sich über den Handrücken. Die Narben der Verbrennungen konnte man zwar kaum spüren, doch sie waren da.
„Ich hab mal ein paar Filmrollen geholt. Ganz vorne.“ Chaya sprach plötzlich leiser. Das waren Geheimnisse. Irgendwie. „Aber wirklich tief rein bin ich noch nicht gegangen.“
„Und die Tür …?“
„Die Tür zum Buchland? Vermutlich fest verschlossen. Ich schätze, dass er sie verrammelt und verriegelt hat.“
„Hat er denn mit dir darüber gesprochen?“
„Ja …“ Chaya zögerte. „Vielleicht solltest du ihn deswegen lieber selbst interviewen.“
„Warum?“
„Ich denke, dass ich nicht die Richtige für das Thema bin.“
Bea blieb so abrupt stehen, dass Sophia durch den Ruck ihr Brötchen verlor. Es kullerte bis zum Schoß. „So was Blödes hab ich schon lange nicht mehr gehört. Wir beide sind mit deinem Schöpfer vorbei an unendlichen Buchregalen gelatscht, haben Drachen geritten und unsere Leben riskiert. Mit wem, außer mit dir, kann ich denn über das Buchland reden?“
Chaya griff nach dem Brötchen und reichte es mit einem liebevollen Lächeln der Kleinen. „Mit Arno. Du willst ja was über seinen Keller wissen.“
„Sein Keller führt ja auch ins Buchland. Er ist Teil des Buchlands …“
„Nein“, sagte Chaya bestimmt. „Ist sein Keller nicht.“
„Was?“
„Der Keller hat einen Zugang zum Buchland. Eine Verknüpfung. Aber glaube mir: Dieser Keller hat seine ganz eigenen Geheimnisse.“
„Was für Geheimnisse?“ Bea wurde zunehmend ungeduldig. „Ich denke, dass du mir …“
„Sag jetzt nicht, dass ich dir etwas schuldig bin“, sagte Chaya scharf. „Wir wissen beide, dass wir nicht meinetwegen da runter gegangen sind.“
Nein, musste Bea sich eingestehen, Chaya war alles andere als freiwillig in den Keller gebracht worden. Sie war nur eine Homunkula gewesen: Eine lebende, aber leere Hülle, die als Gefäß für die Seele von Beatrice’ verstorbener Tochter hatte dienen sollen. Schuldbewusst blickte Bea zu Boden.
„Du schuldest mir nicht das Geringste.“
„Ich bin nicht deine Tochter …“, sagte Chaya leise, trat zu Bea heran und nahm sie in den Arm. Eine versöhnliche Geste. „… geworden. Wir sind Freundinnen.“
In der Luft lag schwer der Geruch von Flieder. Über den Bürgersteig wehten Blütenblätter von Magnolie und Kirsche. Es war angenehm warm. Dennoch fröstelte Bea und eine Gänsehaut kroch ihr die Arme empor.
Sophia sang lauthals und probierte dabei das Wörtchen „Mama“ in sämtlichen ihr möglichen Tonlagen aus. Dabei verzichtete sie auf eine Melodie.
„Ich muss ins Kino“, sagte Chaya, nachdem sie auf ihre Armbanduhr geschaut hatte. Es war eine uralte Swatch, die sie auf einem Trödelmarkt erstanden hatte. Der grellbunte 80er Jahre-Look traf genau ihren Geschmack. Sie war halt irgendwie doch immer noch ein Kind, dachte Beatrice.
„Jetzt schon?“
„Das Foyer muss gewienert werden, bevor die Nachmittagsvorstellung beginnt. Popcorn vorbereiten. Chips auspacken. Sowas alles. Bringst du mich hin?“
Beatrice zögerte. Sie mied die Straße, in der das Kino war. Gegenüber war das Antiquariat. … Gegenüber war ihr Antiquariat. Ihr Antiquariat, das nun seit gefühlten Ewigkeiten geschlossen war.
„Ich weiß nicht …“
„Komm schon. Vielleicht ist Arno da. Etwas mit ihm zu plaudern, kann nicht schaden. Du könntest ihm deine Fragen bezüglich des Kellers stellen.“ Chaya zwinkerte. „Den Buchladen kannst du ja weiterhin ignorieren.“
„Ich ignoriere doch nicht meinen Buchladen“, log Beatrice. Ihre Empörung wirkte selbst in den eigenen Ohren unecht.
„Ich war halt nur lange nicht mehr da. Sophia nimmt viel Zeit in Anspruch, weißt du?“
„Ja“, sagte Chaya, „natürlich.“
Eine unangenehme Pause entstand. Der Asphalt kroch dabei langsam unter den Rädern des Buggys dahin. „Also gut: Ich komme mit. Nur damit du siehst, dass ich keine Angst habe.“
„Von Angst war gar keine Rede“, antwortete Chaya. An jeder Silbe klebte blasenschlagende Ironie. „Warum auch?“
Ihr Weg führte sie an der Friedhofsmauer vorbei. Um die Ecke noch, dann ein paar hundert Meter und sie würden die Szenerie ihrer beiden Romane betreten. Zwei Bücher hatte Beatrice inzwischen geschrieben. Die Geschichten, die sie darin erzählte, hatte sie zuvor selbst erlebt und sie hatte sie erlebt, weil sie sie geschrieben hatte. Darüber nachzudenken war und blieb sinnlos. Es gab angenehmere Methoden, sich das Hirn zu verknoten, befand Bea. Doch mit dem großen Feuer im Keller des Antiquariats hatte sowieso alles geendet.
Der Verkaufsraum und das dahinterliegende Arbeitszimmer hatten nicht gebrannt. Aber der aus dem Keller aufsteigende Rauch hatte die Einrichtung unbrauchbar gemacht. Die ausgestellten Bücher waren mit Ruß bedeckt, ihre Seiten ausgetrocknet und brüchig, wie zu dünnes Glas. Nichts – weder die alten Folianten noch die modernen Taschenbücher, die einst zum Warenbestand gehört hatten – ließ sich einem potenziellen Leser zumuten. Es war vorbei.
Diese Erkenntnis bescherte Beatrice ein schlechtes Gewissen. Natürlich. Herr Plana hätte nicht gewollt, dass sein Buchland auf diese Weise verloren ging.
„Warst du nochmal drin?“ Chaya hatte sehr leise gesprochen.
Trotzdem zuckte Beatrice zusammen. „Drin?“
„Im Laden.“
Sie erreichten das Kino. Auf dem Bürgersteig stand Arno Davis wieder mal vor den geöffneten Schaukästen. Er wechselte darin die Filmplakate, auf denen ein junger Mann mit erhobenem Lichtschwert zu sehen war. Dazu hatte Arno sich auf einen Tritthocker gestellt, der leidlich seine geringe Körpergröße ausglich. Dieser Anblick bescherte Beatrice ein Déjà-vu, das unangenehm hinter den Augen zu pochen schien. Sie drehte den Kopf reflexartig weg und prompt fiel ihr Blick auf das Antiquariat.
Die große Schaufensterscheibe war blind. Auch das Glas in der Tür war so schmutzig, dass man nicht hindurchschauen konnte. Der grüne Lack der hölzernen Rahmen blätterte an manchen Stellen ab. Graue, tote Splitter ragten empor.
„Ich war seit Sophias Geburt nicht mehr im Laden“, antwortete Bea. Ihr Hals war so trocken, als hätte sie Asche eingeatmet.
„Hast du die Schlüssel dabei?“, fragte Chaya.
„Ja.“
Die Schlüssel hingen immer noch an ihrem Bund. Ein großer, alter Hohlschlüssel aus Messing und ein wesentlich kleinerer aus Eisen. Der Hohlschlüssel hatte eigentlich keinen Nutzen mehr, weil die Tür einstmals aufgebrochen worden war. Die Tür wurde seither durch einen Riegel mit Vorhängeschloss provisorisch abgesperrt. Aus welchem Grund auch immer: Beatrice hatte die Schlüssel nie abgemacht. Zwischen Haus- und Wohnungstür warteten sie darauf, dass sie eines Tages wieder gebraucht würden.
Chaya schob sachte Beas Finger von den Griffen des Buggys. „Gib mir die Wickeltasche.“
„Warum?“
„Ich kümmere mich um Sophia, während du dich mal in deinem Laden umsiehst.“
„Warum?“
„Tu’s einfach! Es wird dir gut tun.“
„Ga? Jaya?“, fragte Sophia und reckte ihre Ärmchen nach der Homunkula, als habe sie alles verstanden. „Jaya.“
Beatrice beugte sich über ihr Kind. „Möchtest du wirklich mit Chaya …“
„Ja! Jaya“, unterbrach Sophia ihre Mama begeistert. Dann präsentierte sie ein weiteres Beispiel ihres frisch erworbenen sprachlichen Repertoires: „Jaya Kino.“
Es war ein seltsames Gefühl, die Schwelle zu überqueren. Mit einem Schritt ließ Bea die gleißende Realität hinter sich zurück und war just wieder in diese diffuse Welt ihrer eigenen Phantasien eingetreten. Die Luft, die sie einatmete, durchströmte grau ihre Lungen. Es roch nach trockenem Staub und alter Asche. In den Regalen reihten sich tot die Bücher auf. Manche waren von Ratten angefressen, bei anderen waren einfach nur die Einbände aufgeplatzt. Der Anblick von Zersetzung und Zerstörung tat Beatrice im Herzen weh. Das Wispern, das einst in der Luft diesen Raum durchdrungen hatte, schien auf immer verstummt zu sein.
„Tja, Chaya“, sagte Beatrice, sich wohl bewusst, allein zu sein, „ich wüsste nicht, wie mir das hier gut tun soll.“ Sie schlurfte zum Arbeitszimmer. Das Bild, das sich ihr dort bot, war ebenso trostlos. Links stand der alte Ohrensessel. Etwas weiter der Sekretär. Die aufgeklappte Arbeitsfläche präsentierte immer noch Schreibfeder, Tintenfässchen und andere ungewöhnliche Schreibutensilien. Doch auch hier hatte sich der graue Staub wie ein Vorhang der Zeit darüber gelegt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes waren zwei Türen. Die eine verbarg die Stiege in die verlassene winzige Wohnung im Obergeschoss, die andere führte zum Keller. Nun … eigentlich führte sie nicht nur zum Keller. Je nachdem, wie man den alten Maschinentelegraphen ausrichtete, wurde einem der Weg anderswohin freigegeben. Die Kammer der ungeschriebenen Bücher zum Beispiel wartete nach einem langen Aufstieg über eine Wendeltreppe aus Setzkästen und Büchern unter der Kuppel eines Turmes. Beatrice erinnerte sich ähnlich vage daran wie an eine Geschichte, die man vor Jahren gelesen hatte. Es fühlte sich fremd an, als hätte sie es nicht selbst erlebt. Sepiafarbene Erinnerungen, deren Ränder verblassten.
Der Rest des Zimmers war für Regale reserviert. Die Lektüre aus vergangenen Jahrhunderten quoll aus ihnen heraus.
Aber nein: Das war nicht die richtige Wortwahl. Die Lektüre aus vergangenen Jahrhunderten war aus ihnen herausgequollen. Jetzt standen und lagen die Bände steif und starr an ihren Plätzen, lehnten aneinander, in ihrem Innersten erkaltet. Sie warteten nicht mehr auf ihre Leser. Sie warteten nur noch auf den endgültigen Zerfall.
„Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.“ Beatrice rieb sich den Arm. Das unangenehme Prickeln auf der Haut konnte sie auf diese Weise kaum vertreiben. Es wurde Zeit, das Feld zu räumen. Hier gab es nichts für sie zu tun. Dennoch ließ sie sich wie ferngelenkt von ihren Füßen durch das Arbeitszimmer tragen. Vielleicht war es ein letzter Rest des Zaubers, der irgendwann hier gehaust hatte, der sie nun zur anderen Seite führte.
Ihre Hand legte sich auf den Hebel des Maschinentelegraphen.
Ihre Hand drückte ihn hinunter.
Klack!
Und …
… nichts geschah. Die Mechanik ratterte nicht. Alles blieb stumm. „Es wird Zeit.“ Beatrice drehte sich weg. Zehn Schritte bis zum Verkaufsraum, fünf bis zur Ladentür. Jetzt noch die Klinke, anschließend wäre sie nur noch einen Schritt von der Wirklichkeit entfernt.
Doch sie hielt inne, wandte sich langsam um, weil sie ein letztes Mal ihren Buchladen betrachten wollte.
Manchmal sieht man das Ungewöhnliche nicht gleich. Zu sehr ist der Geist von dem gefangen, was er zu sehen erwartet. Immer noch waren da die Regale, die kaputten Bücher, der Tresen mit der Kasse, der Staub in der Luft.
„Hier stimmt was nicht“, flüsterte Bea. Die Worte entflohen ihr über die Lippen, ohne dass ihr bewusst wurde, dass sie sie selbst gesagt hatte. Als sie sie jedoch vernahm, begriff sie ihre Bedeutung. Sie kniff die Augen zusammen, schaute genauer hin.
Der Staub!
Der Staub tanzte nicht. Reglos wie kleine Fixsterne am dunstigen Firmament verharrten die winzigen Körner in der Schwebe.
Bea fächerte und wedelte versuchsweise mit der Hand. Kein Windhauch entstand. Die Luft stand still. Sie ging zurück ins Arbeitszimmer. Auch hier bewegte sich absolut nichts. Außerdem waren sämtliche Geräusche abhandengekommen. Der Straßenlärm war ausgeblendet. „Unheimlich“, sagte Bea, ratlos, was sie mit diesen Beobachtungen anfangen sollte. Da fiel ihr Blick auf den Beistelltisch neben dem Ohrensessel.
Dort lag ein braun-beigefarbenes Buch. Der Titel zog sich in einer Jugendstilschrift über das obere Drittel des Covers. Da, wo der Name des Autors zu stehen hatte, las sie „Beatrice Liber“. Hatte das Buch vorhin schon da gelegen?
Sie hob es auf. Es wog ungewöhnlich schwer in der Hand. Obwohl sie den Inhalt zu kennen glaubte, drückte sie den Daumen zwischen die vorderen Seiten, um sie in rascher Abfolge durchzublättern. Doch der Leim im Buchrücken war genauso brüchig wie bei allen anderen Büchern im Antiquariat. Im hohen Bogen flogen die Blätter aus dem Einband und ergossen sich auf das Parkett. Da der Einband seinen Inhalt so plötzlich verlor, rutschte auch er Beatrice durch die Finger. Mit einem lauten Flatschen landete er auf dem schmutzigen Boden. Das Titelbild blieb oben und erst jetzt las Beatrice die Überschrift und den dazugehörigen Untertitel richtig: „Buchland – alle drei Teile der Saga in einem Band“
„Was zum …“, entfuhr es Beatrice. „Ich habe nur zwei Bücher geschrieben!“ Und den zweiten Teil ihres „Buchlandes“ hatte sie nur verfasst, damit Chaya ihre Seele bekam. Regenbögen im Dunkeln! Ja. Das war das Ende. Und nach dem Ende kam allenfalls ein Epilog.
Sie ging in die Hocke und packte in das fühlbare, weiche Grau, ignorierte den Geruch längst vergangener Flammen. Ihre zitternden Finger fassten in die Asche, hoben ein angesengtes Blatt hervor. Kaum hörbar rieselten Ruß und Staub davon herab. Sie sah schwarze Lettern, dicht an dicht gedruckt. Sie las: „Es waren Tage ohne Worte. Sie waren grau, wie unbedrucktes Altpapier. Leise und nichtssagend verstrich die Zeit. Blass, trübe blieb das Licht. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte musste sich fortsetzen. Sie wollte erzählt werden; wollte sich in die Geister, in die Köpfe pflanzen. Aber die Welt verharrte in Stille. Da kam kein ‚Es war einmal‘. Niemand flüsterte: ‚Es begann alles mit …‘ Nein, es waren Tage ohne Worte. Wie auch immer man sie verfasst hatte, es war ohne Worte geschehen.“
Zwischen zwei Geschichten
Das Blut pochte in Beatrice’ Adern. Das Luftholen fiel ihr schwer. Waren ihr die Regale mit den Büchern, den vielen toten Büchern, eben schon so nah gewesen? „Das ist nicht von mir. Ich habe das nicht geschrieben“, keuchte sie, während sie gegen einen plötzlichen Anfall der Klaustrophobie ankämpfte. Die Härchen auf den Armen richteten sich auf, ein kalter Schauer kroch ihr den Rücken hinab. Blut rauschte und pulsierte in den Ohren. Es war, als zöge sich eine Schlinge zu.
Sie zwang sich, wieder ruhiger zu atmen. Dabei ließ sie den Blick schweifen. Alles war immer noch wie zuvor. Nichts hatte sich bewegt. Sogar die Staubkörnchen hingen weiterhin still in der Luft. Ein eingefrorenes Standbild. Ein schwarzweißes Foto, in dem sie, als ungehorsames, buntes Motiv, hin und her zappelte.
„Keine Ahnung, wer diese Zeilen geschrieben hat“, sagte sie trotzig zu sich selbst, bemüht der eigenen Stimme mehr Festigkeit zu verleihen. Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief rasch zur Tür. Die in ihre Bestandteile zerfallene Trilogie blieb auf dem Boden zurück.
Auf der Straße rannte sie fast in einen Passanten hinein. Mit einem beherzten Sprung auf die Fahrbahn wich er ihr aus, was zur Folge hatte, dass ihn beinahe ein alter roter Chrysler erfasste. Der Fahrer des Wagens machte keine Anstalten das schwere Gefährt abzubremsen. Er hielt voll drauf zu und drückte gleichzeitig ausdauernd die Hupe. Im letzten Moment rettete sich der Fußgänger rückwärts auf den Bürgersteig. Dabei strauchelte er und landete auf Händen und Knien.
„Wow“, ächzte er, „das war knapp.“
Beatrice half ihm beim Aufstehen. Eilig klopfte sie ihm den Schmutz von der Hose. „Das tut mir leid. Ich wollte Sie nicht …“
„Plymouth Fury“, sagte der Mann, während er den kleiner werdenden Rücklichtern nachschaute, „die reinste Höllenmaschine.“
„Was?“
„Der Wagen … Ist was Besonderes. So einen Schlitten bekommt man in unseren Breitengraden nicht oft zu sehen. Der da hatte eine Sonderlackierung.“
„Sie hüpfen dem Tod von der Schippe“, stellte Beatrice fest, „und bestaunen das Auto, das Sie platt fahren wollte?“
„Oh“, machte der Mann und lächelte Beatrice unvermittelt an. Er war eine stattliche Erscheinung. Hochgewachsen, breitschultrig und muskulös. Ohne Anzug, Hemd und Krawatte hätte er vermutlich einer griechischen Statue sehr geähnelt. Doch in der Hand hielt er keinen Diskus, sondern nur ein Netz mit Äpfeln. Das Gesicht des Mannes wirkte beinahe jugendlich, jedoch strahlten die Haare grau, sogar fast weiß, im Sonnenlicht. Der gestutzte Dreitagebart kaschierte elegant ein paar kleinere Fältchen. Beatrice war es unmöglich, sein Alter zu schätzen. „Vielleicht sollte ich mich erst einmal mit Ihnen bekannt machen. Dann verstehen Sie unter Umständen, warum ich mich für solch ein Gefährt begeistern kann. Nemo. Mein Name ist Nemo.“ Mit einem festen Händedruck ergänzte er seine Vorstellung.
Beatrice vergaß, ihren eigenen Namen zu nennen. Ihre Gedanken kreisten schon wieder um Literatur: „Wie der Nemo von Verne?“
„Von Verne? Ich bin nicht adelig.“ Seine Tonlage verriet nicht, ob er das scherzhaft meinte. „Ich bin meines Zeichens Uhrmacher. Genau genommen sind zur Stunde Automationen aller Art mein Fachgebiet.“
„Beatrice Liber“, sagte Bea endlich und deutete dabei hinter sich. „Mir gehört dieser Buchladen.“
Mitleidig schaute Nemo an ihr vorbei. Die Ladentür war immer noch offen und zeigte das Chaos im Halbdunkel dahinter. „Sieht etwas desolat aus“, interpretierte er den Anblick. „Die Geschichte dieses Hauses wartet wohl auf bessere Zeiten?“
„Geschichte?“ Beatrice kniff misstrauisch die Augen zusammen. An zufällige Bemerkungen dieser Art glaubte sie inzwischen nicht mehr.
„Ja, Geschichte. Sie kennen das doch: Ein Leser hat eine Seite noch nicht zu Ende gelesen. Das Telefon klingelt und der Leser legt sein Buch auf den Tisch. Er geht zur Anrichte, nimmt den Hörer ab und palavert mit Tante Steffi oder so. In dem Buch verharrt derweil alles. Die bis gerade so lebhafte Geschichte geht nicht weiter. Das Liebespärchen spitzt vielleicht die Lippen, ohne dass es zum Kuss kommt. Oder der Ritter hebt sein Schwert, um den Drachen zu erschlagen, aber es passiert nicht. Selbst der Sturm mitsamt den wilden Böen und Regenströmen ist gefangen. Der Sand in der Uhr rieselt nicht. Der Staub in der Luft vergisst zu tanzen. Dann verabschiedet sich der Leser brav und artig von der Tante am Apparat und kehrt zurück zu seiner Lektüre und endlich geht es weiter. Verstehen Sie, was ich meine? Ach, was frage ich? Natürlich verstehen Sie! Sie sind ja Buchhändlerin.“
Beatrice legte den Kopf schief und dachte nach. Konnte es sein, dass sie gerade von der Vergangenheit eingeholt wurde? Kaum hatte sie ihr Antiquariat besucht, „Buchland“ in den Händen gehalten und schon begann alles von vorne? Sie stemmte die Hände in die Hüfte und fragte gereizt: „Sind Sie eine Personifizierung?“
Nemo zog die Stirn kraus. Seine leuchtend blauen Augen spiegelten absolutes Unverständnis.
„Personifizierung? Was soll das sein?“
„Vater Staat, Mutter Natur … Gevatter Tod. So was. Die Vermenschlichung eines abstrakten Begriffs“, erklärte Beatrice ungeduldig.
Der Mann legte eine zusätzliche Falte über die Augenbrauen. „Das bin ich noch nie gefragt worden.“
Allmählich dämmerte es Beatrice, wie dumm sich ihre Frage anhören mochte. Nicht alles, was vor dem Antiquariat geschah, musste zwangsläufig mit ihren Phantasien zu tun haben, gestand sie sich ein. „Entschuldigung. Klingt wohl etwas blöde.“
„Ach i wo“, entließ Nemo sie gut gelaunt aus dem peinlichen Dialog, „nicht schlimm. Ich werde Sie nicht fragen, wie Sie auf die Frage gekommen sind. Ich gebe Ihnen sogar eine Antwort: Ich bin genauso eine reale Person, wie Sie es sind.“ Er zwinkerte verschmitzt. „Versprochen.“
„Na …“ Beatrice schob sich verlegen eine blonde Haarsträhne hinter das Ohr. Was sollte sie sagen? „Danke.“
Nemo hob die Hand, an der das Netz mit Äpfeln baumelte, und deutete hinüber zum Laden.
„Wann machen Sie denn wieder auf? Sieht so aus, als wäre erst mal eine Renovierung fällig.“
„Mit einer Renovierung ist es da nicht getan. Das ist ein Brandschaden. Im Keller hat es vor einiger Zeit ein verdammt großes Feuer gegeben und der Rauch und die aufsteigende Hitze haben meinem Geschäft den Garaus gemacht.“
„Eine Schande. Ich denke, dass in unserer Straße, auf der so viel Kunst und Kunsthandwerk angesiedelt sind, ein Literaturgeschäft einfach dazugehört. Ohne Bücher verliert die Gegend ihren Zauber, oder?“
„Mag sein“, sagte Beatrice. „Aber das Antiquariat wird in absehbarer Zeit nicht neu eröffnet.“ Plötzlich stutzte sie. „Unsere Straße? Sagten Sie unsere Straße?“
„Oh, habe ich das nicht erwähnt? Mein Laden eröffnet nächste Woche. Da unten.“ Nemo deutete vage in eine Richtung. „Da, wo früher dieser seltsame Kuriositätenhändler drin war.“
„Sie ziehen ins Kuriosum?“ Beatrice war ehrlich überrascht. Außerdem kroch der Argwohn wieder bitter in ihrem Hals hoch. Für ihren Geschmack kamen nun doch zu viele Zufälle zusammen.
„Der Laden steht ja schon lange genug leer. Ich fand die Immobilie sehr interessant. Mit dem Keller und den zahlreichen Nebenräumen gibt es da für meine Werkstatt ausreichend Platz.“
„Außerdem sind alle Räume Fünfecke“, merkte Beatrice an. Die Erinnerungen an das Kuriosum und dessen Eigentümer Quirinus waren nicht die angenehmsten.
Nemo nickte gelassen. „Jetzt wo Sie es sagen.“
„Perfekt für Teufelssymbole“, behauptete sie schnippisch.
„Was?“
„Ich meine Pentagramme.“
„Wie kommen Sie denn auf so etwas?“
Beatrice schob den Unterkiefer herausfordernd vor. Um ihre höfliche Freundlichkeit war es längst geschehen. Einst hatte sie zu viel gegrübelt, zu verwirrende Erinnerungen sortiert und gedeutet. Sie hatte zwar weder einen Kreidekreis noch einen entsprechenden Stern in Quirinus’ Räumen gesehen, aber der Gedanke, dass eben genau das der Zweck der ungewöhnlichen Architektur gewesen war, hatte sich mit der Zeit als fixe Idee in ihr eingenistet. „Wussten Sie, dass Ihr Vormieter für den Brand in meinem Antiquariat verantwortlich ist?“
„Äh.“ Nemo wich einen Schritt zurück. „Wir sind uns nie begegnet. Das Kuriosum ist doch vor ungefähr zwei Jahren ausgezogen … Und“, Nemo versuchte sich in einer Rechtfertigung, „Pentagramme sind ja nicht zwangsläufig Teufelssymbole. War der Architekt des Gebäudes vielleicht Freimaurer? Oder war er besonders in Symbolik bewandert? Erde, Wasser, Feuer, Luft und der menschliche Geist. Alchemie und so.“
„Sie kennen sich gut aus“, warf Beatrice ihm vor.
„Nun“, sagte Nemo und hob dabei in einer abwehrenden Geste die Hände, „ich weiß gerade nicht, wohin dieses Gespräch führen soll. Ich denke, dass ich mich lieber verabschieden sollte.“ Beinahe fluchtartig drehte er sich von Beatrice weg und machte sich in Richtung Kuriosum, das nun keines mehr war, davon. Nachdenklich schaute Beatrice ihm nach. Als er die Tür unter der rot-weiß gestreiften Markise erreichte, schloss er hastig auf, um alsdann im Dunkel dahinter zu verschwinden.
Der saure Geruch von kaltem Popcorn schwebte in der Luft. Sophia saß in einer Plastikwanne umgeben von dem Puffmais. Ihre nackten Füßchen spielten selbstversunken darin, während Hände, Mündchen und der ganze Rest des Mädchens sich mit einem etwas zu großen Eisbecher beschäftigten. Schokoladenverschmiert und vereinzelt mit Popcorn paniert, wirkte das Kind in erster Linie glücklich. An zweite Stelle trat das Attribut „klebrig“. Chaya hing daneben kopfüber in der Popcornmaschine und brachte das Gerät mit Lappen und Putzmitteln auf Hochglanz. Durch die Scheibe, die den vorderen Teil ausmachte, drang ihre Stimme nur gedämpft an Beatrice heran. Trotzdem konnte sie den vorwurfsvollen Unterton unmöglich überhören. „Du hast den Mann wirklich gefragt, ob er eine Personifizierung ist?“ Chaya lachte. Dass Sophia das zum Anlass nahm, ebenfalls ein amüsiertes Glucksen in die Runde zu werfen, machte die Situation für Beatrice auch nicht besser.
„Ja“, sagte sie kleinlaut.
Arno stand etwas abseits und rollte alte Filmplakate ein. Gerade verpackte er die Roboterdame von Metropolis in einer Schachtel. Vorhin waren Wall-E und ein Terminator von seiner Ablage verschwunden. Die Drei konnten nun wohl binäre Unterhaltungen in ihrem Behältnis führen. „Personifizierung? Darauf muss man erst mal kommen, nicht wahr?“ Arno lächelte auf eine unbestimmte Weise, ohne zu verraten, wie viel er eigentlich wusste.
„Ich weiß nicht, warum Sie das so abwegig finden.“ Beatrice verschränkte die Arme vor der Brust.
„Schreiben Sie denn wieder?“ Arno legte die Schachtel zur Seite und schaute Beatrice erwartungsvoll an.
„Schreiben?“ Wie kam er denn jetzt da drauf? Unwillkürlich fühlte sie sich an die Trilogie, die sie eben im Antiquariat gefunden hatte, erinnert.
„Ja. Ich meine, die Geschehnisse in Ihrem Leben und Ihre Bücher … Sie können eine gewisse Symbiose zwischen beidem doch kaum verleugnen. Wenn Sie mir sagen würden, dass Sie wieder schreiben, wäre es eine Erklärung. Ich habe übrigens Ihre Werke mit großem Interesse gelesen, nicht wahr? Ein dritter Band würde sich quasi anbieten. Eine typische Erzählstruktur wäre das. Die klassische Heldenreise. Wie bei den Sternenkriegen: Protagonist wird von Mentor unterwiesen, während sich ihm eine neue Welt samt Prophezeiung offenbart. Der Mentor stirbt, dann schlägt das Imperium zurück und alles liegt in Trümmern. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Imperator besiegen. … nicht wahr?“
„Ich habe mit Sophia alle Hände voll zu tun. Und sobald ich wieder arbeiten gehen kann, werde ich mir eine Stelle suchen müssen.“ Beatrice machte eine kleine Pause, die Platz für ein Seufzen ließ. „Seit das Antiquariat zu ist, sind Ingo und ich etwas in finanzielle Schieflage geraten.“
„Oh, ich dachte“, sagte Arno, „dass Sie mit Ihren Veröffentlichungen ganz gut verdienen.“
Beatrice schnaubte. „Inzwischen gibt es tausendfach Kopien im Netz. Kostenlose E-Books.“
„Raubkopien“, warf Chaya ein, die schon von dem Problem wusste.
Beatrice nickte. „Deshalb schreibe ich nicht mehr. Man kann das bald nur noch als Hobby betreiben. Und für so ein Hobby habe ich keine Zeit mehr.“ Das fand Sophia auch und warf den Eisbecher ins raschelnde Popcorn. Sie wollte von ihrer Mama jetzt ein paar Streicheleinheiten einfordern. „Gelegentlich frage ich mich, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, einen Verlag zu suchen. Wenn man von manchen Lesern dann doch nur bestohlen wird … In meiner Schublade waren meine Geschichten vielleicht besser aufgehoben. Den Weg der Veröffentlichung würde ich gerne ungeschehen machen.“
„Worte kann man nicht festhalten“, erklärte Arno. „Sind sie einmal in die Welt entlassen, kann nichts sie zurücknehmen. Wie will man auch etwas behalten, was einem nicht gehört?“
„Die Worte gehörten mir nicht. Aber es sind meine Zeit, mein Herzblut und meine Ideen, die gestohlen wurden.“
„Ga!“, behauptete Sophia. Sie reckte ihrer Mama eine Hand entgegen. Das vertrieb die düsteren Gedanken aus Beas Kopf. Mit aller Routine fischte sie ein Feuchttuch aus der Wickeltasche und begann damit, ihren Nachwuchs von der Patina aus Zucker, Schokolade und Mais zu befreien.
„Süßer kleiner Dreckspatz.“
„Deckspa!“
„Drrrreckspatz.“
„Deckspa!“
„Ja, das auch.“
„Ga!“
„Na, den Pulitzer-Preis bekommen Sie für solche Dialoge aber nicht, Beatrice.“ Arno griff nach dem nächsten Plakat von seinem Stapel. R2D2 wurde nun aufgerollt.
Bea lachte, küsste die kleinen ausgestreckten Fingerchen. „Wie gut, dass wir nicht in einer meiner Geschichten sind.“
„Sind Sie sich da sicher?“
„Ich bin mir sicher, dass es keine gute Idee war, mein Kind in das Popcorn vom Vortag zu setzen“, sagte Beatrice vorwurfsvoll in Chayas Richtung und rieb mit leidlichem Erfolg über den Stoff des Jäckchens.
Das Wetter trübte sich allmählich ein. Die Luft wurde langsam weiß, als Nebel mit nassen Fingern in die Stadt kroch. Sophia lag im Buggy, schlummerte friedlich. Beatrice saß hinter ihr auf der Bank im Wartehäuschen und schaute unruhig die Straße hinunter. Der Bus hatte Verspätung. Aus irgendeinem Grund fand sie es unheimlich, dass sich die Geräusche und Farben in den Dunstschwaden ausblendeten.
Sie ließ den Blick sinken und die Gedanken treiben. Warum war das heute so ein seltsamer Tag? Zuerst der Traum, dann Chayas Drängen hierher zu kommen, das Antiquariat mit dem Buch. Um es mit Herrn Planas Worten zu sagen: „Das war zu viel Story auf zu wenig Seiten.“ Außerdem brachte es nichts, wenn man einen Sinn dahinter zu ergründen versuchte.
Plötzlich vernahm sie Schritte. Von rechts kam jemand. Aber der Nebel war dort inzwischen so dicht, dass sie den Ankömmling erst erkennen konnte, als er auch unter das Vordach der Haltestelle trat. „Na, der hat mir gerade noch gefehlt“, dachte Beatrice, als sie niemand anderen als Nemo erkannte. Er setzte sich auf den freien Platz neben ihr. Peinliches Schweigen folgte. Dass sie ganz allein hier waren – weder Autos fuhren vorbei, noch schlenderten Leute über den Bürgersteig – betonte die Sprachlosigkeit.
Beatrice rutschte unruhig hin und her. Sie war beinahe dankbar, als Nemo schließlich doch redete. „Habe ich den Bus verpasst?“
„Nein. Er ist überfällig.“
„Hm-m.“
Okay, das war jetzt nicht der erfolgreichste Auftakt zu einer Konversation. Beatrice dachte nach, was sie Sinnvolles von sich geben konnte. „Entschuldigung.“
„Wofür?“
„Für meinen Ausbruch von vorhin“, sagte sie verlegen. „Manchmal hänge ich wohl noch zu sehr in phantastischen Geschichten fest. Meinen Laden in diesem Zustand zu sehen, hat mich möglicherweise zu sehr aufgewühlt.“
Nemo nickte. „Das kann ich mir vorstellen. Nichts für ungut. Es ist ja nix passiert.“
„Wissen Sie …“, begann Beatrice, „die Umstände, die zu dem Brand geführt haben …“ Sie unterbrach sich.
„Ja?“
„… waren ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich ist das richtige Wort.“
„Inwiefern?“ Nemo tat interessiert.
„Nuuun“, sagte Beatrice gedehnt. „Stellen Sie es sich wie ein Märchen vor.“
„Das muss ein böses Märchen gewesen sein“, sagte der Uhrmacher.
„Stimmt. Es handelte von einem magischen Ort, einer Frau und dem Bösen. Am Ende kam kein richtiges Happy End.“
„Kein Happy End?“
„Nein. Das Böse kam davon und der Ort stand zum großen Showdown in Flammen.“
Mit der Hand rieb Nemo sich das Kinn. Er brummte dabei leise, als wäre er sich unschlüssig, ob er sagen sollte, was ihm auf der Zunge lag. Schließlich rang er sich dazu durch. „Vielleicht ist Ihr Märchen nur noch nicht fertig erzählt.“
Diese unscheinbare Feststellung löste etwas in Bea aus. Ein Schalter legte sich in ihr um. Das, was sie nun tat, war ganz und gar nicht ihr Wille. Ein innerer Zwang drehte ihr den Kopf und sie sah zum Antiquariat hinüber. Eingerahmt von einer undurchsichtigen Nebelwand konnte sie das Schaufenster sehen. Für einen kurzen Augenblick erahnte sie ein Licht dahinter, das die Silhouette eines Mannes auf das Glas projizierte. Der Mann stand leicht gebeugt da, lehnte sich auf einen Stock, trug einen Hut und paffte an einer Pfeife.
Dann schob ein Lufthauch den Nebel davor. Schon strafte ihr Verstand die Augen Lügen. Das konnten sie unmöglich gesehen haben.
Zurück zum Hier und Jetzt, ermahnte sie sich. „Ich habe zwei Bücher geschrieben“, erklärte sie Nemo. „Sie erzählen, wie es zu dem Feuer gekommen ist.“
„Autobiographische Werke?“, fragte Nemo erstaunt. „Ich hätte nie gedacht, dass Sie der Typ für sowas sind.“
„Belletristik“, korrigierte Beatrice, „Nur Belletristik. Stark verfremdet und hoffentlich interessanter als das reale Leben. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass diese Geschichte ganz bestimmt geendet hat. Da war eine Frau, die den Büchern geholfen hat. Und die Bücher haben anschließend der Frau geholfen. Oder so ähnlich. Zwei Romane. Fertig.“
„Hört sich nicht spannend an“, kommentierte Nemo ihre lakonische Zusammenfassung. Dann deutete er mit dem Daumen nochmals in die ungefähre Richtung ihres Ladens. „Ihre Bücher scheinen dabei keinen guten Deal gemacht zu haben.“
Bevor Beatrice antworten konnte, öffnete sich zischend die Tür des Busses vor ihnen. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass das Vehikel vorgefahren war. Nemo half ihr Sophia samt Buggy die zwei Stufen ins Innere des Fahrzeugs hochzutragen. Doch anschließend stieg er direkt wieder aus. „Das ist nicht mein Bus“, erklärte er. Die Falttür schloss sich. „Hier fährt nur eine Linie“, rief Beatrice ihm zu. Nemo zuckte mit den Schultern und setzte sich zurück auf die Bank. Die Szenerie wurde zunehmend surreal, befand Beatrice, als der Bus die Fahrt durch das wabernde Weiß begann.
Wie Schemen huschten blass die Häuser an den Fenstern des Busses vorbei. Geparkte Autos, Bäume, Straßenlaternen. Alles stand still, während allein Beatrice mit Sophia dahinfuhr. Jedoch waren sie nicht allein. Zwar hörte man nur das sonore Brummen des Motors, aber trotzdem war jeder Sitzplatz um sie herum besetzt. Die Fahrgäste schwiegen allesamt. Im dämmrigen Zwielicht verschwammen sie beinahe mit der Textur der Kulisse, doch ihre Gesichter leuchteten blau, angestrahlt von den Displays ihrer Smartphones, Reader und Tablets. Ihre Blicke waren leer, derweil sie mit Daumen oder Zeigefinger über die Benutzeroberflächen streichelten, wischten und tippten.
Keiner sprach, stellte Beatrice fest. Noch viel bedeutsamer erschien ihr die Tatsache, dass niemand ein Buch in den Händen hielt. Warum fiel ihr das ausgerechnet jetzt so sehr ins Auge?
Nun …
Das Schicksal hatte sie heute förmlich mit der Nase darauf gestoßen. So heftig, wie ihr Großvater einst seinen Hund mit der Nase in sein Malheurchen gedrückt hatte. Der Hund hatte ziemlich schnell begriffen, dass etwas ganz Bestimmtes von ihm erwartet wurde.
„Vielleicht …“, flüsterte sie. Ja. Vielleicht hatte dieser Nemo recht damit, dass die Bücher die Verlierer in ihrer Geschichte waren. Vielleicht stimmte Arnos Einschätzung, dass ihre Bücher eine Trilogie werden mussten.
„Vielleicht …“, sagte Beatrice noch einmal. Vermutlich zu laut, denn die Teenagerin vor ihr schreckte aus ihrer digitalen Trance auf. Verwirrt schaute sie die ehemalige Buchhändlerin an, schüttelte benommen den Kopf und versank dann wieder im Anblick der virtuellen Welten.
Ja. Vielleicht.
Eine Inspiration formte sich.
Eine Idee nahm Gestalt an.
Ein Plan reifte heran.
Das Wohnzimmer war dunkel. Nur das blasse Licht des Monitors erhellte einen kleinen Bereich vor dem Esstisch. Beatrice starrte auf den Textcursor, der monoton auf der Mattscheibe blinkte. An. Aus. An. Aus. Jene Arbeit verrichtete er ein wenig zu schnell. Der Sekundenzeiger der Wanduhr kam in diesem Tempo kaum mit. Die Zeit verstrich ungenutzt.
Die Maske der Software füllte sich schließlich doch mit Zeichen. Mit zitternden Fingern drückte Bea zunächst ein „P“, dann ein „r“, ein „o“ und die drei weiteren Buchstaben, die dazu gehörten; denn die Story war noch nicht zu Ende.
Prolog
Manchmal beginnt eine Geschichte und man stellt fest, dass man schon mittendrin steckt. Mit einem gleichmäßigen Takt schlug Beatrice ihre Finger auf die Tastatur des Rechners. In ihrem Kopf lief eine Maschine, die piepend und ratternd ihr Programm abspulte. Sie produzierte Worte, ohne sie wirklich wahrzunehmen, tippte, was sie sich selbst erzählte. Zuzuhören brauchte sie sich nicht: Es war alles einfach da. Die Zeit schob die Zeilen voran, einem Fließband gleich, das mit Einzelteilen bestückt wurde, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügten. Es fühlte sich richtig an.
Zärtlich legte sich eine Hand in ihren Nacken. Ein Kuss wurde hinter ihr Ohr gehaucht. Ingo flüsterte: „Du schreibst? Mitten in der Nacht?“