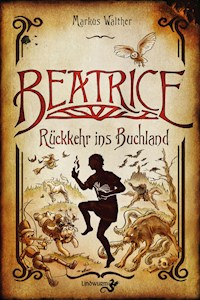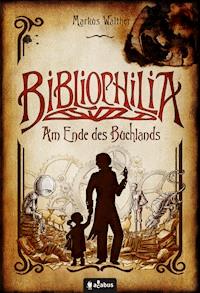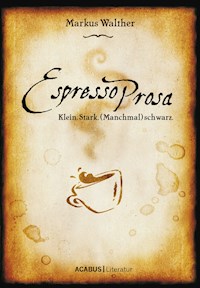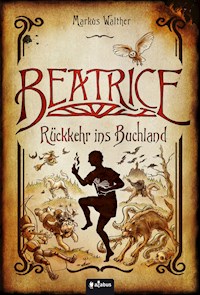
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Buchland
- Sprache: Deutsch
"Sie wusste um das mächtige Eigenleben des geschriebenen Wortes, wusste um die Magie, die die Realität um die Fiktion krümmte, wie das Weltall den Raum um die Masse." Eigentlich müsste Beatrice zufrieden sein. Sie hat das Antiquariat von Herrn Plana übernommen, ihr Mann ist wieder gesund und der Verlag wünscht sich ein neues Manuskript. Alles scheint in geordneten Bahnen zu laufen. Doch dann taucht der kuriose Ladenbesitzer Quirinus auf, der ihr ein Angebot macht, das sie einfach nicht ablehnen kann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zurück in die tiefsten Regionen des Buchlands.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Walther
Walther, Markus: Beatrice. Rückkehr ins Buchland, Hamburg, acabus Verlag 2015
Originalausgabe
PDF-E-Book: ISBN 978-3-86282-374-1
Epub-E-Book: ISBN 978-3-86282-375-8
Hardcover-Ausgabe: ISBN 978-3-86282-401-4
Paperback: ISBN 978-3-86282-373-4
Lektorat: ds, acabus Verlag
Umschlaggestaltung: © Petra Rudolf
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© acabus Verlag, Hamburg 2015
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für Horst †
Dann aber kamen drei Punkte …
Gedanken aus Papier
Die Welt legte wieder ihr Gewand aus Buchstaben an. Schwarze Lettern, die auf weißem Papier die Geschicke der Menschen formten. Nicht greifbar und doch fühlbar sangen die Worte im Konzert der Gefühle, entfalteten ihre spezielle, lautlose Magie.
Und schon ließ Beatrice ihre Realität hinter sich zurück, vergaß das kleine Zimmer, die staubigen Möbel und das Bett, auf dem sie lag. Sie folgte den Zeilen, ließ sich führen und verführen, trieb selbstverloren in den fast vergessenen Gedanken einer Träumerin, die einst zu Stift und Papier gegriffen hatte.
Es war, als würde sie nach Hause kommen, denn sie kannte den Text, hatte ihn wieder und wieder gelesen, ihn in sich aufgenommen, bis ins letzte Detail zu begreifen versucht. Ja, versucht. Aber nie hatte sie es geschafft.
Auf dem Cover stand Buchland. Einen treffenderen Titel hätte es nicht haben können, denn diese Geschichte, die zwischen dem Einband gefangen war, handelte von einem Land voller Bücher. Aber genauso gut hätte das Buch auch Beatrice heißen können, denn diese Geschichte, die manchmal aus dem hellbraunen Einband entfliehen wollte, handelte ebenso von Bea. Das war schwer zu begreifen. Insbesondere, weil sie selbst jene Träumerin gewesen war, die das Buch nach einer wahren Begebenheit geschrieben hatte. Eine wahre Begebenheit, die erst durch dieses Buch wahr geworden war.
Darüber nachzugrübeln war, als ob man sich das eigene Hirn verknotete. Es kam ihr vor wie diese Bilder, in denen die Perspektive dem Betrachter einen Streich spielte: eine Treppe, die rechteckig verlief und nicht an Höhe gewann, weil sie in sich geschlossen war. Vielleicht war es aber auch nur eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz biss.
Auf dem Nachttisch lag ein Brief. Der Briefkopf war schlicht gehalten: Adressat, Absender, Betreff. Darunter ein paar freundliche, auffordernde Zeilen der Verlegerin. Nach zwei Jahren dürfe man doch endlich mit der erhofften Fortsetzung rechnen.
Nein, durfte man nicht. Beatrice war sich sicher, dass sie keine Fortsetzung von Buchland schreiben wollte. Diese Geschichte war abgeschlossen. Es war alles erzählt. Und nur des bisschen Geldes wegen, würde sie sich nichts aus den Fingern saugen. Außerdem …
Außerdem fiel ihr diesbezüglich auch gar nichts ein.
Also schrieb sie keine neuen Kapitel in das Buchland. Sie schlug nur die alten wieder und immer wieder auf, ließ auf diese Weise abermals die vergangenen Geschehnisse Revue passieren. Sie durchwanderte nochmals die endlosen Gänge zwischen den Bücherregalen, ritt auf Pegasos, parlierte mit Goethe und besuchte die Kammer der ungeschriebenen Bücher.
Manche dieser gedruckten Erinnerungen lasteten schwer. Sie drückten auf ihren Brustkorb, schnürten ihr die Luft ab. Es war, als würde ein Gewicht …
„Bea“, flüsterte jemand, „Bea. Du bist schon wieder beim Lesen eingeschlafen.“
Benommen blinzelte Beatrice, strampelte und zappelte dabei ein wenig. Mit einem leisen Rascheln und einem anschließenden plumpsenden Geräusch fiel das Buch von ihrem Oberkörper. „Was’n?“ Ach ja, sie lag im Bett.
Die Matratze knarzte etwas, als sie sich schlaftrunken aufrichtete. Traumwelt, Buchwelt und das wirkliche Leben reichten einander gerade die Hände, grüßten sich höflich, nur um nach ein paar Minuten wieder getrennte Wege zu gehen.
Beatrice stand auf, ging die zwei Schritte zum Fenster, öffnete es weit und sog die kühle Luft des Morgens ein. Auf der dunklen Innenseite ihrer geschlossenen Augenlider tanzten bunte Flecken im Takt der Sonnenstrahlen.
Ingo stand auch auf, kam ihr nach, schmiegte sich an sie und hauchte ihr sachte einen Kuss hinter das Ohr. „Träumerle, Morpheus Arme haben dich noch nicht richtig losgelassen, was?“
Sie ließ die Augen für ein paar weitere kostbare Sekunden geschlossen und reckte ihr Gesicht dem Tag entgegen. „Ich habe bis heute nicht begriffen, warum man mit dem Träumen aufhören soll, wenn man wach geworden ist.“
„Du hast wieder die halbe Nacht gelesen“, stellte Ingo fest. Es lag ein winziger Vorwurf darin. „Kennst du die Story nicht langsam in- und auswendig? Findest du es nicht ein wenig eitel, ständig im eigenen Werk zu schmökern?“
„Ich lese ja auch noch anderes“, rechtfertigte sich Bea. Was hatte es mit Eitelkeit zu tun, wenn man die rätselhaftesten Ereignisse des eigenen Lebens zu ergründen versuchte? Sie löste sich aus Ingos Umarmung, um das Buch aufzuheben und sorgsam, fast liebevoll, zuzuschlagen. „Ich habe in der letzten Woche fünf Bücher gelesen.“
Ingo brummte daraufhin etwas. Es war nicht eindeutig zu verstehen, ob es Worte waren oder nur ein unartikuliertes Grunzen. Als sich Bea nicht die Mühe machte nachzufragen, sagte er leise aber deutlich: „Suchtverhalten. Das ist Suchtverhalten. Du bist ein Bücherjunkie.“ Das war nicht scherzhaft gemeint. Über das Thema Sucht würde Ingo niemals auch nur eine lustige Bemerkung über die Lippen kommen.
„Halb so wild“, sagte Bea. „Wäre ich Floristin, hätte ich jeden Tag mit Blumen zu tun. In der Vase auf unserem Esstisch stünde trotzdem ein Strauß. Ich bin nun halt eine Buchhändlerin in einem Antiquariat. Da gehört das Lesen einfach zum Beruf.“
„Wie du meinst.“ Ingo strich sich mit leidlichem Erfolg über die struppigen Haare. „Ich geh’ unter die Dusche. Wird Zeit, dass wir in die Puschen kommen. Heut’ ist noch viel zu tun.“
Viel zu tun. Ja, das stimmte. Sie wollten sich endlich dazu aufraffen, ihren Keller auszumisten, um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu setzen.
„Fangen wir direkt nach dem Frühstück an?“ Bea fragte so emotionslos, wie es ihr nur möglich war. Trotzdem hatte sie dieses leichte Zittern in der Stimme. „Oder fangen wir damit heut’ Nachmittag nach der Arbeit an? Wir haben eh nur noch zwei Stunden, bis wir los müssen. Wir könnten stattdessen etwas gemütlicher Kaffee trinken.“
Ingo stand schon im Bad, drehte sich langsam zu ihr um. Seine Augen verrieten diese Traurigkeit, die Bea so sehr fürchtete. Es war jene Art der Traurigkeit, die einem das Herz zerspringen lassen wollte; jene Art der Traurigkeit, die alles wie ein Malstrom mitreißen konnte. „Sollen wir’s noch länger aufschieben? Du siehst nicht so aus, als würde dir das gut tun.“
„Mir?“
„Dir. Ja. Dir und mir … Uns.“ Ingo zog etwas verlegen den Mundwinkel hoch. „Wir haben endlich alles im Griff. Du weißt, was ich meine. Ich bin nicht mehr krank, steh’ in Lohn und Brot. Und du hast die Arbeit, die du schon immer wolltest. Du hast Erfolg mit deinem Laden und auch mit diesem Buch. Nur unser Keller … Er ist wie ein blinder Fleck. Wir müssen endlich mit der Vergangenheit abschließen.“
Selbstverständlich hatte Ingo recht, Bea wusste das. Es war ganz leicht zu erkennen, denn sie beide sprachen nur von dem Wort „Keller“. Aber was da im Keller war, blieb unaussprechlich.
Bea ging zu Ingo, griff nach seinen Händen, umfasste sie ganz zart. Dabei vermied sie es, in seine Augen zu schauen. „Also, nach der Arbeit, ja? … Bitte.“
Ingo gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Es ist nur eine Galgenfrist. Wir müssen das irgendwie hinter uns bringen.“
Bea nickte. „Eine Galgenfrist“, wiederholte sie, kämpfte dabei tapfer gegen ihre Tränen an und versuchte verzweifelt, diesen Kloß im Hals herunterzuschlucken.
Bea erreichte das Antiquariat pünktlich um neun Uhr. Es war ein wundervoller Morgen. Die Sonne schien durch die Blätter der neu gepflanzten Bäume, Vögel zwitscherten verliebt und auf der Straße flanierten Leute aller Couleur. Die Szenerie verlangte mit aller Macht nach der Bezeichnung „idyllisch“. Hier, rund um Beas Laden, zeigte sich ein Stückchen heile Welt. Nicht nur für Bea. Alle, die hier lebten und arbeiteten, spürten es in gewisser Weise: Diesem Ort wohnte ein besonderer Zauber inne. In jeder Hinsicht. Außerdem waren die Geschäfte zu einer Art Touristenattraktion geworden. Nirgendwo sonst gab es so viel Kunst und Kunst handwerk auf einem Fleck. Hier fand man Geigenbauer, Glasbläser und Porzellanmaler neben Korbflechtern und Goldschmieden. Straßenmusiker und Pantomime unterhielten die Passanten und in der Galerie rechts vom Antiquariat standen manchmal die Leute Schlange bis hinaus auf die Straße, nur um die Werke junger, bis dato unbekannter Künstler zu entdecken. Auch all die anderen Geschäfte, sei es Friseur, Florist, der Spielzeughändler mit selbstgemachten Teddys oder der Töpfer mit seinen extravaganten Vasen, konnten sich vor Kunden kaum retten.
Sogar das neue kleine Kino hatte sich zu einem Publikumsmagneten gemausert, obwohl dort nur selten aktuelle Filme gezeigt wurden. Die Besucher schätzten das nostalgische Flair mit Vorhang und Barockdekor.
Das Lichtspieltheater war schräg gegenüber vom Antiquariat, und als Bea die Markise vor dem Schaufenster herauskurbelte, winkte ihr Arno Davids, der Eigentümer, freundlich zu.
„Guten Morgen, Arno“, rief Bea. „So früh schon bei der Arbeit?“
„Natürlich! Es ist Donnerstag. Ich häng’ die neuen Plakate in die Kästen.“
Der Begriff „neu“ war in Bezug auf die Plakate eine herzliche Übertreibung, stellte Bea amüsiert fest, als sie beobachtete, dass er die Plakate von Charlie Chaplin sorgsam einrollte und gegen Werbung für Schwarzeneggers Last Action Hero austauschte. Um das zu bewerkstelligen, musste Arno mehrmals auf einer zweistufigen Trittleiter auf und ab klettern, denn der ältere Mann mit dem grauen Haarkranz kam wegen seiner geringen Statur nicht mal ansatzweise an den oberen Rand des Rahmens.
Bea hing die Kurbel ab und lehnte sie an die Ladentür. Dann eilte sie über die Straße zu Arno. Kurzentschlossen nahm sie ihm die Stecknadeln aus der Hand und befestigte das letzte Plakat für ihn. „Denken Sie, dass sich das noch jemand anschauen will? Der Streifen lief doch bereits zig Mal im Fernsehen.“
„Ach, ich glaub’ schon, dass er sein Publikum finden wird. Ich habe eine Schwäche für diesen Film. Es ist lustig, wenn Klischees so schön durch den Kakao gezogen werden, nicht wahr? Die besten Geschichten sind doch immer noch die, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, nicht wahr?“ Arno klappte den Schaukasten zu und schloss ihn sorgsam ab. „Charlie war letzte Woche auch ausverkauft. Ich präsentiere nur Filme, die ich mag. Und was ich mag, scheint auch anderen zu gefallen, nicht wahr? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich hier aufführen kann, was ich will: Die Leute mögen es … es ist eine Art Magie.“
„Wollen Sie in nächster Zeit Highlander zeigen?“
Arno zog erstaunt eine seiner grauen, buschigen Augenbrauen hoch. „Woher wissen Sie?“
Bea lachte. „Ach, nur so eine Ahnung.“
Ein Blick über die Schulter verriet Bea, dass die ersten Kunden das Antiquariat betraten. Also verabschiedete sie sich von Arno und eilte dahin, wo sie für den Augenblick hingehörte: hinter die Verkaufstheke. Der Morgen verlief im Großen und Ganzen ereignislos. Es wurden einige Bestellungen abgeholt und einige Bestellungen aufgegeben. Es waren keine besonders anspruchsvollen Titel. Nichts davon musste aufwendig recherchiert werden. Da blieb mehr Gelegenheit für die Nachmittagsvorbereitungen.
Seit kurzem veranstaltete sie einmal die Woche einen Lesenachmittag für Kinder und Jugendliche. Meistens kamen bis zu zehn junge Zuhörer, die es sich auf weichen Sitzkissen auf dem Boden hinter dem Schaufenster bequem machten.
„In welche Geschichte wollen wir denn heute tauchen?“, fragte Bea in den Raum, nachdem ihr Besuch gegen drei Uhr nach und nach eingetrudelt war. Dabei strich sie sanft mit den Fingerspitzen über die Buchrücken, die sich in überfüllten Regalen aneinander drängten. Einer stand etwas hervor und Bea nahm dies zum Anlass, ihn herauszuziehen. Sie las den Titel und nickte zufrieden, als habe sie eine Abmachung mit jemandem getroffen, den nur sie sehen konnte. Die Kinder kannten jenes spezielle Gehabe ihrer Gastgeberin. Trotzdem stupsten sie einander unauffällig an, tuschelten ein wenig und unterdrückten ein Kichern.
„Was haltet ihr davon, wenn wir mal in Die Geschichte von Peter Hase reinlesen? Das wurde von Beatrix Potter geschrieben.“
„Von dir, Bea!“ Das war die jüngste in der Runde: Anne. Sie lächelte wissend und drückte stolz ihren schmächtigen Oberkörper vor.
„Nein“, lachte Bea. „Ich heiße zwar auch Beatrice, aber mein Name schreibt sich anders. Außerdem lautet mein Nachname Liber. Frau Potter hat dieses Büchlein hier schon vor langer, langer Zeit geschrieben.“
„Potter? Ist das die mit den Hexen und Zauberern?“ Diese Frage stammte von Ronald, dem zwei Jahre älteren Bruder von Anne.
Kevin, einer der Älteren, stöhnte entnervt und knuffte Ronald in die Seite. „Mann, Ron. Wo bist du die letzten Jahre gewesen? Frag mal deine Eltern, wie sie auf deinen Namen gekommen sind. Dann stellst du auch nicht mehr so dumme Fragen.“
Ronald verstand zwar nicht, was Kevin meinte, trotzdem konterte er trotzig auf die einzig richtige Weise: „Ich kann mir denken, wie deine Eltern auf deinen Namen gekommen sind. Sie mussten dafür nich’ lange überlegen und waren dabei allein zu Haus.“
Es war das übliche Geplänkel von Kindern, die sich gegenseitig zeigen wollten, wer der Reifere oder Klügere war. Bea kannte dieses Vorspiel zu Genüge und meisterte es für gewöhnlich, indem sie nicht darauf ein- sondern lieber in medias res ging. Sie schlug vorsichtig das sehr alte, dünne, braune Büchlein auf und las laut vor. Obwohl es eigentlich kaum den Geschmack der Älteren traf – immerhin war die Geschichte für Kinder im Vorschulalter gedacht –, bekam Bea ziemlich schnell auch deren volle Aufmerksamkeit.
Als sie fertig gelesen hatte, saßen die Großen noch immer andächtig auf ihren Kissen, während Anne und Georgina sich irgendwann auf Beas Schoß platziert hatten, um besser die liebevoll gestalteten Bilder betrachten zu können.
„Lesen wir jetzt noch im Kompass weiter?“, schlug Philip, ein hochgeschossener, blonder Teenager mit Streberbrille vor. Der Goldene Kompass war sein absolutes Lieblingsbuch. Obwohl er es inzwischen, nach eigenen Angaben, schon vier Mal gelesen hatte, mochte er es ganz besonders, wenn Bea ihm daraus einzelne Szenen vorlas.
„Na, wie gut, dass ich das Buch eben schon bereitgelegt habe“, sagte Bea. Ohne aufzustehen, ohne sich auch nur umzudrehen, griff sie blind in das Regal hinter sich.
„Wow“, entfuhr es Kevin, der kurz den Eindruck hatte, dass sich die Bücher im Regal bewegten. Die Buchrücken schienen kurz zu flimmern und im nächsten Moment hatte Bea den Kompass zwischen den Fingern. „Habt ihr das gesehen?“
„Was?“, fragte Bea scheinheilig, zwinkerte ihm aber verschwörerisch zu.
Kevin schluckte atemlos. Seine Antwort blieb aber aus, da die Türglocke lautstark bimmelte und die Tür heftig aufschwang. Ein Luftzug fuhr durch den Raum, wirbelte an den Regalen vorbei, um ihnen dann in die Gesichter zu blasen. Instinktiv kniffen die Kinder die Augen zu.
Gleißendes Tageslicht umspülte eine schwarze Silhouette, die breitbeinig wie ein Italowestern-Cowboy im Türrahmen stand. Allerdings passten weder das nachtschwarze Kapuzenshirt noch die durchhängende Blue-jeans zum Look eines einsamen Rächers. Den gerade noch vornüber gebeugten Kopf hebend, schlug der Fremde die Kapuze zurück. Fast gleichzeitig schob sich draußen eine Wolke vor die Sonne und der theatralisch eingeleitete Auftritt endete in der Erscheinung eines etwa vierzig Jahre alten Mannes, der in die Kleidung eines Rappers reingeschossen worden war. Die Augen wurden von den dunklen Gläsern einer Ray Ban verdeckt. Doch die blasse, beinahe weiße Haut und ebenso die wasserstoffblonden Haare des Mannes, ließen darauf schließen, dass die Iris der versteckten Augen leicht weißlich oder sogar rötlich sein musste.
Er schaute sich kurz im Raum um. Dass Kinder und eine erwachsene Frau auf dem Boden hockten, schien ihn nicht zu überraschen. Beim Anblick der überfüllten Regale des Verkaufsraums entfuhr ihm allerdings ein überraschtes „Oh, Bücher.“ Damit war in einem Buchantiquariat für ihn vermutlich nicht zu rechnen gewesen.
Bea schob die beiden Kinder sanft zur Seite, entfaltete ihre Beine aus dem Schneidersitz und erhob sich, um den Neuankömmling zu begrüßen. „Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?“
Ein nicht unsympathisches Lächeln erleuchtete das Gesicht des Mannes, der nun Bea die Hand entgegenstreckte, um sich vorzustellen. „Quirinus. Mein Name ist Quirinus.“
Bea ergriff die Hand. Sie war außergewöhnlich kalt, doch seine Finger drückten angenehm fest zu. „Guten Tag, Herr Quirinus. Ich bin …“
„Oh! Nein. Quirinus ist mein Vorname. Ich halte mich nie mit meinem Nachnamen auf. Eine persönliche Basis ist immer ein guter Anfang für eine gute Nachbarschaft.“ Mit einer unbestimmten Geste winkte er in Richtung der Straße. „Ich habe am Ende der Straße jetzt auch einen Laden.“
„Ich wusste gar nicht, dass noch ein Geschäft leer gestanden hatte“, sagte Bea leicht erstaunt.
Quirinus lachte herzlich. Weshalb, konnte Bea nicht so recht ausmachen. Etwas umständlich kramte Quirinus in seiner Hosentasche. Bei diesem Manöver verschwand fast sein ganzer Unterarm darin. Es klimperte und raschelte dabei. Die Geräusche ließen darauf schließen, dass allerhand Zeugs an seinen Hosenbeinen mitreiste, obwohl man dies von außen nicht sehen konnte. Kurz darauf zog er eine Visitenkarte hervor und überreichte sie ihr mit den Worten: „Quirinus’ Kuriosum. Der Laden, in dem Sie alles finden, was Sie nicht zu suchen glaubten.“
„Ein ungewöhnlicher Name für einen …“
„… Mann“, unterbrach Quirinus gut gelaunt. „Aber ein besseres Aushängezeichen als Nachnamen wie Schmitz und Meier.“
„Eigentlich meinte ich Ihren Laden.“
„Der Laden, der ja auch meinen Namen trägt.“
Bea verzichtete darauf, die Augen zu verdrehen. Dass ihre Kundschaft manchmal etwas speziell sein konnte, war sie inzwischen gewohnt. Bibliophile und Sammler hatten mitunter recht anstrengende Eigenheiten. „Was kann ich für Sie tun?“
„Oh, was Sie für mich tun können? Streng genommen erst mal gar nichts. Aber allgemein betrachtet schon sehr viel. Wie man es nimmt.“ Quirinus plapperte einfach drauf los, während er förmlich durch den Raum zu tanzen schien. Bea erinnerte dieses Gehabe an eine Figur aus ihren Büchern, ohne, dass sie genau festmachen konnte, an welche. Erst sehr viel später würde ihr bewusst werden, welche Saite ihres Unterbewusstseins hier zum Schwingen gebracht worden war. „Zunächst einmal möchte ich nur vorstellig werden. Da wir ja hier im Viertel das gleiche Klientel bedienen, ist es doch sicher angenehm für Sie zu wissen, mit wem Sie es hier zu tun bekommen. Um es vorwegzunehmen: Ich werde Ihnen keine Konkurrenz machen. Sie dürfen weiter unbelästigt Ihre Bücher verkaufen und ich verkaufe die Meinen. Dabei werde ich sorgsam darauf achten, dass es nicht zu viele werden, die ich an den Mann oder die Frau bringe. Oder den geneigten Leser, wie man zu sagen pflegt.“ Die Formulierung, dass Bea seiner Meinung nach weiterhin Bücher verkaufen darf, war vielleicht nur halb so herablassend gemeint, wie sie klang, aber trotzdem blieb es eine ziemliche Unverschämtheit. Sich dessen vollkommen bewusst, schaltete Quirinus umgehend wieder auf sympathisch um. „Ich verkaufe eigentlich kaum Bücher. Aber allerhand Raritäten gibt es bei mir. Schallplatten, die man rückwärts abspielen muss, Chronomaten und Zeitstopper. Pendelbatterien und eine Internettaschenmaschine mit Multichrom-Monitor. Sie sollten mal bei mir reinschauen. Ich bin mir sicher, dass ich auch das Richtige für Sie finden werde.“ Nun machte er einen Satz in die Mitte der Kinder, wuschelte verspielt durch Annes Haare, nur um danach sogleich den Kreis wieder zu verlassen. „Aber wo ich schon mal hier bin, sollte ich mir vielleicht ein Buch aussuchen. Ich sollte mir eins kaufen. Ja! Das wäre eine tolle Idee.“ Er beugte sich hinter Kevin herunter, raunte in sein Ohr, als würden sie sich gemeinsam gegen Bea verschwören: „Das wäre voll krass!“
Dann ließ er seinen Blick über die Auslage schweifen. Auf einem Büchertisch, an höchster Stelle, fischte er nach einem braunen Paperback. Mit salopper Geste tat er plötzlich so, als würde er in einer nichtvorhandenen Brusttasche nach einem Monokel greifen und es sich vor sein Auge klemmen. „Hmm. Tja. Das hier kenne ich schon. War nicht so meins. Buchgeschichten! Ich bevorzuge in diesem Fall doch lieber einen Jasper Fforde oder – wenn es sprachlich etwas hochtrabender sein soll – einen Zafón. Außerdem: Man kann ein dickes Buch über den Tod lesen oder schreiben und trotzdem weiß man nichts vom Leben. Nicht wahr?“ Mit dem Finger tippte Quirinus auf den Namen ganz oben. „Beatrice Liber! Ich schätze mal, dass dieser Name ein Pseudonym ist. Vielleicht hat diese Story sogar ein Mann verfasst. Wer weiß? Aber der Zuname Liber … Das ist zu offensichtlich. Liber heißt unter anderem Buch. Das hier wäre somit ein Buch über Bücher, das von einem Buch geschrieben worden ist. Wie absurd.“
„Ich wusste gar nicht, dass ich das Buch hier im Laden stehen habe“, warf Bea ein. Inzwischen machte sich ein Gefühl der Unruhe in ihrer Bauchgegend breit. Diese hyperaktive Gestalt hatte etwas Unbestimmbares, etwas Unechtes an sich. Und wieso war ihr Buch hier im Antiquariat? Sie hatte sich doch ganz bewusst dazu entschieden, ihr eigenes Werk nicht selbst zu verkaufen. Es wäre ihr vorgekommen, als würde sie versuchen, Sauerbier unter die Leute zu bringen. Solche Autoren, die zu jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit darauf hinwiesen, dass sie ein Buch anzubieten hätten, gab es genug. Sie wollte keinesfalls dazu zählen.
Quirinus überging ihren Einwurf gänzlich. Dennoch hielt er kurz inne, legte den Kopf schief, als ob er lauschen würde. „Manchmal, wenn ich in Räumen mit so viel Literatur stehe, kommt es mir vor, als ob die Bücher wispern würden.“ In einem verschwörerischen Tonfall wandte er sich an Anne und ihre Sitznachbarin: „Hört ihr das auch?“
Bea kniff misstrauisch die Augen zusammen. Wispernde Bücher. Was für ein Spiel wurde hier gespielt? „Sind Sie ein Auktoral?“, entfuhr es Bea.
„Was?“ Quirinus war mit zwei langen Schritten bei ihr. „Was haben Sie gesagt? Auktoral? Nein, das bin ich nicht. Ich bin Quirinus. Hab’ mich doch eben vorgestellt … Wie war nochmal Ihr werter Name?“
„Beatrice“, sagte Bea. Ihr Hals wurde plötzlich ganz trocken. Sie krächzte fast, als sie ihren Namen ganz aussprach. „Beatrice Liber.“
„Ja ups! Da habe ich ja ein kleines Fettnäpfchen erwischt.“ Quirinus warf noch einen kurzen Blick auf das Buch in seiner Hand, gluckste vergnügt und legte es dann auf eine englische Originalausgabe von Peter und Wendy.
Der Tanz durch das Antiquariat endete jäh. Der ungewöhnliche Besucher schien sich seines Outfits zu erinnern. Die Körperhaltung ähnelte unvermittelt einem Fragezeichen und die eben noch wild gestikulierenden Hände verschwanden in der Bauchtasche des Kapuzenshirts. „Leserunde mit Kindern, was?“
„Ja. Einmal die Woche immer um die gleiche Zeit“, erklärte Bea mechanisch. Sie hatte plötzlich den unbestimmten Drang, ihn möglichst schnell loszuwerden. „Aber ich vermute, dass Sie nicht in diese Altersgruppe passen werden.“
„Ich?“ Quirinus lachte erneut. „Nein. Beileibe nicht. Andererseits … Vielleicht darf ich meine … ähm …“ Egal, wen er gerade anmelden wollte: Er war sich über seine verwandtschaftlichen Beziehungen dazu nicht sicher. Hier improvisierte jemand ganz eindeutig, mehr schlecht als recht, seine Rolle in einer billigen Komödie. „… ähm … meine … meine Cousine bei Ihnen unterbringen?“
„Cousine“, wiederholte Bea und zog unmissverständlich eine Augenbraue hoch. „Sie sind also hier, um Ihre Cousine für die Leserunde bei mir anzumelden. Wollten Sie sich nicht eben erst nur als neuer Nachbar vorstellen?“
„Scharfsinnig beobachtet! Die Idee mit meiner … Cousine kam mir gerade. Vielleicht darf ich sie Ihnen kurz vorstellen?“
Beas Augenbraue wanderte wieder nach unten, weil sie die Stirn krauszog. „Sie haben Ihre Cousine mit dabei?“
In Quirinus’ Körper zeigte sich erneut Leben. Allerdings ohne die für andere unhörbare Musik in den Knochen. Er schlurfte zur Tür, ließ den Hals dabei nach vorne wippen und parodierte auf diese Weise perfekt eine Comicfigur. ‚Goofy geht nach Entenhausen‘, durchfuhr es Bea bei diesem Anblick.
Die Ladentür öffnete sich. Die Ladentür schloss sich. Dann war Bea mit den Kindern wieder allein.
„Was war das denn für ein Affe?“, fragte Kevin.
„Affe?“ Anne reckte ihren Hals, um den Fremden durch das Schaufenster zu beobachten. „Mir kam er mehr wie eine Ziege vor. Er springt und hüpft die ganze Zeit über.“
Ronald schüttelte den Kopf. „Er hat doch nicht gemeckert.“
„Hab’ ich ja auch nicht behauptet.“ Anne knuffte Ronald in den Oberarm. „Aber er bewegt sich so.“
„Wo ist er hin?“, fragte Kevin. Er war inzwischen aufgestanden und blickte über die Auslage hinweg auf die Straße. Weder zur einen noch zur anderen Seite konnte er Quirinus entdecken. „Wie vom Erdboden verschluckt“, stellte der Junge verblüfft fest. Jedoch just in dem Augenblick, als er sich zu Bea umwandte, öffnete sich die Tür und Quirinus war wieder da.
Neben ihm stand unscheinbar ein Menschlein. Anders hätte es auf den ersten Blick niemand bezeichnen können. Bei genauerer Betrachtung erkannte man, dass es sich um ein kleines, unproportioniertes Mädchen handelte. Die winzig kleinen Füße steckten in schwarzen Ballerinas. Darüber streckten sich spindeldürre Beinchen in die Höhe. Doch sie endeten viel zu früh in einem knabenhaften Leib, der von einem schlichten, an einen grauen Sack erinnerndes Kleidchen bedeckt wurde. Der etwas zu große Kopf, getragen von einem dünnen, kurzen Hals, war bewachsen von schwarzem Gestrüpp, das mehr einem Reisighaufen ähnelte als Haaren. Riesige Augen, so blau wie der Himmel, schauten in einer beinahe ausdruckslosen Melancholie aus dem Gesicht. Nur die überaus süße Stupsnase verdiente irgendwie das Wort hübsch.
Da niemand ein Wort sprach, entstand eine peinliche Stille. Bea beschloss, dass sie diese Lücke schließen musste. Sie ging behutsam in die Hocke und fragte das Kleine: „Na, wie heißt du denn?“
Das Mädchen antwortete nicht, wich aber einen Schritt zurück. Bea fiel allerdings sofort auf, dass das Mädchen keinen Schutz hinter Quirinus suchte. Ganz im Gegenteil: Es hielt reichlich Abstand.
„Fremdelt ein wenig“, erläuterte Quirinus fröhlich und zog das Kind zu sich heran. Väterlich legte er die Hand auf dessen Schulter. Diese Geste wirkte ziemlich aufgesetzt. Ohne Gegenwehr, aber auch ohne jegliche Emotion, ließ sich das Kleine an sein Bein heranziehen, schmiegte nun sogar seinen Kopf an Quirinus’ Oberschenkel. „Aber vermutlich wird sie nach der ersten Lesestunde auftauen.“ Quirinus strich etwas unbeholfen über ihre Haare. Dann, fast wie zufällig, schaute er auf seine Armbanduhr und rief: „Ach, schon so spät? Ich muss doch ins Geschäft. Ich erwarte eine wichtige Lieferung. Hermeias – äh – Herr Meier bringt mir heute einige Kisten Rucksackgrammophone. Sehr nützlich! Sie sollten sich unbedingt auch eins zulegen, Frau Liber! Immerhin kann man damit, egal wo man gerade ist, die eigene Musiksammlung anhören. Jedem Käufer spendiere ich gratis ein paar weiße Lautsprecher dazu. Ein Angebot, das man kaum ausschlagen kann. Schauen Sie mal vorbei.“
Während er sprach, hatte er bereits den Rückwärtsgang eingelegt. Mit dem letzten Wort hatte er die Tür erreicht und mit dem Punkt am Ende des Satzes war er schon auf die Straße entschwunden. Einsam zurückgelassen stand einzig noch das Mädchen.
„Herr Quirinus! Die Leserunde ist doch …“, rief Bea ihm nach. Als ihr bewusst wurde, dass der Mann schon außer Hörweite war, brachte sie ihre Rede leiser zu einem Ende: „… fast vorbei.“
Es blieb nur eine Viertelstunde, die sie gemeinsam mit Lyra und Pantalaimon im Oxford einer fremden Welt verbrachten. Während Bea vorlas, schaute sie manchmal verstohlen über den Rand der aufgeschlagenen Seiten. Das Kind, das Quirinus bei ihr buchstäblich geparkt hatte, saß still und stumm zwischen den anderen im Schneidersitz. Vollkommen reglos, die Hände im Schoß gebettet, ließ sie sich von der Geschichte berieseln.
Sie schafften ein Kapitel, dann kamen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Dabei schwatzten sie ein oder zwei Sätze mit Bea und kauften sogar ein paar Bücher. Das geschah mehr aus Höflichkeit, denn Bea nahm nichts fürs Vorlesen. Es war so eine Art indirekte Bezahlung für ihre Mühen.
Schließlich blieben nur das Mädchen und Bea zurück. „Tja, Liebes. Jetzt wüsste ich schon gerne, wann dein … Cousin …“ Mann, was hörte sich das falsch an! „… vorhat, dich abzuholen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt.“
Rachel, durchfuhr es Bea. Rachel wäre jetzt ungefähr im Alter von diesem Kind. Wie kam sie denn jetzt da drauf? Dieser Gedanke war wie eingepflanzt. Ein fremdes, namenloses Mädchen würde sie bestimmt nicht automatisch wie ihre verstorbene Tochter nennen. „Wie heißt du?“
Eine Antwort blieb das Mädchen schuldig. Es schaute an Bea vorbei in den benachbarten Raum.
„Das ist das Arbeitszimmer“, erklärte Bea.
Das Mädchen ging nach nebenan, ohne um Erlaubnis zu fragen, und Bea blieb keine andere Wahl, als ihr zu folgen. „Das ist das Arbeitszimmer“, sagte Bea noch einmal. Sie kam sich etwas hilflos vor. Was sollte sie mit einem Kind reden, das ihr nicht antworten wollte?
Das Arbeitszimmer war das Herzstück des Antiquariats und Beas Allerheiligstes. Nie ließ sie Kundschaft in diesen Raum kommen. Na ja, eigentlich auch sonst niemanden. Der Einzige, der hier vielleicht hineingedurft hätte, wäre Ingo gewesen. Doch ihr Mann mied das Antiquariat. Er überquerte nicht mal die Türschwelle des Ladens. Irgendwie konnte sie es ihm nicht verübeln. Denn die vergangenen Ereignisse in diesen Räumen waren für ihn in einen Nebel des Unbegreiflichen gehüllt. Was damals mit ihm, mit ihr, mit Herrn Plana und dem Buchland geschehen war, war für ihn vermutlich am leichtesten zu ertragen, indem er es ignorierte oder sogar vergaß. Fakt war, dass sie nun wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden standen. Fakt war allerdings auch, dass sie dies diesem besonderen Antiquariat zu verdanken hatten.
Seit Herrn Planas Tod war hier fast alles unverändert geblieben. Links von Bea stand der Ohrensessel. Geradeaus von ihr war eine Tür, die zum Keller führte, daneben die Tür, die die Stiege ins Obergeschoss verbarg. Überdies gab es einen Sekretär, dazu einen Bürostuhl und ansonsten nur Bücher. Übervolle Regale verbargen alle Wände und erhoben sich bis unter die Decke. Und zwischen den beiden Türen befand sich ein großer runder Drehschalter, der verblüffende Ähnlichkeit mit einem Schiffstelegraphen aufwies.
Das Mädchen ging zu diesem Apparat und legte sachte die Hand auf den Hebel.
„Es wäre mir lieber, wenn du nicht damit rumspielst“, sagte Bea nervös. Warum war sie nur so angespannt? „Das ist nichts für Kinder.“
Als es plötzlich klingelte, schrak Bea gehörig zusammen. Sie fuhr herum und eilte zum Sekretär, auf dem das uralte Telefon lautstark ein akustisches Inferno anzettelte. Sie hob den Hörer von der Gabel, während ihr das Herz bis in den Hals hämmerte. „Buchantiquariat Liber, guten Tag.“
Ein Klackern am anderen Ende des Raumes erklang.
„Hallo Frau Sechtig“, sagte Bea freundlich.
Eine Mechanik wurde ratternd in Gang gesetzt.
„Das freut mich“, erwiderte Bea ziemlich gehetzt. Sie spürte, dass hinter ihrem Rücken etwas geschah, das nach ihrer Beachtung verlangte.
„Ja, das mag sein. Aber ich habe doch schon in meinem Schreiben darauf aufmerksam gemacht, dass …“
Ein dumpfes „Klonk“ ertönte. In einer Apparatur rasteten Zahnräder ein.
„Nein, wie ich bereits sagte: Eine Fortsetzung des Buches hatte ich nie geplant. Fantasy muss doch nicht immer in Serie produziert werden. Ich finde Fortsetzungen blöd.“
Die nachfolgende Stille war alles andere als beruhigend.
„Nein, über dieses Setting gibt es nichts mehr zu berichten.“
Bea drehte sich, während sie sprach, langsam um.
„Sobald ich wieder etwas schreiben sollte, werde ich es Ihnen mitteilen.“
Der Hebel des Maschinentelegraphen stand ganz vorne. Die Tür zum Keller war offen. Das Mädchen war verschwunden.
„Nein, in die Buchland-Story werde ich bestimmt nicht nochmal eintauchen“, stöhnte Bea, verabschiedete sich eilig, warf den Hörer scheppernd auf die Gabel und rannte dann, so schnell sie konnte, die Treppe hinunter.
Kuriose Ereignisse
Der Keller empfing Bea mit muffiger Dunkelheit. Es roch nach trockenem, sehr altem Papier. Sie sog das eigenwillige Parfum des Buchlandes tief in sich ein. Es war jedes Mal wie Heimkommen. Sie war ein Teil hiervon, untrennbar verbunden mit diesen Regalen, Gedanken, Ideen, Phantasien. Hier gab es Literatur, die sich bis in die Unendlichkeit erstreckte und Gefühle, die sich selbst über diese Unendlichkeit hinwegsetzten.
Sie drehte den Lichtschalter und die Glühbirnen traten alsdann leidlich ihren Dienst an. „Mädchen? Wo bist du?“ Bea bekam keine Antwort. Ihr Echo wurde von Holz, Leder und Kartonagen verschluckt. Im Labyrinth der unzähligen Gänge hatte Bea kaum eine Chance die Ausreißerin zu finden. „Mädchen?“ Ihr Ruf verhallte.
Bea hatte vor einiger Zeit einen altmodischen Kleiderständer neben dem Treppenaufgang platziert. An dessen Haken hingen ein olivgrüner Armeerucksack, eine graue Strickjacke und ein Jutebeutel. Aus diesem fischte sie eine besonders dicke Garnrolle und eine Taschenlampe, die so groß und leuchtstark war, dass man damit den Weihnachtsmann im Landeanflug hätte einlotsen können – und zwar im dichtesten Nebel ohne Rudolph im Gespann.
Routiniert verknotete Bea nun ein Garnende mit dem Kleiderständer, warf sich den Jutebeutel über die Schulter und machte sich aufs Geratewohl auf ins vorerst Ungewisse.
„Habt ihr eine Ahnung, wo die Kleine steckt?“ Ein unbedarfter Beobachter hätte sich gefragt, warum Bea anscheinend mit sich selbst sprach. Allerdings hätte dieser unbedarfte Beobachter auch nicht gesehen, dass am vorausliegenden Kopfende des ersten Ganges auf der rechten Seite ein Oktav-Band aus seiner Reihe hervorstand. Im Vorbeigehen drückte Bea ihn wieder zurück an seinen Platz und bog dann rechts ab. Dabei achtete sie sorgsam darauf, dass sich das Garn in ihrer Hand weiter entrollte. „Wo will das Kind nur hin?“, fragte sie in die Stille hinein. Kurz danach hörte sie ein dumpfes Pochen. Im Strahl der Taschenlampe, die sie eben eingeschaltet hatte, erkannte sie ein Buch, das in einiger Entfernung auf dem Boden lag. Als sie bei ihm ankam, las sie die blasse Überschrift: „Mors porta vitae“. Beas Knie wurden weich und in ihrem Magen befanden sich plötzlich Steine, denn sie wusste nun, wohin sie zu gehen hatte.
In die Wand eingelassen, am Ende einer der vielen Gänge, war eine eiserne Tür. Ornamente zogen sich am Rand entlang und kunstvolle Symbole füllten die Fläche dazwischen. Darüber prangten wuchtig die mittelalterlichen Zeichen „Vita“ und „Mors“.
Das Mädchen stand vor der Tür, legte den Kopf weit in den Nacken, um den oberen Bogen zu betrachten. Dann machte es aus seiner kleinen Hand eine Faust und klopfte so fest es konnte an. Dabei entstand kein hörbares Geräusch. Das Metall war zu alt, zu stumpf, zu schwer und zu anders, als dass es von dieser unschuldigen Kinderhand zum Klingen gebracht werden konnte.
Dennoch vergingen kaum fünf Sekunden und ein Türflügel öffnete sich. Es war nur ein kleiner Spalt. Den Kopf im Dunkel einer schwarzen Kapuze verborgen, beugte sich jemand heraus und schaute kurz in alle Richtungen. Dann, als die Gestalt das kleine Mädchen sah, kniete sie sich hin.
Sie fragte: „Es?“
Das Mädchen antwortete: „Ich.“
„Du?“
Das Mädchen nickte.
Eine Knochenhand tauchte unter der Kutte hervor. Darin befand sich ein in Leder gebundenes Buch. Wortlos nahm das Mädchen es entgegen.
„Du“, sagte die Gestalt. Das klang sehr, sehr nachdenklich.
Auf dem Boden lag ein halbes Dutzend dicker, schwerer Bücher wild verstreut. Das unterste Brett des angrenzenden Regals war leer. In diese Leere hatte sich das Mädchen hineingequetscht und wartete im Halbdunkel auf das Licht, das unstet hin und her raste und sich dabei rasch näherte. Als der Strahl der Taschenlampe das Mädchen fand, heftete er sich auf sie, bis Bea völlig außer Atem ankam. „Verdammt, was tust du mir an? Du kannst doch nicht einfach allein in den Keller gehen. Hier unten kannst du dich verlaufen.“
Bea ließ den Lichtkegel zum Tor gleiten. Verschlossen. „Puh“, machte sie erleichtert. „Und ich dachte schon, dass …“ Sie unterbrach sich, brachte ein mühsames Lächeln zustande. „Da hätte ich deinem Cousin ganz schön was zu erklären gehabt.“
Zaghaft hauchte das Mädchen: „Er ist nicht mein Cousin.“
Bea riss verblüfft die Augen auf. „Du kannst ja doch sprechen.“
Auf diese Feststellung bekam sie allerdings keine Antwort. „Vielleicht magst du mir verraten, wie du heißt, kleine Prinzessin.“
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
Bea stemmte kurz die Hände in die Hüften, seufzte theatralisch, griff dann dem Kind unter die Arme und zog es aus dem Regal. Wie eine Spielzeugpuppe ließ die Kleine es geschehen. Die Arme und Beine baumelten dabei, als ob sie keine Knochen hätten. Erst als die Füßchen den Boden berührten, straffte sich der Körper wieder.
„Was hältst du davon, wenn ich uns auf den Schrecken ein Eis spendiere? Und dann bringe ich dich zum Kuriositätenladen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag bei mir bleiben. Als Gegenleistung fände ich es ziemlich toll, wenn unser Ausflug nach hier unten unser kleines Geheimnis bliebe.“
Bea hatte es nicht anders erwartet: Der Rückweg ins Antiquariat verlief schweigend. Das namenlose kleine Etwas hatte ihr die Hand gereicht und folgte ihr widerstandslos durch das Wirrwarr der Gänge; immer entlang der Garnschnur. Dabei machte sich Bea nicht die Mühe die Schnur wieder aufzurollen. Sie hatte insgeheim beschlossen, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zur Pforte zurückzukehren. Dem Buchhalter, den sie dahinter antreffen könnte, wollte sie zwar – wenn es sich vermeiden ließ – nicht begegnen, aber es konnte nicht schaden, sich dort umzuschauen. Manchmal verraten Bücher Geheimnisse, die man gar nicht zu ergründen versucht.
Dann kam die Treppe und schließlich das Antiquariat. Im Vorbeigehen griff Bea nach ihrer Jacke und schon schlenderten sie und das Mädchen Richtung Eisdiele, nachdem das Schildchen „vorübergehend geschlossen“ in der Tür platziert worden war.
„Was magst du? Schokolade? Erdbeere? Vanille?“ Es gab nur ein unbestimmtes Schulterzucken von dem Mädchen. Also bestellte Bea einfach zwei Mal alle drei Sorten, drückte dem Kind das eine Hörnchen in die Hand und widmete sich dem anderen. Der freundliche Eisverkäufer bekam zu seinem Geld auch ein freundliches Lächeln. Dieser hätte vermutlich genauso herzlich zurückgelächelt, wäre er nicht so sehr damit beschäftigt gewesen, das Kind anzustarren. Irritiert folgte Bea seinem Blick.
„Lutschen“, erklärte Bea, „meinetwegen auch lecken. Aber nimm bitte die Finger raus.“
„Stimmt was nicht mit Ihrer Tochter?“, fragte der Eisverkäufer. Etwas Mitleidiges lag in seiner Stimme.
„Oh“, machte Bea, „das ist nicht meine Tochter. Sie ist nur zu Gast.“ Sie hatte es kaum ausgesprochen, da fühlte sie sich leicht verlegen. Selbst in ihren Ohren hörte es sich abwiegelnd und entschuldigend an. Leider machten ihre nächsten Worte die Situation nicht besser. „Aber wir verstehen uns gut. Fast so wie dicke Freunde, obwohl ich nicht mal weiß, wie sie heißt.“ Das angefügte „Hi, hi“ wurde dann erst recht peinlich. Deshalb zog sie es vor, das Kind rasch weiterzuschieben. Der Eisverkäufer schüttelte verständnislos den Kopf.
„Chaya“, sagte das Mädchen unvermittelt. Danach tastete sie vorsichtig mit der Zungenspitze das oberste, rosafarbene Eisbällchen ab.
Bea wäre beinahe ihr Hörnchen aus der Hand gefallen. „Was hast du gesagt?“
„Chaya.“ Erdbeergeschmack zauberte einen überraschten Gesichtsausdruck in das ansonsten so leblose Gesicht des Mädchens.
„Schaia?“, fragte Bea nach. Langsam dämmerte es ihr.
„Dann brauchst du mich nicht mehr Das zu nennen. Chaya bedeutet unter anderem lebendig.“ Chaya fand ganz offensichtlich Gefallen an dieser speziellen Bedeutung. Sie nickte sich selbst zu, als sie ihr Spiegelbild in einem Schaufenster erkannte. „Chaya!“ Es klang geradezu wie ein Schlachtruf. In einem Anflug von Übermut nahm sie daraufhin das gesamte Erdbeereisbällchen mit einem Happen in den Mund. Die nächste Reaktion war ein schmerzerfülltes Zusammenzucken, weil sie feststellte, dass das Schlucken zu großer Mengen kalter Lebensmittel recht unangenehm sein kann.
„Mädchen, hast du noch nie Eis gegessen?“, fragte Bea erstaunt.
„Chaya“, wiederholte Chaya keuchend, „das Mädchen heißt Chaya.“
Als sie den Kuriositätenladen am unteren Ende der Straße erreichten, versuchte Bea mit einem Taschentuch und mäßigem Erfolg, das Gesicht der Kleinen vom Eis zu befreien. „Chaya, ich denke, dass das mit dem Eis vielleicht keine so gute Idee gewesen ist. Dein … Quirinus … wird nicht begeistert sein, dich so verklebt zu sehen.“
Etwas bang betrachtete sie das Geschäft, mit der rot-weiß gestreiften Markise. In dem eigenwillig dekorierten Schaufenster fanden sich Baseballkarten, Blechspielzeuge und Dampfmaschinen neben einer alten Wurlitzer und einigen vergilbten Briefmarkenalben, in deren aufgeschlagenen Seiten ebenso vergilbte Briefmarken eingesteckt waren. Zylinder und Zauberstäbe, ein Strauß mit ziemlich lädierten Strohblumen und Uhren. Unzählige Uhren! Taschenuhren, Armbanduhren, Wecker, Tischuhren und, und, und.
Das Innere des Ladens präsentierte sich wie erwartet: Muffig und schlecht beleuchtet. Bea fragte sich, wie es möglich war, dass bereits über allen Exponaten eine dünne Staubschicht lag, obwohl die Sachen erst seit zwei Tagen in den Regalen liegen konnten.
„Kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Ein Verkäufer – nicht Quirinus – trat ihnen entgegen. Seine Erscheinung passte nicht ganz in das Gesamtbild. Er war jung, freundlich und gut gekleidet. Bea hätte als Einstellungsbedingung eigentlich das absolute Gegenteil erwartet. Zwischen ausgestopften Eberköpfen, etwas, das nach einem ausrangierten Blasebalg für eine gigantische Mundharmonika aussah, einem Hochrad und zahlreichen anderen Exponaten wirkte der Mann so deplatziert wie Kaviar auf Sauerkraut mit Schokoladensoße. „Schauen Sie nach etwas Speziellem oder stöbern Sie nur? Ich könnte Ihnen ein paar Raritäten aus dem Ersten Weltkrieg zeigen. Oder lieber Antiquitäten aus der Renaissance?“
„Chaya“, sagte Bea etwas überrumpelt.
Der Verkäufer blinzelte verwirrt. „Wie bitte?“
Bea schob das Mädchen sachte vor sich. „Ich bringe Chaya heim. Herr Quirinus hat vergessen, sie bei mir abzuholen.“
Der Verkäufer nickte wie ein Butler, warf die Hände hinter den Rücken und eilte durch eine Seitentür davon. Irgendwo rumpelte es laut, stampften schwere Schritte eine Metalltreppe hinab. Um einiges leichtfüßiger erstiegen Schritte wieder jene Treppe zurück nach oben. Kurz darauf öffnete sich die Tür und Quirinus stand vor ihnen.
Nein, er stand nicht wirklich. Er tänzelte auf der Stelle. Irgendwie war immer mindestens ein Bein oder ein Fuß in Bewegung. Sein Körper vibrierte förmlich zu den Melodien einer unhörbaren Musik. Es wirkte auf groteske Art elegant und verspielt zugleich. Doch schließlich pendelte das Bewegungsmoment in ihm aus und sein Körper kam zur Ruhe.
„Cousinchen!“, rief er und breitete dann wie ein schlechter Theaterdarsteller die Arme aus um eine andere Schauspielerin, die er vermutlich nur von der Bühne her kannte, gespielt herzlich in die Arme zu nehmen. „Chaya hat noch ein Eis mit mir gegessen“, sagte Bea.
„Chaya?“
„Chaya.“
„Ach. Chaya!“ Er legte den Kopf schief und betrachtete das Kind eingehend von oben bis unten. „Ein schöner Name, nicht wahr? Es ist ein indischer Name, oder?“
Für Beas Geschmack waren in den letzten Aussagen ihres Gegenübers eindeutig zu viele Fragezeichen. Ihr Misstrauen bezüglich dieses seltsamen Kauzes wuchs von Minute zu Minute. Vielleicht würde es nicht schaden, mal die tatsächliche Bedeutung des Namens Chaya zu recherchieren.
Quirinus schien in ihren Augen zu lesen und beschloss daraufhin eilig das Thema zu wechseln. „Wo Sie gerade hier sind: Möchten Sie sich mal in meinem Reich umsehen? Es gibt hier bestimmt einige spezielle Schaustücke, die auch Ihr Interesse wecken könnten.“
Bea bedachte den ausgestopften Eberkopf mit ungeschminkter Geringschätzung. Ihre Ironie konnte sie auch kaum verbergen. „Ich bin schon ganz neugierig. Aber …“ Sie schob demonstrativ den Ärmel hoch und deutete auf ihre Armbanduhr. „Ich muss zurück in meinen Laden.“
„Ach, kommen Sie!“ Quirinus drückte Chaya zur Seite und packte Bea bei der Hand. Wie ein Verliebter, der mit seiner Angebeteten in den Siebten Himmel flüchten wollte, zog er sie durch eine Tür in einen angrenzenden Raum. „Photos“, rief er. Bea hatte keine Ahnung, wie er es schaffte, dass man das „Ph“ so deutlich hören konnte. Doch der Unterschied zum folgenden Satz war eindeutig. „Und Fotos gibt es hier auch. Zusätzlich gibt es hier auch noch Fotografien.“ Er lachte.
Das Licht war um ein Vielfaches trüber. Die Luft selbst atmete einen Hauch von Sepia. Aber Quirinus hatte nicht übertrieben: Beas Interesse war geweckt. Dieser Raum präsentierte sich als eine Hommage an die Ikonographie. Die Regale, die sich wie in ihrem Bücher-Antiquariat bis unter die Decke hoben, waren überfüllt mit Rahmen und kartonierten Bildern. Alben und Kartons drängten sich dazwischen. Außerdem gab es allerhand Tische, auf denen Kameras, Projektoren und Entwickler mehr oder minder dekorativ angeordnet waren. Die Geräte stammten aus allen möglichen und unmöglichen Epochen. Ein Fotoapparat schien Herrn Feuerstein gestohlen worden zu sein.
„Ich finde, dass Fotos etwas ganz Besonderes sind. Diese alten Papierzeugen sind ebenso kostbar wie Ihre alten Bücher. Sie sind nicht zu vergleichen mit der digitalen Welt, die heutzutage von jedem Billighandy abgelichtet wird.“
Bea bewies sich als gehorsamer Stichwortgeber. „Warum?“
Quirinus lächelte. „Schauen Sie sich dieses alte Foto an. Es ist ungefähr 100 Jahre alt. Schwarz und weiß. Von dieser Familie mit dem gestrengen Patriarchen gibt es nur noch diese eine Abbildung. Ich möchte wetten: Jeder Angehörige der Sippe hat weit mehr als nur einmal einen Blick darauf geworfen. Unzählige Male hat es sich in die Gedächtnisse eingebrannt. Es ist zu einem Stück Familiengeschichte geworden. Wenn heute jemand ein entsprechendes Foto macht und es im Internet teilt, wird es für den Augenblick vielleicht tausendfach wahrgenommen. Aber in einer Stunde haben es bereits alle wieder vergessen. Was ist schon ein Foto, wenn jeder Depp täglich zwanzig Bilder macht? Mancher teilt sogar seine Portion Pommes mit Majo im Web.“
„Sie erinnern mich an einen alten Herrn, den ich mal kannte“, merkte Bea an. „Er hatte eine sehr ähnliche Meinung. Jedoch in Bezug auf Bücher.“
Quirinus lächelte hinterlistig. Wie dieser Ausdruck zu deuten war, verriet er allerdings nicht. Stattdessen dozierte er weiter. „Bücher! Ja. Ich habe auch einen Verkaufsraum für Bücher.“ Er stellte das Foto halbwegs sorgsam zurück an seinen Platz im Regal. „Kommen Sie!“ Er führte Bea in den benachbarten Raum. Der war ebenso groß, ebenso angeordnet und ebenso chaotisch bestückt. Doch die Thematik der Ausstellungsstücke hatte nichts mehr mit Fotografie zu tun. Es waren ausnahmslos …
„… Bücher!“, rief Quirinus. „Ich habe zwar noch lange kein lückenloses Sortiment, so wie Sie. Aber das gedruckte Wort wird bestimmt irgendwann zu einem Kuriosum. Dann gehört es gänzlich in meine Lokalität. Alles, was mit Kultur zu tun hat, erlebt in diesen Tagen eine wahre Inflation, denke ich.“ Eine kurze Pause folgte. „Wie hieß denn der weise Mann, den Sie vorhin erwähnten?“
„Das war Herr Plana.“
„Herr Plana?“ Quirinus kicherte spitzbübisch. „Ich kannte ihn. Nicht gerade ein Sympathieträger, der Gute. Aber ich mochte ihn trotzdem. Er war ein bisschen wie ich. Aber alles in allem war er mir zu – wie sagt man? – moralin. Philosophie ist was für Leute, die zu viel Zeit haben. Ich habe nie Zeit.“
„Sie kannten ihn? Sie meinen bestimmt, Sie kennen ihn aus meinem Buch, oder?“
„Aus Ihrem Buchland?“ Quirinus begann wieder damit, auf der Stelle zu tänzeln. Irgendetwas erheiterte ihn auf das Heftigste.
„Ja“, sagte Bea ungeduldig, „ich bin die Schriftstellerin.“
„Oh, Sie dürfen sich schon Schriftstellerin nennen? Oder sind Sie vielmehr noch eine Autorin? Ein Buch allein macht per Definition doch noch keinen Schöngeist.“
Beinahe hätte Bea ein unartikuliertes „Häh?“ von sich gegeben. Es geriet zu einem unterdrückten Schnauben.
Quirinus kratzte sich am Hinterkopf. „Wie soll ich es erklären? Vielleicht so: Sie atmen. Das kommt von ganz allein. Sie müssen es zwar tun, aber Sie denken für gewöhnlich nicht darüber nach. Eine unbewusste Handlung Ihres Körpers.
Eines Tages – und ich will nicht behaupten, dass dies ein Glückstag für Sie sein wird – werden Sie genau so unbewusst Literatur im Kopf haben. Alles, was um Sie herum passiert, werden Sie dann im Geiste mit Worten ausformulieren. Sie werden bei jedem Gespräch, das Sie führen, überlegen, wie diese Szene Ihres Lebens in einem Buch lauten würde. Dann beschreiben Sie wortgewandt, was Ihr Gegenüber tut, wie es aussieht, obwohl Sie es direkt vor sich stehen sehen. Und jedem Moment, jeder Situation, der Sie sich stellen, begegnen Sie mit der Frage: Was wäre wenn?
Das wird geschehen. Nicht, weil Sie es so wollen. Nicht, weil Sie es können. Nicht, weil Sie es müssen. Sie werden es einfach tun. Genauso wie Sie gerade atmen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden.
Wenn es so weit ist, dann kennen Sie den Unterschied zwischen einem Autor und einem Schriftsteller.“