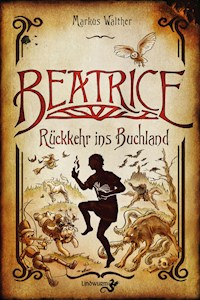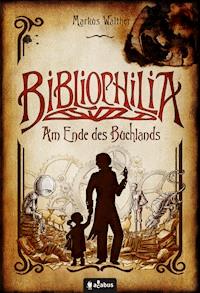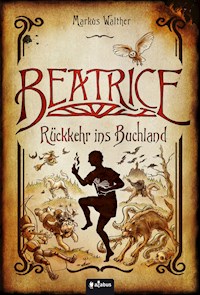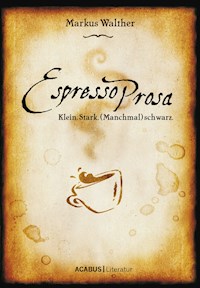Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Buchland
- Sprache: Deutsch
"Das Buchland im Keller unter uns ist unglaublich viel mehr, als diese Aneinanderreihung von gefüllten Regalen. Dort findet man billige Klischees, abgedroschene Fantasien und halbe Wahrheiten direkt neben den großen göttlichen Ideen, die die Welt veränderten. Die ganze Kreativität der Menschheit." Dieses Antiquariat ist nicht wie andere Buchläden! Das muss auch die gescheiterte Buchhändlerin Beatrice feststellen, als sie notgedrungen die Stelle im staubigen Antiquariat des ebenso verstaubt wirkenden Herrn Plana annimmt. Schnell merkt sie allerdings, dass dort so manches nicht mit rechten Dingen zugeht: Wer verbirgt sich hinter den so antiquiert wirkenden Stammkunden "Eddie" und "Wolfgang"? Und welche Rolle spielt Herr Plana selbst, dessen Beziehung zu seinen Büchern scheinbar jede epische Distanz überwindet? Doch noch ehe Beatrice all diese Geheimnisse lüften kann, gerät ihr Mann Ingo in große Gefahr und Beatrice setzt alles daran, ihn zu retten. Zusammen mit Herrn Plana begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch das mysteriöse Buchland. Dort treffen sie nicht nur blinde Buchbinder, griechische Göttinnen und die ein oder andere Leseratte, auch der Tod höchstpersönlich kreuzt ihren Weg. Und schon bald steht fest: Es geht um viel mehr, als bloß darum, Ingo zu retten. Vielmehr gilt es, die Literatur selbst vor ihrem Untergang zu bewahren! Markus Walther, der Autor der Kurzgeschichtensammlungen "EspressoProsa" und "Kleine Scheißhausgeschichten", entführt den Leser nun mit seinem ersten Roman in die phantastische Welt des Buchlandes. Ein Muss für jeden Bibliophilen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Walther
Walther, Markus: Buchland, Hamburg, ACABUS Verlag 2013
Originalausgabe
PDF E-Book: ISBN 978-3-86282-187-7
Epub E-Book: ISBN 978-3-86282-188-4
Print: ISBN 978-3-86282-186-0
Lektorat: Berit Liedtke, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: © Petra Rudolf
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
______________________________
© ACABUS Verlag, Hamburg 2013
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für mein Nugget
mein Goldstück
und
meinen Schatz
„Am Anfang stand das Wort.“
Vom Gewicht der Worte
Die Bücher um mich herum, die sich unter einem staubigen Mantel zu verbergen suchten, schienen leise zu wispern. Sie erzählten sich ihre Geschichten, während sie darauf warteten, einen unschuldigen Leser zu finden, in den sie ihre Saat pflanzen konnten.
Sie offenbarten Welten, die für kommende Generationen eingefangen und ihnen zwischen die Seiten gepresst worden waren. Sie verschenkten gerne die Gedanken, die bedeutungsschwer mit Tinte aus der Feder geflossen waren.
Ich selbst saß an meinem Sekretär, hatte einen großen Folianten aufgeschlagen und folgte den handgeschriebenen Zeilen mit meinem Zeigefinger. Der weiße Stoff des Handschuhs trennte meine Haut von dem Pergament.
Buchstaben, Worte, Zeilen. Sie entführten mich in eine andere Zeit, lange vergangen.
Die Türglocke läutete und nur widerwillig riss ich mich von meiner kostbaren Lektüre los. Ich griff nach meinem Stock und mühte mich nach vorne in den Verkaufsraum. Die Sonne strahlte hell durch das Schaufenster herein und im Gegenlicht konnte ich nur die Silhouette der Frau erkennen, die nun vor dem Tresen stand. Hochgewachsen und nicht zu dünn. Recht attraktiv für eine Frau mittleren Alters.
Mein Blick streifte kurz das Zifferblatt der Wanduhr. Genau neun Uhr.
„Guten Morgen, Frau Liber. Schön, Sie kennenzulernen.“
Ich reichte ihr meine Hand zum Gruß, während sie noch ein wenig erstaunt dreinblickte. Bevor sie fragen konnte, sagte ich vergnügt: „Pünktlich auf die Minute. Das zeugt von Verlässlichkeit. Das ist doch schon mal vielversprechend.“
Mit einem Lächeln legte sie ihre Verwunderung ab. Es war, als würde die Sonne gleich noch einmal so hell den Raum erfüllen. „Dann müssen Sie Herr Plana sein.“ Und als ich ihr abwartend keine Antwort gab, fügte sie unsicher ein „Guten Tag“ hinzu.
Der Weg bis zur Ladentür war zehn schmerzhafte Schritte entfernt. Als ich sie erreichte, drehte ich das kleine Schildchen, das in der Scheibe baumelte um. „Geschlossen.“
„Ich denke, dass wir uns in Ruhe unterhalten sollten.“
Danach führte ich sie in das Arbeitszimmer. Ich brauchte ihr nicht ins Gesicht zu sehen, um zu wissen, dass sie mit Erstaunen und Bewunderung die vollen Regale betrachtete. Die Buchrücken verhießen für jeden Bibliophilen die Erfüllung aller Wünsche.
„Bitte“, ich deutete auf den Ohrensessel in der Ecke des Raumes, der von einer antiken Leselampe überragt wurde, „nehmen Sie doch Platz.“ Ich selbst setzte mich auf meinen Bürostuhl am Sekretär. Gut fünf Meter trennten uns. Das empfand ich als durchaus angenehm.
„Eine beeindruckende Sammlung“, stellte sie fest.
Ich nickte. „Das sind nur die gängigsten Werke. Ein Buchgeschäft sollte verschiedene Titel griffbereit haben. Der Weg in den Keller ist mir“, ich deutete auf meine Gehhilfe, „auf Dauer zu mühsam.“
„Im Keller sind noch mehr Bücher?“
„Natürlich“, sagte ich. Ich musste feststellen, dass es mir Vergnügen bereitete, ein wenig anzugeben. „Hier oben ist nur ein kleiner Teil der antiquarischen Titel. Die Spitze des Eisbergs, wenn Sie so wollen.“
Ich schlug den Folianten vorsichtig zu.
Sie reckte den Hals, um die Schrift auf dem Leder zu entziffern.
„Nur etwas lateinische Belletristik“, merkte ich an und erlaubte mir dabei, etwas die Mundwinkel anzuheben. „Eine lausige Übersetzung und Interpretation aus dem Griechischen. Sie hat mit dem Ursprungstext nur noch wenig gemein. Aber es ist bis zu einem gewissen Grade unterhaltsam. Wenn Platon gewusst hätte, was man mit seiner Idee alles machen würde, hätte er vermutlich darauf verzichtet, den Mythos zu verfassen.“
Im obersten Fach des Sekretärs lag eine aufgeschlagene Programmzeitschrift. Ich nahm sie und deutete auf einen kleinen Eintrag. „Stargate – Atlantis“, sagte ich verächtlich schnaubend und pfefferte dann das Heft in den Papierkorb. „Fernsehen ist wie Opium. Es hält vom Denken ab.“
Ich wandte mich ihr wieder zu. „Aber zurück zu Ihnen. Haben Sie Ihre Bewerbungsunterlagen dabei?“
Sie griff in ihre Handtasche. Es war ein schlichtes schwarzes Modell und passte durchaus zu ihr. „Graue Maus“, flüsterte es leise in mir.
Sie zitterte leicht, wie mir schien, als sie einen Umschlag hervorholte. Im Din-A4-Format, Altpapier, mit der Schreibmaschine beschriftet. Bevor sie aufstehen konnte, um mir ihre darin steckende Bewerbungsmappe zu reichen, sagte ich: „Legen Sie sie auf den Teewagen. Ich werde sie mir vielleicht später ansehen.“
Ja, es war gemein, dass ich ihr das Wort „vielleicht“ unterschob. Aber ich hatte mir vorgenommen, ihr das Spiel nicht zu leicht zu machen.
„Und dann“, sagte ich, „nehmen Sie doch bitte das Buch mit dem braunen Einband aus dem Regal. In der untersten Reihe, das dritte von links.“ Sie tat wie ihr geheißen und machte Anstalten, es mir zu bringen. Ich hob die Hand. „Aber nein, ich bitte Sie. Ich kenne das Buch bereits. Kennen Sie es auch?“
Sie las den Einband. „Die 1,000,000 Pfundnote und andere humoristische Erzählungen und Skizzen von Mark Twain.“ Ihre Stimme klang erstaunt. „Mark Twain habe ich noch nicht gelesen“, gab sie zu. Ich konnte ihr ansehen, dass sie befürchtete, sie hätte nun schlechte Karten für eine Anstellung in meinem Hause.
„Eine fatale Lücke“, stellte ich fest, „die Sie unbedingt schließen müssen.“ Mein Tadel war ehrlich und aufrichtig, aber vielleicht etwas zu heftig hervorgebracht. Sie zog den Kopf ein und ein Hauch von Mitleid erfasste mich. Wie verzweifelt mochte sie sein, dass sie unbedingt eine Anstellung in meinem staubigen Antiquariat brauchte?
Ich senkte also meinen Tonfall wieder und bat sie, mir ein paar Seiten aus dem Buch vorzulesen.
„Ich soll Ihnen vorlesen?“
„Ja, natürlich. Sie wollen doch diese Stelle, oder?“ Ich schmunzelte. „Um hier verkaufen zu dürfen, brauchen Sie eine besondere Eigenschaft: Sie müssen die Seele der Bücher erkennen.“
„Die Seele der Bücher?“
„Ja! Sie müssen das Gewicht jedes Wortes spüren, die Gedanken des Autors fühlen, die Welt der Protagonisten erfahren, hineinschlüpfen zwischen die Seiten und die Druckerschwärze schmecken können.“ Mit einem tiefen Atemzug sog ich Luft ein. „Erwecken Sie das Papier in Ihrer Hand mit Ihrer Stimme zum Leben und geben sie ihm dadurch Bedeutung.
… Lesen Sie!“
Sie las die ersten acht Zeilen recht zögerlich und leise. Immer wieder stockte sie im Text und blickte mich unsicher an.
„Frau Liber, glauben Sie“, unterbrach ich sie schließlich, „dass Mark Twain ein besonders unerfahrener und geistig kraftloser Mann war? Oder glauben Sie, dass Mister Adams, der Hauptdarsteller dieser Geschichte, mit seinen 27 Jahren etwas besonders Langweiliges zu berichten hat?“
Mit einem Räuspern begann sie den Text von Neuem. Mit nun lauter Stimme fand sie sich in der Welt Londons wieder und nahm mich mit in dieses kostbar eingerichtete Zimmer, in welchem zwei ältliche Herren saßen.
Ich schloss meine Augen, konzentrierte mich auf die Silben, die mir im Raume entgegenschwebten und ließ die Zeit verstreichen.
Nachdem sie die letzte Zeile vorgelesen hatte, sagte ich den Satz, den ich eigentlich schon zu Beginn des Bewerbungsgesprächs hätte sagen können. „Sie sind eingestellt.“ Mit einem leisen Stöhnen erhob ich mich, durchschritt den Raum und reichte ihr höflich meine Hand. „Darf ich Sie der Einfachheit halber beim Vornamen nennen?“
„Beatrice“, sagte sie. Tausend Fragen schienen ihr ins Gesicht geschrieben. Die vordergründigste war wohl die nach meinem Vornamen. Doch diese Antwort sowie die Antwort auf die restlichen 999 Fragen blieb ich ihr schuldig. Stattdessen sagte ich: „Gut, Beatrice. Morgen kommen Sie um die gleiche Zeit wieder her. Frühstücken Sie gut, denn es gibt viel für Sie zu tun.“
Ich führte sie zur Tür. Beim Hinausgehen fiel ihr Blick auf den kleinen Bilderrahmen neben dem Lichtschalter. „Ist das …“, setzte sie an, „ich meine …“
„Natürlich ist sie das“, sagte ich und schob Bea sanft aber bestimmt hinaus auf die Straße.
„Ein vielversprechender Anfang“, sagte ich zu mir. „So fangen Romane an.“ Dabei beugte ich mich zu dem Bilderrahmen hinunter und betrachtete mit großem Amüsement den großen Geldschein, der hinter der Glasscheibe ruhte.
Von Dampf und Elektrizität
Als ich am folgenden Tag die Jalousie im Schaufenster hochzog, überkam mich wieder die Wehmut. Ein Umzugswagen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Fettverkrustet klebte der Dreck auf dem Lack des Führerhauses, bedeckte den darunter fressenden Rost in beinahe kosmetischer Weise. Das Fahrzeug war für das Auge eine Beleidigung. So einem Unternehmen vertraute man sein Hab und Gut nur dann an, wenn man auch auf den letzten eingesparten Cent angewiesen war.
Fünf Männer waren damit beschäftigt, die Einrichtung des Friseursalons zu demontieren und in den Laster zu verladen. Frank stand daneben. Mit gequältem Gesicht überwachte er das Geschehen. Dort wurde sein Leben verpackt. Dreißig Jahre gestopft in Umzugskisten; es konnte einem die Tränen in die Augen treiben.
Die Metzgerei nebenan und der Bäcker an der Straßenecke hatten bereits im vergangenen Herbst aufgegeben. Gegen die Übermacht der Discounter im Industriegebiet konnten sie nicht länger ankämpfen. Immer weniger Leute verirrten sich hierher. Aus der kleinen, feinen Flaniermeile war ein Stück Geisterstadt geworden.
Frank winkte mir höflich zu und ich erwiderte seinen Gruß mit einer angedeuteten Verbeugung. Es knackte dabei verdächtig in meinem Kreuz, doch wenigstens schmerzten meine Beine nicht mehr so sehr wie gestern. Mein Stock lehnte am Sekretär im Arbeitszimmer. Ich hatte ihn tatsächlich dort vergessen. Eigentlich ein gutes Zeichen.
Ich sah mein Gesicht, das sich im Glas der Scheibe spiegelte. Man hätte sich bei diesem Anblick fragen können, ob es jemals jung gewesen war. Doch bevor ich mich in unangebrachter Melancholie verlor, bescheinigte ich mir, dass meine Augen noch wach und listig wirkten.
Nun, dachte ich bei mir, wenn es mir besser geht, dann will ich dafür sorgen, dass auch für Frank der Tag etwas erträglicher wird. Mit einem Zwinkern verabschiedete ich mich von meinem Spiegelbild und setzte meine übliche strenge Miene auf. Ich öffnete die Tür und bedeutete dem Friseur, zu mir zu kommen.
„Guten Morgen, Herr Plana“, sagte er herzlich, „schön, dass ich Sie vor meiner Abreise noch sehe.“
„Es ist also soweit“, stellte ich fest, „Sie denken nicht, dass Sie es noch ein Weilchen bei uns aushalten können, Frank?“
„Gegen die ‚Company‘ kann ich nichts mehr ausrichten. Die Ketten haben die Preise kaputt gemacht. Für Meisterqualität ist niemand mehr bereit, Geld auszugeben.“ Da stand dieser gestandene Mann vor mir, tat souverän und kämpfte doch unverkennbar mit bebender Unterlippe gegen seine Verzweiflung.
„Und wie geht es weiter?“, fragte ich.
„Tja.“ Frank rieb sich kurz über die Augen. Ein Seufzen entfuhr ihm. „Die Einrichtung habe ich einigermaßen gut verkauft bekommen. Damit kann ich einen großen Teil meiner Schulden tilgen. Und die Löhne von den Mädchen kann ich dann endlich auch nachzahlen.
Aber das ist schon alles in die Wege geleitet. Heute Nachmittag setze ich mich in den Zug. In München ist eine Stelle frei. Nichts Weltbewegendes. Wenn ich den Gürtel noch etwas enger schnalle, werde ich über die Runden kommen.“
„Und Ihre Frau?“ Ich bereute meine Frage sofort. Hätte ich es mir nicht denken können? Ein unterdrücktes Schluchzen ließ Franks Schultern kurz zucken. Es war nicht die erste Ehe in unserer Straße, die an der Not gescheitert war.
„Ich muss los“, sagte Frank. Dabei wandte er sein Gesicht ab und schickte sich an, zu gehen.
„Moment“, sagte ich. Ich griff in die Auslage des Schaufensters und nahm ein Buch heraus. „Für die Zugfahrt. Eine ungekürzte Ausgabe von Hans Dominiks ‚Atlantis‘.“
Verblüfft nahm Frank das Buch in die Hand. Der Buchrückentext nahm ihn schon gefangen. „Woher wissen Sie, dass ich gerne alte Science-Fiction lese?“
„Vor einiger Zeit haben Sie doch mal den Jules Verne bei mir gekauft“, log ich. In Wahrheit hatte Frank noch nie zuvor meinen Laden betreten. Doch er nahm meine Worte gar nicht richtig wahr.
„Schön, dass Ihnen der Titel gefällt. Auch angesichts einer Katastrophe können sich wunderbare neue Möglichkeiten auftun.“
Ich las in seinen Augen, dass er darüber nachdachte, ob ich noch immer das Buch meinte.
Eine Stunde später betrat Beatrice meinen Laden. Sie hatte ihre Nervosität mir gegenüber noch nicht abgelegt. In ihrem schwarzen, knielangen Rock und der dezent grauen Bluse, schien sie mit den Schatten der Regale verschmelzen zu wollen. Dennoch begrüßte sie mich dieses Mal bemüht freundlich mit einem „Guten Morgen, Herr Plana.“ Es fehlte nur noch, dass sie dabei einen Knicks machte! Fehlendes Selbstvertrauen kann Menschen klein machen, dachte ich bei mir. Aber ihr Lächeln beeindruckte mich wieder wie gestern.
„Beatrice, schön, dass Sie gekommen sind.“ Ich deutete auf die Auslage. „Sind Sie für einige Schandtaten bereit?“
„Schandtaten?“, fragte sie unsicher.
„Sehen Sie sich mein Schaufenster an. Da liegt die ‚Uralte Nürnbergische Chronica‘ neben Büchners ‚Woyzeck. Eine Tragödie‘, da liegt eine handsignierte Ausgabe der ‚Morgenländischen Märchen‘ und eine Schlesische Zeitung von 1846.“
„Richtige Schätze“, kommentierte Beatrice.
„Das muss alles raus“, sagte ich knapp. Fast augenblicklich spürte ich wieder den Schmerz in den Beinen. Verdammt. „Verpacken Sie das Zeug …“ – au – „… die Bücher sorgsam in Kisten. Alles zum Verpacken finden Sie im Schrank hinter der Theke.“ Ich sog keuchend Luft ein.
„Geht es Ihnen nicht gut?“ Beatrice reichte mir ihren Arm, den ich dankbar ergriff. Ich hatte es mir tatsächlich leichter vorgestellt.
„Bitte bringen Sie mich zu meinem Sessel nebenan.“
Der Weg kam mir endlos vor. Als ich endlich saß, schloss ich die Augen. „Veränderung ist niemals leicht“, sagte ich. Beatrice dachte wohl, dass ich ihr meinen Schwächeanfall erklären wollte, doch eigentlich sprach ich zu den Büchern. „In diesem Haus ist die Zeit eingefroren. Momente auf ewig gebannt auf Pergament und Papier. Leider ist hier die Gegenwart verloren gegangen.“
„Die Gegenwart?“ Beatrice fand wohl, dass sich der Begriff in einem Antiquariat zu abstrakt anhörte.
„Wissen Sie, warum Gott den Menschen schuf?“ Mit meinem scheinbaren Themenwechsel verlor sie endgültig den Faden. „Was nutzt das schönste Kunstwerk, wenn es keinen Betrachter hat? Der Kosmos ist ein Kunstwerk und seine Betrachter erheben es erst aus der Bedeutungslosigkeit. Genauso verhält es sich mit Autoren und ihren Büchern. Erst durch den Leser erfüllen die Wörter ihre Bestimmung.
Und jetzt, liebe Beatrice, schauen Sie sich hier um. Was glauben Sie? Wie viel Bestimmung, wie viel Bedeutung, wie viel Kunst ist noch in diesem Raum?
Niemand liest mehr die alten Bücher. Ich meine: Wirklich lesen. Es gibt Kunden, die möchten hier eine Geldanlage erwerben. Andere brauchen ein Schmuckstück für die Vitrine im Büro. Oder Schüler und ihre Lehrer brauchen Klassiker als Schulstoff. Einen Text zu zerlegen, zu diskutieren, zu analysieren – das ist nicht wirklich lesen. Da ist nur Verstand. Kein Herz. Keine Seele.“ Mein Pessimismus drohte mich in diesem Moment zu erdrücken. Die Schmerzen steigerten sich ins Unermessliche und ein Kloß im Hals machte mir das Atmen schwer. Ein Zittern erfasste mich und ich spürte Panik in mir aufsteigen.
„Beatrice“, keuchte ich, „könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun?“
Ihre Haut war aschfahl geworden und die Sorge stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Ein Aspirin?“, fragte sie.
Ich lächelte mühsam. „Danke, nein. Aber es wäre nett, wenn Sie mit der Arbeit noch eine halbe Stunde warten würden. Setzen Sie sich her und nehmen Sie ein Buch. Irgendeines. Lesen Sie mir was vor.“
Ich beobachtete sie eingehend, während sie in den Regalen nach geeigneter Lektüre suchte. Ihre Finger strichen dabei sanft, fast zärtlich, an den Buchrücken entlang. Sie war eine gute Wahl, dachte ich mir. Mein Herzschlag beruhigte sich ein wenig.
Plötzlich blieb sie stehen. Ein Band stand etwas hervor. Sie griff danach und betrachtete den Titel. „Wie wäre es mit ‚Ein Drama in den Lüften‘?“
„Welch eine Überraschung“, stellte ich nüchtern fest. „Jules Verne.“ Mit einer Stunde Verspätung begannen wir endlich, das Schaufenster leer zu räumen. Mir ging es tatsächlich besser und es war mir möglich, ein wenig zu helfen.
„Was sollen wir denn gleich ins Fenster stellen?“ Beatrice staubte gerade eine kleine Miniatur-Staffelei ab.
Ich legte meinen Kopf schief, überlegte kurz. „Was würden Sie denn dekorieren?“
„Ich?“ Sie lachte. „Von einem Antiquariat habe ich wenig Ahnung. Sie kennen doch meine Bewerbungsmappe. Mein Buchladen hatte nur aktuelle Belletristik.“
Ich hatte ihre Bewerbungsmappe natürlich noch nicht gelesen. Ihre Unterlagen ruhten noch immer im Arbeitszimmer auf dem Teewagen.
„Erzählen Sie mir von Ihrem Laden.“
Sie hielt in ihrer Bewegung inne, das Lächeln verschwand. „Da gibt es nicht viel zu erzählen“, sagte sie schließlich. Danach wandte sie sich der nächsten Staffelei zu und putzte das Gestell einen Hauch zu energisch. Es war unmissverständlich: Über ihren Laden würde sie mir, zumindest heute, nichts erzählen. Diese Sprachlosigkeit erinnerte mich wieder an Frank.
„Nun“, sagte ich schließlich, „tun wir einfach mal so, als wäre dies hier Ihr Bücherladen. Was würden Sie im Fenster dekorieren?“
Sie lachte. „Sie nehmen mich auf den Arm.“
Ich stemmte meine Hände in die Hüften und setzte eine gespielt empörte Miene auf. „Sehe ich so aus? Lache ich?“
„Ihr Antiquariat ist aber doch kein Buchgeschäft“, sagte sie.
„Nein?“ Ich tat erstaunt. „Aber was sehen Sie denn hier um sich herum?“
„Bücher“, gab sie zu.
„Sehen Sie.“
„Aber Sie verkaufen alte Bücher. Klassiker.“
„Nehmen wir mal an“, sagte ich, „ich hätte festgestellt, dass dies nicht mehr ausreicht. Sagen wir, dass ich mein Geschäftsfeld erweitern möchte.“
„Möchten Sie das denn tatsächlich?“
„Deshalb habe ich Sie eingestellt.“ Das war zwar nur die halbe Wahrheit. Aber wäre es Gott darum zu tun gewesen, dass die Menschen in der Wahrheit leben und handeln sollten, so hätte er seine Einrichtung anders machen müssen. Zumindest hatte Goethe diese Meinung verfochten. „Liebe Beatrice, es ist so, dass ich dieses Antiquariat seit einer halben Ewigkeit führe. Mit den Jahren habe ich genügend Erfahrung sammeln können. Ich verstehe es wirklich gut, diese Bücher zu hüten. Aber ein Buchgeschäft mit junger Literatur … Dazu brauche ich Ihr Gespür.“
Beatrice schien darüber nachzudenken. Die Vorstellung aus dieser literarischen Schatzkammer ein profanes Buchgeschäft zu machen, widerstrebte ihr offensichtlich. Aber natürlich barg es auch einen gewissen Reiz.
„Wir könnten vielleicht mit einem Thema anfangen. Etwas, was die Leute überrascht. Etwas, das nicht zu weit von den antiquarischen Titeln abrückt und dennoch was ganz Neues ist.“ Ihr Vorschlag begeisterte sie selbst. „Eine Kombination von alt und neu. Nehmen wir zum Beispiel den Verne. Den kennt jeder. Und dazu etwas zeitgenössische Science-Fiction. Oder besser Steam Punk.“
Jetzt hatte ich sie. In diesen Augenblicken, als sie die Auslage plante, war ein Teil ihres Selbst zurückgewonnen.
„Steam Punk?“, fragte ich und heuchelte Ahnungslosigkeit.
„Zukunftsgeschichten im Retrolook“, erklärte sie beiläufig. Im Geiste schien sie bereits die Dekoration zusammenzustellen. „Mit diesen Titeln kenne ich mich zwar noch nicht so gut aus, aber mit ein wenig Recherche … Haben Sie Internet?“
Innerlich frohlockte ich. Doch ich hielt meinen Enthusiasmus zurück. „Natürlich habe ich einen Internetzugang. Im Arbeitszimmer. Kommen Sie.“
Beatrice war im Türrahmen stehen geblieben. Links von ihr stand der Ohrensessel. Geradeaus war die Tür, die zum Keller führte, daneben die Tür, die die Stiege ins Obergeschoss verbarg. Überdies gab es meinen Sekretär, meinen Bürostuhl und ansonsten nur Bücher. Die Regale verbargen alle Wände und erhoben sich bis unter die Decke. „Wo steht denn der PC?“
„PC?“, ich räusperte mich. „Sie haben mich nach einem Internetzugang gefragt. Dazu brauche ich keinen PC.“ Ich humpelte auf die andere Seite. Zwischen den beiden Türen befand sich ein großer runder Drehschalter. „Mein Maschinentelegraph“, erklärte ich süffisant, griff nach ihm und wählte die Einstellung „iNet“.
Irgendwo tief unter uns grollte es. Die Deckenlampe begann zu flackern und der Boden vibrierte. Beatrice entfuhr ein erschrockener Schrei, als sich einige Platten des Parketts zunächst seitwärts schoben und dann mit einem mechanischen Klacken in der Tiefe versanken. Ein etwa drei mal drei Meter großes Loch tat sich in der Mitte des Raumes auf. Dann Stille.
„Vermaledeit“, sagte ich. Aber es lag kein Zorn in meiner Stimme. Vielmehr ergötzte ich mich am verblüfften Gesichtsausdruck Beas. „Es klemmt schon wieder.“ Aus der untersten Schublade des Sekretärs holte ich einen überdimensionalen Schraubenschlüssel hervor. Damit hieb ich einmal kräftig in die Schwärze der Tiefe. Volltreffer. Mit einem Rattern erhob sich eine überdimensionale Apparatur über den Horizont des hölzernen Bodens.
Zentralstück war ein in blassen Sepiafarben leuchtender Monitor. Davor ruhte eine viktorianische Schreibmaschinentastatur. Das ganze restliche Drumherum, die Peripherie, schien auf den ersten Blick ausschließlich aus Zahnrädern, Pumpen und Schläuchen zu bestehen. Ein winziges Oszilloskop nahm seine Arbeit auf. Einige Lochstreifen gerieten auf der Rückseite in Bewegung.
Eigentlich hätten wir direkt mit der Arbeit anfangen können, doch zunächst musste ich meiner lieben Beatrice sanft den Unterkiefer hochklappen.
Noch immer entfalteten sich einige Gerätschaften an den Seiten. Ein überproportionaler Drucker inklusive Farbwanne und Walzen, ein Fotoapparat, nebst Magnesiumblitzlicht. Gläserne Röhren, Dampfpumpen und Plasmakugeln nahmen ihren Betrieb auf.
Kurz bevor das Gerät endgültig zur Ruhe kam, klappte sich an oberster Stelle ein kleines Fähnchen auf. Darauf stand in werbewirksamer Schrift, umgeben von einem mit flottem Pinsel gemalten Kringel: „Positrons inside.“
Ich schob Beatrice den Bürostuhl heran und drückte sie sanft auf die Sitzfläche. Zu eigenständigen Handlungen war sie im Moment nicht fähig.
Ein Textcursor bewegte sich auf dem Monitor.
+++ Verbindung wird aufgebaut +++ Weltweites Netz +++ http://+++ Suchbegriff [bitte um Eingabe]
„Gut“, sagte ich, „legen Sie los.“
„Muss man das Teil nicht noch irgendwo aufziehen?“ Ihre Frage war sarkastisch gemeint. So versuchte sie, ihr Erstaunen und Zweifeln zu überspielen.
„Erst, wenn der Dampfkompressor leer ist“, antwortete ich vollkommen ernst, „die Zugfeder liefert nur den Notstrom.“
Die Zeit verging und Beatrice freundete sich Schritt für Schritt mit der eigenwilligen Hardware an. Die Informationen, die sie dem Internet entlockte, notierte sie mit einem billigen Kugelschreiber auf einem Notizzettel. Bis zum Abend hatte sie an die dreißig Autoren herausgesucht, die für unsere Werbeaktion in Frage kamen. Es waren aktuelle Titel und – sehr zu meiner Freude – auch einige vergriffene Titel dabei. Eine gesunde Mischung aus alt und neu.
Als ich ihr am Abend meine Taschenuhr vors Gesicht hielt, war sie überrascht, dass ihr Arbeitstag schon vorbei war.
„Ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Morgen ist auch noch ein Tag.“
Und was war das für ein Tag! Neben einer ganzen Menge Arbeit, hielt er einige Überraschungen für Beatrice bereit. Doch zunächst musste ich Bea davon überzeugen, dass wir nicht das „Verzeichnis lieferbarer Bücher“ bemühen mussten. Ich reichte ihr den Zettel mit ihren Notizen. Dann drehte ich den Maschinentelegraph zunächst auf null, damit der Rechner wieder in seiner Versenkung verschwand. Nachdem sich der Boden wieder geschlossen hatte, war der Weg zur Kellertür frei.
„Dort unten werden Sie alles finden, was Sie brauchen.“
„Sie haben recht“, sagte Beatrice, „schauen wir erst mal, welche der älteren Titel in Ihrem Fundus ruhen.“
Ich verdrehte die Augen und wiederholte einfach nochmal meinen letzten Satz. „Dort unten werden Sie alles finden, was Sie brauchen. Vertrauen Sie mir. Einige Bücherregale sind alphanumerisch nach Autoren sortiert. In den vorderen Regalen sind die jüngeren Ausgaben. Je weiter Sie sich in die hinteren Ränge vorwagen, desto älter sind die Werke. Aber ich schlage vor, dass Sie nicht zu tief hineingehen, solange Sie sich in meinem Antiquariat noch nicht auskennen. Später zeige ich Ihnen dann den besten Umgang mit dem Faden …“
„Dem Faden?“, unterbrach sie mich.
„Der Keller hat einige spezielle …“, ich suchte nach dem richtigen Wort, „Eigenheiten. Der vordere Bereich ist weitestgehend ungefährlich. Doch dem Unbedarften könnten in den hinteren Gängen einige Überraschungen begegnen. Wer mit der Schnur umzugehen weiß, findet dann wenigstens auf einem sicheren Weg wieder hinaus.“
Bea schluckte. „Wir reden noch immer über Ihren Keller?“ Wenigstens tat sie meine Worte nicht als aberwitzig ab. Ich glaube, der vorangegangene Tag hatte sie ausreichend für die Besonderheiten meines Antiquariats sensibilisiert.
Ich öffnete ihr die Tür. Die in Stein geschlagenen Stufen wanden sich hinab und die Finsternis wurde nur von einigen Glühbirnen in die trockenen Fugen zwischen den Steinen verbannt. Sehr stimmungsvoll, dachte ich bei mir, und hörte im Irgendwo das Echo eines leisen Kicherns.
Bea zögerte kurz und als sie schließlich hinabstieg, bemerkte ich voller Genugtuung, wie vorsichtig und fast ängstlich sie einen Fuß vor den anderen setzte. Beinahe wäre ich der Versuchung erlegen laut „Buh!“ zu rufen. „Kindskopf!“, schalt ich mich selbst.
Ich beschloss, im Ohrensessel auf sie zu warten. Den Kopf an die Seitenstütze angelehnt, schloss ich meine Augen. Auf der schwarzen Leinwand meiner Lider war es mir, als könnte ich Beatrice sehen, wie sie unten ankam. Dutzende Regalreihen, nebeneinander angeordnet und scheinbar unendlich lang.
Von A wie Aabe bis Z wie Zypkin waren alle Schreibenden vertreten. Selbst die seltenen Werke von Hildegunst von Mythenmetz oder Norbert dem Leisen standen dort, eingerahmt von Hemingway, Schiller und Honoré de Balzac.
Beatrice würde nicht lange suchen müssen. Wie ich meine Bücher kannte, waren sie nur allzu bereit, ihr zufällig in die Hände zu fallen oder lässig in vorderster Sortierung auf sie zu warten. Vielleicht würden sie auch etwas mehr Licht auf sich lenken oder raschelnd auf sich aufmerksam machen. Ob Bea schon nach so kurzer Zeit bereit dafür war, wusste ich nicht. Aber der menschliche Geist ist immer wieder verblüffend: Entweder akzeptiert er seine Welt mit einem ignoranten Schulterzucken als von Gott geben, oder er nimmt die Andersartigkeiten um sich herum erst gar nicht wahr. Manchmal scheint das leichter zu sein als Wunder mit offenen Armen anzunehmen.
Trotzdem gab ich mich der Hoffnung hin, dass Bea …
Die Tür flog auf. Beatrice stampfte keuchend herein. Auf ihren Händen balancierte sie einen Stapel Bücher. In ihren Augen stand die nackte Panik. Hinter ihr tobte das Chaos. Ohrenbetäubender Lärm drang von unten herauf und eine Staubwolke drängte an ihr vorbei. Es roch plötzlich nach Papier, Staub und altem Holz.
Bea stolperte und während sie noch verzweifelt um ihr Gleichgewicht rang, kippten ihr bereits die Bücher aus den Händen und fielen polternd zu Boden. Ich sprang auf und es gelang mir, wenigstens Bea aufzufangen. Der Schmerz in meinem Rücken und in den Beinen war verheerend. Kurz wurde mir schwarz vor Augen, doch ich hielt sie, bis es ihr gelang, wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
Dann umgab uns Stille. Was auch immer im Keller geschehen war, es hatte geendet.
„Es tut mir so leid“, wimmerte Beatrice. Tränen rannen ihr über das Gesicht. „Es tut mir so leid!“
Ich ahnte es bereits. Trotzdem musste ich mir Gewissheit verschaffen. „Was ist passiert?“, fragte ich atemlos, während ich mich keuchend zurück in den Sessel fallen ließ.
Ihre Lippen bebten. „Die Regale“, brachte sie mühsam hervor. „Ich habe sie kaum berührt. Es … es war nicht meine Schuld.“
Mein Blick flog zu den Büchern, die auf dem Boden verteilt waren. Der harte Aufprall hatte einigen von ihnen den Rücken abgetrennt oder einige Seiten herausgerissen.
„Ich verstehe nicht ganz, was in sie gefahren ist“, sagte ich.
„Nichts“, beteuerte Beatrice, die sich selbstverständlich angesprochen fühlte. Auf eine Richtigstellung verzichtete ich.
„Ich habe die Liste der Reihe nach abgearbeitet“, erklärte Beatrice. „Eigentlich kam ich ganz gut zurecht. Obwohl die Auswahl riesig ist. Wissen Sie eigentlich, was dort unten für ein Vermögen steht?“ Ich nickte geistesabwesend. „Als ich alle Titel beisammen hatte, wollte ich wieder nach oben kommen. Da habe ich den Bücherwagen gesehen. Darauf lag …“, ein Schluchzen unterbrach sie. „Darauf lag das Buch.“
„Welches Buch?“
Sie zögerte. „Meines.“
Ich zog eine Augenbraue hoch. „Sie haben ein Buch veröffentlicht?“
„Nein“, stieß sie heftig hervor. „Das habe ich natürlich nicht!“
„Natürlich?“
„Ich bin keine Autorin. Ich bin Buchhändlerin … gewesen.“
„Natürlich.“
Sie sammelte die Bücher vom Boden ein. Es lag ein tiefes Bedauern in ihren Augen, als sie die Schäden begutachtete. „Ich komme dafür auf“, sagte sie.
„Geben Sie sie mir“, bat ich. „Und dann erzählen Sie mir von Ihrem Buch.“
„Mein Buch … ist eigentlich nur eine lose Zettelsammlung in der untersten Schublade meines Schreibtischs gewesen. In meinem Buchladen.“ Sie zögerte. „Die letzten Monate war da nicht mehr so viel los gewesen. Zwischen den paar Kunden, die sich in den Laden verirrten, war immer viel Zeit gewesen. Aus lauter Langeweile habe ich mit dem Schreiben angefangen. Es war so eine Art Tagebuch.“
„So eine Art?“, hakte ich nach.
„Ja“, antwortete sie. „Ich habe das Tagebuch in Romanform geschrieben. Albern, ich weiß.“
Ich schüttelte sanft den Kopf. „Schreiben ist niemals albern. Selbst Immanuel Kant hat mal mit einem leeren Blatt Papier angefangen. Ich denke, selbst er wusste nicht, wohin ihn seine Feder eines Tages führen würde.“
Bea wirkte verlegen. Aber wenigstens beruhigte sie sich wieder. „Von den großen Meistern ist mein Geschreibsel so weit entfernt, wie die Erde vom Zentrum der Milchstraße. Im Grunde habe ich nur den Untergang meiner kleinen Firma dokumentiert.“ Damit hatte sie, ganz beiläufig und ohne es so richtig zu wissen, mehr verraten, als sie eigentlich wollte. Ich ließ mir nichts anmerken. „Eine Pleite ist nichts Spannendes. Als ich den Laden schloss, gehörte das gesamte Inventar bereits meinen Gläubigern. Nichts durfte ich mitnehmen. Auch der Tisch blieb da …“
„Und Sie haben Ihr Manuskript in der untersten Schublade liegenlassen?“
„Ich hätte es wegwerfen sollen!“, brach es aus ihr heraus. Wie viel Zorn doch unter ihrer unscheinbaren Oberfläche brodelte. Es war faszinierend, dass sie dabei den größten Groll gegen ihr Buch hegte. Anstatt mit dem Schicksal oder den Gegebenheiten, die zur Geschäftsaufgabe führten, zu hadern, hasste sie das Papier, auf dem sie sich die Seele frei geschrieben hatte.
„Und Ihr Manuskript lag in meinem Keller?“ Ich tat ahnungslos. „Wie sollte es dorthin gekommen sein?“
Sie holte tief Luft, wollte etwas sagen und … blieb sprachlos.
„Oder war es sogar schon gedruckt und gebunden?“
Ihr Mund klappte mehrmals auf und zu. Schließlich brachte sie doch einige zögerliche Worte zustande: „Es sah zumindest so aus. Ich muss mich geirrt haben.“
„Bestimmt“, erwiderte ich. „Und darüber haben Sie sich so erschrocken, dass Sie rückwärts gegen ein Regal gestolpert sind. Dieses ist dann bestimmt umgestürzt und hat in einem Dominoeffekt einige weitere Regale mitgerissen.“
Sie ließ meine Vermutungen über sich ergehen. Ihr Geist fraß mir die erfundenen Erinnerungen förmlich aus der Hand.
„Bestimmt“, sagte sie. Es klang fast, als wäre sie in eine leichte Trance gefallen. „So muss es gewesen sein.“
„Wissen Sie was“, sagte ich, „ich werde mich darum kümmern. Nehmen Sie diese Bücher hier und dekorieren Sie sie wie besprochen im Fenster.“
„Aber die Bücher sind kaputt.“ Bea deutete auf die Stelle, an der eben noch lose Seiten aus den Buchdeckeln herausragten. Doch auf meinem Schoß lag nur saubere, sorgfältig gebundene Lektüre. Fabrikneu, wie es schien.
„Bestimmt haben Sie sich auch hierbei geirrt.“ Ich lächelte. „Hier ist alles unversehrt.“
Als sie damit begann, im Schaufenster zu arbeiten, machte ich mich auf den mühsamen Weg in den Keller. Ich hatte dort ein ernstes Wörtchen zu sprechen.
Über die Lügen in der Wahrheit
Bis zum Abend verblieb ich im Keller. So verpasste ich zwar die ersten Kunden, die aufgrund der Sortimentserweiterung den Weg in den Laden fanden – aber vielleicht war das auch besser so. Zeitgenössische Literatur im Einklang mit Klassikern, das fiel mir schwerer, als ich erwartet hatte. Vielleicht lag es daran, dass jede Generation ihren Schund erst mal aussortieren musste, bevor sich die wahren Schätze hervortaten. Zu viel Müll verbarg so manche Perle. Und die Leser verhielten sich bei Neuerscheinungen meistens wie eine große, dumme Herde. Sie fraßen alles, was ihnen neu vorgesetzt wurde, in sich hinein. Ein aktueller Bestseller muss nicht zwingend auch ein gutes Machwerk sein. Das Gegenteil war mir oft genug bewiesen worden.
Inzwischen kam es mir vor, als würde in Zeiten von Multimedia und Datenautobahn die Flut der neuen Texte so verheerend wachsen, dass sie alles mitriss und verschlang. Das Schreiben war zu leicht geworden. Die Textcursor der Programme schienen Worte aus den Fingern zu saugen, noch bevor über sie nachgedacht wurde. Wie war es davor gewesen, als man noch die Feder zunächst zum Tintenfass schicken musste?
Atemlos erreichte ich gerade die oberste Stufe der Kellertreppe, als Bea mir entgegeneilte. Ihr Gesicht war noch immer blass vom Schrecken des Vormittags, doch ihre Mimik verriet mir eine unbestimmte Erregung. „Da vorne steht ein Kunde, der sich lieber von Ihnen bedienen lassen möchte. Er sagt, er wäre ein alter Freund.“
„Das scheint ja ein außergewöhnlicher Gast zu sein. Sie blicken ja drein, als hätten Sie einen Geist gesehen.“
Ich eilte, so schnell es mir möglich war, in den Verkaufsraum. Im Zwielicht des Abends stand dort ein auffällig gekleideter Mann. Ein altmodischer Anzug, ein blass gelbes Halstuch und ein Gehstock – ähnlich dem meinen –, so stand er vor mir. In seinem Gesicht funkelten mich Augen, überdacht von kräftigen Augenbrauen und unterkellert von gräulichen Tränensäcken, voller Ironie an.
„Hello Eddie“, sagte ich hocherfreut, „was darf es denn heute sein? Krimi oder was von der anderen Seite?“ Dabei reichte ich ihm meine Hand. Er ergriff sie, zog mich an sich heran und machte aus unserer Begrüßung eine herzliche Umarmung.
„Die andere Seite, bitte“, sagte er. Der starke amerikanische Akzent ließ keinen Zweifel an seiner Herkunft aufkommen.
Ich sah kurz zu Bea. Sie stand im Türrahmen und … Sie zitterte am ganzen Leibe wie Espenlaub. Hoffentlich würde sie mir nicht ohnmächtig.
„Also gut“, sagte ich eilig, griff in ein Regal mit den nicht ganz so alten Büchern und nahm mir zielstrebig einen Band mit Kurzgeschichten heraus. „Das ist was von King. Zeitgenössisches Populärzeugs, wenn du so willst. Ich denke, dass dir trotzdem einiges davon gefallen wird.“
„Wenn du es mir empfiehlst …“ Eddie war zwar skeptisch, doch er legte mir ein paar Münzen in die Hand. Bea schwankte leicht.
„Sorry, dass ich gerade nicht mehr Zeit für dich habe.“ Ich drückte ihn sanft zum Ausgang. „Vielleicht kommst du in den nächsten Tagen nochmal auf einen Kaffee vorbei? Wir könnten über alte Zeiten reden.“
„Ich kenne diesen Kunden“, sagte Beatrice, als der Mann außer Sicht war. „Ich habe Bilder von ihm gesehen …“
„Beatrice, ich denke, dass Sie sich setzen sollten.“
Sie hörte mich nicht. „… aber er ist tot.“
„Auf mich wirkte er sehr lebendig.“
„Er ist seit … keine Ahnung …“ Bea schien im Geiste zu rechnen. „Seit über 150 Jahren, oder so, tot.“
„Über wen reden wir denn?“, fragte ich unschuldig.
„Das wissen Sie ganz genau!“ Ihre Stimme überschlug sich. „EdgarAllan Poe! Wie ist das möglich? Da ist gerade ein toter Schriftsteller durch unseren Laden gelaufen und hat sich ‚Nachtschicht‘ gekauft.“
Das ging wohl alles etwas zu schnell. Ich musste unbedingt das Tempo drosseln, sonst würde Beas Verstand die Notbremse ziehen. Was sie jetzt brauchte, war ein geistiger Rettungsring.
„Schon mal darüber nachgedacht, dass Mr. Poe vielleicht noch lebende Fans haben könnte?“
Beatrice schnappte nach Luft. Protest lag ihr auf der Zunge. Sie schluckte ihn herunter. Ihre Gedanken rasten im Strom der Ereignisse. Dann erreichte sie wieder den festen Boden der Rationalität. Mit meiner Erklärung konnte sie für den Augenblick leben. Sicher gab es Fans, die ihr Outfit dem eines Schriftstellers anpassen würden.
„Ein Fan?“
Ich sparte mir eine Antwort.
Doch Beatrice hatte sich anscheinend wieder unter Kontrolle. Sie hakte nach. „Ist das möglich? Ein Fan?“ Sie schien diese Möglichkeit regelrecht abzuschmecken. War es ein Hauch offenen Misstrauens, der mir da entgegenschlug? „Ist das wahr?“
Eine sehr konkrete Fragestellung, die ich ehrlich beantworten konnte. Außerdem konnte ich so von den Tatsachen ablenken.
„Meine Liebe! Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Nehmen Sie einen beliebigen Roman: Alles, was der Erzähler in Worte fasst, ist aus der Sicht seiner Protagonisten ohne Frage wahr. Es ist deren Realität. Sie können sie fühlen, riechen, schmecken, sehen und hören. Die Personen, die Landschaften, das ganze erdachte Universum drum herum mag dem Leser dieses Romans ebenso bekannt erscheinen wie den Protagonisten, weil die Welt des Lesers den gleichen allgemeinen Regeln folgt. Doch schlussendlich hat allein der Erzähler die Macht und wenn es für die Geschichte, die er erzählen möchte, wichtig ist, dann könnte er Raben sprechen oder Raumschiffe kämpfen lassen. Es könnte sogar Frösche regnen, wenn der Autor es nur will.“
Draußen donnerte es.
„Die Wahrheit in einem Buch ist formbar wie ein Teig. Wir stehen hier in meinem Antiquariat und haben wenig Einfluss darauf, was um uns herum passiert. Selbst so profane Dinge wie das Wetter draußen können wir nur passiv geschehen lassen.“
Ich öffnete die Ladentür. Der angenehme Geruch eines Gewitters wehte sanft in meine Nase. Vor meinen Füßen nahm ich keineswegs überrascht eine Bewegung wahr: Ein kleiner, grüner Frosch sprang über die Türschwelle. Vorsichtig hob ich ihn auf. Dann griff ich nach Beatrice’ Hand und legte ihr den Frosch hinein.
„Sie sehen ihn“, sagte ich, „Sie fühlen ihn. So unwahrscheinlich es auch zu sein scheint, für Sie ist dieser Frosch real. Er ist ein Teil Ihrer Wahrheit.“
Ich griff in einem Regal neben mir nach einer Übersetzung von Descartes. „Ich denke. Also bin ich!“, zitierte ich. „Welch ein grandioser Satz! In diesem Buch hier ist dieser revolutionäre Gedanke eingefroren auf Papier, konserviert für die Ewigkeit. Deshalb lebt Descartes immer noch, oder? Seine Gedanken und somit sein Ich sind immer noch unter uns, als hätte er sie eben erst ausgesprochen. Wir müssen nur die richtige Seite aufblättern und hören in unserem Geist seine Stimme.“
Ich ließ Beatrice einen Augenblick. Doch bevor sie etwas erwidern konnte, sagte ich: „Stellen Sie sich vor, Descartes wäre nur eine fiktive Figur: Es war einmal René Descartes, ein junger Denker, der in einer dunklen Kaschemme im Jahre 1619 anno Domini ein Gewitter abwartete. Und er fragte sich, wenn er alles um sich herum in Frage stellen und die Realität als Trugbild seiner Sinne entlarven würde, was bliebe von ihm übrig? Die einzige, letzte Wahrheit?
Der Autor, der diese Geschichte über Descartes erfindet, sitzt vielleicht an seinem Schreibtisch und legt seinem Protagonisten die richtigen Worte in den Kopf; lässt ihn eine Unterhaltung mit dem eigenen Geist führen: ‚Ich denke. Also bin ich.‘ Dabei lächelt der Autor, denn er weiß, dass dies eine Lüge ist.“ Auch ich lächelte nun. „Wahrheit. Beatrice, wie viel Wahrheit bleibt Ihnen, wenn Sie Ihre Realität in Frage stellen? Denken Sie? Oder erweckt ein Leser gerade in diesem Moment Ihre Person zu einem kurzen Leben, das zwischen den Zeilen darauf wartet, erweckt zu werden?“ Ich nahm ihr den Frosch wieder aus der Hand und brachte ihn zurück nach draußen. Der Himmel klarte bereits wieder auf. Das Unwetter war vorbeigezogen.
Zurück im Laden hüstelte ich, um dann den Faden erneut aufzunehmen. Doch ich musste feststellen, dass ich eigentlich schon zu viel gesagt hatte. Wenn ich mein Mundwerk nicht beherrschen konnte, würde ich mir noch den ganzen Spaß verderben.
„Aber das sind nur philosophische Taschenspieler-Tricks“, schloss ich deshalb – ein wenig selbstgefällig – meinen Vortrag.
„Stimmt“, sagte Beatrice überraschend, „denn selbst Ihr Leser wurde nur erdacht. Es gibt ihn genauso wenig wie den Autoren. Beide sind nur Phantasie-Gespinste.“
„Ja.“ Ich rieb mir nervös die schmerzenden Finger. Schon befand ich mich in einer Defensive, die ich mir vermutlich selbst eingebrockt hatte. „Phantasie-Gespinste … Natürlich. Wie wahr. Wie wahr.“
Es war Zeit, Feierabend zu machen. Ich drückte Beatrice meinen Zweitschlüssel in die Hand und bat sie darum, dass sie, wenn sie ginge, hinter sich abschließen solle. Dann schleppte ich mich die hölzernen Stufen hinauf in meine Wohnung.
Als das trübe Licht der Wohnzimmerlampe den Raum erhellte, begann sofort das Wispern. Es war wie das Rascheln von zerknittertem Papier, durch das eine leichte Brise wehte. Unzählige tonlose Stimmen umgaben mich „Schhht!“, machte ich. „Habt Geduld mit ihr.“
Auf den ersten Blick sah mein Wohnzimmer für einen unbedarften Betrachter ganz gewöhnlich aus. Auch wenn ich hier oben bislang noch keinen Besuch empfangen hatte, wahrte ich auch in den eigenen vier Wänden gerne den Schein. Da waren der Tisch, dahinter das breite Sofa, ein Teewagen und ein großer Apothekerschrank, den ich als Sideboard verwendete. Auf dem Boden lag ein schwerer Perserteppich. Die Decke war in Stuck gekleidet.
Bei genauerem Hinsehen konnte man feststellen, dass mit den Wänden etwas nicht stimmte. Die Tapete war unregelmäßig und bunt. Und eigentlich war es keine Tapete. Es waren Bücher, die wie Mauerwerk waagerecht gestapelt, die eigentlichen Wände verdeckten.