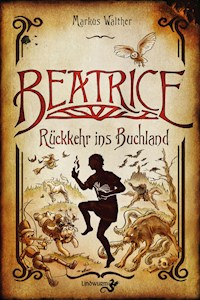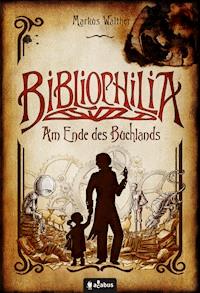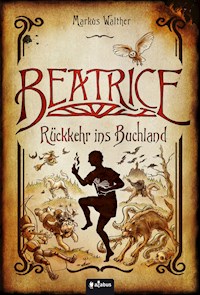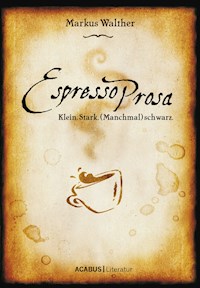13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt aus einem der dunkelsten Kapitel in der Schweiz: von dem Schicksal der Verdingkinder. Aber auch davon, wie Gott in die Geschichte eingreift und mit uns neue Wege geht! Entwurzelt, ausgebeutet, ohne Identität - Meck Walther wird sein Leben lang herumgereicht. Als seine Mutter stirbt, verliert er seine Heimat. Erst kommt er ins Heim, dann als Arbeiterkind auf einen Bauernhof nach Luzern. Sein Herz sehnt sich nach Liebe, doch stattdessen muss er harte Arbeit leisten - und entkommt nur knapp dem Tod. Es dauert Jahre, bis er seine Identität als Kind Gottes erkennt. Und seine ruhelose Seele von seinem himmlischen Vater gesund geliebt wird. inkl. 8 S. Bildteil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Markus Walther
mit Hauke Burgarth
VERDINGKIND
Mein Leben als Arbeiterkindund wie ich meinen liebenden Vater fand
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7571-5 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-6105-3 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© 2022 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Bildteil:
© Markus Walther, außer:
S. 5 oben: © Miriam Majaniemi
S. 5 unten: © Lukas Gieringer, ICF Zürich
S. 6 oben: © Bernhard Stegmayer
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Lektorat: Christiane Kathmann, www.lektorat-kathmann.de
Umschlaggestaltung: Stephan Schulze, Stuttgart
Titelbild: Miriam Majaniemi, www.maj-photo.ch
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
In diesem Buch erzähle ich meine Geschichte,so wie sie sich tatsächlich zugetragen hat.Natürlich geschieht das aus meiner persönlichen Perspektiveund muss nicht unbedingt die Ansichten, Erinnerungenund Empfindungen Dritter widerspiegeln.Wo es mir angebracht schien, wurden deshalb aus Gründendes Persönlichkeitsschutzes Namen, Orte und Details geändert.
INHALT
Über die Autoren
Alles neu?
Immer unterwegs
Ab ins Heim
Verdingkind auf dem Bauernhof
Eigentlich tot
Noch ein Bruder
Ein gutes Heim
Schiefe Türme, steile Berge
Bomberjacke und Edel-Jeans
Allein unter Frauen
Zwischen Familienleben und Drogen
Als Taxifahrer unterwegs
Im Schuhgeschäft
Liebe und Familie
Den Boden unter den Füßen verloren
Mit Jesus auf der Bank
Sechs Monate ohne
Wenn Gott spricht
Beruf und Berufung
Danksagung
Anmerkungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ÜBER DIE AUTOREN
Markus Walther (Jg. 1974) lebt in Schwerzenbach (Zürich). Er arbeitet als Vermögensverwalter, ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Freizeit verbringt er mit Familie und Freunden, genießt die schweizer Natur und vertieft sich gern in spannende Biografien.
Hauke Burgarth (Jg. 1964) lebt in Pohlheim bei Gießen. Er arbeitet freiberuflich als Lektor und Journalist, ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. In seiner Freizeit engagiert er sich in einer FEG.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ALLES NEU?
Wer beim Arbeiten am Computer in eine Sackgasse gerät und merkt, dass es scheinbar nicht weitergeht, kann auf den »Refresh«-Button drücken. Dann fragt der Computer automatisch die aktuelle Situation ab – und plötzlich funktioniert vieles wieder.
So etwas hätte ich mir gewünscht, als ich im Sanatorium Kilchberg in Zürich war.
»Refresh« – und alles wäre wieder gut.
Aber das war es nicht.
Ich war auf dem absoluten Nullpunkt angekommen.
Nein – ich war schon darunter.
Eine Ehe war zerbrochen. In meiner zweiten Ehe kriselte es. Groß geworden war ich in Heimen, wo Liebe absolute Mangelware war, und als Verdingkind bei einer Bauernfamilie, die mich ausnutzte und misshandelte. Trotz allem hatte ich etwas auf die Beine gestellt und war beruflich erfolgreich geworden. Doch was war der Preis dafür? Äußerlich befand ich mich auf Erfolgskurs, innerlich war ich getrieben von Angstattacken, und die Ärzte hatten mir eine Erschöpfungsdepression attestiert. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte.
Ein Bekannter hatte mir ein christliches Buch in die Hand gedrückt. Brauchte ich so etwas? Ich doch nicht! Lange hielt ich den frommen Inhalt für Hokuspokus. Doch während ich darin las, wurde mir plötzlich warm ums Herz. Ich verstand auf einmal, worum es ging, und auch, dass Gott mich liebte.
Da saß ich nun auf einer Bank neben dem Sanatorium und weinte. Ich spürte, dass das nicht nur ein kurzfristiges Betroffensein war. Ich hatte keine Ahnung warum, aber irgendwie war ich gerade am Ziel angekommen. Nein, eigentlich hatte mein Leben gerade neu angefangen! Als hätte Gott selbst den »Refresh«-Button gedrückt.
Ich heiße Markus Walther, aber jeder nennt mich Meck. Und das ist meine Geschichte.
Ich erzähle sie, weil ich erlebt habe, wie Gott in mein Leben eingegriffen hat.
Ich erzähle sie, weil sie wahr ist.
Und ich erzähle sie, weil Gott mir gesagt hat: »Schreib es auf.«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
IMMER UNTERWEGS
»Mama, ich habe einen neuen Freund!«
Aufgeregt lief ich durchs Treppenhaus in unsere Wohnung zu meiner Mutter, die in der Küche am Herd stand. Sie schaute auf. »Wer ist es denn? Es ist doch niemand neu in die Nachbarschaft gezogen?«
»Es ist kein Junge. Es ist ein Schwan!«
»Was hast du gesagt?«
»Mein Freund ist ein Schwan. Ich brauche Brot, ich will ihn füttern.«
Es war schon ein paar Tage her, da hatte ich ihn das erste Mal gesehen. Auf dem See gab es viele Schwäne, aber dieser hier flog bis zu unserem Haus, landete auf der Wiese daneben und zupfte mit seinem starken Schnabel etwas Gras ab.
Er war riesig, fast so groß wie ich, aber Angst hatte ich nicht vor ihm. Er sah so wunderschön sauber und weiß aus. Schnell holte ich etwas altes Brot aus der Küche und lief wieder hinaus, um ihn zu füttern. Er fraß es Krümel für Krümel.
Am nächsten Tag war er wieder da. Vorsorglich hatte ich schon etwas Brot in die Tasche gesteckt. Scheu war der große Vogel nicht, und nach ein paar weiteren Tagen nahm er mir die Brotstücke vorsichtig aus der Hand. Zuerst hielt ich vor Aufregung die Luft an, doch für den Schwan schien das völlig normal zu sein. Selbst als ich ihn später streichelte und sogar in den Arm nahm, blieb er da. Andere Kinder hatten ein Meerschweinchen oder Kaninchen – ich hatte einen Schwan. Tatsächlich war er für mich mehr als nur ein Tier. Er wurde mein Freund.
Ich kam am 8. September 1974 im Kantonsspital in Zug zur Welt. Später sagte einmal jemand zu mir: »Du bist nicht von hier. Du bist in Zug geboren.« Hatte ich es falsch verstanden oder wollte ich aus meiner Geburt ein Abenteuer machen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war ich als Kind jahrelang der Überzeugung, dass ich im Zug geboren sei. Das klang zwar seltsam, aber irgendwie gefiel mir der Gedanke, in einer Eisenbahn das Licht der Welt erblickt zu haben. Wer konnte das schon von sich sagen? Erst als ich ein Teenager war, klärte sich das Missverständnis auf.
Dabei waren wir als Familie tatsächlich viel unterwegs. Das lag nicht zuletzt an meiner Mutter, die eine gebürtige Graf war und eine »Jenische«, ein Zweig des fahrenden Volks, der weniger bekannt ist als Sinti und Roma. Wie viele Menschen sich zu den Jenischen zählen, ist unbekannt, aber sie leben hauptsächlich in der Schweiz. Nur dort und erst seit 2016 werden sie als nationale Minderheit anerkannt, wobei es unwichtig ist, ob sie sesshaft oder fahrend leben.
Meine Familie wohnte anfangs in einem Wohnwagen und dort kamen auch meine beiden älteren Geschwister zur Welt: Amara war acht Jahre älter als ich, mein Bruder Andy sieben Jahre älter. Die beiden erlebten noch während ihrer Primarschulzeit hautnah, was es hieß, immer auf Achse zu sein, wenn unser Vater seiner Arbeit hinterherreiste. Ich selbst kann mich an diese Zeit nicht mehr erinnern. Als meine Eltern den Wohnwagen verkauften und sich in Küssnacht am Rigi niederließen, war ich noch ein Kleinkind.
Auch als wir sesshaft wurden, war unser Vater immer noch als Scherenschleifer unterwegs. Dafür benutzte er eine Karette, eine Art Schubkarren, auf der sein Schleifstein befestigt war und mit der er sein Werkzeug transportierte. Oft begleitete ich ihn und saß als Krönung obendrauf. Die Karette rumpelte ordentlich, und ich musste mich gut festhalten, aber ich liebte unsere Touren.
Mein Vater schob den Wagen von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, von Tür zu Tür, klingelte und sagte: »Grüezi, der Scherenschleifer ist da. Haben Sie Messer oder Scheren zum Schärfen?«
Meine Aufgabe war es, freundlich zu lächeln, ab und zu wurde ich auch an die Türen geschickt, um zu klingeln. Wenn die Bewohner seinen Dienst in Anspruch nehmen wollten, nahm mein Vater die stumpfen Werkzeuge in Empfang und öffnete seine Schleifmaschine. Er trieb den Schleifstein mit einem Pedal an und schärfte, dass die Funken flogen. Vor dem Stein hatte ich Respekt, da hielt ich lieber etwas Abstand, aber meinen Vater bewunderte ich für sein Können. Anschließend gaben wir die Messer und Scheren wieder zurück und kassierten den Lohn dafür.
Vater hatte mich gern dabei. Viele Leute hatten Bedenken, wenn Jenische in der Nähe waren – es könnte ja etwas wegkommen –, doch so ein kleiner Junge stellte Vertrauen her.
Ich genoss es ebenfalls, meinen Vater zu begleiten. Zum einen wurde ich den ganzen Tag über herumkutschiert und bekam einiges zu sehen, zum anderen griff manche Hausfrau in ihre Schürzentasche oder eine Schublade und bot mir mit den Worten »Magsch en Schoggi?« etwas zum Naschen an.
Abends ging es dann wieder zurück nach Hause in den Hörnligarten. Dort standen vier oder fünf mehrstöckige Mietshäuser, Plattenbauten mit mehreren Wohnungen pro Etage. Der Putz bröckelte an etlichen Stellen ab und die Fenster waren nicht ganz dicht. Die grauen Klötze hätten schon damals keinen Schönheitspreis gewonnen, doch ich mochte unsere kleine Wohnung, den großen Parkplatz zwischen den Häusern, die vielen Kinder, die auf dem Gelände herumsprangen, und natürlich die Aussicht. Nur ein paar Hundert Meter entfernt lag der Vierwaldstättersee, bergauf schauten wir Richtung Seebodenalp.
Wenn ich an so etwas wie eine normale Kindheit denke, fällt mir immer wieder diese Zeit ein. Tatsächlich war es der schönste und normalste Abschnitt meiner jungen Jahre. Ich konnte nicht wissen, dass meine Geschichte so ganz anders verlaufen würde als die meiner Nachbarn und Spielkameraden, die hier wie ich in einfachen Verhältnissen lebten.
Auf den Parkplätzen, die zwischen den Wohnblöcken lagen, lernte ich als Dreikäsehoch schon Fahrrad fahren. Erst setzte mein Vater mich auf den Sattel und hielt das Fahrrad am Gepäckträger fest, dann drehte ich meine erste Runde allein, und schließlich fuhr ich auf der Asphaltfläche herum. Viele Autos standen dabei nicht im Weg.
Zunächst funktionierte es wunderbar, doch gerade, als ich dachte, ich hätte alles im Griff, verlor ich die Kontrolle und stürzte. Vor Wut und Enttäuschung warf ich das Fahrrad in die Büsche. Aber ich holte es bald wieder heraus, denn alle fuhren Fahrrad, und ich konnte unmöglich als einziger Fußgänger hinterherlaufen.
In der Regel aber war die Stimmung beim Toben und Spielen richtig gut. Sie wurde sogar noch besser, als ich einmal eine Torte auf den Hof herunterbrachte, die ich bei uns im Kühlschrank gefunden hatte. Weil mir die Kinder aus unserer Nachbarschaft wichtig waren, verteilte ich fleißig davon. Alle, die wollten, bekamen ein Stück. Es war ein richtiges Fest. Doch die gute Stimmung dauerte nur so lange, bis Mutter die Kühlschranktür öffnete und entsetzt fragte: »Wo ist denn die Geburtstagstorte von Amara?«
Ich wollte es natürlich nicht gewesen sein. So war es kein Wunder, dass die Eltern mir bei anderen Gelegenheiten nicht glaubten, wenn ich wirklich unschuldig war.
Nach dem Schwan – dem ich übrigens keinen Namen gab – war Negi mein nächstbester Freund. Negi war unser Hund, ein Schnauzer. Wenn ich morgens nach dem Aufstehen in den Flur kam, lief er mir bereits schwanzwedelnd entgegen. Tagsüber legte Negi sich oft ruhig an meine Seite und war einfach da. Dann spürte ich seine Wärme und den Herzschlag, und er gab mir ein Gefühl großer Nähe.
Negi konnte aber auch wie ein Wilder herumtollen und er liebte Süßes. Ich habe den lauten Ruf »Markus!« noch im Ohr, der eines Tages im Dezember aus dem Wohnzimmer kam. Dort war schon alles weihnachtlich dekoriert, in der Zimmerecke stand unser Tannenbaum, geschmückt mit Kugeln, Kerzen und bunt verpackten Schokoladenstücken. Nur dass die Schokolade nicht mehr vorhanden war. »Markus, wo ist die Schokolade geblieben?« Ich stutzte und stotterte, war mir aber keiner Schuld bewusst. Ich mochte Süßes, aber in der Weihnachtszeit gab es genug davon. Weshalb hätte ich etwas aus dem Baum nehmen sollen? Und warum hätte ich gleich alles nehmen sollen?
Plötzlich sah ich Negi, der mit dem Schwanz wedelte und sich die Schnauze leckte. Unsere Blicke trafen sich. Wenn je ein Schnauzer schuldbewusst dreingeblickt hat, dann er. Aber echte Freunde verraten sich nicht gegenseitig. Ich war es zwar nicht gewesen, doch man gab mir die Schuld.
Genauso wenig, wie ich das Geld meines Vaters ausgegeben hatte.
Wie so oft rief er mich zu sich: »Komm doch mal eben her.«
»Was ist?«
»Geh in den Laden unten im Ort und hol mir eine Packung Zigaretten. Hier hast du Geld.«
Mein Vater griff ins Portemonnaie und drückte mir ein paar Münzen in die Hand. Schnell machte ich mich auf den Weg zu dem Laden, denn ich wurde von einer gefährlichen Bande verfolgt, die nur ich sehen konnte. Ich rannte die Hörnlistraße so schnell hinunter, dass ich sie fast abgehängt hätte, aber sie waren noch da. Deshalb sprang ich beim Eckhaus unten auf die Mauer und balancierte über die ganze Länge hinweg. Ich hatte einen guten Vorsprung. Also hüpfte ich den Rest des Weges am Bordstein entlang – immer wieder nach oben und auf die Straße, hoch und runter. Das würden sie nicht schaffen!
Um wenigstens eine Hand frei zu haben, steckte ich ein 50-Rappen-Geldstück in den Mund, wo es auch vor der Bande in Sicherheit war. Ich machte einen großen Satz und landete hart.
So ein Mist! Ich hatte das Geldstück hinuntergeschluckt!
Damit war das schöne Spiel zu Ende. Ich schaute traurig auf den kläglichen Rest der Münzen in meiner anderen Hand. Das reichte nie im Leben für eine Packung Zigaretten. Schweren Herzens kehrte ich um. Erst langsam und dann noch langsamer schlich ich zurück nach Hause, zurück zu meinem Vater.
»Da bist du ja endlich.«
»Du, Vater …«
»Hast du die Zigaretten?«
»Nein. Ich hab ein Geldstück verschluckt. Aus Versehen!«
»Du meinst, du hast dir davon etwas zum Schlecken gekauft?«, schimpfte er.
»Nein. Wirklich. Ich hab’s verschluckt.«
Mein Vater glaubte mir kein Wort. Aber was sollte er tun? Das Geld reichte nicht mehr, um Zigaretten zu kaufen, also zückte er schweren Herzens noch einmal das Portemonnaie und gab mir eine weitere Münze.
»Die wird aber weder ausgegeben noch heruntergeschluckt oder weggeworfen. Ist das klar?«
»Ja.«
Der restliche Einkauf lief ganz normal ab, auch wenn er ohne Verfolgungsjagd nur halb so spannend war.
Solche Aktionen waren typisch für mich, weil ich meistens einfach loslief und spontane Ideen direkt umsetzte. Nachdenken kam für mich erst später – und manchmal eben zu spät.
So schön die Umgebung des Hörnligartens für mich als Kind war – die Wohnung dort war für unsere Familie zu klein. Deshalb zogen wir bald darauf in die Ortsmitte. Das Litzihüüsli war ein altes Holzhaus. Es lag zentral in der Nähe des Bahnhofs und nicht weit vom Bootshafen entfernt. Dort teilten Andy und ich uns zwar noch einen Raum, aber Amara hatte jetzt ein eigenes Zimmer.
Wenn sie aus der Schule nach Hause kam, verschwand sie direkt darin. Sekunden später drückte sie die Play-Taste an ihrem Kassettenrekorder und es dröhnte durch die Wohnung: »You ain’t nothin’ but a hound dog …«
Elvis war angesagt, und ich kleiner Kerl liebte seine Songs.
»Amara, mach das Geplärr leiser!«
»Das ist Musik!«
»Mach leiser, sag ich.«
Mutter unterschied sich in diesem Punkt nicht von anderen Müttern. Mit dem Musikgeschmack ihrer Kinder konnte sie nicht viel anfangen. Wenn Amara kompromissbereit war, erklang es danach etwas ruhiger: »Wise men say only fools rush in …« Wenn nicht, dann war es eben der »Jailhouse Rock«.
Schräg gegenüber von unserem Haus war ein Restaurant. Wenn Vater gut verdient hatte, holten wir uns dort etwas zu essen. Mein Lieblingsgericht war »Poulet im Körbli«, ein halbes gegrilltes Huhn in Soße mit Pommes.
Eigentlich hätten wir glücklich sein können, doch Stück für Stück veränderte sich die Stimmung bei uns im Haus. Meine Geschwister übernahmen mehr Verantwortung und kümmerten sich stärker um mich. Mein Vater zog aus dem Elternschlafzimmer aus und schlief im Wohnzimmer auf der Couch. Immer öfter stand dort morgens eine leere Flasche auf dem Tisch. Regelmäßig kam es zum Krach mit den Eltern, aber auch unter uns Kindern. Meine Mutter zog sich immer mehr zurück. Als irgendwann ein Arzt ins Haus kam und ihr einen Infusionsständer neben dem Bett installierte, erfuhr ich die schreckliche Wahrheit: Mutter hatte Krebs. Und es sah nicht gut aus.
Plötzlich verstand ich, warum wir nichts mehr gemeinsam unternahmen, nicht mehr im Haus spielten oder gar lachten. Jedes Geräusch war ihr zu viel.
Ich war zu viel.
So kam es jedenfalls bei mir an, wenn Vater mich bei jeder Gelegenheit anfuhr: »Kannst du keine Rücksicht nehmen?«
Er war völlig überfordert mit der Situation, doch das waren wir Kinder erst recht. Was wusste ich kleiner Bub schon von Krebs? Ich hatte gehört, dass es eine Krankheit war und sehr schlimm, dass man sogar daran sterben konnte. Aber meine Mutter konnte doch nicht einfach sterben. Oder doch?
Eines Nachts wachte ich von seltsamen Geräuschen auf. Ich konnte sie zuerst nicht zuordnen, doch dann realisierte ich, dass meine Mutter im Schlafzimmer den Vater rief. »Felix«, hörte ich sie wimmern. »Felix!«
Ich wartete auf seine Schritte, darauf, dass er zu ihr ging und sich um sie kümmerte, doch nichts geschah. Irgendwann stand ich selbst auf und ging ins Schlafzimmer. Als ich das Licht anschaltete, erstarrte ich vor Schreck. Mutter lag in einer Blutlache am Boden und rief immer noch leise »Felix«.
Ich schrie. Laut. Voller Entsetzen.
Jetzt wachte mein Vater auf. Ich hörte ihn herankommen, aber ich konnte meine Augen nicht von meiner Mutter abwenden. Ob sie jetzt sterben müsste?
Vater hob sie erst einmal auf und legte sie ins Bett. Er brachte mich ins Wohnzimmer – schlafen hätte ich sowieso nicht können – und rief den Notarzt. Dieser beruhigte uns. Meine Mutter war aufgestanden und gestürzt. Dabei hatte sie sich ungewollt die Infusionsnadel herausgezogen, deshalb war dort so viel Blut.
In den folgenden Tagen traute ich mich kaum, abends einzuschlafen. Was wäre, wenn sie wieder rufen würde? Was, wenn ich sie nicht hören könnte?
Kurz darauf starb Mutter. Eines Morgens lag sie einfach tot im Bett. Wir hatten alle gewusst, dass es so kommen würde, trotzdem konnte ich es nicht ertragen, sie blass und leblos auf ihrem Krankenlager zu sehen.
Später kamen ein paar Männer und holten sie ab. Ich verstand nicht, was passiert war. Sie musste doch gleich wieder zur Tür hereinkommen! Aber sie kam nicht mehr. Nie mehr.
In uns allen war etwas zerbrochen, und ich ahnte, dass nichts mehr so sein würde wie vorher. Damit war der schöne Teil meiner Kindheit vorbei.
ANDY WALTHER, Mecks Bruder, erzählt:
Einfach war es bei uns in der Familie nie gewesen. Das gehört zu meinen ersten Erinnerungen aus der Zeit, als wir noch im Wohnwagen mit den Eltern unterwegs waren. Auch als wir uns in Küssnacht niederließen, ging es uns finanziell sehr, sehr schlecht. Es war halt nie Geld da, um das zu kaufen, was gerade nötig war. Viele unserer Gespräche drehten sich ums Geld.
Damals wurde meine Mutter wieder schwanger, und Amara und ich bekamen bald mit, dass es irgendwelche Probleme gab. Erst im Nachhinein erzählten uns die Eltern, dass der Arzt bei einer Routinekontrolle während der Schwangerschaft etwas gesehen hatte, das sich dann als Krebs herausstellte. Es gab nur die Möglichkeit, das Kind abzutreiben und den Krebs zu behandeln oder das Kind auszutragen und zu riskieren, dass der Krebs danach nicht mehr behandelbar wäre. Die Eltern entschieden sich für das Kind, für Meck – mit dem Ergebnis, dass Mutter ein paar Jahre später starb.
Als Meck geboren wurde, lief unser Familienleben eigentlich so weiter wie vorher. Doch als er etwas größer wurde, war es schon sehr anstrengend. Er war noch nicht im Kindergarten und ich schon am Ende meiner Primarschulzeit. Der Altersunterschied zwischen uns war einfach zu groß. So hatten wir eigentlich keine gemeinsame Kindheit – es gab fast keinen Kontakt. Und seine Versuche, bei Amara und mir Aufmerksamkeit zu bekommen, brachten uns eher in Schwierigkeiten. Als kleiner Bub war er ein echter Rätschbäsä, eine Petze. Wenn er irgendetwas bei uns Großen mitbekam, wusste es der Vater sofort. Daher hielt ich Meck damals, so gut es ging, auf Abstand.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
AB INS HEIM
»Packt einen Koffer mit den Sachen zusammen, die ihr braucht«, sagte Vater eines Morgens zu Amara und Andy.
Ich war noch zu klein, um zu packen. Daher holte mein Vater den alten Koffer vom Schrank und packte meine Siebensachen selbst hinein.
»Was ist los?«, wollte ich wissen. »Fahren wir weg?«
»Hmmm«, machte er nur.
»Wohin geht’s denn?«
»Wirst schon sehen.«
Vielleicht ahnten meine Geschwister etwas, aber sie sagten nichts. Stumm packten wir unsere Kleidung ein, trugen die Koffer zum Auto und legten sie in den Kofferraum. Ehe wir uns versahen, saßen wir zu dritt auf der Rückbank und sahen ängstlich, wie wir das Ortsschild von Küssnacht hinter uns ließen.
Ich liebte Überraschungen, aber diese Tour ins Unbekannte ließ den Kloß in meiner Magengegend mit jedem Kilometer größer werden. Ich war erst vier, dennoch spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Die ganze Fahrt fühlte sich verkehrt an.
Nachdem wir eine Weile über Land gefahren waren, bog Vater schließlich in irgendeinem Dorf ab und kurvte in eine Gasse hinein. Vor einem großen, alten Haus hielt er an.
»Sind wir da?«, wollte ich wissen.
»Hmmm«, machte er wieder.
Wir nahmen unsere Koffer und gingen hinein. Ein älteres Ehepaar bat uns in ein Büro. Sie stellten sich als Heimleiter vor und hießen uns im Kinderheim willkommen.
Wir Kinder waren starr vor Schrecken. Das durfte doch nicht wahr sein!
Vater unterschrieb nur kurz ein paar Blätter, die ihm hingelegt wurden, erhob sich und ging zur Tür. Er sah uns nicht einmal richtig an. Wahrscheinlich konnte er es nicht.
»Also dann …«, sagte er und wollte den Raum verlassen.
»Vater, du kannst doch nicht ohne uns gehen«, rief ich.
Er zuckte die Achseln.
»Ist nur für eine kurze Zeit«, meinte er entschuldigend.
Dann ging er.
Als ich hörte, wie die schwere Haustür ins Schloss fiel, kamen mir die Tränen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Wie sollte es jetzt weitergehen?
Die ganze letzte Zeit war schwierig gewesen. Nichts war mehr wie zuvor. Unser Vater war offensichtlich mit uns und der gesamten Situation überfordert.
Deshalb suchte er nach drei Heimplätzen für uns Kinder und fand sie in einem Dorf im Luzerner Hinterland. Die zuständigen Ämter gingen von einer Übergangslösung aus, doch das Provisorium sollte länger dauern.
Als ich in mein neues Zimmer gebracht wurde – zusammen mit Andy, aber ohne Amara –, drehten sich meine Gedanken wie ein Karussell. Mir wurde ganz schwindelig. Lag es an mir, dass wir ins Heim mussten? War ich schuld? Hätte ich etwas daran ändern können? Würden wir dem Vater sehr fehlen? Würde er merken, dass wir zu ihm gehörten? Bestimmt käme er bald und würde uns wieder nach Hause holen …
Vater kam zwar zurück, doch nur, um uns ab und zu übers Wochenende zu holen. Danach brachte er uns immer wieder ins Heim. Die Frage nach dem Warum verbot er uns. Es war halt so.
Ich war noch nicht einmal fünf, als wir ins Heim kamen. Es lag am Ortsrand im Schatten einiger großer Bäume und wirkte ein bisschen wie ein Schulhaus. Die Kleine Emme floss nur hundert Meter entfernt vorbei. Das Haus wurde von einem Ehepaar geführt, das für die etwa zwanzig Kinder und Jugendlichen zuständig war. Die beiden kümmerten sich um alles, vom gemeinsamen Essen bis hin zu den Elternkontakten.
Das Heim war alles andere als eine große Familie und die beiden keine liebevollen Eltern für uns. Sie schlugen nie ein Kind, aber sie hatten ihre eigenen Methoden, um uns zu bestrafen oder zu schikanieren. Ich lernte schnell, ihnen aus dem Weg zu gehen, wo immer es möglich war. Aber ich litt.
Am schlimmsten waren die Nächte. Da fühlte ich mich besonders allein. Ich war der Jüngste im Kinderheim und ich fühlte mich abgeschoben.
Wenn ich morgens aufstand, ging ich mit den beiden anderen aus unserem Zimmer in den Waschraum. Wir wuschen uns kurz, putzten uns die Zähne, zogen uns an und gingen zum Frühstück. Das gab es im Erdgeschoss im Speisesaal an einem langen Tisch, wo wir alle zusammensaßen.
Während die anderen anschließend zur Schule liefen, konnte ich in meinen Hausschuhen in den Kindergarten gehen, der im Erdgeschoss des Hauses untergebracht war. Die anderen Kindergartenkinder wohnten im Ort und wurden von ihren Eltern gebracht, ich ging nur die Treppe hinunter. Das war schon praktisch.
Mein Lieblingsplatz im Heim war der große Garten. Dort gab es nicht nur einen Fußballplatz, sondern auch eine Wiese mit einem Totempfahl, der jedem Indianerdorf Ehre gemacht hätte – nur wären die Indianer sicher nie so daran herumgeklettert, wie ich es tat.
Was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist die Kleine Emme. So klein, wie der Name vermuten lässt, war das Flüsschen nämlich gar nicht. Es hatte ein paar Stauschwellen, hinter denen das Wasser tief genug war, um zu schwimmen.
Einmal waren wir mit etlichen Kindern und Jugendlichen aus dem Heim am Wasser, als mich ein Großer fragte: »Kannst du eigentlich schwimmen?«
»Nein.«
»Na«, meinte er, »dann wird es ja höchste Zeit.«
Damit packte er mich, hob mich hoch und warf mich in hohem Bogen ins Wasser.
Ich habe keine Ahnung, ob er mich im Blick hatte oder gerettet hätte. Gefühlt kämpfte ich dort um mein Leben. Immer wieder ging ich unter und schluckte jede Menge Wasser. Irgendwann blieb ich oben. Was blieb, war jedoch kein Triumphgefühl, sondern eine tiefe Abneigung gegen jedes Wasser, die lange anhielt.
Manches, was ich dort im Heim erlebte, konnte ich damals nicht richtig einordnen. Ich verstand es nicht oder dachte über Jahre, dass ich es mir nur eingebildet hätte. Dazu gehört auch das dunkelste Kapitel dieser Einrichtung. Als einer der Jüngsten im Heim musste ich jeweils eine Mittagsruhe halten. Während die Größeren ihre Hausaufgaben machten oder spielten, draußen tobten und lärmten, wurde ich ins Zimmer geschickt.
Regelmäßig öffnete sich eine Weile später meine Zimmertür. Bruno kam herein, einer der Ältesten im Heim. Er setzte sich zu mir, und wir redeten. Das war eine willkommene Abwechslung für mich. Damit bekam ich nicht nur Gesellschaft, sondern fühlte mich gleich wichtiger, weil er als Großer seine Zeit mit mir verbrachte.
Irgendwann meinte er beiläufig, er müsste mal meine Unterwäsche kontrollieren und nachsehen, ob ich mich nach der Toilette gut abgeputzt hätte. Also drehte ich mich herum, und er »kontrollierte«. Ich hatte keine Ahnung, wieso das so lange dauerte, was das für eine Flüssigkeit war, die danach an mir klebte, und warum mein Hintern so wehtat.
Von da an setzte Bruno sich nicht mehr zum Reden auf den Stuhl, sondern kam jedes Mal sofort zu mir ans Bett. Ich hätte damals nicht sagen können, dass das seltsam oder falsch war – mein ganzes Leben fühlte sich seltsam und falsch an.
Dass er mich über einen längeren Zeitraum sexuell missbrauchte, wurde mir erst ungefähr zehn Jahre später klar. Ich war mit meinem Bruder in der Stadt unterwegs und dabei sahen wir Bruno, der sich offensichtlich potenziellen Freiern anbot.
Andy meinte dabei: »Der steht schon lange auf Männer – vor allem auf kleine Jungs.«
Ich schluckte. Auf einen Schlag war die Erinnerung wieder da. Ich sagte nichts, aber ich fühlte mich mit einem Mal schmutzig und missbraucht.
Zum Glück waren wir als Geschwister in dem Heim zusammengeblieben. Auch wenn wir nur selten etwas miteinander unternahmen, waren wir immer noch eine verschworene Gemeinschaft. An etlichen Wochenenden und vor allem in den Ferien durfte ich nach Hause zum Vater. Doch war das noch unser Zuhause? Dauerhaft wohnen konnten wir bei ihm nicht. Außerdem hatte er sehr bald eine Freundin, mit der er zusammenlebte. So fühlten wir uns eher als unwillkommene Gäste denn als Kinder, wenn wir ihn besuchten.
Manchmal war ich während dieser Wochenenden mehr bei den Nachbarn als bei unserem Vater. Zu Wittwers, die nur ein paar Häuser entfernt wohnten, konnte ich immer kommen. Die Eltern stellten einfach wortlos einen weiteren Teller auf den Esstisch. Und Nici, der Sohn, war mir ein echter Freund.
Das Kinderheim konnte auch kein wirkliches Zuhause für mich sein, eine liebevolle Umgebung sah anders aus. So gab es an dem großen Esstisch, an dem wir alle Mahlzeiten einnahmen, eine Regel: Alles, was auf den Tisch kommt, wird zumindest probiert, auch Spinat und Rosenkohl. Das wäre im Prinzip okay gewesen, doch die Umsetzung funktionierte nicht.
Einmal gab es Kutteln. Die kann man mögen, muss man aber nicht. Ich konnte dem gekochten Kuhmagen noch nie etwas abgewinnen. Er sah aus wie ein Lappen, fühlte sich wabbelig an und roch seltsam säuerlich. Dazu bekam ich auch keine Probierportion, sondern einen ganzen Teller voll. Ich kämpfte die Kutteln herunter und war froh, dass ich es trotz Übelkeit geschafft hatte. Plötzlich stand der Heimleiter hinter mir.
»Fertig?«, fragte er.
»Ja«, antwortete ich erleichtert.
»Noch nicht«, meinte er und gab mir eine weitere Portion.
Natürlich war das Schikane, doch was sollte ich als kleines Kind dagegen tun?
Ich nahm meinen Löffel in die Hand, kämpfte mit den Tränen und aß weiter. Doch die zweite Portion war zu viel. Mir war so übel, dass ich brechen musste. In hohem Bogen spuckte ich über den Tisch. Das wiederum fanden andere Kinder so eklig, dass sie sich ebenfalls übergeben mussten.
So hatte sich der Heimleiter seine Schikane wohl nicht vorgestellt. Doch natürlich hatte ich Schuld und nicht er. Er packte mich, schob mich aus dem Speiseraum und die Treppe hoch, brachte mich in die Dusche und brauste mich eiskalt ab. Danach bekam ich Zimmerarrest.
Schläge bekam ich in diesem Heim nie. Aber immer wieder kalte Duschen. Gewalt hat viele Gesichter.
Ich verstand nicht, was ich falsch gemacht hatte. Ich hatte mir doch Mühe gegeben. Ich hatte unsere Essensregel eingehalten. Und trotzdem wurde ich bestraft.
Gut zwei Jahre war ich in diesem Heim. Dann wurde wieder alles anders.
Wahrscheinlich hat es viele ähnliche Vorfälle gegeben, vielleicht noch wesentlich drastischere. Jedenfalls wurde das Kinderheim vom Amt geschlossen.
Das Heimleiterehepaar kaufte sich daraufhin ein Chalet tief im Luzerner Hinterland. Es lag malerisch am Ende eines Seitentals. Ihre Lieblinge unter den Jugendlichen nahmen sie mit – und Andy, mein Bruder, war dabei.
Meine Schwester wurde in einer Pflegefamilie untergebracht, wohin genau, bekam ich damals nicht mit. Sie kam jedoch in der Familie nicht zurecht und hatte auch das Heimleben satt, deshalb lief sie davon. Erst später erfuhr ich, dass sie schon kurze Zeit danach auf dem Züricher Platzspitz gelandet war. Dieser Park in der Innenstadt war damals der bekannteste Treffpunkt für Drogensüchtige. Weil die Polizei lange nichts unternahm, deckten sich hier Tausende täglich mit Drogen ein. Der Platzspitz ging deshalb als »Needle Park« in die Geschichte ein – und die Spur meiner Schwester verlor sich hier.
Und ich? Ich kam nach einer kurzen Zeit bei meinem Vater mit sieben Jahren vom Regen in die Traufe: Ich wurde in die Gegend von Ruswil auf einen Bauernhof geschickt.
ANDY WALTHER, Mecks Bruder, erzählt:
Natürlich wussten wir schon länger von Vaters Plänen, uns in ein Heim zu geben. Eine ganze Weile vorher hatte er uns gesagt: »Ich schaff das nicht. Ich muss euch weggeben.« Und einen guten Monat bevor es ernst wurde, besuchten wir gemeinsam das Kinderheim und besichtigten es. Ich bin mir nicht sicher, ob Meck bei dieser Gelegenheit dabei war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er die ganze Aktion nicht mitbekommen hat – er war ja erst vier. Trotzdem war es für uns alle eine Katastrophe, tatsächlich im Heim zu landen. Liebe oder Wärme erfuhren wir überhaupt nicht.
Als Schüler kam für mich dazu, dass ich die Schule im Ort besuchen musste – und dort war ich von vorneherein als »Heimkind« unten durch. Meck hatte es da etwas leichter, weil er noch im Kindergarten war, aber er war der Einzige in seinem Alter und mit Abstand der Jüngste im Heim – das war sehr schwer für ihn. Weil der Kindergarten direkt im Haus untergebracht war, kam er nur selten weg vom Gelände und war den Heimeltern praktisch den ganzen Tag ausgeliefert. Dennoch war ich damals neidisch auf ihn. Er mag es nicht so empfunden haben, aber für uns war er Vaters Liebling.
Alle drei Wochen hatten wir ein Heimfahrwochenende. Meck durfte nach Hause, Amara und ich mussten zu unserem Onkel. Genauso war es in den Ferien. Und als das Kinderheim schließlich aufgelöst wurde, durfte er als Einziger heim – jedenfalls für eine Weile.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
VERDINGKIND AUF DEM BAUERNHOF
»Sag mal, arbeitest du oder schläfst du? Das geht ja gar nicht vorwärts.«
Erschreckt schaute ich zu René hoch, der schon ausholte und mir einen Fußtritt in den Hintern gab. Weil ich sowieso schon auf allen vieren war, fiel ich platt auf das Feld und landete mit dem Gesicht im Dreck.
»Haha, da gehörst du hin«, meinte der älteste Sohn des Bauern ungerührt und ging weiter.
Ich rappelte mich wieder auf, kniete mich neben die Reihe mit Rübenpflanzen und verzog sie weiter. So schnell ich konnte, zupfte ich die kleinen Pflänzchen aus und ließ nur die größten stehen. Doch die Reihe vor mir schien endlos und nebenan waren noch viele, viele weitere.
Ich ging zwar zur Schule, doch in erster Linie war ich zum Arbeiten auf dem Bauernhof. Ich war ein Verdingkind geworden.