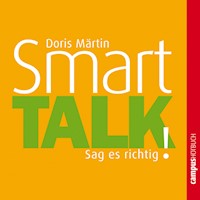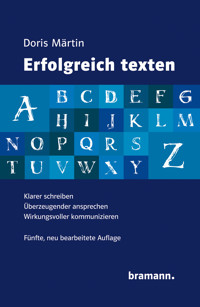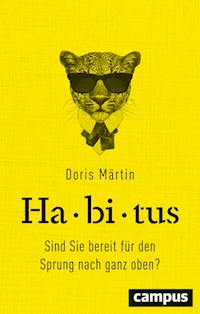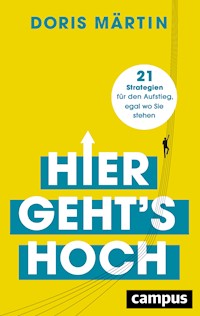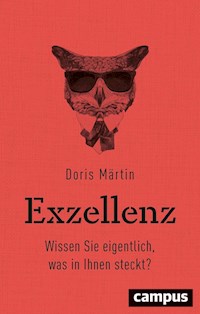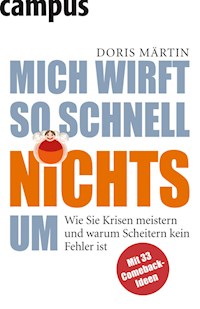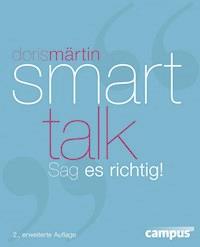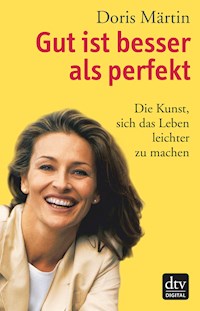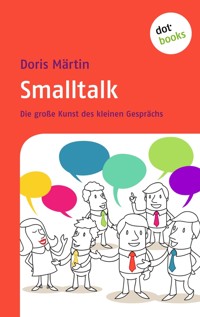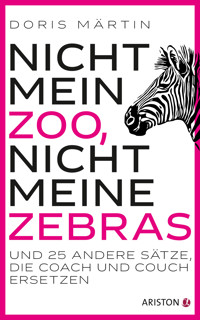
12,99 €
Mehr erfahren.
Mentale Snacks gegen den täglichen Wahnsinn
Wenn der Körper schlapp macht, wissen wir uns zu helfen: ein paar Nusskerne, ein Kaffee und wir finden zu gewohnter Form zurück. Vergleichbares gibt es auch für die Psyche, es ist uns nur nicht bewusst: Positive Leit- und Glaubenssätze liefern halb psychologisches, halb philosophisches Gedankenfutter, wenn wir ratlos sind oder die Welt nicht so will, wie wir es gern hätten. In solchen Momenten brauchen wir keinen Coach. Es reichen ein paar Worte, die uns aufbauen, beruhigen und zurück auf die Spur bringen.
Das ist kein Hokuspokus. Aus der Sprachpsychologie wissen wir: Worte prägen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Positive, einprägsame Sätze wirken im Gehirn wie ein Medikament – nur viel schneller. 25 mentale Snacks versammelt Doris Märtin in diesem Buch. Die meisten sind so fluffig wie Popcorn. Aber sie haben es in sich.
- Energiekugeln für die Seele: 25 motivierende und sofort wirksame Impulse für mentale Stärke
- Inspirationen für mehr Halt, Klarheit und Leichtigkeit im Alltag
- Liebevoll illustriert und ausgestattet – ein wunderbares Geschenk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mentale Snacks gegen den täglichen Wahnsinn
Wenn der Körper schlapp macht, wissen wir uns zu helfen: ein paar Nusskerne, ein Kaffee und wir finden zu gewohnter Form zurück. Vergleichbares gibt es auch für die Psyche, es ist uns nur nicht bewusst: Positive Leit- und Glaubenssätze liefern halb psychologisches, halb philosophisches Gedankenfutter, wenn wir ratlos sind oder die Welt nicht so will, wie wir es gern hätten. In solchen Momenten brauchen wir keinen Coach. Es reichen ein paar Worte, die uns aufbauen, beruhigen und zurück auf die Spur bringen.
Das ist kein Hokuspokus. Aus der Sprachpsychologie wissen wir: Worte prägen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Positive, einprägsame Sätze wirken im Gehirn wie ein Medikament – nur viel schneller. 25 mentale Snacks versammelt Doris Märtin in diesem Buch. Die meisten sind so fluffig wie Popcorn. Aber sie haben es in sich.
Zur Autorin:
Dr. Doris Märtin begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen, Organisationen und Persönlichkeiten beim Aufstieg und Auftritt. Als Autorin denkt sie über das gute, erfüllte Leben nach und gibt innovative Impulse für emotionale Intelligenz, persönliche Entwicklung, beruflichen Erfolg und Exzellenz auf Augenhöhe. Dabei verknüpft sie psychologische, philosophische und Management-Perspektiven und fasst sie in eine klare Sprache und einprägsame Storys. Zu ihren erfolgreichsten Büchern zählen Small talk. Die Kunst des kleinen Gesprächs, Erfolgreich texten, Gut ist besser als perfekt. Die Kunst, sich das Leben leichter zu machen und Habitus. Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben?. Ihre Bücher erscheinen unter anderem auch in China, Japan, Südkorea, den Niederlanden, Spanien und Italien.
Doris Märtin
Nicht
mein
Zoo,
nicht
meine
Zebras
und 25 andere Sätze,
die Coach und
Couch ersetzen
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2024 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Evelyn Boos-Körner
Illustrationen: Isabel Klett
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock Images LLC (1921653323)Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-31452-1V001
Inhalt
Natürlich spreche ich mit mir selbst: Ich brauche ja kompetente Beratung
1 Ich komme immer zurecht
2 Ich hau sie mit Freundlichkeit um
3 Nicht mein Zoo, nicht meine Zebras
4 Küss den Frosch gleich nach dem Frühstück
5 Darüber denke ich nicht einmal nach
6 Ich bin, wie ich bin. Alles andere ist mir zu anstrengend
7 Es gibt nichts Wohligeres, als zu Hause zu sein
8 Glaub dir nicht alles, was du denkst
9 Table for one, dinner for two
10 Wenn du nicht besser sein kannst als die Konkurrenz, dann zieh dich einfach besser an
11 Deine Firma liegt nicht nachts wach und denkt an dich
12 Gut ist besser als perfekt
13 Das sind keine Macken, das sind Special Effects
14 Up is, wenn up is, und nu is nich up
15 Ich greife nach den Sternen, selbst wenn ich am Ende nur auf dem Mond lande
16 Ein gutes Leben ist die beste Rache
17 No news, no shoes
18 Ich bin nicht neidisch, ich bin inspiriert
19 Paris ist immer eine gute Idee
20 Ich bin völlig unkompliziert, solange keine anderen Lebewesen beteiligt sind
21 Glänzt du noch oder strahlst du schon?
22 Weniger ist mehr. Außer bei Schokolade
23 Ich werfe alles hin und werde Prinzessin
24 Es steht auf meiner Liste
25 Awesome!
PS: Das ist ein Gedanke
Quellenangaben
Natürlich spreche ich mit mir selbst: Ich brauche ja kompetente Beratung
»Ich bin klug«, lese ich in schönster Kalligrafie auf Pinterest. »Ich bin stark. Ich gehöre dazu. Ich werde täglich besser und besser.« Fehlt eigentlich nur noch: »Ich werde Hollywoodstar.« Mal unter uns: Glauben Sie sich diese Art von Selbstgespräch? Bewährt es sich für Sie, morgens vor dem Spiegel die eigene Person schönzureden? Meine Erfahrung damit ist: Ich trage einstweilen lieber guten UV-Schutz auf. Dessen Wirksamkeit ist nämlich wissenschaftlich erwiesen. Krampfhafte Selbstbespiegelung hingegen flog schon der Stiefmutter in Schneewittchen um die Ohren. Denn Wunschdenken allein genügt eben nicht. Den Wirklichkeitstest müssen die Botschaften an uns selbst auch bestehen.
Wir können uns deshalb lang suggerieren, der Klügste im Raum, die Schönste im Land und demnächst so reich wie die Kardashians zu sein. Es nutzt nur nicht viel.1 Laut Studien zeigen positive Floskeln bei erfolgsgewissen Teilnehmern praktisch kein Ergebnis, wenig selbstbewusste Menschen ziehen sie sogar herunter. Positives Denken bewirkt also keine Wunder. Wir können uns die Welt nicht mal eben schöner reden, als sie ist. Es hat aber einen ungeheueren Effekt, wenn wir uns das Leben so erzählen, dass wir die Silberstreifen am Horizont erkennen.
Angeblich verbringen wir ein Viertel unserer Zeit mit lautlosen Gesprächen im Kopf. Wir beglückwünschen uns, feuern uns an, reden uns zu, vergleichen uns, machen uns Vorwürfe, hoffen das Beste, befürchten das Schlimmste und gelegentlich sprechen wir uns jedes Talent ab. Sie merken schon: Der innere Monolog hält uns auf Trab. Die Art, wie wir mit uns selbst sprechen, beeinflusst unser Selbstvertrauen, unser Wohlbefinden und unser Verhalten. Deshalb ist es klug, den »Self-Talk« um so viele förderliche Gedanken zu bereichern, wie es nur geht. Gedanken, die mehr Glück und Leichtigkeit ins Leben bringen. Gedanken, die Tür und Tor für kreative Lösungen öffnen. Gedanken, die Ihnen guten Mut schenken und das Vertrauen, dass Sie in jeder Situation zurechtkommen. Und nicht zu vergessen: Gedanken, die Ihrem Verstand schlüssig erscheinen. Anderenfalls würde er sie nämlich nicht glauben.
Solche produktiven Gedanken kann man bewusst trainieren. Mental gesunde Menschen müssen dazu nicht einmal einen Coach anheuern oder sich auf die Therapiecouch legen. In den meisten Situationen können Sie sich nämlich sehr gut selbst beraten. Sie brauchen dafür nur ein paar wirkungsvolle Impulse, eingelernte Denkmuster auf links zu drehen und die Dinge im Gespräch mit sich selbst mal anders als gewohnt zu betrachten. Am besten achten Sie auf den Tonfall Ihrer inneren Stimme so selbstverständlich wie darauf, genügend Wasser zu trinken oder etwas für den Rücken zu tun.
Wenn der Körper eine Stärkung braucht, wissen wir uns zu helfen: ein Stück Obst, eine Handvoll Nüsse, vielleicht ein Kaffee, schon finden wir zur gewohnten Form zurück. Ein vergleichbarer Energieschub täte auch der Psyche gut, wenn wir uns ein bisschen aus dem Lot fühlen und die Welt nicht so will, wie wir es gern hätten. Am unkompliziertesten hilft in solchen Fällen ein verrückender Gedanke, der das Denken in andere Bahnen lenkt. Denn die Psychologie wirkt im Wesentlichen über die Sprache. Beim Coaching und in der Therapie spielt der Dialog eine entscheidende Rolle. Unterstützende und erforschende Verbaltechniken sorgen dafür, dass wir Ereignisse anders wahrnehmen und darauf reagieren. Im sprachlichen Austausch entdecken wir unsere Ressourcen. Worte bringen uns in Bewegung und regen zur Selbstreflexion an. Coaches und Psychotherapeutinnen setzen deshalb ein breites Spektrum von Kommunikationstools ein, und wenn Sie aus einem mentalen Loch nicht mehr herausfinden, holen Sie sich am besten professionelle Hilfe.
Bei kleinen seelischen Durchhängern brauchen Sie dagegen nicht das ganze Programm. Meistens genügt es, wenn Sie selbst ein paar gute Strategien greifbar haben. Nichts Großes, Kompliziertes, einfach verschiedene Energieriegel für die Seele, die Sie die Welt freundlicher sehen lassen und dafür sorgen, dass es wieder einigermaßen geht. Tatsächlich gibt es solche Mood Foods fürs Gehirn. Sie kommen fertig vorgedacht und knackig verpackt als Spruch, Zitat oder Lebensweisheit daher. Ich für mich sammle sie seit Langem, vor allem wenn sie widersinnig genug formuliert sind, um Gewissheiten ratzfatz auf den Kopf zu stellen. Veränderungen zum Guten entstehen ja besonders dann, wenn man etwas anderes tut als das, was man gewohnheitsmäßig tut, obwohl es nicht optimal funktioniert. Aus diesem Grund klingen gute Mood-Food-Sätze immer eine Spur irritierend und vielleicht sogar provozierend. Sie fordern Sie heraus, Dinge neu zu denken und alternative Wege zu entdecken.
25 solcher Sätze habe ich in diesem Buch für Sie zusammengestellt. Manche von ihnen habe ich mir in Gesprächen abgelauscht, einige sind mir im Urlaub gekommen, andere finden sich in Büchern, in den sozialen Medien und bei berühmten Persönlichkeiten, sogar aus einem GAP-Store in San Francisco ist mir einer zugeflogen. Alle sagen mit wenigen Worten viel, und wenn man sie erst im Kopf hat, gehen sie dort so schnell nicht mehr raus. Als Miniimpuls liefern sie Ihnen Gedankenfutter, das erstaunliche Aha-Effekte hervorbringen kann. Wenn Sie also zwischendurch das Gefühl haben, eine Portion geistiges Superfood könnte Ihnen guttun, dann haben Sie ab jetzt immer einen unkomplizierten Energiekick zur Hand. Was soll ich lange reden: Am besten probieren Sie es einfach aus.
Schauen Sie sich entspannt in diesem Buch um, lassen Sie sich auf die Sätze ein, die Ihnen spontan am meisten sagen, und dann nehmen Sie sie in das Repertoire Ihres inneren Sprechens auf. Nach und nach kommt ein Impuls zum anderen, je nachdem, welcher Ihnen gerade geeignet erscheint, mehr Elan in Ihr Leben zu bringen. Küssen Sie den Frosch gleich nach dem Frühstück, kultivieren Sie Ihre Spezialeffekte, greifen Sie nach den Sternen, auch wenn Sie nur auf dem Mond landen, sprechen Sie mit sich selbst und unbedingt: Lassen Sie sich überraschen, was sich hinter dem Spruch verbirgt, der mich auf die Idee zu diesem Buch gebracht hat – »Nicht mein Zoo, nicht meine Zebras«. Und wenn Ihnen das alles in einem Durchgang zu viel ist, dann setzen Sie den Rest einfach auf Ihre Liste (ein Satz übrigens, der auch in meinem eigenen Repertoire ganz neu ist und mich schon jetzt Prioritäten viel entspannter sortieren lässt).
Vielleicht wollen Sie sich aber überhaupt nicht entscheiden. Vielleicht lesen Sie Bücher wie ich gern von A bis Z, weil man anderenfalls vielleicht das Beste verpasst. Besonders bei diesem Buch könnte das gut sein, denn Isabel Klett schenkt ihm mit ihren Illustrationen eine federleichte zweite Dimension. Wie Sie es auch angehen: Fühlen Sie sich willkommen! Lassen Sie sich ein auf die Wirkkraft der halb ernsten und voll wirksamen Mood-Food-Sätze. Und wenn Ihnen Ihre innere Stimme gelegentlich zu kritisch oder pessimistisch kommt, setzen Sie ihr einfach einen Spruch entgegen, der ihr die Schärfe nimmt. »One of the hardest things you will ever have to do is make peace between your ears«, habe ich bei der amerikanischen Coachin Brittany Burgunder gelesen.2 Frei übersetzt: Zu den schwersten Dingen im Leben gehört es, Ruhe zwischen den Ohren zu schaffen. Mit den richtigen Worten im Kopf klappt das oft verblüffend leicht.
1
Ich komme immer zurecht
Sie ist zehn Jahre alt, ihre Mutter ist früh gestorben und ihr Vater meistens im Ausland unterwegs. Sie hat keinen, der das Einmaleins mit ihr übt, und hieße sie nicht Pippi Langstrumpf, würde jeder halbwegs erwachsene Mensch denken, da muss doch jemand was tun. Doch zum Glück haben wir sie kennengelernt, als wir ungefähr so alt waren wie sie, und wie immer wir Pippilotta Efraimstochter fanden: Nicht im Traum wäre uns eingefallen, dass sie eine Pflegefamilie braucht oder einen Besuch vom Jugendamt.
Ich erinnere mich gut, wie sie mich faszinierte, kaum hatte ich das Lesen gelernt, ganz allein in ihrer heruntergekommenen Villa, mit den Goldkoffern und dem Pferd auf der Veranda. Ich konnte mich zwar nicht mit ihr identifizieren, dafür steckte zu viel von der braven Annika in mir. Aber wenn sie abends vor dem Schlafengehen ihrer Mutter im Himmel versicherte »Hab keine Angst, ich komme immer zurecht«, dann spürte ich: Pippi war nicht bloß stark, weil sie ihr Pferd hochheben konnte, und unabhängig, weil niemand sie ermahnte, wenn sie mit den Füßen auf dem Kopfkissen schlief. Sie besaß Superkräfte, weil sie die Bälle parierte, die das Leben ihr zuschoss. Und wenn Sie Pippi Langstrumpf kennen, wissen sie: Die waren nicht ohne. Doch Pippi heulte nicht. Sie blieb guten Mutes und fand einen Ausweg. Obwohl sie keinen Papa hatte, der sie raushaute, und keine Mama, die sie in die Arme nahm.
Auf Englisch heißt Pippis Haltung attitude, was nicht mit dem deutschen Wort Attitüde zu verwechseln ist, das eher in Richtung Pose und Gebaren weist. Attitude steht für die Einstellung, Herausforderungen und Zumutungen mutig anzupacken. In den angelsächsischen Ländern gilt sie als wichtiges Zeichen von Persönlichkeit. Vielleicht kennen Sie den Ausspruch des amerikanischen Motivationstrainers Zig Ziglar: »It is your attitude, more than your aptitude, that will determine your altitude.« Auf Deutsch: Mehr als dein Können entscheidet deine Einstellung über die Flughöhe, die du erreichst. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Wo es auf Spezialkenntnisse ankommt, beim Hautscreening zum Beispiel oder bei der Heizungsinstallation, messe ich dem Können die höhere Bedeutung bei.
Das war es aber auch schon mit den Einschränkungen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist »Ich komme immer zurecht« ein Satz, der es in sich hat. Wenn Sie aus dieser Haltung heraus handeln, wendet sich zwar nicht alles zum Guten. Auch der Glaube an die eigenen Fähigkeiten zaubert nicht weg, dass der Partner fremdgeht, das Kind gemobbt wird oder kein Arzt den Grund für die chronischen Schmerzen findet. Doch die Grundzuversicht, man wisse sich zu helfen, stabilisiert in jeder Lage Seele und Geist. Immer. Auch wenn man im Moment das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen kann und die üblichen Sprüche (»Das wird schon wieder«, »Da stehst du doch drüber«) schmerzhafte Erfahrungen nur bagatellisieren. Im Vergleich zu ihnen wirkt »Ich komme immer zurecht« ernüchternd nüchtern. Genau das gefällt mir daran. Weder wischt der neue Glaubenssatz Schwierigkeiten vom Tisch noch verspricht er uns das Blaue vom Himmel herunter. Er leugnet nicht, dass wir uns besorgt, durch den Wind oder sogar ziemlich am Ende fühlen. Sein Trost liegt in der Botschaft, dass wir trotzdem zurande kommen.
Man könnte heulen, wenn der Laptop den Geist aufgibt, die Katze seit vier Tagen nicht mehr nach Hause gekommen ist oder die Baufinanzierung in sich zusammenfällt. »Ich komme immer zurecht« bringt unsere innere Stimme in solchen Situationen dazu, optimistischer und lösungsorientierter zu sprechen. Wie kann ich mir in schwieriger Lage etwas Gutes tun? Was hat mir in einer ähnlichen Situation schon einmal weitergeholfen? Was kann ich tun, um die Situation zu entschärfen? Oder wenigstens nicht daran zu verzweifeln?
Wer sich als weniger hilflos erlebt (und sei es nur ein winziges bisschen), hat viel gewonnen. Denn jede klitzekleine Eigeninitiative verbessert die Lage. Von dieser Erfahrung erzählt die neuseeländische Schriftstellerin Claire Nelson in ihren faszinierenden Memoiren Things I Learned from Falling. Bei einer Solowanderung im kalifornischen Joshua Tree Park kam sie vom Weg ab, stürzte und zertrümmerte sich das Becken. Ohne Handyempfang und fast ohne Proviant lag sie bewegungsunfähig in der Mojave-Wüste. Kein Mensch wusste, dass sie unterwegs war, geschweige denn wo. Nach vier Tagen unter glühender Sonne und drei eiskalten Nächten wurde Claire wie durch ein Wunder gefunden. Dass sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte, verdankte sie nicht dem Glück, sondern der Haltung, auch in aussichtsloser Lage zu tun, was noch geht. Gegen die unerträglichen Schmerzen schluckte sie Aspirin. Aus einem T-Shirt und ihren Wanderstöcken bastelte sie ein provisorisches Sonnensegel. Solange sie Strom hatte, nahm sie Handyvideos von sich auf. Sie konnte sie zwar nicht versenden. Doch das Gefühl, irgendwie mit der Welt in Kontakt zu treten, gab ihr Kraft. Nichts davon befreite sie aus ihrer Lage. Es half ihr aber, sich am Leben zu halten. Wenn sie gerettet werden konnte, dann weil sie jede noch so unscheinbare Möglichkeit nutzte, die ihr geblieben war.
Wie viele Breitseiten haben Sie im Leben schon abbekommen? Wie viele Grenzsituationen haben Sie erlebt? Wie oft waren Sie von Angst, Unsicherheit oder Überforderung betroffen? Wann hat der ganz normale Alltagsstress Ihnen gefühlt den letzten Nerv geraubt? Und wie viel davon haben Sie gemeistert? Vermutlich sehr, sehr viel. So schwer es uns fällt, so weh es auch tut, meistens passen wir uns unfreiwilligen Veränderungen mit mehr Resilienz an, als wir für möglich halten. Auch wenn es kein Zuckerschlecken ist, wir kämpfen uns durch und kommen zurecht. Der Gedanke daran relativiert die Angst und ermutigt, sich auf die eigenen Kräfte zu besinnen. Zumal sich die meisten Katastrophen eher als kleiner denn als größer erweisen.
Gerade höre ich von einem Freund: Die Lungenentzündung, die schon ausgeheilt schien, hat sich zurückgemeldet. Eigentlich wollte er mit seiner Familie durch Frankreich reisen und an der Atlantikküste einen runden Geburtstag feiern. Der Wohnwagen war gepackt, die schönsten Stellplätze seit Langem gebucht, da zeigt das vermeintlich abschließende Röntgenbild: Aus der Reise wird nichts. Statt Schlemmen und Sport ist Abwarten und Schonen angesagt. Die ausgefallene Tour bedeutet sicher keinen Weltuntergang. Aber auch vergleichsweise geringe Enttäuschungen können uns in ein Loch stürzen, vor allem wenn sich auf absehbare Zeit nichts daran ändern lässt.
Alternativ halten wir es wie Pippilotta und gewinnen misslichen Situationen etwas irgendwie Positives ab. In der Frühlingssonne zu dösen, während die Lunge sich erholt, ist gewiss nicht das Schlechteste. Auch wie draußen die Apfelblüte weiß-rosa wogt, hätte man auf Reisen versäumt. Denn man wäre dann ja, so die Pippi-Logik, nicht zu Hause gewesen. »Und das wäre schade.« Zweckoptimismus? Mag sein. Doch die Haltung, aus dem Unvermeidlichen das Beste oder jedenfalls etwas Vernünftiges zu machen, gibt den Dingen einen anderen Dreh. Wenn nichts anderes hilft, kann es die wichtigste Veränderung sein, das Leben so anzunehmen und zu schätzen, wie es ist.
Düstere Gedanken bremsen uns aus. Wenn wir nicht aufpassen, konzentrieren wir uns bei Enttäuschungen und Problemen nur auf die negativen Aspekte. Das Schwierige und Schlechte rückt in den Fokus. Wir malen uns aus, wie schön das Leben sein könnte, wenn der Wunschzustand eingetreten oder der gute Lauf weitergegangen wäre. Die negativen Gedanken sind rational und berechtigt. Das Dumme ist nur: Sie ziehen uns runter und schränken das Verhaltensrepertoire ein. Man hält sich für technisch unbegabt und probiert nicht einmal, das Rad flottzukriegen. Man hasst Papierkram und beantragt erst gar keine Fördergelder. Wie auch, wenn man doch weiß, dass es eh nix wird? In Situationen wie diesen lohnt es sich, »Ich komme immer zurecht« in die innere Diskussion einzuspeisen. Im Handumdrehen erinnert uns der Satz an unsere Selbstwirksamkeit. Halb stupst er uns, halb pusht er uns aus der Panik, der Hilflosigkeit, dem Selbstmitleid heraus. Er bringt uns dazu, den Kopf einzuschalten und zu schauen, was wir tun können, auch wenn sich die Situation schwierig gestaltet.
Irgendwann, irgendwie treffen die Schleudern und Pfeile des Schicksals jeden von uns. Sie sind unangenehm und schmerzhaft, und oft können wir nicht einmal etwas dafür. In solchen Fällen profitieren wir davon, wenn wir dem Schweren unsere Kräfte und unseren Glauben entgegenstemmen. Denn etwas geht immer, erst recht, wenn man jede Menge Lebensklugheit hat, liebe Menschen, großartige Abschlüsse, gefragte Kompetenzen und hilfreiche Kontakte. Von unserer Einstellung hängt ab, ob wir auch aus widrigen Situationen etwas halbwegs Gutes herausholen. Weil wir uns nämlich selbst helfen, soweit es eben geht.
Menschen, die ihre Kompetenzen kennen, zeigen Verhaltensweisen, die sie erfolgreich machen. Sie sind von der inneren Überzeugung getragen, dass sie ihre Ziele verwirklichen und schwierigen Situationen gewachsen sind. Sie wissen, wie man sich beruhigt und Verantwortung für das eigene Leben übernimmt. Sie holen sich Hilfe, nehmen harte Schnitte in Kauf, akzeptieren Unvermeidliches und verstehen auch kleine Schritte in die richtige Richtung als Erfolg.
Die Frage ist, wie gelangt man zu dieser Einstellung? Ein Schlüssel liegt in unserem Attributionsstil. So bezeichnen Psychologinnen und Psychologen die Art, wie wir Widrigkeiten bewerten. Möglichkeit 1: Wir dramatisieren die Lage, indem wir verzweifeln, uns selbst niedermachen und nicht das kleinste Licht im Dunkeln erkennen (»Warum immer ich?«). Möglichkeit 2: Wir überlegen, wie wir im Auge des Orkans sinnvoll reagieren können (»Am wichtigsten ist jetzt …«).
Das klingt kompliziert? Das finde ich auch. Wenn etwas aus dem Ruder läuft, möchte ich nicht groß nachdenken, wie ich mir das Problem zielführend zurechtreden kann. Der Satz »Ich komme immer zurecht« nimmt uns diese gedankliche Arbeit ab. Instantmäßig ruft er uns unsere innere Stärke ins Bewusstsein. Probleme wirken plötzlich handhabbarer. Die Angst lässt nach, die Hoffnung wächst und damit auch die Motivation. Sie finden Provisorien, Zwischenlösungen und Alternativpläne. Mit jedem Erfolgserlebnis kehrt Selbstbewusstsein zurück. Mit jedem winzigen Schritt erweitert sich Ihr Repertoire, mit Widrigkeiten klarzukommen. Sie nehmen unangenehme Situationen sportlich und wissen immer besser: Was auch passiert, Sie sind nie vollkommen hilflos. Wenn das Leben nicht in Ordnung ist, hängen Sie sich erst recht rein. Mit allen Ressourcen, die Sie haben. Möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar, lässt sich der Idealzustand nicht wiederherstellen. Vielleicht ist ein Traum für immer geplatzt. Ganz sicher bleibt die Lage auf absehbare Zeit schwierig. Aber bestimmt finden Sie etwas Besseres, als an der Situation zu verzweifeln.
Das Beste aus dem nicht so Tollen zu machen, darauf verstand sich auch Astrid Lindgren, die Frau, die Pippi Langstrumpf erfunden hat. Die berühmteste Kinderbuchheldin der Welt wäre nämlich vielleicht nie erdacht worden, hätte nicht Lindgrens Tochter Karin in einem kalten Stockholmer Winter krank und fiebrig im Bett gelegen. Es war 1941, und außerhalb von Schweden fiel die Welt in Trümmer. »Erzähl mir von Pippi Langstrumpf«, keuchte Karin zwischen zwei Hustenanfällen, und ihre Mutter hatte keine Ahnung, wer diese Pippi war. Also erfand sie ein Mädchen mit karottenroten Zöpfen, mit einem kleinen Affen, der Herr Nilsson heißt, und einem Pferd namens Herr Onkel … Drei Jahre später brachte Astrid Lindgren die Pippi-Geschichten zu Papier, während sie selbst eine Verletzung auskurierte. Es bedurfte einiger Anläufe und einer Umarbeitung, ehe sie einen Verlag für ihr Manuskript fand. Der Rest ist bekannt: Pippi Langstrumpf wurde bis heute millionenfach verkauft und in über 75 Sprachen übersetzt. Wie ihre Heldin hat Astrid Lindgren sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen: Sie kannte keine Angst und kam immer zurecht. Mit diesem Gedanken im Kopf geht vieles leichter. Ich würde sogar behaupten: alles.
2
Ich hau sie mit Freundlichkeit um
Ein heißer Juliabend. Ein bröckelndes Renaissanceschloss Untermalt von den Stimmen tobender Kinder zelebriert ein Jazzquartett Standards und Balladen. Die Stimmung ist so heiter wie im Sommerfilm. Dann entschweben die Saxofontöne, und die Sängerin leitet zum nächsten Song über: »Es gibt immer anstrengende Menschen, Verwandte, Kollegen, denen man nicht ausweichen kann«, sagt sie mit dunkler Stimme ins Mikro. »In solchen Fällen ist es am besten, finde ich, wir hau’n sie mit unserer Freundlichkeit um. Hilft ja nichts.« Sie nickt der Band zu, der Sound setzt ein, und es kommt: »The world can be a nasty place.« Und weiter: »See, we don’t have to fall from grace / Put down the weapons you fight with / And kill ’em with kindness.« Die Sängerin Selena Gomez hat den Track geschrieben. Seither hat er sich als moderner Standard etabliert.
Kill them with kindness. Der Gedanke klingt paradox, ist aber nicht neu. Er tauchte schon vor über 400 Jahren bei Shakespeare auf. Allerdings war er mir bis vor Kurzem ein bisschen zu mörderisch. Viel besser gefällt mir die Übersetzung, die ich beim Jazz gehört habe. Schaut man genau hin, erweist sich das Wort »umhauen« nämlich geradezu als Wundertüte der Konfliktlösung. Es bedeutet: 1. zu Fall bringen, 2. die Widerstandskraft beeinträchtigen, 3. verblüffen und 4. begeistern. »Hau sie mit Freundlichkeit um« bietet uns also einen Strauß von Möglichkeiten, Spannungen einzufangen, einzudämmen, aufzulösen. In einer Welt, in der die Werte und Vorstellungen auseinanderdriften, liegt darin ein unschätzbarer Vorteil.
Gestern zum Beispiel. Auf dem Supermarkt-Parkplatz stauen sich die Autos. Der Fahrer hinter mir drängelt, jemand hupt, Einkaufswagen versperren den Weg. Das ganz normale Abendchaos. Links vor mir schiebt sich aus der Parkbucht ein Wagen. Glück gehabt, freue ich mich, lasse den anderen ausscheren, fahre an und sehe, wie aus der Gegenrichtung ein dunkler SUV in den frei gewordenen Parkplatz schießt. Mein Fuß tritt auf die Bremse, meine Hand bewegt sich in Richtung Hupe, auf meinen Lippen formt sich ein Zorneswort, dann bremse ich mich. Will ich dem Vordrängler jetzt wirklich eine Szene machen? Ich atme durch und umrunde den Parkplatz noch einmal. Ein paar Minuten später, der Vorfall ist schon vergessen, reihe ich mich am Fischstand ein. Im gleichen Moment spricht mich jemand von der Seite an. Ich kenne ihn von irgendwoher. Der Leiter des Bauamts, fällt es mir ein. Vor ein paar Jahren hat er mit viel großzügiger Auslegung unsere etwas schwierige Baugenehmigung ermöglicht. Es täte ihm leid, höre ich ihn sagen. Ich verstehe nicht gleich. Dann fallen die Worte »Auto« … »Parklücke« … »nicht beabsichtigt« …, und ich zähle eins und eins zusammen. Wie gut, dass ich gefasst geblieben bin.
Nicht jeder Kleinkrieg löst sich mit einer Entschuldigung in Wohlgefallen auf. Das wäre wunderbar, doch Freundlichkeit funktioniert auch einseitig. Entgegen landläufiger Vorstellung können wir auch allein einiges tun, um Spannungen zu lösen. Dabei hilft ein Prinzip, das Sie vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben: die Macht der Homöostase oder Konstanterhaltung. Will heißen: Systeme tendieren dazu, einen ausgeglichenen Zustand aufrechtzuerhalten beziehungsweise nach einer Störung wiederherzustellen. Hinter dem Automatismus steht eine Art Selbstregulation, die auch im Umgang mit Menschen zum Tragen kommt. Grundsätzlich streben nämlich Gruppen, von der Familie bis zur Eigentümergemeinschaft, nach Stabilität, um möglichst gut funktionieren zu können. Gerät das Miteinander aus irgendeinem Grund aus der Balance, zum Beispiel, weil jemand sich im Ton vergreift, verhindern kleine Ausgleichreaktionen anderer Beteiligter, dass die Stimmung entgleist. In der Fachsprache heißt das: Die Homoöstase des Beziehungsgeflechts wird wiederhergestellt.
In der Regel genügt dafür ein leichtes, sachtes Gegenlenken. Statt mit harten Bandagen zu kämpfen, lässt man Unstimmigkeiten oder unpassende Kommentare passieren, auch wenn man die Kraft hätte, sich dagegenzustellen. Weder erregt man sich noch unterwirft man sich. Stattdessen macht man weiter, als wäre nichts gewesen. Hinter der verhaltenen Reaktion steht die Absicht, im Gespräch zu bleiben, zumindest aber den Konflikt kleinzuhalten. Schließlich sieht man sich meist öfter im Leben, und Streit und Uneinigkeit haben noch selten zu etwas Gutem geführt. Auch unserem Wohlbefinden tun wir den größten Gefallen, wenn wir nicht auf jede Provokation eingehen: Freundlichkeit lässt nachweislich den Blutdruck sinken und flutet uns mit Glückshormonen wie Oxytocin und Serotonin. Menschen, die beim kleinsten Anlass explodieren, erhöhen dagegen ihr Infarktrisiko und schwächen ihr Immunsystem. Trotzdem ist die Neigung nicht totzukriegen, bei Widerständen reflexhaft die Ellenbogen auszufahren.
»Es ist so viel einfacher, gemein zu reagieren«, sagt Selena Gomez, die die Botschaft »Kill ’em with Kindness« in die Welt trägt, und spricht aus, was wir alle kennen. »Es ist so einfach, den eigenen Gefühlen nachzugeben, und so schwer, aus der Situation rauszugehen und die größere Person zu sein.« Der Wunsch, Stärke zu zeigen und sich zu wehren, ist menschlich. Die Angst, den Kürzeren zu ziehen, auch. Deshalb klingt der Vorsatz, unter allen Umständen die Haltung zu wahren, vor allem theoretisch gut.
Wenn der Kunde ausrastet, die Chefin das Wort Anerkennung nicht kennt oder die Freunde fröhlich das beste Zimmer im gemeinsamen Ferienhaus beziehen, ist freundliche Gelassenheit nicht das Erste, wonach uns der Sinn steht. Niemand lässt sich gern kränken oder missachten. Wer kann, demonstriert lieber Macht statt Milde. Wer keinen Streit will oder sich eine Auseinandersetzung nicht leisten kann, zieht sich zurück. Weder das eine noch das andere bewirkt etwas Gutes. Angriffslust verstärkt den Durchsetzungsdrang der Gegenseite und schaukelt den Konflikt hoch. Passivität überlässt Angreifenden das Feld, und macht schon allein deswegen nicht glücklich. Bleibt als dritte Reaktion passive Aggressivität: Man zeigt sich nach außen verständnisvoll, während man hintenrum lästert, mauert oder sabotiert. Wer so handelt, bleibt in Deckung und verschafft sich trotzdem Genugtuung. Das entlastet zwar, passt bei Ihnen aber vermutlich so wenig ins Selbstbild wie bei mir.
Wie wir es also drehen und wenden, egal ob wir Konflikte aggressiv, passiv oder passiv-aggressiv angehen, irgendein Haken bleibt immer. Schon allein deshalb lohnt es sich, »Ich krieg sie mit Freundlichkeit rum« oder wie immer Sie es für sich formulieren, in den inneren Monolog aufzunehmen. Ich kann Ihnen zwar nicht versprechen, dass Friedlichkeit unverschämte Gegenspieler schachmatt setzt. Niemand kann das. Die kanadischen Organisationspsychologinnen Kirsten Robertson und Jane O’Reilly haben aber in einer Managementstudie herausgefunden: Freundlich-bestimmte Reaktionen zeigen mehr Wirkung als alle impulsiven Streittaktiken zusammen. In der Mehrzahl der Fälle deeskalieren sie die Situation und senken die Unhöflichkeit in der Interaktion.3 Nettsein kann also direkt entwaffnen. Ich finde, das ist eine Ansage, über die es sich lohnt nachzudenken.
Doch es kommt noch besser: Um unter Feuer ruhig zu bleiben, brauchen Sie kein großes Redetalent. Emotional auf eine höhere Ebene zu steigen, erweist sich gerade dann als Option, wenn Ihnen ein Angriff mal kurz die Sprache verschlägt. »Hau sie mit Freundlichkeit um« lebt ja gerade nicht von schlagfertiger Rhetorik, sondern von elementaren Umgangsformen: einen deplatzierten Einwand überhören, ein ungutes Wort verhallen lassen, ein unangemessenes Verhalten überspielen, höflich bleiben. Mehr braucht es nicht, um unangenehme Mitmenschen respektvoll und sehr souverän in die Schranken zu Weisen. »When they go low, we go high«, hat Michelle Obama gesagt. Frei übersetzt: Wenn andere sich danebenbenehmen, reagieren wir mit Stil und Anstand.
Diese Freiheit kann Ihnen niemand nehmen. Niemand zwingt Sie, dass Sie Fehlverhalten und Fiesheiten Ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie bestimmen, was Sie triggert. Was kein Echo findet, verpufft ins Leere. Wenn Sie wollen, thematisieren Sie ohne Unterton und Bewertung das Offensichtliche: »Mein Vorschlag irritiert Sie« oder »Du hast es eilig«. Noch einfacher blicken Sie erstaunt, lächeln zerstreut und machen weiter im Text. So, als wäre überhaupt nichts gewesen.
Viele Angreifer sind überwältigt, wenn sie kein Echo finden. Sie rechnen mit allem Möglichen. Nur nicht mit nichts. Keine Angst, kein Widerspruch, kein Einknicken, kein Ausrasten, keine Verteidigung, nicht einmal ein »Ich verbitte mir diesen Ton«. Die Verblüffung darüber will erst mal verarbeitet sein. Inzwischen können Sie in Ruhe überlegen, ob der Vorfall ein Nachspiel braucht. Und, wenn ja, wie Sie notwendige Wahrheiten mit einem Lächeln servieren und Grenzen in gesichtswahrende Worte kleiden. Idealerweise übergehen Sie die Entgleisung und formulieren stattdessen Ihre Vorstellung von einem freundlichen Miteinander: »Ich möchte das gern sachlich klären.«
Vielleicht lassen Sie Ihren Ärger aber auch abperlen und den Vorfall auf sich beruhen. Bei nächster Gelegenheit trinken Sie mit der anstrengenden Kollegin oder dem unkooperativen Teenager einen Kaffee oder Kakao, reden miteinander, tauschen sich aus, hören zu und geben zu erkennen, wie wichtig es Ihnen ist, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten gesehen werden. Nehmen Sie sich Zeit, einen Draht zueinander zu finden, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu verfolgen.
Und das klappt? Einen Versuch ist es wert, und das Risiko, das Sie dabei eingehen, eher klein. Die meisten Menschen sind keine wild gewordenen Trolls, auch wenn sie sich manchmal so benehmen. Sie lassen sich mit Freundlichkeit gewinnen und von guten Vorbildern beeinflussen. Vielleicht wollen sie nur sicherstellen, dass sie nicht zu kurz kommen. Vielleicht bedauern sie die eigene Schroffheit im Nachhinein und kommen von allein zur Einsicht. Beziehungen vor überkochenden Emotionen zu schützen, ist kein normierter Prozess, sondern ein Weg der Versuche und Irrtümer. Was funktioniert, was ist zu viel, was zu wenig, mit dieser Person, in dieser Sache, in dieser Situation?
Von allen Varianten des Streitverhaltens stresst und schädigt es am wenigsten, wenn zumindest ein Streitpartner überbordende Gefühle im Zaum hält. Im Zweifelsfall übernimmt diese Verantwortung die Klügere oder der Kühlere. Denn der Mensch, der, warum auch immer, auf Krawall gebürstet ist, ist dazu nicht in der Lage. Jedenfalls nicht in diesem Moment.