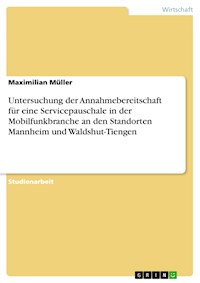Haftung des eintretenden Gesellschafters für Altverbindlichkeiten der GbR E-Book
Maximilian Müller
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 16, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (FB Rechtswissenschaften), Veranstaltung: Gesellschaftsrechtliches Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Seitdem der Bundesgerichtshof im Jahr 2001 die Gesellschaft bürgerlichen Rechts für rechtsfähig erklärt hat, stellen sich verschiedene Fragen im Umgang mit einer GbR. Besondere Relevanz im wirtschaftlichen Verkehr kommt dabei der Frage nach einer Haftung des eintretenden Gesellschafters für Altverbindlichkeiten der GbR zu. Soll der Gesellschafter tatsächlich für solche Schulden persönlich und akzessorisch mit seinem eigenen privaten Vermögen haften, auch wenn er die Schulden nicht (mit-)verursacht hat? Kann § 130 HGB auch für die GbR im Wege des Analogieschlusses herangezogen werden oder geht dies angesichts der Unterschiede zwischen einer OHG und einer GbR doch zu weit? Auf diese Fragen versucht das vorliegende Buch eine Antwort zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 12
a) Keine Schützwürdigkeit des Gläubigers - 11 -
b) §130 HGB als handelsrechtliche Sondernorm - 11 -
c) Bedeutung der Ausgestaltung anderer Gesellschaftsformen - 12 -
d) Kein Verkehrsbedürfnis für die Anwendung des §130 HGB - 13 -
e) Schutzwürdigkeit des neuen Gesellschafters - 13 -
f) Ablehnung aus verfassungsrechtlichen Gründen - 13g) Zusammenfassung - 14 -
1) Gesetzesimmanente Rechtsfortbildung - Vorliegen einer Lücke - 15 -
a) Der Wortlaut der §§705ff BGB - 15b) Historische Materialien - 16 -
c) Gesetzliche Systematik der §§705ff BGB - 16 -
i) Die Systematik der GbR nach dem Gesetzestext - 16 -
ii) Veränderung durch neue Rechtssprechung? - 18 -
d) Ergebnis - 18 -
2) Gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung - 19 -
II) Bedürfnis des Rechtsverkehrs - Rolle des Gläubigerschutzes - 20 -
Page 13
Page 1
A) Einleitung
I) Historische Entwicklung
Die Frage nach der Haftungsverfassung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) stand lange Zeit im Mittelpunkt gesellschaftsrechtlicher Diskussionen.1Hierbei standen sich die auf Ulmer zurückgehende
Doppelverpflichtungstheorie2und die insbesondere im vergangenen Jahrzehnt aufgekommene Akzessorietätslehre3gegenüber. Beide im Schrifttum in der Vergangenheit nahezu mit paritätischen Verhältnissen vertretenen Modelle versuchten eine persönliche Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsschulden zu begründen.