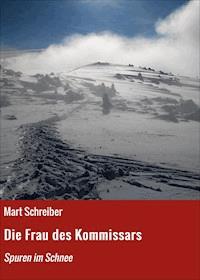2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Anruf seiner Mutter aus dem Pflegeheim lässt vergrabene Erinnerungen aus seiner Kindheit wieder erwachen. Frau Murer war einst eine gehässige und streitbare Nachbarin und ist nun im Pflegeheim aufgenommen worden. Gustavs Mutter fühlt sich von ihr bedroht. Erste Vorfälle scheinen dies zu bestätigen. Und Gustav durchlebt seine trostlose Kindheit und ein dramatisches Ereignis am Beginn der Pubertät noch einmal. Das Verbrechen, das er damals begangen hat, holt ihn wieder ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mart Schreiber
Halterberg
© 2021 Mart Schreiber
Umschlagentwurf:
germancreative(Fiverr) unter Verwendung eines Fotos von depositphotos.com
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-39022-5
Hardcover:
978-3-347-39023-2
e-Book:
978-3-347-39024-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Hinweis:
An einigen Stellen in diesem Roman werden sexuelle Handlungen beschrieben und es wird rohe Sprache verwendet.
Prolog
Gustav erblickte in einer Kellerwohnung das Licht der Welt. Es geschah an einem späten Nachmittag im April, der nicht launisch und ausgesprochen trocken war. Die Verhältnisse waren düster, es drang wenig Licht durch die beiden Oberlichten in den Raum. Von den am Gehsteig Vorbeigehenden sah man kaum mehr als die Schuhe, die sich mit einem mehr oder weniger lauten Klacken und Klappern ankündigten. Während Gustavs Mutter in den Wehen lag und stöhnte, sah die Hebamme ab und an zu den Schuhen hinauf. Sie versuchte zu erraten, zu wem die Schuhe gehörten. Dann wandte sie sich wieder der Gebärenden zu und zeigte ihr, wie sie zu atmen habe, damit die Wehen leichter zu ertragen waren.
Der Vater war mit den beiden älteren Kindern in die Konditorei gegangen, die sich im selben Haus befand. Er arbeitete dort als Bäcker, die Kellerwohnung war ein Teil seines kärglichen Salärs. Die Geburt verlief unspektakulär, Gustav kam zwei Wochen später als errechnet zur Welt und wog fast viereinhalb Kilo. Er schrie erst, als er einen kleinen Klapps auf den Po bekam, dann aber umso kräftiger. Der erste Sohn war nach dem Vater benannt worden. Dessen strenger Stiefvater trug den Namen Gustav, da der Überlieferung nach dessen Mutter die Musik des Komponisten Gustav Mahler über alles geliebt hatte.
Nur ein Jahr später bemerkte Gustavs Vater rötlichen Pusteln an seinen Händen. Zunächst versuchte er es selbst mit einer Fettcreme, aber der unangenehme Ausschlag breitete sich immer mehr aus. Das Jucken wurde immer unerträglicher, er konnte nicht aufhören, sich blutig zu kratzen. Aus Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, gelang es ihm fast einen Monat lang, den immer schlimmer werdenden Zustand seiner Hände vor dem Bäckermeister zu verbergen. Schließlich konnte er es nicht mehr verheimlichen, er wurde zum Arzt geschickt, der eine Mehlallergie diagnostizierte. Für Gustavs Vater hatte diese Diagnose schlimme Folgen, er wurde gekündigt. Mit seiner Familie durfte er aber in der Kellerwohnung bleiben. Um Frau und Kinder zu versorgen, nahm er eine Stelle als Tankwart an und hatte fortan durch diese Arbeit meist schmutzige Hände. Gegen Öl und Schmierfett war er zum Glück nicht allergisch.
Als Gustav in sein fünftes Lebensjahr eingetreten war, bekamen die Eltern eine Gemeindewohnung am Rande der kleinen Stadt zugesprochen. Bevor sie in die neue Wohnung zogen, verbrachte sein Vater dort eine Nacht, mit einer Axt bewaffnet. Gustav fand das seltsam, stellte aber keine Fragen, als er davon hörte. Er war auch nicht beunruhigt. Es erschien ihm nicht ungewöhnlich, dass man vor dem Einziehen in eine neue Wohnung dort mit einer Axt schlief. Noch spielten die Geschwister, Gustav hatte eine Schwester und einen Bruder, im Hinterhof der Kellerwohnung. Es war ein verwildertes Rechteck, in dem allerhand Gerümpel herumstand.
Als es dann so weit war, dass er mit seiner Mutter und den Geschwistern zum neuen Gemeindebau ging, während der Vater im VW-Bus seines Chefs mitfuhr, in dem der Hausrat der Kellerwohnung eingeladen worden war, ergriff ihn eine drückende Angst. Er erinnerte sich daran, dass sein Vater eine Nacht mit einer Axt bewaffnet in der neuen Wohnung verbracht hatte. War es dort so gefährlich? Musste man damit rechnen, überfallen und ausgeraubt zu werden? Ohne ein Wort zu sagen, begann er zu weinen. Seine Schwester, die drei Jahre älter als er war, versuchte ihn zu trösten. Sein Bruder ignorierte das Weinen und kaute stoisch an einer Semmel. Er solle nicht heulen, schimpfte seine Mutter. In der neuen Wohnung würden alle mehr Platz haben und sogar eine Badewanne gäbe es da. Sie müssten nicht mehr über einen kalten dunklen Gang zu einem Waschbecken oder Plumpsklo gehen, wo man manchmal Ratten begegnen konnte.
Die neue Wohnung bestand aus zwei Zimmern, einer Küche, einem kleinen Badezimmer und einem separaten WC. Das Fenster, eine Oberlichte, zeigte im WC, genauso auch im Badezimmer, in Richtung Küche. Deshalb roch es in der Küche nicht immer nach gekochtem Essen, sondern nach der Toilette und im Badezimmer wiederum nach gekochtem Essen. Im ersten Raum befand sich das Wohnzimmer. Hier stand ein Bett, das am Tag senkrecht an der Wand hochgeklappt war, bis auf den Kopfteil, der diente als Sofa. Im zweiten Raum waren ein großer Kasten und drei Betten für die Kinder untergebracht. Etwas eng war es hier, so blieb nicht viel Platz zum Spielen übrig. Da aber der Vater schon früh am Morgen mit dem Rad zur Tankstelle fuhr und erst zehn, manchmal sogar zwölf Stunden später wieder nach Hause kam, durften die Kinder im Wohnzimmer spielen. Vom französischen Balkon aus, im Kinderzimmer, konnte man eine Böschung sehen, die sich nach rechts zu einem, für diese flache Gegend beträchtlichen Hügel, hinaufzog. Zwei schmale Pfade führten gleich hinter dem Gemeindebau auf den Hügel und ein grasbewachsenes Plateau, von dem man weit in die ebene Umgebung blicken konnte. Viel interessanter als der Rundblick waren für die Kinder jedoch Lehmhöhlen, die am Rande des Plateaus oder etwas unterhalb auf ihre Entdeckung warteten. Zum größten Teil waren diese Höhlen nicht auf den ersten Blick zu sehen. Man musste schon durch dichtes Gestrüpp hindurch, um die Höhleneingänge zu finden. Gustavs älterer Bruder Jakob hatte schon bald das Interesse an den Höhlen und dem Gestrüpp verloren, an dem er sich mitunter durch dornige Zweige die Hände und Arme aufkratzte. Die Schwester wollte sich von Anfang an nicht schmutzig machen. Gustav jedoch brannte darauf, Höhle für Höhle zu erkunden. Er versuchte, sie mit einer kleinen Spielzeugschaufel zu erweitern, was ihm nicht gelang. Manchmal verbrachte er mehr als eine Stunde in einer Höhle. Die Rufe seiner Mutter, sofort nach Hause zu kommen, drangen nicht bis zu ihm. Wenn er schließlich die Wohnung betrat, waren Hände, Schuhe und die Hose voller Lehmspuren, besonders dann, wenn es kurz davor geregnet hatte. Seine Mutter war wenig begeistert, stellte ihn mitsamt der Kleidung in die Badewanne und duschte ihn mit kaltem Wasser ab. Gustav mochte das kalte Nass nicht, aber sein anfängliches Gezeter und Schreien verstummte schnell. Er ließ es einfach über sich ergehen. Schlimmer als das kalte Wasser war der Hausarrest, den die Mutter gegen ihn verhängte, denn er konnte nicht zu seinen Höhlen gehen. Zu seinem Glück vergaß sie oft schon am nächsten Tag darauf.
Der Halterberg zog auch einige andere Kinder in seinen Bann, aber nicht viele. Möglicherweise hatten die Eltern den Kindern verboten, in diese unberührte Wildnis hinaufzugehen. Die Kinder, denen es nicht verboten wurde oder die sich einfach über den Willen der Eltern hinwegsetzten, spielten Cowboy und Indianer, begaben sich in den Höhlen auf Schatzsuche oder bauten Lehmburgen. Gustav erzählte seiner Mutter nichts von den Höhlen am Halterberg, er befürchtete, sie würde auch ein Verbot aussprechen. Beim Spielen freundete sich Gustav mit einem gleichaltrigen Buben namens Toni an. Toni wohnte nicht in den drei neuen Gemeindebauten. Er lebte mit seinen Eltern in einem schmucken Einfamilienhaus mit Garten, unweit vom Halterberg. Zum ersten Mal schmerzte es Gustav, dass seine Familie, also auch er, viel weniger Geld zur Verfügung hatte als andere. Er war noch nie in Tonis Elternhaus gewesen, aber das Auto davor reichte schon aus, damit sich Gustav arm, klein und unwichtig vorkam. Tonis Vater arbeitete in der Erdölförderung, die es damals noch in dieser Gegend gab. Gustav sah ihn ein einziges Mal. Bei der Gelegenheit erkundigte sich Tonis Vater nach Gustavs Familie und erwähnte dann, dass er seinen Vater gut kenne. Er sei ein sehr freundlicher Tankwart, sagte er. Gustav schämte sich und lief rot an. Sein Vater musste Tonis Vater bedienen, ihm die Scheiben putzen und für einen Schilling Trinkgeld einen Buckel machen. Gustav konnte nicht verstehen, warum sein Vater viel weniger Geld verdiente als andere Väter, die sich ein Auto leisten konnten und vielleicht sogar in einem Einfamilienhaus lebten. Beim Spielen mit Toni vergaß er aber schnell wieder seinen Kummer, auch dass seine Eltern kein Auto hatten. Seine Mutter erwähnte immer wieder, dass sie sparen müssten. Nie kaufte sie den Kindern beim Fleischhauer eine Wurstsemmel. Manchmal gab die nette Verkäuferin den Kindern ein dünnes Blatt der Extrawurst, die himmlisch schmeckte. Zu Hause wurden die Brote für die Kinder mit Margarine, manchmal auch mit Schmalz bestrichen, für den Vater wurde ein Achtel Butter im Kühlschrank bereitgehalten.
Über ihnen im ersten Stock wohnte eine Familie mit Namen Murer, die ebenfalls zwei Söhne und eine Tochter hatte. Das Auto von Herrn Murer parkte unter dem Klopfbalkon des Kinderzimmers. Es war ein großer Ford, Gustav kam er jedenfalls wie ein riesiger Straßenkreuzer vor und wesentlich eindrucksvoller als das Auto von Tonis Vater. Oft wurde Gustav vom Zuschlagen der Autotür und dem Starten des Motors am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen. So wurde ihm jeden Tag bewusst gemacht, dass seine Familie kein eigenes Auto hatte. Herrn Murers dunkelblaue Limousine war für Gustav etwas Unerreichbares, Überirdisches, aber Wünschenswertes. Der Straßenkreuzer war immer sauber und glänzte blank poliert. Der Wagen strahlte wie ein Schmuckstück. Wenn Gustav vom Balkon, der nur dreißig Zentimeter nach außen ragte, auf das Autodach schaute, spiegelte sich bei entsprechendem Sonnenstand sein Gesicht darin.
Kapitel 1
Er hatte seiner Mutter auf seinem Handy den Klingelton Homecoming zugeordnet. Die, nach einem Glockenspiel klingende, Melodie erinnerte ihn an ein Kinderlied. Den Ton wählte er vor einigen Jahren intuitiv, also ohne sich über seine Auswahl Gedanken zu machen. Erst viel später meinte er, die Melodie als Reminiszenz an seine Kindheit gewählt zu haben. Seine Mutter war die Einzige, für die er einen persönlichen Klingelton eingerichtet hatte. Seit einigen Jahren war sie im Pflegeheim und rief ihn mehrmals am Tage an, auch zu ungewöhnlichen Zeiten wie am frühen Morgen. Aber sie rief auch an, wenn er gerade aß oder am WC saß und das nervte ihn. Sie rief an, wenn er Sex hatte oder wenn er seine Morgenrunde lief. So auch dieses Mal. Wenn er trainierte, hielt er beim Joggen immer das Handy in seiner linken Hand. Das hatte er sich so angewöhnt, nicht um immer erreichbar zu sein, sondern eher für den Fall, dass er im Gelände stürzte. Das war ihm schon einmal passiert und wegen der Schwere der Verletzung konnte er nur mehr humpeln. Damals hatte er kein Handy mit und musste sich auf einen nahen Weg schleppen, der frequentierter war als der vom Wild ausgetretene Pfad, auf dem er sich befand.
Seine Mutter rief also an. Am Klingelton erkannte er sie und musste nicht aufs Display blicken, so konnte er konzentriert weiterlaufen. Nach dem Duschen würde er sie zurückrufen. Als sie wegen ihrer Stürze zu Hause im Pflegeheim aufgenommen wurde, hatte sie noch kein Handy. Für einen Anruf musste sie das Festnetztelefon, das in ihrem Zimmer stand, benutzen. Dazu musste sie natürlich aufstehen, was ihr oft viel zu beschwerlich war. Später hatte Gustav ihr ein Handy mit großen Tasten für Senioren geschenkt und es gleich wieder bereut. Nun konnte sie ihn auch vom Bett aus im Liegen anrufen. Der häufigste Grund für ihre Anrufe war die Frage, wann er sie wieder besuchen käme. Auch wenn er ihr sagte, dass es erst in zwei Wochen möglich sein werde, rief sie ihn trotzdem spätestens am nächsten Tag wieder an und stellte die gleiche Frage. Oder sie beschwerte sich am Telefon über die slowakische Pflegerin oder erzählte ihm, das Mittagessen schmeckte so schlecht, dass sie es stehen lassen musste. Fast immer klagte sie zusätzlich über ihre Schmerzen und erkundigte sich zu guter Letzt nach seinem Befinden. Sie mache sich Sorgen, sagte sie dann. Sie habe geträumt, dass er in einen Unfall verwickelt war und verletzt in einem Spital lag.
An ihrer Telefonrechnung, die Gustav regelmäßig beglich, konnte er sehen, dass sie mehrmals die Woche mit seiner Schwester in Teneriffa telefonierte. Diese war mit ihrem neuen Mann nach Teneriffa gezogen, zwei Jahre, nachdem die Mutter ins Pflegeheim musste. Nicht zum ersten Mal war sie zu Hause gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Dann musste sie viele Stunden am Boden verbringen und auf Hilfe warten. Er hatte seine Mutter gebeten, nur einmal in der Woche ihre Tochter in Teneriffa anzurufen, weil diese Gespräche recht teuer waren. Im Laufe der Zeit ließ er sie aber gewähren. Am Geld sollte das Glück seiner Mutter nicht scheitern. Er verdiente genug und hatte es zu einem ansehnlichen Wohlstand gebracht.
Am Joggen konnte er sich nicht mehr erfreuen. Gewissensbisse befielen ihn, er fürchtete, seine Mutter würde enttäuscht sein. Was war schon dabei, wenn er ein paar Worte mit ihr wechselte und ihr damit einen Gefallen tat. Allerdings war es nicht leicht, ein Gespräch mit ihr wieder zu beenden. Ständig fiel ihr etwas Neues ein oder sie wiederholte bereits Gesagtes, um ihn länger am Telefon zu beschäftigen. So manches Gespräch musste Gustav abrupt beenden, da sie einfach ignorierte, dass er das Telefonat wegen eines Termins nicht fortsetzen konnte. Wenn er sie auf seinen Job hinwies, in dem er auch viel telefonieren musste, redete sie einfach ohne Unterbrechung weiter. Er wollte sie doch nicht kränken, aber es blieb ihm nichts anderes übrig als »Mach’s gut. Auf bald.« zu sagen und auf das rote Telefonsymbol zu klicken.
Er rief sie vor dem Duschen zurück.
»Du musst mich sofort hier herausholen«, sagte sie in großer Aufregung.
»Warum denn? Was ist passiert?«
»Sie ist da!« sagte die Mutter aufgeregt.
»Wer ist da?«
»Der Teufel, du weißt schon.«
Gustav war verwundert und hatte keine Ahnung, wen sie damit meinen könnte.
»Die Murer ist da. Sie muss gestern aufgenommen worden sein.«
»Ja, und wo ist dein Problem?«
»Sie wird mich umbringen. Erinnere dich doch.« Die Mutter konnte sich gar nicht beruhigen.
Die Murers waren damals aus dem Wohnhaus ausgezogen, noch bevor er die Schule in Wien begann. Niemand wusste, wo sie dann wohnten, aber das war Gustav letztlich auch egal. Wichtig war nur, den Murers nicht mehr über den Weg zu laufen und ihren Gehässigkeiten und manchmal sogar Handgreiflichkeiten ausgeliefert zu sein. Weder die Kinder noch die Eltern sah er jemals wieder.
»Das ist doch Jahrzehnte her, liebe Mutter.«
Sie mochte es nicht, wenn er Mutter zu ihr sagte. Mama wollte er sie aber nicht nennen. Das erschien ihm zu vertraut, zu intim, viel zu wenig distanziert.
»Aber jetzt ist sie da. Sie hat mich auch gesehen und nicht gegrüßt.«
»Hast du sie gegrüßt?«
»Nein, warum sollte ich. Schön dumm wäre ich, sie auf mich noch aufmerksam zu machen.«
»Hör doch auf mit den alten Geschichten, liebe Mutter«, sagte er.
»Hol mich sofort da raus!« Ihr Befehlston ärgerte Gustav.
»Wie soll das denn gehen? Du bist dort gut versorgt. Deine Tochter lebt in Teneriffa, sie kann sich nicht um dich kümmern und ich habe absolut keine Zeit für deine Pflege.«
»Dann wird sie mich zerstören und du schaust einfach zu. Dabei solltest gerade du wissen, wie gefährlich sie ist. Erinnere dich an die schwere Verletzung, die sie dir mit dem Eimer zugefügt hat.«
Gustav hielt inne. Er dachte an seinen Bruder Jakob, wie war es ihm gelungen, Distanz zu der Mutter zu wahren und sich rauszuhalten? Warum rief sie ihn nur selten an? Aus Angst, von ihm grob abgewiesen zu werden? Warum besuchte er sie bloß zweimal im Jahr, einmal um ihren Geburtstag herum und dann noch vor oder nach Weihnachten? Warum redete seine Mutter trotzdem nur nett über ihn? Es lag wohl daran, dass er seiner Mutter gegenüber konsequent geblieben war. Mehr als einige Anrufe im Jahr und die beiden Besuche konnte seine Mutter nicht von Jakob erwarten. Irgendwann hatte sie es akzeptiert.
»Ich muss jetzt Schluss machen«, sagte er unvermittelt und legte schnell auf. Er nahm sich vor, sie am frühen Abend nochmals anzurufen. Hoffentlich hatte sie sich bis dahin wieder beruhigt. Welche konkrete Gefahr sollte von Frau Murer ausgehen? Sie war eine alte Frau geworden und sicher nicht mehr in einem guten Gesundheitszustand. Andernfalls wäre sie nicht im Pflegeheim gelandet. Seine Mutter hatte schon immer zur Hysterie geneigt. Sie konnte – wie man so sagt – aus einer Mücke einen Elefanten machen, eine Nebensächlichkeit zur Bedrohung anwachsen lassen. Wenn jemand sie nicht grüßte, empfand sie das als Ablehnung oder Bösartigkeit. Dass diese Person in diesem Moment vielleicht nicht aufmerksam war und an etwas anderes gedacht haben konnte, kam ihr nicht in den Sinn.
Er frühstückte alleine, seine Freundin, eine Ärztin für innere Medizin, war noch im Nachtdienst. Sie arbeitete in einem Spital, das für die Hauptstadt Österreichs doch klein war. Komisch, dass die Murer wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht war. Hatte die Familie weiterhin in der kleinen Stadt gewohnt und war sie nur ans andere Ende gezogen? Im Bezirk musste sie geblieben sein, sonst wäre die Murer nicht in diesem Pflegeheim gelandet. Vor dem Umzug der Murers war deren Tochter nicht mehr nach Hause gekommen und trotz intensiver Suche blieb sie verschwunden. Wie hieß sie gleich? Gustav wunderte sich, dass ihm der Name nicht sofort einfiel. Vera. Wollte ihm sein Gehirn helfen, nicht mehr an sie erinnert zu werden? Nur er wusste den Grund um Veras Verschwinden. Er hatte sie umgebracht. So war das, er hatte sie getötet und dann so getan, als wüsste er von nichts. Wie konnte er das nur vergessen oder verdrängen? Vielleicht einen Monat danach wurde sein Vater auf dem Weg zur Arbeit von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Zur gleichen Zeit wurde Herrn Murers Auto als gestohlen gemeldet.
Viele Jahre quälte ihn der Gedanke an Veras Tod. Immer wieder überlegte er, zur Polizei zu gehen und ein Geständnis abzulegen. Aus Furcht vor Strafe blieb es bei der Überlegung. Er erzählte niemandem von seiner Tat, keiner Menschenseele.
Das schlechte Gewissen machte ihm sehr zu schaffen. Einige Jahre hatte er eine Therapie gemacht, um die Panikattacken und die Schlaflosigkeit in den Griff zu bekommen. Beim Therapeuten traute er sich nicht von Vera zu erzählen, nichts von seiner Tat, die er im Affekt begangen hatte. Sein eigenes Leben musste er retten, dieser Gedanke half ihm. Wenn er sich auf diesen Gedanken konzentrierte, fühlte er sich weniger schuldig. Mit seinem Therapeuten war er seine Kindheit rauf und runter durchgegangen. Es gab genügend Ereignisse, die als traumatische Erlebnisse gelten konnten. Der Therapeut arbeitete sich daran ab und glaubte, dass Gustav das Trauma seiner Kindheit überwinden konnte, wenn er es im Gespräch quasi noch einmal durchlebte. Nach zwei Jahren beendete Gustav die Therapie. Er hatte keine Panikattacken mehr und konnte mit einem schlaffördernden Antidepressivum leidlich gut durch die Nacht kommen. Vera war aus seinem Bewusstsein verschwunden. Er hatte seine Tat erfolgreich verdrängt. Zu den ersten Therapiesitzungen war er mit dem Vorsatz gekommen, ein Geständnis abzulegen und sein Gewissen zu erleichtern. Der Therapeut war gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es würde keine negativen Konsequenzen haben, wenn er sein Herz bei ihm ausschüttete. Im Gegenteil, nur so konnten seine Schuldgefühle aufgearbeitet werden, nur so konnte er vom Therapeuten eine Absolution bekommen. Gustav hatte Gründe für seine Tat. Die damaligen Ereignisse waren mehr als dramatisch gewesen, er konnte nicht anders handeln. Mehr als einmal hatte er das Bedürfnis, dem Therapeuten von Vera zu erzählen, doch kein erstes Wort dazu kam über seine Lippen. Irgendetwas hielt ihn davon ab. Er war sich nicht sicher, wie der Therapeut reagieren würde. Vielleicht würde er Gustav überreden wollen, bei der Polizei ein Geständnis abzulegen. Vielleicht würde er Gustav damit drohen, die Therapie abbrechen zu müssen, wenn Gustav nicht zur Polizei ginge. Vielleicht würde er argumentieren, dass Veras Eltern ein Recht auf die Wahrheit hätten. Gustav war damals noch nicht strafmündig gewesen. Er konnte auch im Nachhinein nicht bestraft werden. Aber er konnte die Sache aufklären und so der Familie Murer helfen, mit dem Verlust ihrer Tochter und Schwester abschließen zu können. Im Laufe der Zeit traten Vera und die Tat immer mehr in den Hintergrund, wurden verdrängt. In der Therapie gab es auch vieles andere aufzuarbeiten. Beruflich war Gustav sehr erfolgreich. Das bedeutete Arbeit, viel Arbeit. So viel Arbeit, dass er sich kaum um etwas Privates, Persönliches kümmern wollte und konnte. Vielleicht hatte ihm die Arbeit mehr geholfen als die Therapie. Es könnte auch beides zusammen gewesen sein.
Am Abend rief er seine Mutter an. Sie erzählte ihm, dass Frau Murer ihren Kuchen gestohlen habe.
»Die stellen den Kaffee und den Kuchen vor meine Tür, wenn ich das Schild <Bitte nicht stören> an den Türgriff hänge. Ich habe mich hingelegt und wollte nicht aufgeweckt werden. Doch diesmal fehlte der Kuchen. Der Teller mit einigen Bröseln darauf stand noch auf dem kleinen Tablett, auch die kleine Gabel, um den Kuchen zu essen. Der Kaffee war da, aber nicht mehr der Kuchen. Noch nie ist das vorgekommen, nicht, seit ich hier bin. Stell dir vor, einfach weg.«
»Und warum soll Frau Murer den Kuchen genommen haben, Mutter?«
»Ich war vorne bei der Stationsleitung und habe nachgefragt, ob sie mir diesmal keinen Kuchen zum Kaffee gebracht haben. Aber selbstverständlich war auch der Kuchen auf dem Tablett, haben sie mir gesagt. Hundertprozentig. Und jetzt sag du mir, warum der Kuchen weg ist. Den Kaffee wollte die Murer wohl nicht, der war ja noch da. Wer weiß, ob sie überhaupt Kuchen isst, vielleicht hat sie ihn weggeworfen. Könnte doch sein, dass sie das nur aus Boshaftigkeit macht, so wie damals. Du weißt schon.« Ihre Worte klangen verschwörerisch.
»Liebe Mutter, du musst aufpassen. Sei vorsichtig mit solchen Beschuldigungen, für die es keinerlei Beweise gibt.«
»Du meinst, so wie damals, als sie das Attentat auf dich begangen hat.«
»Bitte vergiss doch, was einmal gewesen ist. Das ist alles ewig her.«
»Das Böse verschwindet nicht. Denn ein Mensch, der so böse ist wie die Murer, bleibt es das ganze Leben lang. Vielleicht kann es sich im Alter zum Besseren ändern, aber selbst die Hälfte dieser Bösartigkeit reicht noch aus, um Schlimmes anzurichten.« Die Hartnäckigkeit der Mutter war verblüffend.
»Du könntest doch einmal mit Frau Murer reden. Macht euch bekannt, vielleicht hat sie sich verändert. Die Zeit geht an Menschen nicht spurlos vorbei. Viele werden im Alter sanft und friedlich.«
»Bist du verrückt? Wenn du mich nicht herausholst, werde ich Jakob fragen.«
Gustav lachte. »Ausgerechnet Jakob, der sich kaum um dich kümmert. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen oder mit ihm telefoniert?«
»Das ist jetzt nicht wichtig und nicht der Punkt. Wenn ich ihn brauche, wird er da sein.«
Die Frau Murer entpuppte sich schon kurz nach dem Einzug in den Gemeindebau als Schrecken seiner Familie. Sein Bruder hatte davon wenig mitbekommen. Er war mit zehn Jahren in einem katholischen Knabenseminar aufgenommen worden und durfte in den Ferien oft bei Tante Rosi sein. Gustav war sich nicht sicher, ob er Frau Murer im Pflegeheim begegnen wollte, aber seine Neugier meldete sich. Er schwankte zwischen Neugierde und Angst hin und her. Würde er ihr in die Augen blicken können? Würde bei ihm nicht alles wieder aufbrechen? Er fürchtete es insgeheim und er spürte auch, dass der Aufbruch schon im Kopf begonnen hatte. Gustav konnte nicht verhindern, dass die Bilder von Vera dem Archiv seines Gehirns entstiegen. Sie breiteten sich förmlich vor seinen Augen aus, sie machten ihn unruhig.
Jakob meldete sich bei Gustav. Was das solle, fragte er. Warum er mit Kaffeetratsch belästigt werde. Was denn überhaupt passiert sei. Die Mutter habe wirres Zeug geredet, von einem verschwundenen Kuchen und von Frau Murer. Langsam zweifle er an ihrem Verstand. Ob Gustav nichts unternehmen könne. Mutter müsse ein Medikament gegen ihre Verwirrtheit bekommen. Er habe jedenfalls keine Zeit für solche Spompanadeln. Am Samstag spielt er ein Konzert im Musikverein. Darauf muss er sich nun konzentrieren.
Wieder der Morgenlauf. Die Mutter rief nicht an. Anstatt sich zu freuen, rätselte Gustav über den Grund. Glaubte sie, dass Jakob sie abholen würde? Da konnte sie lange warten. Vielleicht hatte sie sich einfach beruhigt. Es war nichts weiter passiert. Nichts jedenfalls, das man, selbst mit der blühenden Fantasie seiner Mutter, als eine Bösartigkeit von Frau Murer interpretieren konnte. Beim Frühstück mit seiner Freundin fragte er, ob sie ihn am Sonntag beim Besuch seiner Mutter begleiten könnte. Er hat sie doch erst vor einer Woche besucht. Ja, das stimmt. Nur jetzt ist etwas passiert, was die Mutter sehr beunruhigt. Er erzählte ihr, dass sie Frau Murer vor kurzem im Pflegeheim gesehen hatte, als neue Bewohnerin. Seine Freundin wusste, wer Frau Murer war. Er hatte ihr manchmal Bruchstücke aus seiner Kindheit erzählt, mehr um ihr Drängen, von ihm mehr aus seinem Leben zu erfahren, zu beschwichtigen als aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus. Auch Veras Verschwinden war in seinen Erzählungen vorgekommen, nur seinen Anteil daran hatte er ausgespart. Seine Freundin musste lachen. Das sei wie im Film. Die verfeindeten Frauen begegnen einander im Pflegeheim wieder, stoßen zusammen. Das sei der Stoff für eine Komödie, meinte sie. Oder für eine Tragödie, sagte Gustav. Er möge sich nicht von seiner Mutter in den Streit hineinziehen lassen. Es sei doch nichts passiert. Ach ja. Und nein, sie könne am Sonntag nicht mitkommen, sie hätte Dienst. Leider. Eine Kollegin sei krank geworden.
Es vergingen zwei Tage, an denen sich seine Mutter nicht bei ihm meldete. Er hatte so viel um die Ohren, dass er es gar nicht bemerkte. Bis am Abend des zweiten Tages seine Freundin fragte, ob sich Gustavs Mutter wieder beruhigt habe. Er zuckte zerstreut mit den Schultern. Sie habe die letzten zwei Tage nicht angerufen, antwortete er. Ob das nicht komisch sei, da sie normalerweise täglich anruft, fragte seine Freundin. Und ob er nicht bei der Station anrufen wolle, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Gustav nahm sich vor, gleich nach dem Morgenlauf zuerst die Mutter und, wenn die sich nicht meldete, die Station anzurufen. Jetzt war es schon zu spät dafür.
Am nächsten Tag verzichtete er auf den Morgenlauf.
Sein Magen fühlte sich flau an, im Mund schmeckte er Reste von Magensäure. Am Abend davor hatte er einige Gläser Rotwein getrunken und eine unruhige Nacht verbracht. Auch sein dumpfer Kopf war keine gute Voraussetzung für Sport. Nach dem ersten Espresso rief er seine Mutter an. Nach längerem Läuten landete er in der Mailbox. Eine leichte Beunruhigung setzte bei ihm ein. Also jetzt die Station anrufen, sagte er leise zu sich. Er musste es lange läuten lassen, bis endlich eine Pflegerin abhob. Sie war verwundert, dass er über das Missgeschick der Mutter nicht informiert war. Die Mutter wäre vorgestern gestürzt und hätte sich den rechten Oberarm gebrochen. Zum Glück ein glatter Durchbruch direkt unter der Schulter. Jetzt läge sie meistens im Bett. Ob sie einen Gips habe, fragte Gustav. Nein, das sei in diesem Fall nicht möglich. Sie müsse einen Gilchristverband tragen. Gilchristverband? Damit fixiere man die Schulter und auch den Arm am Körper. Ob sie das Telefon nicht abheben könne? Das habe man ihr abnehmen müssen, damit sie die rechte Hand und den Arm nicht unnötig belaste. Gustav sagte, man möge ihr schöne Grüße ausrichten. Am späten Nachmittag werde er sie besuchen. Die Pflegerin antwortete, dass ein Besuch gut für das Wohlbefinden seiner Mutter wäre. Sie müssten ohnehin unter vier Augen mit ihm reden. Warum denn? Gustav war verwundert. Die Pflegerin deutete an, dass seine Mutter eine andere Patientin verdächtigte, sie von hinten gestoßen und so zu Sturz gebracht zu haben.
Kurzerhand verschob er die Termine am Nachmittag und machte sich nach Mittag in die Stadt seiner Kindheit auf. Er rief aus dem Auto seine Schwester in Teneriffa an. Sie hob nicht ab. Er sprach ihr auf das Band. Er wollte mit jemandem sprechen, also dann mit Jakob, dachte er. Auch Jakob war nicht erreichbar und Gustav war sich sicher, dass er sich einfach nicht melden wollte. Irgendwann schnappte die Verbindung ab. Nicht einmal eine Nachricht auf der Mailbox konnte er hinterlassen. Seine Mutter hatte also sofort eine Schuldige gefunden, die ihren Sturz verschuldet hatte. Wenn an der Anschuldigung etwas dran wäre. Vielleicht doch?
In seiner Kindheit hatte es das Pflegeheim noch nicht gegeben. Erst vor ungefähr fünfzehn Jahren wurde das Heim auf einem Acker errichtet, zirka hundert Meter entfernt von einer Siedlung mit wenigen Einfamilienhäusern. Nun war nur mehr die Rückseite des Heims unverbaut. Es verfügte über einen großen Garten, der, natürlich durch einen Zaun getrennt, an ein Maisfeld grenzte. Gleich neben dem Heim hatte man später eine Ambulanz hingestellt. Das Pflegeheim machte einen freundlichen, gepflegten Eindruck, sowohl die ansprechende Fassade als auch die inneren Räumlichkeiten. Das Entree war großzügig über zwei Stockwerke verteilt. So konnten darin zwei riesige Palmen fast ein Gefühl eines Urlaubshotels vermitteln. Wären da nicht alte und zum Teil gebrechlichen Menschen im Rollstuhl sitzend oder einen Rollator vor sich herschiebend gewesen. Die meisten von ihnen wirkten abwesend, manche aber grüßten laut und nickten mit dem Kopf, sichtlich erfreut, einem anderen Menschen zu begegnen. Gustav schien für die Bewohner des Heimes noch im Leben zu stehen. Mit ausladenden Schritten strebte er Richtung Stiegenaufgang. Er grüßte die Leute, die ihm begegneten, kurz zurück, konnte aber doch Enttäuschung in ihren Gesichtern sehen. Sie wurden nicht von ihm besucht, er hatte auch keine Worte des Zuspruchs oder der Aufheiterung für sie parat. Ohne sich umzusehen, nahm er rasch die Stufen in den zweiten Stock und ging direkt zum Zimmer seiner Mutter. Sie lag wie erwartet im Bett. Ihr rechter Arm war oberhalb des Bauches am Körper fixiert, der Oberarm seitlich nach unten und der Unterarm angewinkelt.
»Endlich holst du mich ab«, sagte sie forsch zur Begrüßung. Als sie versuchte sich aufzurichten, gelang es ihr nicht. Durch die Anstrengung keuchte und jammerte sie.
»Bleib doch liegen«, sagte er und beugte sich für einen flüchtigen Kuss über sie. Es kostete ihn Überwindung, ihren Atem zu spüren, ihr körperlich so nahe zu sein. Diese Frau war nicht mehr seine Mutter, vielleicht schon nicht mehr, als er Vera ermordet hatte. Eher hätte er sich damals einem Fremden anvertraut als ihr. Er hatte sich mutterseelenallein und verlassen gefühlt. An dieser Einsamkeit hatte sich im Laufe der Jahre für ihn wenig geändert. Der Mutter fiel die Stimmung des Sohnes nie auf, sie beanspruchte ihn und forderte seine Zuneigung. Er konnte sich nicht einfach davonstehlen. Mitleid, das war es, er hatte Mitleid mit ihr. Er hatte mit Jakob noch nie darüber geredet, ihn gefragt, wie er zur Mutter stand. Wie sollte er auch? Seine Gespräche mit Jakob waren immer kurz und oberflächlich geblieben. Mit wem waren seine Gespräche nicht oberflächlich? Hatte er jemals einer anderen Person sein Herz ausschütten können? Nicht einmal dem Therapeuten hatte er seine Tat, Veras Ermordung erzählt. Es gab keinen Menschen, dem er sich anvertrauen hätte wollen.
»Du machst ja Sachen.« Er zog einen Stuhl zum Bett der Mutter und setzte sich zu ihr.
»Die Murer war’s«, sagte sie trotzig. »Sie hat mich von hinten gestoßen. Ich habe sie nicht gleich bemerkt, aber als ich schon am Boden lag, war sie ganz knapp hinter mir und hat Hoppala gesagt.«
»Aha. Du hast also nicht gespürt, dass sie dich gestoßen hat.«
»Doch. Aber realisiert habe ich es erst, als ich schon gestürzt war. Du kennst sie ja von früher. Wenigstens du musst mir glauben.«
»Hat es jemand gesehen?«
»Nein. Natürlich nicht. Die Frau ist raffiniert. Das weißt du doch noch.«
»Hm. Also, du hast keinen Stoß gespürt, oder?« »Nicht direkt einen Stoß. Ich glaube, sie hat mich mit ihrem Stock zum Fallen gebracht. Den hat sie zwischen meine Füße geschoben und ich bin darüber gestolpert.«
»Wozu hat sie einen Stock dabei, wenn sie im Rollstuhl sitzt?«, fragte Gustav verwundert.
»Als Hilfe, wenn sie aufstehen muss.«
»Und führt sie den Stock am Schoß mit?«
»Nein, der steckt in einer Halterung des Rollstuhls, rechts hinten.«