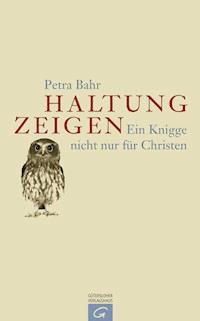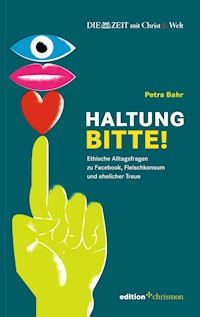Inhaltsverzeichnis
Widmung
RÜCKENSCHULE
Copyright
Für Matthäus
RÜCKENSCHULE
»Halt Dich gerade, Mädchen«, hat meine Großmutter immer gesagt. Mit dieser Mahnung wollte sie nicht meine Lümmelei bei Tisch korrigieren, obwohl sie auf guten Manieren beim Essen bestand. »Halt Dich gerade« war auch kein Appell gegen eingezogene Schultern, mit denen die Dreizehnjährige ihre Unsicherheit in Körpersprache übersetzte. Haltungsschäden befürchtete sie wohl, mit ihrem Hinweis nörgelte sie allerdings nicht an meiner schlechten Erziehung herum. Das stete »Halt Dich gerade« zielte auf den inneren Anstand, der sich auch bei der Enkelin gut entwickeln möge. »Halt Dich gerade«, ermunterte sie mich deshalb immer, wenn ich schlecht geschlafen hatte, weil mich mein Gewissen plagte oder eine schwierige Entscheidung anstand. Ansonsten ließ sie mich mit meinen Überlegungen allein. Sie vertraute darauf, dass ich schon selbst herausfinden würde, wie ich mit geradem Rückgrat aus einer heiklen Situation heraus käme. Der kleine Satz war Maßstab und Aufmunterung genug.
Ich hätte ihren Hinweis sicher als eines dieser geflügelten Worte abgetan, mit denen Ältere bisweilen die eigene Lebensweisheit an die nächste Generation weitergeben. Von der geronnenen Erfahrung merken die Jüngeren allerdings wenig, weil der erhobene Zeigefinger im Wege steht. Dass dieser Satz mir zu einem Lebensbegleiter wurde, den ich ernst nehmen konnte, lag daran, dass meine Großmutter dafür gebürgt hat, wie er sich vor meinen Augen entfaltete. »Halt Dich gerade« - dieses Motto hat sie sich auch selbst morgens vor dem Spiegel zugerufen. Deshalb klang dieser Satz auch nicht vorwurfsvoll. Ihr eigenes Leben war Anschauung für die Art Haltung, die eine große innere Freiheit mit einer ungewöhnlichen Zugewandtheit im Umgang mit den Menschen verband. Auch äußerlich hielt sie sich gerade, obwohl sie allen Grund gehabt hätte, sich unter der Last eines schweren Lebens zusammenzukrümmen. Bis ins hohe Alter, als die Zeit den Rücken schon gebeugt hatte, ging sie so aufrecht, wie sie es eben mit einiger Anstrengung schaffte. Nachlässigkeit, auch in äußerlichen Dingen, war für sie ein Zeichen der mangelnden Achtung vor der Umgebung, in der sie lebte. Sogar gute Kleidung war für sie weniger eine Frage des Stylings als die Weise, mit Bluse und Tuch den Anlass des Tages und des Gegenübers zu würdigen. Sie wollte sich bis ins hohe Alter nicht gehen lassen. Vielleicht hatte sie manchmal Sorge, so ihre innere Fassung zu verlieren. Ein wenig eitel war sie auch. Trotzdem konnte sie großzügig über Äußerlichkeiten hinwegsehen. Vor allem Jugendliche im schwierigen Alter merkten das sofort. Grün gefärbte Haare, Nasenpiercings und ungewaschene Hälse überging die alte Dame lässig, wenn es darum ging, mit den Enkeln oder deren weitgestreutem Freundeskreis das Verhältnis zu Lehrern oder Eltern wieder in Ordnung zu bringen. Für die Etikette, die - komme, was wolle - den äußeren Schein wahrt oder einer fraglosen Konvention des »man tut das aber« folgt, hätte sie nur milden Spott übrig gehabt. Aber Arroganz oder Gleichgültigkeit ließ sie niemandem durchgehen, ob in Seidenkleid oder zerfetzter Jeans.
Von großen Worten über Moral hielt sie nichts. In meiner Erinnerung hat sie auch nie über den Verfall der Werte, das ungehörige Benehmen der Jugend oder die Sittenlosigkeit der Politiker geschimpft. Diese Art der kulturpessimistischen Welteindunkelei wäre ihr wohl larmoyant vorgekommen. Selbstmitleid mochte sie genauso wenig wie Menschen, die sich bei Kaffee und Kuchen an ein ominöses Früher erinnern, in dem alles besser war. »Diese alten Leutchen leben nur in der Vergangenheit«, kommentierte sie noch als über Achtzigjährige den Rückwärtsblick mancher Freundinnen mit einer Spur von Ungehaltenheit in der Stimme. Die innere Form, die ihr in den schweren Zeiten des Lebens Halt gab, hat Menschen weit über ihren Tod beeindruckt, vermutlich, weil sie so wenig Aufhebens um sich machte. Nun könnte man meinen, meine Großmutter wäre mit dieser Lebensweise die typische Repräsentantin ihrer Generation von Frauen, die ihr Leben für andere aufgeopfert haben. Über Todesanzeigen steht dann ein Verslein, das der Selbstlosigkeit der Verstorbenen ein Denkmal setzt. »Sie lebte für andere.« Oder »Arbeit war ihr Leben«. Manchmal sehe ich dieses Lebensskript in den Gesichtern alter Frauen. Vor langer Zeit blickten sie sicher einmal keck und voller Lebenslust in die Welt. Dann haben der Krieg, die Entbehrungen der Jahre danach, die vielen Tode und die stete Sorge um die vaterlosen Kinder den Glanz aus den Augen gewischt. Sie sehen mit einer Müdigkeit in die Welt, gegen die kein Schlaf mehr hilft.
So hätte meine Großmutter ohne weiteres werden können. Sie teilt das Schicksal dieser Frauen. Wundersamerweise war sie so nicht. Ihre Augen waren bis ins hohe Alter hellwach. Ihre Lebenshaltung wirkte unangestrengt und heiter. Sie wollte nichts Besonderes, ja nicht mal besonders gut sein, aber sie hatte einen ausgeprägten Sinn fürs gute Leben, konnte genießen, feiern und sogar feierlich mit sich alleine sein. Nein, selbstlos war sie nicht. Sie verausgabte sich manchmal bis zur Erschöpfung und gab viel von sich an andere, aber sie hatte ein Selbst, auf das sie achtete. Bisweilen, wenn die Familie oder die Menschen, um die sie sich sorgte, ihr unbotmäßig nahe kamen oder ihr etwas unter die Haut ging, zog sie einen Zaun um sich herum. Betreten verboten! Für eine kurze Zeit konnte die Welt bleiben, wo der Pfeffer wächst: für die Spanne eines Mittagschläfchens, für die Dauer eines Spaziergangs oder die Länge eines Gebets zog sie sich zurück. Besonders die letzte Fähigkeit finde ich im Rückblick bemerkenswert. Beten war ihr so selbstverständlich wie ein Telefonieren. Beides tat sie ausgiebig. Sie redete mit Gott ohne verquaste Kirchenvokabeln, ganz so, wie sie sonst auch redete. Manchmal freundlich, manchmal mit verhaltener Enttäuschung in der Stimme, manchmal voller Übermut, immer aber mit Respekt und Pausen, die dem Gegenüber die Chance boten, etwas einzuwerfen, nachzufragen oder Zustimmung zu äußern. Kleine Zeichen deuteten darauf hin, dass sie nicht nur den Nächsten, sondern ganz biblisch auch sich selbst von Herzen lieben konnte. Der Tisch mit den Blumen und dem feinen Geschirr, den sie nur für sich allein eindeckte. Das Lieblingsessen, Hasenpfeffer mit Apfelkompott, mit Hingabe zubereitet. Die Sendung im Radio, bei der sie sich nicht stören ließ. Sie hatte ein Gefühl für sich selbst. Für ihre Lebenskunst brauchte sie keine Zuschauer. Wahrscheinlich hätte sie mich deshalb ausgelacht, wenn ich ihr noch erzählen könnte, dass sie die Hauptfigur in einer Einleitung zu einem Buch ist, das ihr eigenes Lebensmotto im Titel trägt.
Was ihr diese Lebenshaltung stiftete, war allerdings so altmodisch wie die gehäkelten Handschuhe, die sie gegen die Wetterfühligkeit der Hände überstreifte: Demut und Tapferkeit, Freimut und Barmherzigkeit, Treue und Besonnenheit, dazu das, was der christliche Glaube in ihr formte: Glaube, Liebe und Hoffnung. Ihr feiner Humor, ihr Charme und die unverhohlene Neugier auf die Welt verhinderten, dass man sie zu der Art »Gutmenschen« zählte, die man zwar von ferne bewundern, aber möglichst nicht zu nah an sich heran lassen will, weil sie einem mit ihrer Perfektion ein schlechtes Gewissen machen. Wer sich für moralisch überlegen hält, kann ja sehr herablassend sein. Das kann ziemlich auf die Nerven gehen oder sogar Beklemmungen auslösen, vor allem, wenn diese Moral vom stirnrunzelnden »Ich weiß, was gut für Dich ist« begleitet wird. Heute würde man die Fähigkeit des unverkrampften Wohlwollens gegenüber Freunden und Fremden vielleicht Empathie nennen. Oder schlicht »Nächstenliebe«. Nächstenliebe ist freilich in erster Linie kein überschäumendes Gefühl, sondern das Vermögen, vom Anderen her zu denken, und zwar so, dass dieser nicht als Umweg zur eigenen Selbstbestätigung gebraucht wird. Die richtige Distanz räumt der Zugewandtheit zum Anderen die nötige Luft zum Atmen ein. Aufgezwungene Zutraulichkeit sucht dagegen in der Regel nur sich selbst über den Umgang des Anderen.
Wer den Abstand zwischen Desinteresse und Zugewandtheit wahrt, macht nicht durch aufgedrängte Umarmungen, stete Nachfragen oder künstliche Küsse auf sich aufmerksam. Solcher plakativen Menschenliebe geht es nur um sich selbst. Diskretion und Takt gehören zum Wesen angebotener Freundschaft. Meine Großmutter war trotz ihrer überzeugenden Lebenshaltung alles andere als perfekt. Wie geschickt sie ihre Schwerhörigkeit einsetzte, wenn sie einen Gesprächsverlauf gerne in eine andere Richtung schieben wollte. Das war nicht sehr tugendhaft. Ihre Ungeduld, gepaart mit ihrem ausgeprägten Ordnungssinn, den ich als Kind ziemlich übertrieben fand, konnte einen schon in den Wahnsinn treiben. Zum Glück verlangte sie auch von anderen keine Perfektion. Sie gab sich keine Mühe, eine fügsame alte Dame zu sein. Schwiegersöhne, Pastoren, Ärztinnen und Postboten mussten so manch überraschenden und unlogischen Widerspruch herunterschlucken. Das war manchmal ziemlich anstrengend. Es scherte sie nämlich nicht, was andere von ihr hielten. Da hielt sie es mit dem Freiherrn Knigge. Dieser gelassene Umgang mit den eigenen und fremden Ansprüchen gehörte zum Geheimnis ihrer Glaubwürdigkeit.
Viel besser als die Fehlerfreiheit sei die Vergebungsbereitschaft, hat die Großmutter immer gesagt - und dabei auch sich selbst ins Verzeihenkönnen einbezogen. Auch Scheitern können will offenbar geübt sein. Mit sich selbst barmherzig sein ist manchmal schwerer, als bei anderen leichtherzig über kleine Macken hinwegzusehen. Wie viel schwerer ist es, mit sich gnädig zu sein, wenn man auf ganzer Linie versagt hat. Vielleicht war diese Fähigkeit zur Vergebung der Schlüssel zu ihrer Liebe zu den Menschen mit Ecken und Kanten. Die stete Erinnerung »Haltung zeigen!« zog keine Patentrezepte nach und hatte nichts von einem Appell, mit dem sie ihre Umgebung malträtierte. Tugendkataloge, wie sie seit der Antike überliefert sind, hätte sie sicher nicht behandelt wie Listen, die sie abends mit rotem Stift abarbeitet, bevor sie das Nachtgebet spricht. Es hätte sie sicher befremdet, wenn ich ihr erzählt hätte, dass große Gelehrte im Mittelalter dicke Bücher mit der Überlegung gefüllt haben, ob die Klugheit die höchste Tugend sei oder doch die Weisheit den Preis der Meistertugend bekommt. »Warum soll denn eine Tugend an der Regierung sein? Sie können sich die Arbeit doch teilen«, hätte sie den Streit auf ihre Weise beendet. Auch die Ordnungsgefüge der alten Tugendethiken hätte sie wohl eher beiläufig zur Kenntnis genommen. Was unter dem Lemma »Tugend« im Lexikon zu finden ist, ist schnell zusammengefasst. Da sind die Kardinaltugenden, die nicht so heißen, weil ein Mann in roter Soutane sie für sich beansprucht hätte. Nach dem lateinischen Begriff »cardo« sind sie in der antiken Philosophie der Dreh- und Angelpunkt der menschlichen Existenz: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Auf sie satteln die christlichen Tugenden, die auf den Dreiklang des Apostels Paulus gestimmt sind - Glaube, Liebe, Hoffnung - und später beliebig erweitert wurden: Demut und Güte, Sanftmut, Geduld, Barmherzigkeit und Dankbarkeit. Sogar das Gebet kann manchem Kirchenvater zur Tugend werden, als Haltung, die mit Gott im Gespräch das Leben meistert. Für Philipp Melanchthon ist das Gebet gar die wichtigste Tugend, »ein Licht und Trost ist in aller Fähigkeit unseres Lebens und ist die Wurzel aller Tugenden«. Sie wird schon allein deshalb zur Meistertugend, weil in ihr deutlich wird, dass Haltung, die Halt gibt, aus Beziehung lebt. Außerdem versichern sich die Betenden eines Haltes, der in dieser Welt frei und unabhängig macht.
Ob ihre Haltungen unzeitgemäß oder einfach nur zeitlos sind, hat im Rückblick auf ihr Leben aus der Perspektive der Enkelin interessiert. Ich wollte mehr über die Hintergründe wissen, die den Menschen prägten, der mich sicher neben den eigenen Eltern am meisten beeinflusst hat. Ihre Freude an dem, was sein soll, ist mir noch viele Jahre nach ihrem Tod so stark im Gedächtnis geblieben, dass ich ihren Haltungen auch in der Gegenwart Einiges zutraue. Deshalb teilen sich berühmte Kirchenmänner, ihre preußische Erziehung und Freiherr Knigge, der Volksphilosoph des 18. Jahrhunderts, der es seit zweihundert Jahren als Haltungsexperte in die Bestsellerlisten schafft, die Hauptrolle in diesem Tugendbrevier. Das ist so rückwärtsgewandt erst einmal wie die Sammeltassen, die mir meine Großmutter vermacht hat. Doch die sind ja neuerdings auch wieder modern. Im übrigen soll auf diese Weise auch einer Generation von Frauen gedacht werden, die wir nur als Kriegswitwen, Trümmerfrauen und Großmütter erinnern. Das geht nicht ohne Blick zurück. Ihre Kraft, ihr Trotz, ihr zähes Ringen um den vielfachen Neubeginn sind viel zu schnell vergessen worden. Das Wirtschaftswunder, die Demokratie und die Entwicklung des Geistes und der Kultur waren ja schnell wieder Männersache. Dieser Versuch über innere Haltungen, die auch äußerlich Halt geben, will mit philosophischen oder theologischen Büchern über Moral nicht konkurrieren. Die persönliche Auswahl könnte auch anders ausfallen. Sie weist große Lücken auf, ist entschieden einseitig und subjektiv, eine schreibende Form der Selbstüberredung gegen die Mutlosigkeit, die mich manchmal krumm und haltlos werden lässt. »Halt dich gerade, Mädchen«, höre ich sie dann sanft rufen.
Das Wort »Tugend« war lange ein Ladenhüter. Mit der Generation meiner Großmutter landete es erst einmal in der Mottenkiste der Geschichte. Es müffelte nach der verlogenen Attitüde einer Generation, die sich erst moralisch desavouiert und dann hinter Vorgartenwohlanständigkeit versteckt hatte. Laster haben dagegen bleibend Konjunktur. Fast könnte man den Eindruck haben, als hätte die dunkle Schattenseite des Menschen klammheimlich die Stelle eingenommen, die früher der Tugend zustand. Lasterkataloge sind eine Art Überlebenswissen in den Untiefen des sozialen Lebens. Gegenwärtig werden die ehemaligen Laster gar zu einer positiven Triebkraft der Gesellschaft umgedeutet. Ein Ökonom erklärt die Habgier zum unverzichtbaren Grundtrieb unseres Wirtschaftssystems. Ein Politiker ruft »das Ende der Barmherzigkeit« aus und nimmt mit diesen Worten den Sozialstaat ins Visier. Eine Bildungsforscherin gibt Neid als wichtige Motivation für den sozialen Aufstieg an. Eltern sitzen am Rande des Sandkastens und ermuntern ihre Kinder, ihre Ellebogen anständig zu trainieren. »Setz dich durch!«, werden die Drängeleien der Sprösslinge befeuert. »Geiz ist geil.« Mit diesem Slogan wirbt eine Elektromarktkette um Kunden. Was für ein obszöner Reim. Doch laut sagen will das lieber niemand. Schließlich will keiner wie ein Moralapostel dastehen, der kleinlich über die Nachlässigkeit des Sprachgebrauchs anderer wacht oder sofort den Zeigefinger hebt. Schlimmer als jedes Laster, das im Zweifel zur Tugend umgedeutet wird, scheint gegenwärtig das zu sein, was unter dem Stichwort »Moralisierung« das Stirnrunzeln moderner Zeitgenossen provoziert.
Wer wagt es, den Stab zu brechen? Mit der Ablehnung aufgezwungener oder bloß überlieferter Moralvorstellungen ist das moralische Urteilen an sich in Misskredit geraten. In dem Maße, wie das Private bewertenden Blicken von echten oder selbsternannten Tugendwächtern entzogen ist, werden viele ehemalige Moralfragen zur Geschmackssache. Da erzählt jemand davon, dass ein Familienvater aus dem Freundeskreis seine Frau mit drei Kindern wegen einer jungen Studentin verlassen habe, und schiebt entschuldigend hinterher: »Ich will das jetzt gar nicht moralisch beurteilen. Ist aber schlechter Stil, oder?« Mit der Zahl der Lebensformen wird auch die Frage von Moral und Unmoral zu einer Frage des Standpunktes. Und den behält man lieber für sich. Wer will schon Spielverderber sein?
Doch ist das nur die eine Seite der Medaille. Von einer Entmoralisierung des Lebens kann man wahrlich nicht sprechen. Es gibt eine Art der öffentlichen Empörung, die sich so sehr selbst gefällt in ihrer Betroffenheit über die vermeintliche Verrohung oder Entgleisung, dass sie nur noch als Reflex in einem Spiel von Tabubruch und Erregung wahrgenommen wird. Der Rede vom allgemeinen Sittenverfall hat sich definitiv nicht erledigt. Sie ist an jeder Ecke zu hören. Entmoralisierung und Remoralisierung haben sich in einem Spannungszustand eingependelt. Kein Wunder, dass auch das, was als Laster zu gelten hat, unklar geworden ist.
Laster gelten eher als schlechte Angewohnheit denn als verwerfliche Handlung, die es gesellschaftlich ernsthaft zu ächten gilt. Eine Bagatelle wie Falschparken oder die Lüge aus der Not sind alltägliche Verlegenheiten, die sich jeder großzügig verzeiht. Gier und Geiz als lasterhafte Geschwister werden nur dann an den Pranger gestellt, wenn sie mit einem ganzen Berufszweig in Verbindung stehen.
Wenn Laster auch als Todsünden schon lange nicht mehr ernst genommen werden, so haben sie auch noch als düstere Macken eine geradezu unheimliche Anziehungskraft. Das mag daran liegen, dass in ihnen so etwas wie die Banalität des Bösen aufscheint, aus der so manches Monster entsteht. Viel vom Übel in der Welt nimmt seinen Anfang nicht durch gezielte Willkür oder Niedertracht. Neid und Klatsch, Geiz oder Maßlosigkeit sind in ihren Folgen oft genug zerstörerischer. Moralvergessene Haltungen zeichnen ja nicht nur die echten Schurken aus. Sie gehören zur unheimlichen Aura jedes Menschen. Wie in Schatten folgt uns allen das, was in den abendländischen Lasterkatalogen dingfest gemacht wird und Romanautoren wie Filmemacher zu immer neuen Nacherzählungen animiert. Krimis und Gesellschaftsthriller spielen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2010 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
eISBN 978-3-641-04993-5
www.gtvh.de
Leseprobe
www.randomhouse.de