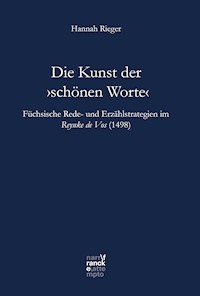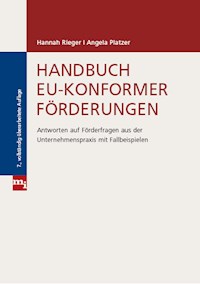
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mi-Wirtschaftsbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine neue Ära für Förderungen in Europa hat begonnen, das Handbuch erschließt die wichtigsten Programme und Spielregeln. Gewusst wie, gewusst wo: Wer Unternehmensförderungen ausschöpft, ist klar im Vorteil im globalen Standortwettbewerb um Forschungsinitiativen, Industrie-Investitionen und Arbeitsplätze. Doch die beihilfenrechtlichen Spielregeln wurden wesentlich geändert: Es gibt eine neue europäische Fördergebietskarte (nationale Regionalfördergebiete) mit einer stärkeren Differenzierung nach Wohlstandsgefällen. Und es gibt neue Förderintensitäten sowie neue Bestimmungen für die Kofinanzierung aus den EU-Strukturfonds. Unternehmer und Finanzchefs finden mit diesem Handbuch Zugang zu den wichtigsten europäischen und bundesweiten Förderaktionen, zum EU-Beihilfenrecht und zum österreichischen System der Unternehmensförderung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Hannah Rieger | Angela Platzer
Handbuch EU-konformer Förderungen
Hannah Rieger | Angela Platzer
Handbuch EU-konformer Förderungen
Antworten auf Förderfragen aus der Unternehmenspraxis mit Fallbeispielen
7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86880-008-1
7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage (Endredaktion Mai 2009)
© 2009 by mi-Wirtschaftsbuch, FinanzBuch Verlag GmbH, München www.mi-wirtschaftsbuch.de
Dieses Buch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Verlag und AutorInnen ersuchen um Verständnis dafür, dass alle Angaben ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Lektorat: Karina Matejcek, Wien Umschlaggestaltung: Jarzina Kommunikations-Design, Holzkirchen Satz: Dr. Andreas Zeiner, Rechnitz Printed in Germany
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Vorwort
Innerhalb von nur einem Jahr war die 6. Auflage unseres Handbuchs vergriffen. Ein unveränderter Nachdruck ist von uns aus Aktualitätsansprüchen nicht vertretbar. Im Detail befindet sich das Fördersystem in Österreich und Europa in einem unglaublichen permanenten Wandel. Das heißt, es ist seit der letzten Auflage im Jänner 2008 vieles neu. Die inhaltliche Struktur der großen „Fördergeschichte“, die wir in unserem Buch erzählen, bleibt auch in der 7. Auflage gleich:
Das Handbuch EU-konformer Förderungen erzählt also die Geschichte der Unternehmensförderungen in Österreich bis 2013. Eine Geschichte in 10 Kapiteln. Beginnend mit allen wesentlichen Playern im österreichischen Fördersystem, geht es dann um die konkreten europäischen Spielregeln für Unternehmen, die Kurzdarstellung von rund 120 für Unternehmen relevanten Förderaktionen auf Bundes- und Bundesländerebene sowie die europäischen Förderquellen (Strukturfonds, 7. EU-Rahmenprogramm und EIB). Fallbeispiele und über 500 Glossarbegriffe vervollständigen die Story.
Es geht bis 2013 um viel Geld für Unternehmen. Viel Geld, denn wir sind erst am Ende des ersten Drittels der neuen Förderperiode, und es gibt zusätzliche Mittel im Rahmen aktueller Konjunkturbelebungsprogramme.
Angesichts der derzeitigen Finanzmarktsituation und der ökonomischen Herausforderungen sind Förderungen wichtiger denn je. Sie unterstützen Investitionen und sind entscheidend für den Wirtschaftsstandort Österreich. Innovative Unternehmen gestalten und sichern die Zukunft Österreichs und Europas ebenso wie die öffentliche Hand zusätzliche Beiträge zur wirtschaftlichen Stabilität leistet. In diesem Zusammenhang finden Entwicklungen auf mikro- und makroökonomischer Ebene statt. Förderungen befinden sich an der Schnittstelle dieser wirtschaftlichen Prozesse. Unternehmensförderungen auszuschöpfen ist ein Vorteil im globalen Standortwettbewerb um Forschungsinitiativen, Industrieinvestitionen und Arbeitsplätze. Förder-Know-how ermöglicht Unternehmen, ihre Finanzierung zu optimieren, ihre Finanzierungskosten zu senken bzw. ihr Risiko zu minimieren.
Das Handbuch ist als Nachschlagewerk für Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und Tourismus konzipiert. Unser Anliegen ist es, Halt und Orientierung in einem schnelllebigen Fördersystem anzubieten. Das Förder-Know-how haben wir in vielen Gesprächen mit Kunden, Ministerien, Förderstellen und Banken aufgebaut. Das Buch verbindet Wissen über Fördersysteme und Förderangebote mit den Bedürfnissen der Unternehmen nach Zugangsmöglichkeit, Transparenz und Kalkulation. Das Buch ist für uns nicht nur ein Kommunikations- und Marketinginstrument, sondern ein wichtiger Faktor in unserem eigenen Lernen. Es trägt zum Wissensmanagement im Konzern und im Sektor der Volksbanken bei.
Unser Buch konnte nur im Wege einer langjährigen Teamarbeit aktualisiert werden. Viele Expertinnen und Experten haben uns bei der 7. Auflage unterstützt. Unsere beiden Gastautoren des Kapitels „Unternehmensförderungen im größeren Europa“, Dr. Sándor Richter und Mag. Roman Römisch, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), führten mit uns viele intensive Diskussionen über die neue Strukturfondsperiode.
Andrea Vitali begleitete uns lösungsorientiert beim Förder-Update der einzelnen Aktionen, bei vielen Recherchen und bei der Umsetzung des gesamten Buchprojekts. Dr. Larissa Kahr aktualisierte die europäischen Forschungs- und Technologieförderungen, insbesondere das 7. EU-Rahmenprogramm. Dr. Margot Coosmann-Binder überarbeitete mit uns die Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank. Alle betroffenen Förderinstitutionen haben dankenswerterweise die von ihnen betreuten Aktionen auf Aktualität und Vollständigkeit geprüft. Generaldirektor Franz Pinkl hat das Buchprojekt mit Interesse und Engagement zielorientiert unterstützt.
Für ihre fachliche Expertise und wertvollen Impulse bei der Neuauflage danken wir besonders: DI Dr. Doris Agneter, DI Alexandra Amerstorfer, Sylvia Bardach, Karin Bauer, Mag. Stefan Bernhardt, Mag. Matthias Bischof, Ing. Mag. Friedrich Blaha, Dr. Magnus Brunner, Mag. Kristin Duchâteau, Mag. Manuela Eder, Mag. Heinrich Gruber, Dr. Elisabeth Hagen, Mag. Dr. Franz Hartl, Dr. Reinhard Hönig, Mag. Hans-Jörg Hummer, Kurt Kaiser Msc., Mag. Elfriede Kober, Mag. Cornelia Krajasits, Dr. Michael Krassnigg, Martina Kurz, Mag. Kurt Leutgeb, Dr. Christian Lossgott, Dr. Sonja Mayrhofer, Mag. Johann Moser, Dr. Christian Nordberg, Dipl.oec. Thorsten Paul, Mag. Barbara Pürer, DI Dr. Bernd Rießland, Mag. Karlheinz Rüdisser, DI Bernhard Sagmeister, Mag. Klaus Schnitzer, Mag. Hans Schönegger, Mag. Markus Seidl, Dr. Wilfried Stadler, Mag. Stefan Tauchner, Mag. (FH) Gerlinde Tuscher, Dr. Ulrich Zacherl.
Karina Matejcek von mi-Wirtschaftsbuch, FinanzBuch Verlag, motivierte uns, die Neuauflage so rasch in die Welt zu bringen. Dr. Claudia Schmied, die Co-Autorin der ersten fünf Auflagen, ermutigte uns, das Buchprojekt fortzusetzen. Dafür bedanken wir uns herzlich.
Wien, im Mai 2009
Mag. Hannah Rieger Mag. Angela Platzer
1. Das österreichische System der Unternehmensförderungen
Das österreichische System der Unternehmensförderung ist in einem Zeitraum von fast 50 Jahren historisch gewachsen. Schon in der Wiederaufbauphase Österreichs hat die Wirtschaftspolitik die Bedeutung der Investitionen für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft erkannt. Seit den sechziger Jahren verstärkte sich die Tendenz zum Ausbau direkter Förderungen mit der Betonung strukturverbessernder Maßnahmen.
Resultat der wechselnden wirtschaftspolitischen Schwerpunkte ist heute ein im internationalen Vergleich umfangreiches Fördersystem, das weniger wegen seines budgetären Volumens, sondern vielmehr wegen seiner Vielzahl an Institutionen und Instrumenten immer wieder Reformdiskussionen unterzogen wird.
Mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995, den wettbewerbspolitischen Regelungen der EU und der europäischen Strukturfondspolitik wurden zusätzliche Anforderungen an das traditionelle österreichische System der direkten Unternehmensförderung gestellt. Große programm- und abwicklungstechnische Koordinationen waren mit der Implementierung der Kofinanzierung aus den EU-Strukturfonds (EFRE, Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung, ESF, Europäischer Sozialfonds) verbunden. Die für Österreich aus den EU-Strukturfonds reservierten Mittel werden im Wege der Kofinanzierung zu innerstaatlichen Förderprogrammen und Budgets abgerufen. Für den Zeitraum 2007 bis 2013 stehen Österreich Mittel in Höhe von EUR 1.461 Mio. (zu laufenden Preisen) zur Verfügung.
Die Maßnahmen zur Förderung von Unternehmen sind auf Bundesebene in unterschiedlichen Ministerien kompetenzmäßig verankert (siehe Übersicht 1). Grundsätzlich werden folgende Modelle der Förderabwicklung unterschieden:
Ein institutioneller Überblick über die für wirtschaftsnahe Fördermaßnahmen zuständigen Stellen auf Bundesebene ist Übersicht 1zu entnehmen. Insbesondere sechs Ministerien sind mit Agenden der Wirtschaftsförderung befasst. Sonderaufgaben, auch in Hinblick auf Förderkoordination und Abstimmung, nimmt das Bundeskanzleramt wahr.
Übersicht 1: Wirtschaftsnahe Bundesförderungen — ein institutioneller Überblick
Quelle: Volksbank AG
In der 2002 gegründeten Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) wurden die langjährigen Fördereinrichtungen Finanzierungs-Garantie Gesellschaft m.b.H., BÜRGESFörderungsbank, Innovationsagentur und ERP-Fonds zusammengeführt und die unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderungen des Bundes gebündelt.
Der Auftrag der aws als Finanzierungs- und Förderbank der Republik ist es, den Wirtschaftsstandort Österreich und seine Unternehmen optimal zu unterstützen. Hierzu bietet die aws individuell passende Förderungen und Finanzierungen sowie ein breit gefächertes Beratungsangebot. Die Instrumente der aws umfassen Zuschüsse, Kredite, Haftungen, Eigenkapital und Beratungs- und Serviceleistungen.
Diese werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Gründer & Junge Unternehmen, Regionalförderung & KMU-Wachstum, Eigenkapital sowie Innovation & Technologieverwertung eingesetzt.
Die Aufgaben der aws umfassen im Wesentlichen
Mit dem Zuschussinstrumentarium setzt die aws gezielte Akzente in wirtschaftspolitisch und ökonomisch wichtigen Bereichen – wie zum Beispiel Innovation, Gründung, Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen in besonderen Regionen oder thematischen Schwerpunktfeldern. Zuschüsse können je nach Region, Unternehmensgröße und Projekt von 10 % bis zu 30 % der Investitionssumme abdecken.
Die aws unterstützt die Gründung und den Auf- und Ausbau junger Unternehmen. Ebenso im Fokus der Aktivitäten stehen Betriebsübergaben und -nachfolgen. Im Bereich Hochtechnologie bietet die aws besonders intensive Betreuung und Beratung schon in der Vorgründungsphase.
Wichtiges Anliegen ist die Finanzierung und Förderung von betrieblichen Investitionsund Innovationsprojekten. Erweiterungsinvestitionen sind ebenso förderbar wie Aufwendungen für Betriebsmittel oder die Einführung von neuen Produkten und Ideen. Begleitend unterstützt die aws den Aufbau und die Absicherung der betrieblichen Wissenskapitalbasis mit den Schwerpunkten in den Beratungsleistungen zum Schutz und zur Verwertung von geistigen Eigentumsrechten sowie Markt- und Technologierecherchen. Weiters fördert die aws die Gründung von Unternehmen sowie Joint Ventures jenseits der österreichischen Grenzen in wirtschaftlichen Schwerpunktländern.
Als Finanzierungspartner unterstützt die aws die Aufbringung von Eigenkapital. Fehlende Sicherheiten ersetzt die aws durch ihr Haftungsinstrumentarium. Mit der Übernahme von Haftungen (Garantien und Bürgschaften) für Fremdfinanzierungen (einschließlich Leasing) werden Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen. Um die Aufbringung von Eigenkapital zu erleichtern und das Risiko zu verringern, bietet die aws mit Haftungen Unterstützung bei der Eigenkapitalfinanzierung.
aws/ERP-Fonds stellt ERP-Kredite (aus der ehemaligen Marshallplan-Hilfe) zu günstigen Konditionen für ambitionierte Wachstumsprojekte und folgende Schwerpunkte zur Verfügung:
In die Förderabwicklung sind die österreichischen Banken als ERP-Treuhandbanken (siehe www.awsg.at) eingebunden. Die Investkredit Bank AG – gemeinsam mit den österreichischen Volksbanken – war 2008 an dritter Stelle unter den 24 Treuhandbanken gemessen am genehmigten Kreditvolumen. Die Treuhandbanken begleiten die Unternehmen von der Antragseinreichung bis zur Abrechnung des Investitionsprojekts. Die zinsgünstigen ERP-Kredite werden treuhändig über die Banken vergeben. Da der ERP-Fonds kein Bonitätsrisiko des geförderten Unternehmens trägt, übernimmt die Treuhandbank in der Regel die Bankhaftung gegenüber dem ERP-Fonds. Sonderaufgaben nimmt der ERP-Fonds unter anderem bei der Abwicklung der Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE-Monitoring, siehe Kapitel 5) wahr.
Durch die aktuellen Konjunkturbelebungsprogramme sind derzeit zusätzliche Fördermittel über aws/ERP-Fonds verfügbar:
Durch Mittelerhöhungen vor allem für Haftungen und Zuschüsse, Ausweitungen bestehender Förderaktionen auf zusätzliche Förderinhalte und – in der Regel bis 31.12.2010 befristete – zusätzliche Förderprogramme haben die Bundesländer Konjunkturbelebungspakete geschnürt. Die Umsetzung erfolgt über die Förderstellen in den Bundesländern.
Im Zuge der jüngsten Förderreform wurde auch die österreichische Forschungsförderung vereinfacht. In der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) wurden 2004
zusammengefasst. Die FFG ist die Förderagentur des Bundes für die anwendungsorientierte und wirtschaftsnahe Forschung in Österreich. Die FFG fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekte und unterstützt österreichische Unternehmen, Forschungsinstitutionen, Forscherinnen und Forscher mit einem umfassenden Angebot von Dienstleistungen: von den Förderprogrammen der öffentlichen Hand bis zu Beratungsleistungen in allen Phasen der Technologieentwicklung und Innovation, von der Unterstützung zur Einbindung in europäische Forschungsprogramme und Netzwerke bis zur Wahrnehmung österreichischer Interessen auf europäischer und internationaler Ebene.
Auf Grundlage des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes (FTFG) wurde der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF – Der Wissenschaftsfonds) 1967 ins Leben gerufen. Zweck des FWF ist die Förderung von nicht auf Gewinn gerichteten Forschungsvorhaben aus allen Fachdisziplinen im Bereich der Grundlagenforschung, wobei keinerlei thematische Vorgaben gemacht werden. Ziele des FWF sind die Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Österreichs im internationalen Vergleich, die qualitative und quantitative Ausweitung des Forschungspotenzials nach dem Prinzip „Ausbildung durch Forschung“ sowie die Verstärkung der Kommunikation und der Ausbau der Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und allen anderen Bereichen des kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Österreich. Neben den Einzelprojekten als größte Förderkategorie sind die Schwerpunktprogramme (Spezialforschungsbereiche, Nationale Forschungsnetzwerke) sowie die Doktoratskollegs zu nennen, die einen wesentlichen Beitrag zur Profilbildung und Schwerpunktsetzung insbesondere an Österreichs Universitäten leisten. Aus FWF-Mitteln sind pro Jahr mehr als 2.000 junge WissenschafterInnen auf Projektbasis angestellt – ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Humanressourcen des Landes.
Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank Ges.m.b.H. (ÖHT) ist eine Spezialbank zur Finanzierung und Förderung von Investitionen im Tourismus. Die ÖHT fördert auf Basis des KMU-Förderungsgesetzes und daraus abgeleiteter Richtlinien Tourismusvorhaben. Die ÖHT ist auch Treuhandbank des ERP-Fonds für die Vergabe zinsgünstiger ERP-Kredite.
Umweltschutzinvestitionen werden seit dem Inkrafttreten des Umweltförderungsgesetzes 1993 auf Bundesebene über die Kommunalkredit Austria AG gefördert. Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) – eine Tochter der Kommunalkredit Austria AG – übernahm 2003 die Aktivitäten des Fördermanagements und Consultings. Heute managt die KPC diverse Förderungen auf Bundes- und Landesebene, die der Umsetzung umwelt-, klima- und energiepolitischer Zielsetzungen dienen.
Die größten Förder- und Ankaufsinstrumente sind
Weiters ist die KPC seit 2007 neben der Forschungsförderungsgesellschaft eine der beiden gesetzlich festgelegten Abwicklungsstellen des Klima- und Energiefonds.
Als Nischenanbieter hat sich die KPC im Wesentlichen auf die Bereiche Beratung und Implementierung von Förder- und Programmmanagementaufgaben, die Erstellung von Infrastrukturmaßnahmenprogrammen sowie die wirtschaftliche Analyse und Finanzierungsaufbereitung von Infrastrukturprojekten spezialisiert. Mit „Climate Austria“ bietet die KPC darüber hinaus in Kooperation mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Austrian Airlines ein Produkt zur freiwilligen Kompensation von CO2-Emissionen an.
Förderungen gemäß Ökostromgesetz werden durch die OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG abgewickelt, der die gesamte Ökostromabwicklung obliegt. Dies erfolgt über ein neu geschaffenes, modernes und durchgängig elektronisches Abwicklungssystem, das durch ein hohes Maß an Effizienz, Kundenorientierung und Transparenz geprägt ist. Zu den Hauptaufgaben der OeMAG zählen neben der Abwicklung der Förderanträge vor allem die Abnahme des Ökostroms zu den durch das Ökostromgesetz bestimmten Preisen, die Berechnung der Ökostromquoten, die tägliche Zuweisung des Ökostroms auf Grund der Ökostromquoten an die Stromhändler und die Bewirtschaftung der neu geschaffenen Förderkontingente.
Die unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung ressortiert zum Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Im Zusammenhang mit der Realisierung von Arbeitsplatz schaffenden und Arbeitsplatz sichernden Investitionen können Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes Förderungen ansprechen. Die Abwicklung dieser Fördermaßnahme erfolgt über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws). Die Beteiligung der Länder an dieser Fördermaßnahme wird in mindestens gleicher Höhe vorausgesetzt. Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte werden über das Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) und dessen Geschäftsstellen in den Bundesländern gestioniert.
Entwicklungs- und Transformationsländer werden im Rahmen der Internationalisierung auch zu neuen interessanten Märkten für Unternehmen. Die Österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit (OEZA), die zum Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten ressortiert, unterstützt Unternehmen bei der Realisierung von Investitionsprojekten mit entwicklungspolitischem Effekt in Entwicklungs- und Transformationsländern. Dadurch entstehen Arbeitsplätze, Einkommen für die Menschen der Region werden erwirtschaftet und Know-how wird geschaffen. Die Austrian Development Agency (ADA), die die OEZA in Österreich umsetzt, bietet Unternehmen Unterstützung im Rahmen von Machbarkeitsstudien sowie Wirtschaftspartnerschaften an.
Auf Länderebene (siehe Übersicht 2) erfolgt die Wirtschaftsförderung über die jeweiligen Ämter der Landesregierungen oder über Fördergesellschaften, wie zum Beispiel die Wirtschaftsservice Burgenland AG (WIBAG).
Übersicht 2: Förderungen in den Bundesländern – ein institutioneller Überblick
Quelle: Volksbank AG
Die ursprüngliche „europäische“ Bewährungsprobe hat das österreichische System der Unternehmensförderung mit der Genehmigung (nach der „Notifizierung“) aller wesentlichen Förderaktionen durch die EFTA Surveillance Authority (ESA) in Brüssel bestanden. Von 25 österreichischen Förderstellen wurden im Jahr 1994 über 60 Förderaktionen des Bundes und rund 130 Förderaktionen der Länder der europäischen Beihilfenkontrolle unterzogen und nach einzelnen Adaptierungen als EU-konform klassifiziert. Die seit EU-Beitritt 1995 zuständige Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission hat die Möglichkeit, die EU-Konformität zu prüfen und Richtlinienänderungen vorzuschreiben. Richtlinienänderungen bei bestehenden Aktionen sowie die Einrichtung zusätzlicher Aktionen erfordern die Genehmigung seitens der Kommission. Für Beihilfen, die die Bestimmungen der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO, der EU erfüllen, und für Beihilfen von geringer Bedeutung („De minimis“) entfällt dieses Genehmigungsverfahren (siehe Kapitel 2). Die De minimis-Bestimmung begünstigt tendenziell ein weiteres Ansteigen der Zahl kleinerer Förderaktionen, insbesondere auf Bundesländerebene.
Die direkten Förderaktionen für Unternehmen weisen folgende Charakteristika auf:
Seit dem Beitritt Österreichs zur EU stehen der österreichischen Wirtschaftspolitik auch die Strukturfonds der EU zur Verfügung.
Wegen der von der EU vorgegebenen Schwerpunkte und der großen Zahl von österreichischen Förderstellen und Aktionen sind durch die Strukturfondspolitik zusätzliche Anforderungen an Koordinationsmechanismen gegeben.
Der Grundsatz der Kofinanzierung (Kombination von innerstaatlichen Finanzierungen mit Mitteln der Strukturfonds) stellt für die befassten Ressorts, die Förderstellen und die geförderten Unternehmen eine abrechnungstechnische Herausforderung dar.
Die Kofinanzierung war in der ersten Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 ihrem Wesen nach eine Refinanzierung der österreichischen Förderstellen aus Mitteln der EU-Strukturfonds. Projekte von Unternehmen in Zielgebieten konnten im Einzelfall unter Beachtung der damaligen Wettbewerbskulisse und im Rahmen notifizierter, kofinanzierungsfähiger Aktionen höher gefördert werden. Aus EU-abrechnungstechnischen Gründen setzte sich in diesem Fall die so genannte „Zielgebietsprämie“ in der Praxis durch. Eine andere Möglichkeit zur Verwendung der Strukturfondsmittel bestand darin, den Begünstigtenkreis zu erweitern, das heißt mehr Projekte als bisher in den regionalen Zielgebieten zu fördern. Es oblag der einzelnen Förderstelle, zu entscheiden, welchen Weg der Kofinanzierung – höhere Förderung oder größere Zahl von Projekten – sie in der Praxis beschritten hat. Für die Inanspruchnahme der EU-Kofinanzierung haben sich seit der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 die Abwicklungsstrukturen verändert. Die EU-Strukturfondsmittel werden von den Unternehmen gleichzeitig mit den anderen Förderungen auf Bundes- und Landesebene bei den zuständigen österreichischen Förderstellen beantragt. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich die Kofinanzierung jetzt nicht mehr auf einzelne Förderaktionen bezieht, sondern das Gesamtprojekt und dessen Finanzierung einschließlich der Förderungen Grundlage für den EU-Kofinanzierungsanteil ist.
Die direkten Förderaktionen sind damit nach wie vor ein wichtiger Hebel, um die für Österreich bereitgestellten Strukturfondsmittel auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Wie bereits ausgeführt, erfolgt die Einreichung von Förderanträgen seitens der Unternehmen bei den für die österreichischen Förderungen zuständigen Förderstellen und im Rahmen der österreichischen Förderaktionen.
Das Instrument der Kofinanzierung aus den EU-Strukturfonds führt zu einer deutlichen Orientierung der österreichischen Förderpolitik an den Grundsätzen der Förderpolitik der EU. Regional- und technologiepolitische Überlegungen haben in der Wirtschaftsförderung einen zentralen Stellenwert.
2. Das EU-Beihilfenrecht
Für die Realisierung des Binnenmarktes mit fairen Wettbewerbsbedingungen ist eine weitgehende Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen der EU-Mitgliedstaaten notwendig. Gleichzeitig sind mit dem Ziel der wirtschaftlichen und politischen Einheit gemeinsame Politiken der EU verbunden.
Für die wirtschaftliche Integration ist dieWettbewerbspolitik ein wichtiges Instrument. Um den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen zu schützen, sind in der EU Regelungen wirksam, die folgende Bereiche umfassen:
Während das Kartellrecht verhindern soll, dass Unternehmen durch Markt- oder Preisabsprachen den Integrationsprozess unterlaufen, regelt das EU-Beihilfenrecht einseitige staatliche Eingriffe in den Wettbewerb durch Förderungen, die den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.
Diese wettbewerbspolitischen Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, im Wege der Beihilfenlimitierung und -kontrolle den Subventionswettlauf der Mitgliedstaaten im Gemeinsamen Markt zu verhindern. Seit EU-Beitritt sind zudem die aktiven struktur- und regionalpolitischen Schwerpunkte der EU wirksam.
Die wichtigsten Instrumente zur Erreichung der Ziele der EU-Regional- und Strukturpolitik (Kohäsionspolitik) sind die in Kapitel 5und Kapitel 6dargestellten Strukturfonds und der Kohäsionsfonds. Aber auch die Förderpolitik der Kommission selbst muss in Einklang mit der gemeinschaftlichen Beihilfendisziplin, verankert im EU-Beihilfenrecht, stehen.
2.1. Allgemeine Rahmenbedingungen für Förderungen
Bereits mit dem Beitritt Österreichs zum EWR per 1. Jänner 1994 war Österreich verpflichtet, die Unternehmensförderungen den EWR-Bestimmungen anzupassen. Seit dem EUBeitritt Österreichs per 1. Jänner 1995 sind Artikel 87 und Artikel 88 EG-Vertrag maßgeblich.
Artikel 87 EG-Vertrag sieht vor allem unter dem Aspekt der Wettbewerbsverfälschung ein grundsätzliches Verbot von staatlichen Beihilfen an Unternehmen vor.
„Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“ (Artikel 87 (1) EG-Vertrag).
Eine Beihilfe liegt somit vor, wenn vier Bedingungen erfüllt sind:
Der Begriff der staatlichen Beihilfe ist dabei sehr weit gefasst. Gemeint sind alle Arten unmittelbarer oder mittelbarer wirtschaftlicher Förderungen an Unternehmen. Darunter fallen beispielsweise:
Charakteristisch für jede Beihilfe ist, dass diese dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, den es im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit ohne die staatliche Maßnahme nicht hätte. Dieser Vorteil für das begünstigte Unternehmen muss aus staatlichen Mitteln kommen, um den Beihilfenregelungen zu unterliegen, jedoch nicht unbedingt von staatlichen Stellen selbst vergeben werden. Bei der Feststellung der Begünstigung zählt nicht die Absicht, sondern ausschließlich die Wirkung der Maßnahme.
Bei Unternehmen im öffentlichen Eigentum erfolgt die Beurteilung möglicher Fördereffekte im Rahmen eines so genannten Drittvergleiches. Demzufolge enthalten Kapitalzuführungen (z.B. Kredite oder Bürgschaften) an Unternehmen keine Beihilfenelemente, wenn ein marktwirtschaftlich handelnder privater Kapitalgeber unter den gleichen Umständen die entsprechenden Mittel ebenfalls bereitgestellt hätte.
Beihilfen dürfen erst dann vergeben werden, wenn sie von der Kommission genehmigt sind (). Dazu müssen sie vorab bei der Kommission angemeldet () und von dieser im Rahmen eines formellen Verfahrens geprüft werden. Innerhalb der Kommission ist für das Verfahren die Generaldirektion Wettbewerb zuständig. Die Kommission ist nach Artikel 87 Abs. 3 EG-Vertrag ermächtigt, bestimmte Beihilfen zu genehmigen, wenn dies den Zielen und Interessen der Gemeinschaft nicht zuwiderläuft. Dabei verfügt sie über einen sehr großen Ermessensspielraum.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!