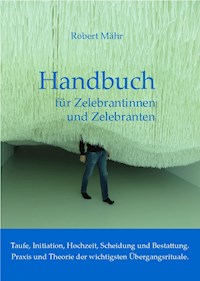
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die Welt ändert sich in einem unglaublichen Tempo und unsere alten Orte der Zuflucht werden uns zunehmend fremd. Immer mehr Menschen fühlen sich in den traditionellen kirchlichen Institutionen nicht mehr zuhause. In der Schweiz gibt bereits jede fünfte Bürgerin an, keiner Glaubensgemeinschaft mehr anzugehören. Die Gründe für den Austritt aus der Kirche sind vielfältig, aber nur in den seltensten Fällen verbindet sich damit eine Abkehr vom Glauben oder von der Spiritualität. Wie aber können wir diese Bedürfnisse befriedigen? Wir brauchen Menschen, die uns in einer turbulenten Zeit mit seriösen und gewissenhaften Ritualen neue Orte der Zuflucht eröffnen können: Zelebrantinnen und Zelebranten. Robert Mähr führt die Leserin mit seinem "Handbuch für Zelebrantinnen und Zelebranten" in die Praxis der fünf zentralen Übergangsrituale Taufe, Pubertätsinitiation, Hochzeit, Scheidung und Beerdigung ein. Das Handbuch ist ein Ratgeber und dient sowohl als Schulungsgrundlage als auch als Ergänzung zur praktischen Arbeit. In einer einfachen und verständlichen Sprache findet man neben der Theorie auch Beispiele, Checklisten und Tipps und Tricks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Als Zelebrantin oder Zelebrant zu arbeiten ist eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe, die Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und psychische Belastbarkeit voraussetzt. Wie in allen Berufen kann man sich Techniken aneignen, Methoden übernehmen und Theorien umsetzen. Dieses Handbuch soll eine entsprechende Grundlage bieten.
Es ist hilfreich, in der Ausübung der Tätigkeit auf persönliche Lebenserfahrungen zurückzugreifen. Aber auch persönliche Erfahrung schützt den Zelebranten nicht vor Isolation aufgrund mangelnder Selbstreflexion und fehlender Rückmeldungen. Dies wiederum birgt die Gefahr der Verunsicherung und kann ein übersteigertes und unreflektiertes Sicherheitsgefühl fördern, was sich oft negativ auf die Qualität der Arbeit auswirkt. Um dieser Gefahr vorzubeugen ist es notwendig, dass sich Zelebranten regelmässig austauschen und ihre Leistungen von Zeit zu Zeit überprüfen lassen. Dieser Prozess der Intervision beziehungsweise Supervision ist aus vergleichbaren Berufen (Sozialarbeiter, Pädagogen u. Ä.) bekannt und hat sich dort bewährt und etabliert.
Zum Buch
Ein weiteres Handbuch, ein weiterer Ratgeber – wozu? In einer Zeit, in der eine Vielzahl an Leitfäden und Kompendien zu relevanten Lebensfragen und banalen Alltäglichkeiten entstehen, ist diese Frage durchaus berechtigt. Weshalb also über ein Thema schreiben, das so alt ist wie die Menschheit und das bereits ausführlich dokumentiert wurde?
Vor allem zwei Gründe haben den Autor zum Verfassen des vorliegenden Buchs bewogen. Einerseits gab es keine Literatur mit praktischen Anleitungen. Andererseits ist die vorhandene Literatur stark religiös geprägt.
Um den Umfang möglichst knapp zu halten, wurde der Fokus auf die fünf Weltreligionen gesetzt – wohl wissend, dass in praktisch allen anderen Religionen und Glaubensgemeinschaften ähnliche Rituale praktiziert werden.
Eine weitere Motivation, dieses Buch zu schreiben, ist das Fehlen verbindlicher Grundlagen für die Berufstätigkeit der Zelebrantinnen und Zelebranten. Bis heute gibt es im europäischen Raum keine Richtlinien und Definitionen für konfessionslose Priesterinnen und Priester, da der Beruf des Zelebranten noch nicht offiziell etabliert ist. Ohne diese fundamentalen Grundlagen ist es aber nicht möglich, verbindliche und allgemeingültige Qualitätsstandards aufzubauen, zu vereinbaren und zu etablieren.
Die bisher fehlenden Grundlagen bedeuten jedoch nicht, dass die Informationen und Fakten für dieses Buch nicht auch aus anderen Quellen stammen können. Es ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil an Fachwissen bereits in diversen Artikeln zusammengetragen und teilweise auch publiziert wurde. Hier wird bekanntes und reaktiviertes Fachwissen aus der Praxis strukturiert und in einer verständlichen Sprache in eine komprimierte Form gebracht.
In diesem Handbuch sind alle relevanten Themen zu den wichtigsten Übergangsritualen in einer kompakten Form gesammelt und in einer verständlichen Sprache aufbereitet.
Zur Leserin und zum Leser
Das Handbuch wurde selbstredend sowohl für angehende als auch für ausgebildete Zelebrantinnen und Zelebranten verfasst. Der Frage, wer diese Zielgruppe ist, wird später ausführlicher nachgegangen. Vereinfacht gesagt handelt es sich um Priesterinnen und Priester, die keiner religiösen Organisation wie beispielsweise einer Kirche unterstellt oder angeschlossen sind. Man könnte auch von Freiberuflichen sprechen. Diese Berufsgruppe, die sich erst langsam in den säkularisierten Gesellschaften etabliert, bewegt sich zurzeit in einem beruflichen Vakuum. Denn mit dem Fehlen einer übergeordneten bestimmenden Organisation (analog der Kirche oder dem Staat) fehlen auch Regeln, Richtlinien und Sakramente. Ziel dieser Publikation ist es, Zelebrantinnen und Zelebranten eine praxisbezogene Grundlage für die Ausübung ihres Berufs zur Verfügung zu stellen. Mit einer einheitlichen und anerkannten Zertifizierung soll sichergestellt werden, dass die Profession eine seriöse Grundlage bekommt, auf die sich Kundinnen und Kunden verlassen können, denn Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für dieses Geschäft.
Auch ausgebildete Theologinnen und Laienprediger können sich mit dieser Lektüre auseinandersetzen – im Hinblick darauf, eines Tages «nicht-kirchliche Rituale» anzubieten, zu planen und durchzuführen und somit als Zelebrantinnen und Zelebranten tätig zu werden.
Zudem sind auch potenzielle Kundinnen und Kunden sowie interessierte Kreise eingeladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Rituale, und insbesondere die hier beschriebenen Übergangsrituale, dürfen keine «geheimen Handlungen» sein. Im Gegenteil: Es ist wichtig, diese Rituale in derÖffentlichkeit sichtbar zu machen. Auch sollen der Beruf und die Tätigkeiten der Zelebrantinnen und Zelebranten dank mehr Transparenz besser verstanden werden. Wünschenswert ist, das Handbuch einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen.
Zum Autor
Robert Mähr wurde in der Schweiz an der Fachschule für Rituale im ersten Lehrgang zum Zelebranten ausgebildet. Da der Begriff des Zelebranten zu dieser Zeit nicht greifbar beziehungsweise kaum bekannt war, wurde er unter der Berufsbezeichnung «Ritualmeister» aktiv. In dieser Funktion hat er unzählige Rituale entwickelt und durchgeführt. Während dieser Zeit hat sich der ausgebildete Pädagoge, technische Kaufmann, IT-Spezialist und Unternehmensberater immer daran gestört, dass er mit seinem «neuen Beruf» nirgends verwurzelt war. Ferner besteht bei der Bezeichnung «Ritualmeister» nicht nur grosser Erklärungsbedarf, die Benennung ist in der westlichen Welt teils auch negativ besetzt. Alternativ bot sich der Begriff «Ritualleiter» an. Dieser deckt aber nicht das gesamte vom Autor angebotene Spektrum ab. Der Wunsch, diesem undefinierten Zustand ein Ende zu setzen, verstärkte sich. Bei der Suche nach einem passenden Namen spielte der Zufall eine wichtige Rolle: Als ein alter Freund aus Mexiko erzählte, dass er in den USA eine Ausbildung zum «Celebrant» absolviert hatte, wurde dem Autor klar, dass in Europa etwas Ähnliches aufgebaut werden muss. Damit eine Vereinheitlichung geschaffen werden kann, müssen zuerst die Standards festgelegt werden. So wurde die Idee eines Handbuchs geboren.
Geschlechtsspezifische Formulierungen
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat der Autor vorwiegend die männliche Form «Zelebrant» eingesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass bei geschlechtsspezifischen Formulierungen Personen jeglichen Geschlechts gemeint sind. Damit möchte sich der Autor bewusst von religiösen Organisatoren distanzieren, die Frauen den Zutritt zum Priesteramt verweigern. Wenn nur eine Form gewählt wurde, sind andere automatisch auch gemeint.
Handbuch für Zelebrantinnen und Zelebranten
Taufe, Initiation, Hochzeit, Scheidung und Bestattung. Praxis und Theorie der wichtigsten Übergangsrituale.
Robert Mähr
2. überarbeitete Ausgabe
Deutsche Ebook-Ausgabe, 2019
Verein Celecert, St. Gallen, Schweiz
Umschlaggestaltung: M. Mähr
Umschlagbild © Robert Mähr
© Celecert
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-9524898-6-4
www.celecert.org
Beruf Zelebrant
Der Begriff «Zelebrant» wird in verschiedenen Kulturen und Religionen unterschiedlich verwendet und hat dementsprechend unterschiedliche Bedeutungen. Für die weitere Verwendung des Begriffs gilt folgende Definition:
Eine Zelebrantin oder ein Zelebrant ist eine Fachperson für die Gestaltung und Durchführung von Übergangsritualen in einem unabhängigen Rahmen; das heisst, eine ökumenische Priesterin oder ein ökumenischer Priester.
Herkunft des Begriffs «Zelebrant»
In allen Religionsgemeinschaften werden Menschen mit besonderen spirituellen Fähigkeiten oder einem geheimen Wissen für die Durchführung und Weitergabe der eigenen Lehre bestimmt und ausgewählt. Oft verfügen diese Personen auch über Sachkenntnisse zu überlieferten spezifischen rituellen Abläufen und Handlungen, sind also Eingeweihte, oft auch Geweihte. Von den Gläubigen werden diese ausgewiesenen Spezialisten als Priester, Schamanen, Druiden, Gurus u. A. verehrt und stellen oft ein Verbindungsglied zwischen einer übergeordneten (göttlichen) Kraft und der Glaubensgemeinschaft dar.
In verschiedenen vorchristlichen Kulturen wurden Personen, die sich mit übersinnlichen oder unerklärlichen Taten profilierten, in Initiationsritualen zu Schamanen oder Priestern geweiht, wobei auch Frauen diese Stellung innehatten. In dieser Funktion wirkten sie als Heiler, Wahrsager, Berater, Vermittler und spirituelles Oberhaupt und waren für die Einhaltung und Durchführung der Rituale zuständig.
Verschiedene Herrscher übernahmen in ihren Kulturen selbst die religiöse Führung (Kaiser) oder setzten dafür Priester oder Priesterinnen ein. Daraus ist in einigen Religionsgemeinschaften ein abgesonderter Priesterstand mit genau definierten Rechten und Pflichten entstanden. Dieser Priesterstatus wurde und wird durch Vererbung weitergegeben oder kann in einem Studium erlernt und mit einem spezifischen Aufnahmeprozedere – einer Initiation – erlangt werden.
In der jüdischen, christlichen, moslemischen und der buddhistischen Kultur werden Priester zur Vorbereitung auf ihr künftiges Amt in eigens dafür vorgesehenen Schulen beziehungsweise Universitäten ausgebildet. Rabbis, Imame, Pfarrer und Priester sind somit Schriftgelehrte der entsprechenden «Heiligen Schrift». Diese Funktion wird in einem feierlichen Akt von einer religiösen Autorität vergeben beziehungsweise werden die Anwärterinnen und Kandidaten durch einen Weihakt in ihr Amt eingesetzt.
Beim Hinduismus zählen vor allem der persönliche Lebensweg sowie die vollbrachten spirituellen Taten und Erfahrungen, die einen Priester (Guru) auszeichnen. Die Gurus werden analog der schamanischen Tradition nicht von einer Instanz ausgewählt, sondern von den Gläubigen dazu erkoren.
Sowohl Schamanen als auch Priester führen verschiedene «heilige» Funktionen und Aufgaben aus, man spricht auch von Sakramenten. Neben der Organisation und Durchführung spiritueller Rituale wirken sie oft auch als Medizinmänner und Hellseherinnen. Um das Berufsfeld in diesem Buch möglichst klar abzugrenzen, beschränkt sich das Einsatzgebiet des Zelebranten auf die klassischen Übergangsrituale.
Aufgaben des Zelebranten
Als Fachperson für rituelle Handlungen ist ein Zelebrant auf die zentralen menschlichen Übergangsrituale spezialisiert. Somit beziehen sich die Hauptaufgaben auf die Taufe, die Pubertätsinitiation, die Hochzeit, die Scheidung und das Bestattungsritual. Da verbindliche Grundlagen und Vorschriften für diese Rituale fehlen und die Betroffenen explizit keine bestehenden kirchlichen Rituale wünschen, müssen Alternativen gesucht, entwickelt und angeboten werden. Das bedeutet nicht zwingend, dass für jeden Kunden ein neues Ritual erfunden werden muss. Bestehende Rituale können auch reaktiviert, angepasst und weiterentwickelt werden, stets mit dem Ziel verbunden, bei den Betroffenen eine «heilende» Wirkung auszulösen. Oft ähneln diese Rituale den bestehenden kirchlichen Ritualen, sie unterscheiden sich aber im Wesentlichen in der freien Wahl des Durchführungsorts, der Inhalte und des Ablaufs. Das Miteinbeziehen der Kunden in die Planung stellt sicher, dass die Beteiligten vom Ritual bewegt und gleichzeitig keine Tabus gebrochen werden.
Selbstverständlich kann der Aufgabenbereich eines Zelebranten auf andere rituelle Handlungen ausgeweitet werden – stets unter der Voraussetzung, dass die ethischen Grundwerte eingehalten werden (siehe weiter unten «Ehrenkodex für Zelebranten»).
Entwickeln, Anpassen und Verändern von Übergangsritualen
Übergangsrituale werden in allen Kulturen und Religionen in unterschiedlichen Formen durchgeführt. Wichtige Funktionen dieser Rituale sind die Festigung des Glaubenssystems und die Bindung an die Gemeinschaft beziehungsweise an die Kirche. In den meisten Religionen werden diese Rituale nach einem festen Ritus durchgeführt, der von Zeit zu Zeit an gesellschaftliche Veränderungen angepasst wird. Jüngstes Beispiel einer solchen Anpassung in der katholischen Kirche ist die Heraufsetzung des Firmalters von 13 auf 18 Jahre. Damit wird die Firmung1 der staatlichen Volljährigkeit mit 18 Jahren gleichgestellt. Als weiteres Beispiel sind die Bestattungsrituale in säkularisierten Ländern Europas zu nennen. Da heute eine Mehrheit die Kremation2 einer Erdbestattung vorzieht (in der Schweiz werden ca. 85 Prozent der Menschen kremiert), müssen auch die Bestattungsrituale diesen Veränderung angepasst werden.
Die Entwicklung von Übergangsritualen ist in der Regel ein evolutionärer und stetiger Prozess. Das heisst, die bestehenden Rituale werden bei Bedarf mit kleinen Änderungen angepasst. In unseren multikulturellen Gesellschaften werden Elemente unterschiedlicher Rituale miteinander kombiniert, verändert und weiterentwickelt. Dieser Adaptionsprozess wurde schon früher praktiziert. Beispielsweise haben Christen rituelle Elemente der Kelten, die in der Bevölkerung sehr verbreitet und stark verankert waren, übernommen. Dies erklärt beispielsweise, weshalb der Tannenbaum das Symbol des christlichen Weihnachtsfest ist, obwohl er einer vorchristlichen Tradition entstammt.
Rituale und ihre Symbole werden oft mit einer Religion gleichgesetzt, sind manchmal negativ besetzt oder werden tabuisiert. Das Kreuz beispielsweise wird häufig mit dem Christentum assoziiert, obschon das Symbol schon in vielen vorchristlichen Religionen verwendet wurde. Deshalb ist es wichtig, diese scheinbaren Details bei der Anpassung von Ritualen zu berücksichtigen. Kleine Adaptionen der Rahmenbedingungenoder Hilfsmittel können die Wirkung eines Rituals massgebend verändern.
Es ist davon auszugehen, dass die meisten Rituale irgendwo auf der Welt schon einmal praktiziert wurden. Da Rituale von unterschiedlichen Faktoren (Ort, Zeitpunkt, Teilnehmende, Hilfsmittel, Leitung u. a.) abhängen, sind unzählige Variationen möglich. Werden überlieferte Rituale in einen bestimmten Kontext gestellt, wirken sie für die Betroffenen wie «neue» Rituale. Beispielsweise ist eine Jazzbeerdigung (New Orleans Funeral) bei einer protestantischen Abdankung in der Schweiz nicht üblich und kann deshalb bei einigen Gläubigen Unverständnis und Verunsicherung auslösen. Unbekannte Rituale müssen deshalb im Vorfeld transparent gemacht werden, damit die Betroffenen nicht überfordert sind und auch von der Möglichkeit Gebrauch machen können, dem Ritual fernzubleiben.
Rituale können gesellschaftlichen Veränderungen angepasst, müssen aber nicht ständig verändert werden. Erfolgreiche Rituale sollen wiederholt werden, so lange sie eine positive Wirkung erzielen und von den Betroffenen nachgefragt werden.
Unbekannte Rituale müssen den Teilnehmenden unbedingt im Voraus erklärt werden, damit sich diese darauf einstellen oder auf die Teilnahme verzichten können.
Durchführen von Übergangsritualen
Die Durchführung beziehungsweise die Leitung von Ritualen ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die einen hohen Grad an Verantwortung erfordert. Im Gegensatz zu vielen anderen Tätigkeiten kann ein Übergangsritual in der Regel nicht wiederholt werden – eine Taufe, eine Pubertätsinitiation oder eine Beerdigung sind einmalige Momente, die dadurch noch bedeutungsvoller werden. Dies erfordert eine besondere Achtsamkeit und Sorgfalt. Der Kunde legt die Verantwortung für das Gelingen des Rituals in die Hände des Zelebranten, der dafür sorgen muss, dass alles wunschgemäss abläuft. Dies setzt aber auch voraus, dass dem Zelebranten die uneingeschränkte Leitungsverantwortung übertragen wird. Leitung heisst in diesem Zusammenhang nicht nur Begleiten, sondern auch Führen. Somit übernimmt der Zelebrant in seiner Rolle die Gesamtverantwortung, was oft grossen Erwartungsdruck und eine entsprechende Belastung erzeugen kann.
Übergangsrituale können meistens nicht wiederholt werden, weshalb sie für die Beteiligten einmalig sind.
Verantwortung des Zelebranten
Wie schon ausgeführt kann ein Ritual nur dann funktionieren, wenn der Zelebrant die volle Verantwortung übernimmt. Das bedeutet, dieser Person eine enorme Macht zu übertragen, die unter keinen Umständen ausgenützt oder missbraucht werden darf. Um dies sicherzustellen, werden die Zelebranten zur Einhaltung eines einheitlichen Ehrenkodex verpflichtet, der auch den Kunden bekannt sein muss.
Ehrenkodex3 für Zelebranten
Eine Zelebrantin oder ein Zelebrant verpflichtet sich, folgende ethische Grundsätze einzuhalten.
Wir achten und respektieren unsere Mitmenschen, unabhängig von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Sprache, Alter, Kultur, Lebensform, religiöser, weltanschaulicher oder politischer Überzeugung, Gesundheit, Ansehen, Bildung, Entwicklung und sozialer Zugehörigkeit.
Wir grenzen uns von Haltungen und Gruppierungen ab, die dem Leben feindlich gesinnt sind.
Wir anerkennen die Autonomie und Würde unserer Mitmenschen und das Recht auf Selbstbestimmung.





























