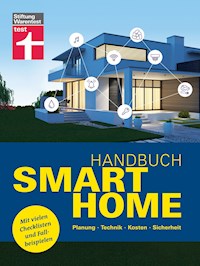
Handbuch Smart Home: Wie funktioniert die Technik? - Schritt für Schritt zum eigenen Smart Home - Systeme im Überblick E-Book
Frank-Oliver Grün
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Schritt für Schritt zum eigenen Smart Home Dieses Handbuch bietet Baufamilien, Eigenheimbesitzern, Wohnungseigentümern und Mietern den kompetenten Überblick über alle aktuellen Systeme zur Hausautomatisierung. Checklisten und Beispiele aus der Praxis zeigen, wie man smarte Haustechnik am besten für sich nutzt. Im Smart Home ist vieles möglich, doch was ist sinnvoll? Nutzen Sie unsere Checklisten zur Ermittlung Ihres wirklichen Bedarfs und kalkulieren Sie nicht nur Kosten, sondern auch Zeit- und Arbeitsaufwand. - Wie funktioniert Smart Home? Die Optionen vom smarten Heizungsventil bis zum vollautomatischen Hausmanagement - Das richtige System finden: Unabhängige Bewertung der Vor- und Nachteile aller relevanten Smart-Home-Anbieter - Kosten und Nutzen: Detaillierte Kostenrechnungen für den Einstieg mit Starter-Set bis zum Profi-System für das vernetzte Eigenheim Der Ratgeber der Stiftung Warentest gibt einen kompetenten Überblick über alle aktuellen Systeme am Markt, informiert über Gerätesicherheit sowie den Schutz des Netzwerks und der Privatsphäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANDBUCH SMART HOME
Frank-Oliver Grün
INHALTSVERZEICHNIS
WARUM SMART HOME?
Komfortgewinn
Sicherheit
Energiesparen
Flexibilität
Risiken und Nebenwirkungen
Interview: „Ein vernünftiges Konzept spart Geld“
WIE FUNKTIONIERT SMART HOME?
Vom smarten Gerät zum smarten Gebäude
Sender und Empfänger
Sensoren im Smart Home
Aktoren im Smart Home
Alles hört auf ein Kommando
Die Steuerung: zentral oder dezentral?
Zentrale Steuerung
Dezentraler Aufbau
Eine Mischung aus beidem
Online- und Offlinebetrieb
Selbst ist das Haus: die Automatisierung
Verknüpfungen und Regeln
Software und Zugriffsrechte
Die Bedienung: alles unter Kontrolle
Klassisch: Wandtaster im Smart Home
Visualisierung: auf einen Blick
Touchscreen an der Wand
Digitale Assistenten
Sprachsteuerung ohne Internet
Automatisierung: Das Haus kontrolliert sich selbst
Kompatibilität: eine Frage des Standards
Herstellerstandards
Smart-Home-Funkprotokolle
Multistandard-Zentralen
HomeKit & Co.
Der Über-Standard Matter
Musterbeispiel KNX
Der Unterhalt: laufende Kosten
Energiekosten
Softwareupdates
Smart Home im Abo
Rechenbeispiel: günstiges Smart Home in der WG
WAS GEHT ÜBERHAUPT?
Licht: mehr als nur Beleuchtung
Anwesenheit simulieren
Zentralschalter
Stimmung auf Knopfdruck
Biologisch wirksames Licht
Intelligente Auslöser
Netzwerke fürs Licht
Hue, Trådfri & Co.
Funklampen ohne Bridge
Steckdosen: schalten und messen
Stand-by-Stopp
Zwischenstecker
Wandsteckdosen
Beschattung: Sicht- und Sonnenschutz
Elektrische Antriebe
Intelligente Automatik
Alles, was sich bewegt
Klima: richtig heizen, kühlen, lüften
Intelligent heizen
Vernetzung ab Werk
Smarte Regler nachrüsten
Kühlen nach Bedarf
Automatisch frische Luft
Energie: intelligentes Management
Was ist ein Smart Meter?
Vorteile vernetzter Zähler
Gestatten: Energiemanager
Sonderfall Balkonkraftwerk
Bad und Sanitär: vernetztes Wasser
Elektronische Armaturen
Sauna und Dampfbad
Smarte Spiegel
Rechenbeispiel: die junge Familie
Garten: im grünen Bereich
Mähroboter
Bewässerung
Licht und Sensoren
Musik im Freien
Videoüberwachung: voll im Bild
IP-Kameras
Cloud-Kameras
Türkameras
Alarm: auf Nummer sicher
Was ist eine Alarmanlage?
Technische Eigenschaften
Smart-Home-Integration
Zertifiziert oder nicht?
Multiroom-Audio: Musik im ganzen Haus
Multiroom-Audiosysteme
Woher kommt die Musik?
Unsichtbare Lautsprecher
Integration ins Smart Home
Multiroom-Video: verteiltes Programm
Fernsehen über IP
Videos im Netzwerk
Geeignete Programmquellen
Smart-TV & Co.
Kontrollmöglichkeiten
Universal-Fernbedienung
Professionelle Systeme
Tür und Tor: Zugang unter Kontrolle
Was ist ein Smartlock?
Türöffner für das Mehrfamilienhaus
Garagen- und Hoftore
Hausgeräte: kleine und große Helfer
Der Internetkühlschrank
Haushaltsgroßgeräte
Vernetzte Kleingeräte
Ambient Assisted Living
Umgebungsunterstütztes Leben
Hilfe bei der Pflege
Smarte Problemlöser
Hilfe auf Zuruf
Interview: „Smart Homes sind auch AAL-Systeme“
SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM EIGENEN SMART HOME
Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?
Typ A – Tüftler
Typ B – Heimwerker
Typ C – Auftraggeber
Typ D – Anwender
Wie ist die Ausgangssituation?
Neubau und Sanierung
Bestandsgebäude nachrüsten
Darauf sollten Mieter achten
Drahtgebunden oder drahtlos?
Weniger Elektrosmog
Eingebaute Sicherheit
Das spricht für Funk
Große Flexibilität
WLan nicht vergessen
Mögliche Hindernisse
Zuerst: Machen Sie sich ein Bild
Inspirationen sammeln
Wünsche formulieren
Vorstellungen konkretisieren
Rechenbeispiel: Funkinstallation vom Profi
Die Fünf Ws der Systemauswahl
Was kostet der Spaß?
Ausstattungswerte
Finanzielle Förderung
Die Partnersuche
Fertighäuser: das schlüsselfertige Smart Home
Funk im Fertigbau
Verkabelte Systeme
Was passiert nach dem Bau?
Kabel & Co: Tipps für die Planung
Zukunftssichere Elektrik
Die richtigen Kabel
Rechenbeispiel: Sanierung mit Funk und Kabel
SYSTEME IM ÜBERBLICK
Spezialisten für bestimmte Aufgaben
Netatmo Wetterstation
Nuki Smartlock
Philips Hue
Ring Video Doorbell
Sonos
Tado
Komplettsysteme für Selbermacher
Apple HomeKit
AVM Fritzbox
Bosch Smart Home
Devolo Home Control
EQ-3 Homematic
EQ-3 Homematic IP
Homee
Ikea Home Smart
Mediola
Samsung SmartThings
Telekom Deutschland Magenta Smart-Home
Die Gebäudetechnik der Profis
Afriso Home
Busch-Jaeger Busch-free@Home
Coqon
Digitalstrom
Eltako
EQ-3 Homematic IP wired
Fibaro Home Center (Yubii Home)
Gira/Jung eNet Smart Home
Jäger Direkt Opus GreenNet
KNX
Loxone
MyGekko
Rademacher HomePilot
Somfy Tahoma
Wibutler Pro
Interview: „Den Großen nicht einfach das Feld überlassen“
Selbst gebaut von Anfang an
Was ist der Raspberry Pi?
Einkaufsliste für Selbermacher
Die Aufgabe von Middleware
FHEM
Home Assistant
Homebridge
ioBroker
IP Symcon
OpenHab
Rechenbeispiel: Smart Home – all inclusive
Ein Wort zum Internet der Dinge
Vorteile von IoT
Nicht immer kostenlos
Vertrauen auf Sicherheit
Smarte Displays und Apps
Amazon Alexa
Apple Siri
Google Assistant
Home Connect Plus
IFTTT
WIE SICHER IST DIE SMARTE TECHNIK?
Gefühltes und reales Risiko
Gerätesicherheit
Serversicherheit
Netzwerksicherheit
Personenbezogene Daten
Prüfzeichen und Qualitätssiegel
Interview: „Viele Billiganbieter sparen an Sicherheit“
SERVICE
Literatur
Musterhaus-Ausstellungen
Stichwortverzeichnis
WARUM SMART HOME?
Wenn es nach Studien und Umfragen geht, steht der Heimvernetzung eine große Zukunft bevor, und zwar schon ziemlich lange. Seit Jahren prophezeien die Marktforscher dem Thema riesiges Wachstumspotenzial. Bis 2020 sollte die Zahl der Smart-Home-Haushalte in Deutschland bereits die Millionengrenze überschreiten, rechnete der Branchenverband Bitkom auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung 2014 vor.
Ob dieses Ziel erreicht wurde, hängt nicht zuletzt von der Definition ab. Laut jüngsten Zahlen von 2021 (Quelle: Bitkom Research) haben mittlerweile 4 von 10 Deutschen ab 16 Jahren mindestens ein Smart-Home-Gerät. Oft handelt es sich dabei um fernbedienbare Lampen oder Heizungsregler. Auch Funksteckdosen erfreuen sich großer Beliebtheit. Das zeigt, wo eine Hauptmotivation für den Kauf vernetzter Haustechnik liegt: in der Bequemlichkeit.
Komfortgewinn
Ein smartes Heim übernimmt viele Alltagsaufgaben. Sei es der Griff zum Lichtschalter oder der Gang in den Keller um nachzusehen, ob die Waschmaschine ihr Programm beendet hat. Elektrische Rollläden stellen an sich schon einen Komfortgewinn dar, spart der Motor doch lästiges Kurbeln von Hand oder die morgendliche Turnübung am Gurt. In einem unvernetzten Haus müssen Sie aber trotzdem noch von Raum zu Raum gehen. Die Wandtaster der Antriebsmotoren drücken sich schließlich nicht von selbst. Sind die Antriebe mit einer Steuerung verbunden, reicht dagegen ein zentraler Befehl, um alle gemeinsam in Bewegung zu setzen – oder eben nur die Rollläden auf der Sonnenseite, wenn gewünscht.
Genauso funktioniert das mit vernetztem Licht. Beim Nachhausekommen bereiten die Lampen einen freundlich hellen Empfang. Sensoren an der Wohnungstür oder Bewegungsmelder machen es möglich. Zum Fernsehen, Arbeiten oder Lesen wählen programmierbare Lichtszenen auf Knopfdruck die passende Einstellung. Und abends müssen Sie nicht mehr durch die Wohnung patrouillieren, um jede Tischleuchte einzeln auszuknipsen. Stattdessen genügt ein Druck auf den zentralen „Alles aus“-Schalter am Bett.
Der Branchenverband Bitkom macht jährliche Umfragen zum Thema Smart Home. Danach steigt die Zahl vernetzter Produkte im Haushalt kontinuierlich. Besonders beliebt sind smarte Lampen und Leuchten.
Oft gehörtes Argument von Skeptikern: So eine Hausautomation mache die Menschen träge und bequem. Vom Sofa aufzustehen und selbst den Lichtschalter zu betätigen, habe noch niemandem geschadet. Das hieß es freilich auch, als die ersten drahtlosen TV-Fernbedienungen auf den Markt kamen. Elektrische Fensterheber im Auto? Automatikgetriebe? Auf viele Helfer, die früher Seltenheitswert hatten, möchte heute niemand mehr verzichten. Das dürfte in der Gebäudetechnik nicht anders sein.
Ein anderer Verdacht liegt da schon eher nahe. Abläufe im Haus zu steuern und den digitalen Befehlen bei ihrer Ausführung zuzuschauen, übt eine Faszination aus, der sich vor allem Männer schwer entziehen können. Manch einer fühlt sich vor seiner Smart-Home-Konsole wie Captain Picard im Kommandostand des Raumschiffs Enterprise. Doch was spielerisch beginnt und in der Jugend vor allem Spaß macht, kann in späteren Jahren ganz praktische Vorteile haben. Dann nämlich, wenn alltägliche Handgriffe wie das mechanische Öffnen oder Schließen von Rollläden beschwerlich werden. Wenn im Alter das Aufstehen aus dem Sessel langsamer geht und der Schalter für die Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche nicht mehr so leicht erreichbar ist.
Dann bekommt die Vernetzung eine neue Bedeutung. Sie hilft Ihnen, länger und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Die Technik reagiert auf Situationen im Alltag und erkennt mit der richtigen Sensorik sogar, ob alles in Ordnung ist. Ambient Assisted Living, kurz AAL, heißt dieses Prinzip im Fachjargon – auf Deutsch etwa „Umgebungsunterstütztes Leben“ (Seite 147).
Sicherheit
Ein Öffnungskontakt an der Wohnungstür, Bewegungsmelder im Flur – wer denkt da nicht an eine Alarmanlage? Es stimmt: Manche Bauteile aus dem Smart-Home-Sortiment kommen so oder so ähnlich auch in professionellen Einbruchmeldeanlagen vor. Und sie erfüllen hier wie dort denselben Zweck. Die Sensoren überwachen einen Bereich und schlagen Alarm, wenn etwas vor sich geht.
Ein vernetztes Alarmsystem erhöht die Sicherheit und kann weitere Aktionen auslösen – etwa bei einem Einbruchversuch zur Abschreckung das Licht einschalten.
Das macht die Hausinstallation aber nicht automatisch zu einer vollwertigen Alarmanlage. Gerade wenn es um den Schutz vor Einbrechern und anderen Gefahren geht, stellen Experten hohe Anforderungen an die Technik.
Wer teuren Hausrat, Kunst oder andere Wertgegenstände versichern will, benötigt eine Anlage, die vom Verband der Schadenversicherer (VdS) zertifiziert ist (siehe Seite 118). So ein System arbeitet als geschlossene Einheit, kann unter bestimmten Umständen aber seinen Status an ein Smart Home weitergeben, damit im Falle eines Alarms oder beim Scharfund Unscharfschalten automatisch Aktionen ausgelöst werden. Welche Lösung auf Ihre persönliche Situation passt, besprechen Sie am besten mit dem Fachbetrieb, der auch die zertifizierte Einbruchmeldeanlage installiert.
Auch ohne VdS-Siegel hebt ein smartes Gebäude jedoch das Sicherheitsniveau. Nur wenige Einbrecher werden sich in aller Seelenruhe die Zeit für einen Diebstahl nehmen, während draußen die Alarmsirene heult und drinnen eine Videokamera ihr Treiben dokumentiert. Vorteil im Smart Home: Vernetzte Komponenten können sich ergänzen und in ihrer Wirkung unterstützen. So sieht das Bild von Überwachungsvideos gleich viel schärfer aus, wenn zusammen mit dem Alarm das Licht angeht.
Im Idealfall kommt es gar nicht erst so weit, dass Kriminelle Ihre Wohnung ins Visier nehmen. Abschreckung lautet die Devise. Kaum ein Objekt wirkt auf Einbrecher so wenig einladend wie ein Gebäude, das rund um die Uhr bewohnt ist. Genügte früher ein Lämpchen mit Zeitschaltuhr, um Anwesenheit vorzugaukeln, fallen Profis heute darauf immer seltener herein. Doch was, wenn die Anwesenheitssimulation vom Verhalten echter Menschen nicht zu unterscheiden ist? Ein automatisiertes Gebäude schafft das in Perfektion – etwa über Lichtszenen, die den Alltag nachbilden und virtuellen Bewohnern scheinbar von Raum zu Raum folgen. Auch Jalousien, die ihre Lamellen nach dem Sonnenstand ausrichten und nicht wochenlang in derselben Position verharren, täuschen externe Beobachter über längere Urlaubsreisen hinweg. Wenn dann noch Lautsprecher nach dem Zufallsprinzip ein Radioprogramm spielen oder Hundegebell abspielen, dürften selbst gute Nachbarn glauben, dass jemand zu Hause ist.
PhotovoltaikÜberschüssiger Solarstrom fließt in einen Batteriespeicher oder treibt Hausgeräte an.
LüftungSensoren messen die Luftqualität und schalten bei Bedarf die Lüftung ein.
WärmepumpeSolarstrom vom Dach heizt für den Abend das Warmwasser vor.
HeizungRegler in den Räumen fordern nur dann Wärme von der Anlage im Keller an, wenn sie benötigt wird.
HausgeräteDie Waschmaschine meldet, wenn ihr Programm fertig ist. Der Herd schaltet selbst den Dunstabzug ein.
BeschattungRollläden oder Markisen öffnen und schließen sich automatisch.
BeleuchtungAußen- und Innenlampen sind programmierbar. Lichtszenen verändern die Beleuchtung nach Wunsch.
SteckdosenDie Steuerung schaltet elektrische Geräte ein und wieder aus – etwa beim Verlassen der Wohnung.
BedienungVernetzte Wandtaster oder Touchdisplays rufen programmierte Smart-Home-Szenen auf.
ZugangEin elektrischer Türschlossantrieb (Smartlock) lässt autorisierte Bewohner ins Haus – wenn nötig und erwünscht sogar ferngesteuert über das Internet.
BewässerungRegner und Rasensprenger treten automatisch in Aktion, wenn der Boden zu trocken wird.
RasenmäherDer Mähroboter zieht abhängig von Witterung und Anwesenheit der Bewohner seine Runden.
LautsprecherMultiroom-Lautsprecher spielen Musik im ganzen Haus und geben Alarmtöne wieder.
SprachsteuerungSmart Speaker mit einem integrierten digitalen Assistenten steuern die Haustechnik auf Zuruf.
AlarmOb Rauchentwicklung oder Einbruch: Das Smart Home warnt seine Bewohner in gefährlichen Situationen.
VideoüberwachungInnen- und Außenkameras behalten das Haus bei Abwesenheit im Blick.
E-Auto-LadestationDie Wallbox tankt den Akku vollautomatisch auf, wenn genügend Solarstrom zur Verfügung steht.
FernbedienungEine Smartphone-App gewährt von unterwegs aus Zugriff auf Licht, Heizung, Kameras und mehr.
Hinzu kommen Überwachungsmaßnahmen, die unbemerkt im Hintergrund ablaufen, den Bewohnern und Bewohnerinnen aber zusätzliche Sicherheit geben. Da wäre zum Beispiel der Feuchtesensor unter der Küchenspüle, der frühzeitig warnt, wenn ein Wasserschaden droht. Wer am offenen Kamin kuschelt, erfährt per CO-Sensor, wenn etwas mit der Verbrennung nicht stimmt und lebensgefährliches Kohlenmonoxid in den Raum entweicht. Vernetzte Rauchmelder tragen den Feueralarm vom Keller bis hinauf unters Dach. Außerdem informieren sie mit einer Nachricht auf dem Handy darüber, dass zu Hause womöglich gerade ein Brand ausbricht. Im Livestream der Überwachungskamera können Sie sich dann selbst ein Bild machen – und im Ernstfall gleich die Feuerwehr verständigen.
Energiesparen
Die Anbieter vernetzter Heizungsregler werben teilweise mit großen Einsparpotenzialen. Von einem Rückgang der Heizkosten um bis zu 30 Prozent ist die Rede. Es gibt Studien, die das belegen. 2013 hat das Fraunhofer Institut für Bauphysik im Auftrag von Tado die smarten Thermostate des Herstellers überprüft und konnte einen Rückgang des Energiebedarfs um 14 bis 26 Prozent feststellen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine gemeinsame Untersuchung von Rheinenergie und der Technischen Hochschule Köln im Jahr 2018.
Allerdings sind diese Aussagen nicht auf jeden Haushalt übertragbar. Die Heizungsanlage muss vor dem Umbau schon ziemlich ungeregelt gewesen sein, damit eine smarte Steuerung so viel bringt. Die Fraunhofer-Forscher gingen in ihrer Berechnung zum Beispiel davon aus, dass die Temperatur im unvernetzten Vergleichshaus konstant auf 20 Grad eingestellt war. Wenn die Heizung rund um die Uhr durchläuft, benötigt das vergleichsweise viel Energie. Schon eine automatische Nachtabsenkung, wie sie moderne Anlagen bieten, reduziert jedoch den Verbrauch. Nach Berechnungen der Stiftung Warentest senken 4 Grad weniger in der Nacht den Energiebedarf um 8 Prozent (test 8/2019). Eine außengeführte Kesselsteuerung mit Temperaturfühler im Freien lässt die Differenz weiter schrumpfen. Wie groß das Sparpotenzial einer vernetzten Steuerung ist, hängt also nicht zuletzt davon ab, wie energieeffizient das Heizsystem vor seiner Installation bereits war.
Smarte Heizsysteme helfen beim Energiesparen. Die App von Tado etwa kalkuliert Heizkosten im Voraus und gibt die voraussichtliche Ersparnis an.
Ein Tür- oder Fensterkontakt erkennt, wenn der Flügel offensteht. Er meldet dies der Heizung, worauf der Regler am Heizkörper automatisch sein Ventil schließt.
Hinzu kommt die Bausubstanz als temperaturausgleichender Faktor. Im gut isolierten Passiv- oder Niedrigenergiehaus machen sich smarte Thermostate weniger bemerkbar als in einem Gebäude, das durch seine Außenwände schnell Wärme verliert. Altbauten sind deshalb prädestiniert für eine intelligente Steuerung – und Haushalte mit einem unregelmäßigen Tagesablauf profitieren besonders von ihr. So kann ein System mit Anwesenheitserkennung zum Beispiel automatisch die Heizung drosseln, wenn alle das Haus verlassen haben. Beim Heimkommen der ersten Person regelt es die Temperatur von selbst wieder hoch. Die Zeit dazwischen, in der weniger geheizt wird, spart Geld. Mit Präsenzmeldern (siehe Seite 81) lässt sich dieses Prinzip noch weiter verfeinern. Sie schalten normalerweise das Licht, stellen aber auch fest, ob Schlafräume oder Gästezimmer längere Zeit unbewohnt sind. Dort kann die Temperatur dann ruhig etwas niedriger liegen.
Ein Kontakt- oder Temperatursensor am Fenster verhindert, dass Heizkörper beim Lüften unnötig aufdrehen und extra Energie verschwenden. Wer hinterher vergisst, seine offenen Fenster wieder zu schließen, kann sich von einer Smart-Home-Automation daran erinnern lassen, ehe der Raum völlig auskühlt. Prinzipiell gilt: Je langsamer das Gebäude von sich aus auf Temperaturänderungen reagiert, desto weniger bringen kurzzeitige Korrekturen. Eine vergleichsweise träge Fußbodenheizung muss nicht jedes Mal herunterfahren, wenn Sie zum Einkaufen aus dem Haus gehen.
Im Vergleich mit der Heizung und Warmwassererzeugung machen Lampen und andere Elektrogeräte nur etwa 15 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in privaten Gebäuden aus. Der Anteil für Beleuchtung ist wegen effizienter LED-Technik über die Jahre sogar gesunken. Weil gleichzeitig die Strompreise steigen, kann es sich trotzdem lohnen, den Verbrauch im Blick zu behalten. Ein Smart Home bietet dafür gleich mehrere Möglichkeiten. Die offensichtliche: Es zeigt an, wie viel Watt- oder Kilowattstunden durch die Leitung fließen. Dadurch werden Kontrollen des Energiebedarfs überhaupt erst möglich.
Im einfachsten Fall genügt dafür eine Messsteckdose mit App. Sie erfasst den Verbrauch und dokumentiert ihn über längere Zeit. Allerdings liefert sie nur Werte eines einzelnen Geräts – oder die Summe aller Verbraucher, die gemeinsam an einer Steckdosenleiste hängen. Mehr Überblick bieten sogenannte Energiezähler oder Smart Meter im Sicherungskasten (siehe „Energie …“ Seite 90). Sie ermitteln ihre Daten direkt am Zähler oder an der Stromzuleitung und ordnen sie Verbrauchern im Haushalt zu. So bleiben heimliche Energiefresser nicht lange verborgen – und die Wohnenden wissen schon vor der jährlichen Stromrechnung, welche Kosten auf sie zukommen.
Was sich mit den Erkenntnissen sonst noch anfangen lässt, hängt von der Smart-Home-Installation ab. Steckdosen, die per Funk oder Leitung vernetzt sind, können auf diesem Weg auch Steuersignale empfangen. Ein Befehl trennt dann zum Beispiel die Kaffeemaschine vom Netz, sobald das Frühstück vorbei ist. Schon eine Stunde, die das Gerät weniger heizt, spart bei Filtermodellen mit 1000 Watt Leistungsaufnahme rund 30 Cent am Tag – macht aufs Jahr gerechnet mehr als 100 Euro. Bereitet ein Kaffeevollautomat den Cappuccino oder die Latte Macchiato zu, kann der Effekt auch größer ausfallen. Das kommt auf die Stand-by-Einstellungen und -Funktionen der Maschine an.
Soll ein Gebäude nicht nur Energie sparen, sondern auch selbst welche erzeugen, macht sich Vernetzung doppelt bezahlt. Denn Photovoltaikanlagen auf dem Dach liefern Strom, sobald die Sonne scheint, egal, wie viel davon gerade benötigt wird. Bei klarem Himmel übersteigt die Leistung der Solarmodule regelmäßig den Eigenverbrauch. Früher lohnte es sich, diesen Überschuss zum gesetzlich festgelegten Preis an Stromversorger zu verkaufen und ins öffentliche Netz einzuspeisen. In Zeiten sinkender Einspeisevergütungen ist es besser, ihn selbst zu verbrauchen (siehe Seite 93).
Die Kontrolle elektrischer Verbraucher macht smarte Gebäude zu einem wichtigen Bestandteil der Energiewende. Wenn Stromversorger künftig last- und zeitabhängige Tarife anbieten, in denen der Kilowattpreis den Tag über schwankt, steuert die Elektronik das Haus so, dass es am günstigsten ist.
Flexibilität
Ein Vorteil vernetzter Gebäude wird leicht übersehen oder findet bei der Planung wenig Beachtung: Funktionen lassen sich nachträglich ändern. Sie sind buchstäblich nicht mehr in Stein gemeißelt wie bei einer traditionellen Elektroinstallation. Dort geben Leitungen und Unterputzdosen vor, wo zum Beispiel die Lichtschalter liegen. Als Auftraggeber müssen Sie im Planungsstadium entscheiden, an welche Wand im Schlafzimmer das Bett kommt – damit der Elektriker die Anschlüsse vorsehen kann. Wenn Ihnen nach dem Einzug ein anderer Aufstellungsort besser gefällt? Pech gehabt.
An die Esszimmerwand soll nachträglich ein Dimmer? Dann hat der Elektriker im Rohbau hoffentlich schon eine tiefe Unterputzdose gesetzt. Sonst reicht der verfügbare Platz für die Montage nicht. Die Kinder ziehen aus und eins der Zimmer soll künftig als Hobbyraum dienen? Solche Nutzungsänderungen kommen öfter vor, als man denkt. Im Smart Home kein Problem: Mit einem funkbasierten System kleben Sie Taster, Dimmer, Raumthermostate oder Rollladenwippen einfach dorthin, wo es gerade am besten passt. Auch sogenannte Hausbussysteme mit Steuerleitungen in den Wänden sind meist über drahtlose Module erweiterbar. Da bei ihnen die Intelligenz aber häufig ohnehin im Schaltkasten sitzt, lässt sich vieles per Software lösen. Der verkabelte Wandtaster spielt dann nur den Auslöser. Welche Lampen, Steckdosen oder Rollläden er steuert, entscheidet die Programmierung.
Viele Smart-Home-Systeme dokumentieren die Leistungsaufnahme angeschlossener Verbraucher. So lässt sich feststellen, wohin der Strom im Haushalt fließt.
Wichtig bei allen Festinstallationen mit Leitungen in den Wänden: Planen Sie den späteren Ausbau mit ein. Auch wenn vorerst nur ein wenig Lichtsteuerung gewünscht ist. Das macht den Bau oder die Sanierung zwar etwas teurer (siehe Seite 187), spart langfristig aber Geld, weil das „Nervensystem“ für ein smartes Gebäude bereits existiert. Das „Gehirn“, die Steuerintelligenz, kann dann jederzeit folgen, wenn wieder mehr Budget da ist.
Risiken und Nebenwirkungen
Neben vielen guten Argumenten für die Hausautomatisierung gibt es auch ein paar Risiken, die hier nicht verschwiegen werden sollen. Sie hängen vor allem mit der Systemauswahl zusammen. Denn anders als im klassischen Elektrohandwerk fehlt für intelligente Gebäude eine durchgängige Standardisierung. Elektroinstallationen sind in Deutschland durch VDE-Bestimmungen und DIN-Normen geregelt. Von der Leitungsführung über die Montagehöhe der Lichtschalter bis hin zur Mindestanzahl von Steckdosen pro Raum reichen die Vorschriften. Wer Komponenten nachkauft – selbst nach Jahren oder Jahrzehnten – kann sicher sein, dass sie technisch zu einer bestehenden 230-Volt-Installation passen.
Im Smart Home gelten etwas andere Regeln. Zwar gibt es auch hier Standards und Konventionen, doch sind sie weniger verbindlich. Verschiedene Lösungen haben sich parallel entwickelt und existieren nebeneinander. Manche davon gehen auf einen bestimmten Hersteller zurück, der die Komponenten baut, pflegt und weiterentwickelt. Vorteil eines solchen Komplettangebots: Weil alles aus einer Hand kommt, spielt die Technik reibungslos zusammen. Andererseits birgt die Abhängigkeit von einer einzigen Firma auch Gefahren. Sollte der Anbieter des proprietären Systems irgendwann sein Sortiment ändern oder vom Markt verschwinden, kann es schwierig werden, Ersatzteile zu bekommen.
Wer auf namhafte, gut eingeführte Produkte setzt, minimiert dieses Risiko. Bei einem System, das schon lange existiert und viele Kunden hat, lohnt sich die Weiterentwicklung eher als wenn kaum Nachfrage besteht. Zusätzliche Sicherheit bringen standardisierte Funkprotokolle wie EnOcean, Z-Wave und Zigbee. Sie kommen herstellerübergreifend zum Einsatz und vergrößern die Produktauswahl. Fällt zum Beispiel ein Anbieter von Zigbee-Leuchtmitteln weg, lässt sich die Lücke mit Lampen aus dem Sortiment eines anderen schließen.
Problem dabei: Nicht alles an den Funkprotokollen ist komplett durchstandardisiert. Manche Funktionen setzen die Smart-Home-Hersteller in Eigenregie um. So kann es passieren, dass Fremdprodukte nur eingeschränkt kompatibel sind oder ihre Eigenschaften von System zu System variieren. Auch deshalb bevorzugen viele Installationsbetriebe einen anderen Standard. Er heißt KNX und entstand 1999 aus dem Zusammenschluss dreier europäischer Verbände (siehe „Musterbeispiel KNX“, Seite 53). Mittlerweile produzieren einige Hundert Hersteller in aller Welt Geräte und Software dafür. Mehr als die Hälfte aller intelligenten Gebäude in Deutschland sind damit vernetzt.
Im Zweckbau hat sich KNX als Industriestandard etabliert. Auch luxuriöse Smart Homes machen sehr oft Gebrauch von der Technik. Allerdings gehört eine Automatisierung mit KNX zu den eher kostspieligen Lösungen, was auch an der kabelgebundenen Bus-Installation liegt. Zwar lassen sich KNX-Signale inzwischen drahtlos per Funk und im normalen Stromnetz übertragen (Powerline), Busleitungen spielen aber immer noch die Hauptrolle. Wer mit spitzem Bleistift rechnet oder ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, sucht deshalb häufig nach Alternativen.
Zum Glück gibt es viele davon. Manchmal muss es gar nicht eine Installation allein sein, die sämtliche Anforderungen erfüllt. Viele Smart-Home-Produkte bieten Schnittstellen zu anderen Systemen. So finden zum Beispiel auch Insellösungen für Licht, Musik oder Sicherheit den Anschluss ans Gebäude. Oder eine Zentrale mit mehreren Funkstandards bringt Geräte verschiedener Hersteller unter einen Hut. Die folgenden Kapitel helfen Ihnen dabei, eine passende Kombination zu finden.
„EIN VERNÜNFTIGES KONZEPT SPART GELD“
Frank Völkel plant seit 2007 intelligente Gebäude im KNX-Standard. Aus den Erfahrungen beim Bau seines privaten Eigenheims und anfänglichen Freundschaftsdiensten für Bekannte ist ein bundesweit agierendes Unternehmen geworden. Mit seiner Firma Smartest Home betreut der Diplomingenieur Bauherren bei der Konzeption, Elektroplanung und Programmierung ihrer KNX-Lösung. Außerdem schreibt er Fachbücher, hält Vorträge und gibt Videokurse zum Thema und betreibt einen YouTube-Kanal mit mehr als 20 000 Abonnenten.
Sie haben vor vielen Jahren mit KNX angefangen und sind dabei geblieben. Warum?
Vor allem wegen der Flexibilität und Zukunftssicherheit. Mit dem KNX-Standard sind Sie herstellerunabhängig und wissen, dass es auch in 10 oder 20 Jahren noch Geräte gibt. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, für jedes Einsatzgebiet die beste Lösung zu wählen. Es gibt Hersteller, von denen der Jalousieaktor besonders gut ist, Heizungsaktoren würde ich vielleicht von einem anderem nehmen, die Gartenbewässerung von einem dritten Anbieter. Das geht nur mit KNX so gut – vorausgesetzt, Sie kennen die Stärken und Schwächen der einzelnen Sortimente. Aber dafür gibt es ja Planer wie uns.
KNX hat den Ruf, besonders teuer zu sein. Stimmt das?
Vor wenigen Jahren noch hätte ich dieser Aussage sofort zugestimmt. Mittlerweile würde ich sagen, dass Sie in einem per Kabel vernetzten Neubau kaum günstiger kommen als mit KNX. Das ist Herstellern wie MDT zu verdanken, die den Preis gegenüber Marken wie Busch-Jaeger oder Gira halbiert haben. Damit will ich keine Wertung abgeben, ob ich das gut finde oder nicht. Ich sage nur, was sich am Markt abspielt. Und da stimmt das Klischee vom Smart-Home-Standard für die Villa in Saint-Tropez eben nicht mehr. Natürlich gibt es die absolute Luxusklasse – mit Sensortastern von Basalte für bis zu 700 Euro, die aus massivem Nickel oder Messing gefräst sind. Da kosten schon Material und Herstellung eine Menge Geld. Der Hersteller verdient sich daran keine goldene Nase. Aber es geht eben auch deutlich günstiger.
Mit welchen Kosten sollten Bauleute für ein KNX-System rechnen?
Das kommt darauf an – welchen Ausstattungsgrad man sich wünscht und wo gebaut wird. Bei uns in Süddeutschland, wenn Sie ein Haus für 500 000 Euro planen – ohne Grundstück –, dann sind Sie mit 50 000 Euro für die Elektrik inklusive KNX auf der ganz sicheren Seite und haben schon eine hohe Ausstattung. Zehn Prozent der Bausumme eignen sich da als Richtwert. Wenn Sie als Kunde sagen, Sie möchten nur die Grundfunktionen, dann geht es auch günstiger. Für fast jedes Budget lässt sich eine Lösung finden.
Wo investiere ich dieses Geld am besten?
Vor allem in die Planung. Nichts spart so viel Geld, wie eine vernünftige Konzeption. Das ist wie bei einem Buchprojekt. Ich kann einfach drauflosschreiben und hinterher schauen, wie ich alles zusammenkriege. Dann gibt es jede Menge Ergänzungen, Umstellungen, Nachträge und Korrekturen. So arbeiten leider noch immer viele Elektriker. Die gehen mit der Kreide oder Spraydose durchs Haus und fragen, wo der Bauherr seine Steckdosen haben will. Dort machen sie dann ein Kreuz an der Wand. Hinterher stellt sich heraus, dass vieles nicht geht wie gewünscht und der Bauherr bezahlt für Änderungen. Eine gründliche Planung im Vorfeld kostet natürlich Geld. Aber sie holt an anderer Stelle auch leicht Zehntausende Euro und mehr wieder rein.
Wie läuft diese Konzeption normalerweise ab?
Wir fangen an, wenn vom Architekten die genehmigte Werkplanung kommt. In der Regel erhalten wir den digitalen Datensatz und machen anhand der Grundrisse die Elektroplanung. Dafür sprechen wir mit den Bauleuten die Räume durch. Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass das auch gut zu Hause am Computer geht – mit einem geteilten Bildschirm. Die Kunden sind dabei sogar konzentrierter als bei einem Termin vor Ort. Der Elektriker bekommt dann eine Stückliste und kann loslegen. Er kauft auch alle Komponenten wie Dosen und Kabel ein, muss also keine Angst haben, dass wir etwas von seiner Marge wegnehmen. In der Praxis sind viele Elektriker sogar froh, dass sie keine Planung mehr machen müssen.
Wie finde ich den richtigen Planer für ein solches Projekt?
Vor allem anderen sollte es menschlich passen. Bis ein Haus fertig ist, vergeht leicht ein ganzes Jahr. Während dieser Zeit hat man immer wieder miteinander zu tun. Außerdem würde ich mir Referenzen zeigen lassen, was der Planer schon gemacht hat. Und mindestens genauso wichtig: Kann er sich auf mich und meine Wünsche einstellen? Wenn ich sage, mein Budget beträgt 25 000 Euro, dann sollte das auch gelten. Nicht wie bei manchen Architekten, die wir in unserem Alltag erleben. Da sagt der Kunde dreimal, ich will keine Holzverkleidung am Haus haben, und der Architekt sieht trotzdem eine vor.
Gelten für die Sanierung andere Regeln als im Neubau?
Das nachträgliche Verlegen von KNX-Kabeln ist in der Regel teurer. Es gibt meist keine genauen Pläne, deshalb wissen Sie nicht, wo die Leitungen liegen. Es fehlt an Leerrohren und Platz für die Kabel. Das alles kostet Zeit und Geld. Ein bereits existierendes Bussystem ohne Projektdaten ist aber genauso schlimm. Ohne Datei für die ETS-Software müssen Sie alles durchmessen. Wie bei einem Auto, das mit einer diffusen Fehlerbeschreibung in die Werkstatt kommt. Es kann eine Woche dauern, bis man sich in eine derartige Installation reingearbeitet hat. Das will kein Elektriker, und die Eigentümer möchten so viel Zeitaufwand auch nicht gerne bezahlen. Deshalb: Grundsätzlich alle Daten einer KNX-Installation aufbewahren. Dann sind Änderungen auch nach Jahrzehnten kein Problem. Projekte, die vor 25 Jahren mit der ETS 2 erstellt wurden, lassen sich heute noch einlesen.
Welche Fehler gilt es sonst zu vermeiden?
Mein Eindruck ist, dass viele Bauherren die Bedeutung des Themas noch immer unterschätzen. Sie rechnen nicht damit, dass Digitalisierung, Automatisierung und Fernsteuerung in fünf bis zehn Jahren omnipräsent sein werden. Dabei hat sich schon gezeigt, wie wichtig ein Homeoffice mit guter Infrastruktur plötzlich sein kann. Es geht darum, in die Zukunft zu schauen. Das kann man gar nicht oft genug sagen.
WIE FUNKTIONIERT SMART HOME?
VOM SMARTEN GERÄT ZUM SMARTEN GEBÄUDE
Die Vorsilbe „smart“ wird seit einigen Jahren geradezu inflationär gebraucht. Auf das Smartphone folgten der Smart-TV und die Smartwatch. Lautsprecher mit Sprachsteuerung heißen Smart Speaker, Dosierautomaten für Hunde- und Katzenfutter Smart Feeder. Ja selbst Wasserkocher, Zahnbürsten und Fieberthermometer nehmen das Attribut in Anspruch, irgendwie smart zu sein. Nicht selten erschöpft sich dieser beworbene Vorteil in Vernetzung. Die Geräte sind per Funk steuerbar, über eine Onlineverbindung können sie Informationen austauschen, digitale Medien und neue Software aus dem Internet nachladen.
Als kleinster gemeinsamer Nenner trifft das auch auf viele Smart-Home-Produkte zu, die mittlerweile unsere Wohnungen bevölkern. All die vernetzten LED-Lampen, Raumthermostate, Türschlösser und WLan-Kameras haben eines gemeinsam: Ihr Bedienkonzept basiert auf dem Smartphone. Die App des Herstellers hilft bei der Installation der Geräte und assistiert später im Alltag. Sie macht das gedruckte Handbuch überflüssig – sofern der Anbieter sein Software-Handwerk versteht und dem Gerät nicht einfach ein billig zugekauftes Programm überstülpt.
Funkthermostate wie das Wiser-System von Eberle regeln die Raumtemperatur.
Fast immer handelt es sich bei diesen Produkten um Insellösungen. Sie kümmern sich um ein Gewerk, wie Fachleute am Bau sagen würden. Das kann zum Beispiel die Licht- oder Heizungssteuerung sein. Es gibt Spezialisten, die das Haus überwachen, Musik wiedergeben den Rasen mähen oder die Blumen bewässern. Je mehr davon zusammenkommen, desto aufwendiger und unübersichtlicher wird die Steuerung. Denn proportional zu den Geräten steigt die Zahl der Apps auf dem Smart-phone. Timer sind über viele Programme verteilt und müssen dort mehrfach eingestellt werden, wenn etwa das Bad morgens zur selben Zeit warm, hell erleuchtet und aufmunternd beschallt sein soll. Mit jeder neuen Insellösung wächst der Wunsch, die Technik zu vereinheitlichen und zusammenzufassen.
Überwachungskameras wie die Nest Cam von Google behalten die Wohnung im Blick.
Womöglich sind Sie bereits an diesem Punkt angekommen. Vielleicht lesen Sie dieses Buch aber auch in kluger Voraussicht – oder mit der Vorahnung, dass smarte Produkte allein Sie nicht weiterbringen werden. Dann ist es an der Zeit, über ein vernetztes Gebäude nachzudenken, ein Smart Home, das diesen Namen wirklich verdient. Es führt verschiedene Aufgaben unter einer Steuerlogik zusammen. Das Ganze ist dabei mehr als die Summe seiner Teile, weil die Geräte zusätzliche Aufgaben übernehmen können. Ein Fensterkontakt ist Teil der Alarmfunktion und drosselt gleichzeitig die Heizung, wenn gelüftet wird. Lautsprecher dienen der Unterhaltung, spielen aber auch Warntöne und Durchsagen ab.
Der Unterschied besteht im ganzheitlichen Ansatz. Während smarte Insellösungen meist zweckgebunden und nach aktuellem Bedarf angeschafft werden, beginnt die Planung eines Systems am anderen Ende der Investition: dem Vollausbau. Wer weiß, wo er hinwill, kann gleich von Anfang an den richtigen Weg einschlagen. Dabei macht es einen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt die Installation stattfindet. Geschieht sie im Rohbaustadium, beziehungsweise während einer grundlegenden Gebäudesanierung? Dann sind Operationen am offenen Mauerwerk meist kein Problem. Oder soll sie lieber nachträglich in der möblierten Wohnung passieren, quasi minimalinvasiv wie bei einem ambulanten medizinischen Eingriff? Dann bleiben die verputzen Wände besser unangetastet.
Systeme wie Digitalstrom lassen sich auch nachträglich in eine vorhandene Elektroinstallation integrieren.
Gebäudenetzwerke im Vergleich
Abhängig von der Situation und vom Budget kommen unterschiedliche Vernetzungslösungen infrage. Am wenigsten Arbeit und Schmutz macht eine Installation mit Funktechnik. Manche Systeme kommunizieren auch über die gewohnte Elektroinstallation (Stromversorgung). Sie schicken ihre Befehle quasi huckepack auf der Wechselstromfrequenz von Raum zu Raum. Dabei handelt es sich um ein ähnliches Verfahren, wie es Powerline-Datenadapter für den Computer verwenden. Das 230-Volt-Netz übernimmt die Aufgabe von Netzwerkkabeln. Am leistungsfähigsten und zuverlässigsten ist aber eine eigene Datenautobahn für die Haustechnik. Dazu legt der Elektriker spezielle Unterputzleitungen in die Wände. Die verdrillten Kupferkabel werden auch Busleitungen genannt, das ganze Prinzip heißt Installationsbus.
Für die Bezeichnung Bus gibt es verschiedene Erklärungen, je nachdem, wen man fragt. Manche Informatiker leiten sie vom englischen Begriff für Steckplätze an der Rückwand eines 19-Zoll-Computerschranks her: Backpanel Unit Sockets, kurz BUS. Anschaulicher ist die Vorstellung einer Omnibuslinie, auf der Datenpakete von einer Station zur nächsten reisen. Die Businstallation ist quasi das Liniennetz, angeschlossene Geräte bilden die Haltestellen. In der Gebäudetechnik zeichnen sich Bussysteme vor allem dadurch aus, dass sie Daten- und Energienetz voneinander trennen. Das muss nicht zwingend über Kupferlader geschehen. Ein Funkbus kann Steuerdaten ebenso übertragen. Trotzdem hat sich das Kürzel im Zusammenhang mit Leitungen eingebürgert. Wenn pauschal von Installationsbus die Rede ist, sind in der Regel verkabelte Systeme gemeint.
Die Tabelle auf Seite 21 gibt einen ersten Überblick. Das Kapitel „Schritt für Schritt zum eigenen Smart Home“ (Seite 155) beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema. Doch jetzt geht es erst einmal um den prinzipiellen Aufbau. Wie funktioniert ein Smart Home? Woraus besteht es? Und was lässt sich überhaupt alles automatisieren?
SENDER UND EMPFÄNGER
Zwei Begriffe werden Ihnen in diesem Buch noch häufiger begegnen: Sensoren und Aktoren. Ohne diese beiden Gerätetypen läuft im Smart Home nichts. Sie „sprechen“ miteinander und tauschen Informationen aus. Wie im richtigen Leben gibt es Redner und Zuhörer, man könnte auch sagen Sender und Empfänger. Allerdings hinkt der Vergleich ein wenig, da es in dieser Kommunikation nicht nur ums Verstehen geht. Der Empfänger eines Befehls muss ihn auch gleich ausführen, also etwa das Licht einschalten oder die Rollläden schließen. Darum verwenden Gebäudetechniker statt Sender und Empfänger lieber die Bezeichnungen Sensor und Aktor. Ersterer schickt Signale ins Netzwerk hinein, die zum Beispiel als Auslöser dienen können. Der Zweite reagiert darauf und führt die gewünschte Aktion aus.
Sensoren im Smart Home
Auch ohne intelligentes Gebäude sind wir im Alltag von Sensoren umgeben. Das Auto nutzt sie, um Geschwindigkeit und Drehzahl zu messen. Abstandswarner oder Einparkhilfe prüfen mit ihrer Hilfe die Entfernung zum nächsten Fahrzeug. Jedes Mikrofon im Smartphone ist ein Schalldetektor, die Wetterstation ein Temperatur- und Luftdruckmesser, die Badezimmerwaage ein Fühler fürs Gewicht. Alle haben eines gemeinsam: Sie erfassen das Ausmaß bestimmter Werte. Daher kommt auch der Begriff Sensor. Er geht auf das lateinische Wort „sensus“ zurück, was so viel bedeutet wie Gefühl, Bewusstsein oder Wahrnehmung.
In einem Smart Home gibt es besonders viele Werte zu ermitteln. Entsprechend umfangreich ist das Angebot an Sensoren. Hier nur eine Auswahl der wichtigsten Funktionen, manche Hersteller kombinieren mehrere davon in einem Gehäuse.
Bewegungs- und Präsenzmelder reagieren auf Veränderungen in der Umgebung, meist mit Sensoren für Infrarotstrahlung.
Rauchmelder erkennen mithilfe einer Infrarot-Lichtschranke, ob die Luft sich eintrübt.
Helligkeitssensoren messen die aktuelle Beleuchtungsstärke im Raum.
Temperaturfühler stellen fest, wie warm oder kalt es am Ort ihrer Montage ist.
CO2-Sensoren prüfen die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Raumluft.
Wassermelder warnen vor undichten Leitungen oder einer Überschwemmung.
Luftfeuchtemesser liefern einen Prozentwert für die relative Feuchtigkeit.
Kontaktsensoren an Türen und Fenstern erkennen, ob sie geöffnet sind.
Regenmesser ermitteln die Niederschlagsmenge über einen definierten Zeitraum.
Verbrauchszähler erfassen die Verbrauchsmengen von Wasser, Gas, elektrischer Energie und Heizungswärme.
Der häufigste Sensortyp in Gebäuden ist auf den ersten Blick gar nicht als solcher zu erkennen: Auch Taster wie etwa Lichtschalter gehören zur Familie der Sensoren – weil sie ein Signal an andere Geräte senden. Ob das manuell per Fingerdruck geschieht, wie in diesem Fall, oder ohne direktes Zutun der Menschen, spielt für die Haustechnik keine Rolle.
Typische Sensoren: Funktaster mit Display, Öffnungskontakt
Dass Lichtschalter nur selten als Sensoren wahrgenommen werden, hat historische Gründe. In einer herkömmlichen Elektroinstallation übernehmen sie die Aufgabe des Aktors gleich mit: Beim Umlegen der Wippe schließt der Schalter den Stromkreis oder unterbricht die Leitung. Entsprechend geht das Licht an oder aus. Traditionelle Dimmer für die Unterputzdose machen es ähnlich, ein klassisches Thermostatventil am Heizkörper arbeitet ebenfalls autark. Es bezieht die Information, wie warm es ist, von einem Temperaturfühler direkt im Thermostatkopf. Sensor und Regler bilden eine geschlossene, funktionsfähige Einheit.
Ein Hauptvorteil vernetzter Installationen besteht darin, beide Aufgaben voneinander zu trennen. Der Lichtschalter unterbricht den Strom nicht mehr selbst, er steuert einen Aktor, der irgendwo im Haus montiert sein kann: an der Lampe, in einer Verteilerdose unter Putz oder auch im Zählerschrank. Physikalisch getrennt vom Sensor empfängt ein Aktor so seine Befehle auf vielerlei Weise. Neben einer Bedienung per Wandtaster kommen auch Raumsensoren oder Sprachbefehle als Auslöser infrage. Eine Smartphone-App kann die Kontrolle übernehmen und bei entsprechender Konfiguration den Aktor sogar von unterwegs aus steuern. Welche Möglichkeiten im Einzelnen zur Verfügung stehen, hängt vom System ab.
Konventionell: Der Lichtschalter und der Rollladentaster sind gleichzeitig Aktor und Sensor (A/S).
Drahtlos: Funksensoren (S) steuern einen Aktor (A), der sich vor dem Gerät im Stromkreis befindet.
Businstallation: Die Sensoren (S) sind über eine eigene Busleitung mit Aktoren im Elektroverteiler (A) verbunden.
Aktoren im Smart Home
Das Gegenstück zum Sensor heißt Aktor. Leicht zu merken, weil der Name an Aktion erinnert und somit die Funktion beschreibt. Wahrscheinlich waren es die Techniker aber einfach Leid, den sperrigen Fachbegriff Aktuator (engl. „actuator“) zu verwenden. Eine Abkürzung geht leichter über die Lippen. Beide Ausdrücke stehen für dasselbe: Bauteile oder Baugruppen, die aus elektrischen Signalen eine Wirkung erzeugen. Das Ergebnis kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Beispiel Lautsprecher: Ein elektromagnetischer Aktor, auch Schwingspule genannt, treibt die Membran an und wandelt Tonsignale in Musik um. Optoelektrische Aktoren senden unter elektrischer Spannung Licht aus, wie man es von Leuchtdioden, den LEDs, kennt. Technisch gesehen arbeiten viele Alltagsgeräte mit Aktoren – vom Akkuschrauber über Spielzeuge mit Elektromotor und Tintenstrahldrucker bis hin zur Computerfestplatte. Im Smart Home ist der Begriff etwas enger gefasst. Er kommt vor allem dort zum Einsatz, wo es etwas zu schalten oder zu regeln gibt.
Schaltaktoren unterbrechen den Stromfluss und geben ihn bei Bedarf wieder frei.
Dimmaktoren regeln die Helligkeit von Leuchtmitteln im vernetzten Gebäude.
Zwischenstecker für die Steckdose rüsten Schalt- oder Dimmfunktionen nach.
Rollladenaktoren steuern Motorantriebe bis zu einem definierten Endpunkt.
Jalousieaktoren kontrollieren zusätzlich die Neigung der Lamellen.
Ventil-Stellantriebe regulieren die Wärmezufuhr am Heizkörper oder Heizkreislauf.
Klima-Steuermodule kontrollieren Heizkessel, Kühlanlagen Wärme- und Zirkulationspumpen.
Antriebsmotoren setzen Markisen, Jalousien, Vorhänge und Tore in Bewegung.
Alarmsirenen erzeugen Warn- und Hinweistöne, wenn ein Sensor auslöst.
Anzeigen und Displays jeder Art informieren über den aktuellen Betriebszustand.
Sensoren und Aktoren kommunizieren über ein Netzwerk miteinander. Das kann drahtlos per Funk geschehen oder über Leitungen in der Wand (siehe Tabelle: „Gebäudenetzwerke im Vergleich“, Seite 21).
In einem Installationsprozess werden die Teilnehmer „miteinander bekannt gemacht“. Nach dieser ersten Programmierung oder Parametrierung „weiß“ dann jeder Sensor und Aktor, wohin er gehört. Einem dezentralen System wie KNX oder LCN genügt das schon, um mit der Steuerung loszulegen. Die Sensoren und Aktoren verfügen über ausreichend eigene Intelligenz, um Aufgaben zu erledigen. Ein Schaltaktor fürs Treppenhauslicht „lernt“ zum Beispiel, dass er die Lampen nach einer gewissen Zeit wieder ausschalten soll. Bewegungsmelder merken sich, ab welcher Raumhelligkeit eine zusätzliche elektrische Beleuchtung gewünscht ist.
Jedoch hat diese Netzwerkintelligenz auch Grenzen. Wenn sie komplexe Aufgaben mit vielen Bedingungen erledigen soll, wird die Programmierung kompliziert. Typisches Beispiel: eine automatische Rollladensteuerung, die Wetter, Sonnenstand, Uhrzeit und die Anwesenheit berücksichtigen soll – am besten so, dass sie niemanden aussperrt, der im Garten gerade den Rasen mäht. Dieser Wunsch lässt sich mit einem sogenannten Server oder Logikmodul im Netzwerk leicht erfüllen. Deshalb erlauben viele Systeme den zusätzlichen Einbau solcher Bausteine. Oder sie lagern die Intelligenz von Sensoren und Aktoren gleich ganz dorthin aus. Mehr dazu im folgenden Kapitel.
Alles hört auf ein Kommando
Die Arbeitsteilung zwischen Sensoren und Aktoren macht eine vernetzte Elektroinstallation flexibler als normal verdrahtete Gebäude, ganz einfach, weil Sender und Empfänger an verschiedenen Orten untergebracht sein können. Sie bietet aber noch zwei andere Vorteile: die Steuerung mit Gruppen und Szenen. Beide ersetzen die klassische Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Geräten durch einen Sammelbefehl. So kann der Lichtschalter – um im Beispiel zu bleiben – mehrere Aktoren auf einmal steuern.
Eine Gruppe reagiert dabei synchron. Das heißt: Lampen schalten gemeinsam oder dimmen auf dieselbe Helligkeit – ähnlich wie unvernetzte Leuchtmittel, die im selben Stromkreis hängen. Auch mehrere Heizkörperregler können so ein Team bilden. Sie folgen dann den Vorgaben eines zentralen Temperatursensors. Wäre das Smart Home ein Orchester, die Teams würden am ehesten den Instrumentengruppen auf der Bühne entsprechen: Erste Geige, Zweite Geige, Bratschen, Celli …
Szenen dagegen dirigieren das komplette Ensemble. Sie beziehen Solisten und Gruppen mit ein. Beim Fernsehen soll das Licht im Sofabereich herunterdimmen, den Esstisch aber noch hell erleuchten? In der Nacht ist auf dem Weg zur Toilette ein sanfter, blendfreier Schimmer gewünscht? Dann speichern Sie die Werte aller beteiligten Lampen einfach als Szene ab oder geben Ihrem Installateur den Auftrag dazu. Fortan genügt ein Tastendruck oder ein anderer Steuerbefehl, um die programmierte Lichtstimmung abzurufen.
Eine Smart-Home-Szene kann theoretisch alles enthalten: Leuchtmittel, Steckdosen, Raumtemperatur, Rollladenposition. Sind der Fernseher und die Surroundanlage ebenfalls vernetzt, schaltet sich mit einem Kommando vielleicht das Heimkino ein. Oder ein Befehl schickt die komplette Technik in den Stand-by-Betrieb, wenn es Zeit zum Schlafengehen ist. Nur der Ausbaugrad des Systems – und wahrscheinlich das verfügbare Budget – setzen Ihrem Einfallsreichtum Grenzen.
DIE STEUERUNG: ZENTRAL ODER DEZENTRAL?
Jede Gebäudeautomatisierung basiert auf Daten. Sie fallen an, werden übermittelt und verglichen. Beim Erreichen bestimmter Werte lösen sie eine Aktion aus. Informatiker haben für dieses Prinzip einen Namen: EVA – Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Aber wenn Smart-Home-Sensoren für die Eingabe und Aktoren für die Ausgabe zuständig sind, wer übernimmt dann die Datenverarbeitung? Wo befindet sich die Intelligenz des Gebäudes, sozusagen das Gehirn?
Zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang häufiger fallen, sind zentral und dezentral. Beide haben eine doppelte Bedeutung. Denn zunächst beschreiben sie nur den Montageort, also wo Geräte untergebracht sind. Dezentrale Bausteine verteilen sich übers Haus, zum Beispiel als Unterputzaktoren. Zentrale Geräte sitzen dagegen im Verteilerschrank und schalten oder dimmen von dort aus. Das heißt allerdings nicht, dass die Intelligenz sich an derselben Stelle befinden muss. Unabhängig vom Installationsort der Geräte kann die Steuerung zentral oder dezentral organisiert sein.
Zentrale Steuerung
Um im Beispiel des menschlichen Körpers zu bleiben: Viele Smart-Home-Installationen haben tatsächlich ein Gehirn. Ihre Nervenbahnen, drahtlos oder kabelgebunden, laufen in einer Automatisierungszentrale zusammen. Diese empfängt Daten von Sensoren im Haus und verarbeitet sie. Ähnlich wie Sinnesorgane informieren die Eingabegeräte über Änderungen in ihrer Umgebung. Das digitale Gehirn prüft, ob alle Werte im vorgesehenen Rahmen liegen und lässt bei Bedarf die Muskeln spielen. Es sendet dann zum Beispiel einen Befehl an den Heizungsaktor, sein Ventil zu öffnen, bis die Temperatur im Raum wieder stimmt.
In der zentral aufgebauten Steuerung laufen Befehle über eine Schaltstelle. Darüber hinaus ist in manchen Systemen auch die direkte Verknüpfung von Sensoren und Aktoren möglich.
Vorteil der zentralen Steuerung: Sensoren und Aktoren müssen über wenig bis gar keine eigene Intelligenz verfügen. Sie benötigen, wenn überhaupt, nur einfache Prozessoren, was die Herstellungskosten senkt und sich günstig auf den Gesamtpreis auswirken kann. Da alle Gebäudefunktionen an einem Punkt zusammenlaufen, sind sie leicht zu automatisieren. Die Zentrale weiß zu jeder Zeit, in welchem Zustand sich Fenster, Rollläden, das Garagentor oder auch die Steckdose fürs Aquarienlicht befinden. Sie kann über logische Verknüpfungen eine Verbindung zwischen den Geräten herstellen. Nach dem Motto: Wenn … dann … sonst. Auch eine Zeitschaltung oder die Berücksichtigung externer Daten aus dem Internet, etwa von einem Wetterdienst, sind in der Regel kein Problem.
Gleichzeitig sinkt der Programmieraufwand, weil Eingaben für alle Geräte gesammelt am zentralen Smart-Home-Server geschehen. Statt verteilter Einstellungen an jedem Sensor oder Aktor gibt es eine zusammenhängende Bedienoberfläche. Und weil das Gebäudemanagement so gut informiert ist, kann es sein Wissen anschaulich auf einem Bildschirm darstellen. Apps für Smartphone und Tablet oder Browsermenüs am Computer gehören in Anlagen mit Zentrale zum Standard. Viele moderne Nachrüstlösungen – besonders solche mit Funk – arbeiten nach dem Prinzip „eine für alle – alle für eine“.
Die Serverabhängigkeit hat allerdings einen Nachteil: Geht die Zentrale kaputt, verliert das Smart Home komplett seine Funktion. Um einem Totalausfall vorzubeugen, lässt sich in manchen Funksystemen zusätzlich eine direkte Verknüpfung zwischen Sensoren und Aktoren herstellen. Standards wie Homematic und Homemativc IP oder Z-Wave bieten solch eine Option. Der Fachmann nennt sie Assoziation oder Gruppierung. Ein Funktaster kommuniziert dabei nicht nur mit der Zentrale, sondern zum Beispiel auch direkt mit dem ihm zugewiesenen Rollladenantrieb. Der Bewegungsmelder im Treppenhaus kann an den Schaltaktor des Treppenlichts gekoppelt sein. Oft reagieren solche Paarungen sogar schneller als bei der reinen Kommunikation via Zentrale – und die Grundfunktionen bleiben erhalten, wenn das „Gehirn“ der Anlage ausfällt. Falls möglich, sollte die Serverkonfiguration aber trotzdem auf einem externen Speichermedium gesichert werden. Dann lässt sich im Falle eines Hardwaredefekts die Zentrale austauschen und das Backup zurückspielen. So ist die Haussteuerung schnell wieder betriebsbereit.
In einer dezentralen Steuerung kommunizieren Sensoren und Aktoren direkt miteinander. Bei komplexen Aufgaben unterstützt sie häufig ein Logikbaustein.
Dezentraler Aufbau
Der Gegenentwurf zum zentral gesteuerten Smart Home ist eine Installation mit verteilter Intelligenz. Soll heißen: Die Sensoren und Aktoren verfügen über genügend eigene Rechenleistung, damit sie Aufgaben ohne Hilfe eines Servers erledigen können. Der Hersteller hat ihnen die Fähigkeit dazu bereits einprogrammiert – oder sie wird per Software aufs Gerät geladen. Ein Bewegungsmelder bringt so zum Beispiel Einstellungen für die Empfindlichkeit und Auslösedauer mit. Am Aktor sind Werte wie Ein- und Ausschaltverzögerung wählbar, die Position der Lamellen bei geschlossener Jalousie oder die Dimmgeschwindigkeit.
Wenn zentrale Server so etwas wie das Gehirn im Smart Home sind, dann lässt sich eine dezentrale Steuerung am ehesten mit dem vegetativen Nervensystem vergleichen. Aktionen laufen reflexartig ab. Der Sensorreiz genügt, um Wirkung zu entfalten. Wie bei einer heißen Herdplatte, vor der die Hand automatisch zurückzuckt. Oder wenn der Arzt mit seinem Hämmerchen den Kniesehnenreflex testet: Ein leichter Schlag unters Knie lässt den Fuß ganz unbewusst nach vorn schnellen. Befehle vom Gehirn sind dafür gar nicht notwendig. Die Nerven und Muskeln kommunizieren auf direktem Weg übers Netzwerk, in diesem Fall das Rückenmark, miteinander.
Vorteil dezentraler Strukturen im Smart Home: Sie erweisen sich als relativ robust, wenn einzelne Komponenten ausfallen, weil die Steuerintelligenz in den Geräten sitzt. Geht eine Komponente kaputt, funktioniert das Gesamtsystem weiter. Es müssen schon wesentliche Verbindungen unterbrochen sein, um den Betrieb zu gefährden. Das kann zum Beispiel ein Ausfall der Spannungsversorgung sein – oder jemand bohrt beim Heimwerken aus Versehen wichtige Busleitungen an. Apropos Bus: Die klassischen Installationsbussysteme wie KNX, LCN oder LON sind allesamt dezentral aufgebaut. Das erklärt auch teilweise ihren höheren Preis. Die Komponenten benötigen mehr Intelligenz als Bauteile, die lediglich einen Status an die Zentrale senden. Entsprechend aufwendiger und teurer ist die Technik.
Aufwendig kann in einer dezentralen Struktur auch die Fehlersuche werden. Die Konfiguration verteilt sich über viele Geräte, was den Überblick erschwert. Zu Sensoren und Aktoren kommen manchmal noch Logikbausteine, die abhängig von der Tageszeit und anderen Faktoren das Smart Home steuern. Darum sollte die Installation möglichst gut dokumentiert sein. Ein Techniker, der die Anlage nicht selbst montiert hat, verbringt sonst viele Stunden damit, Probleme einzukreisen.
Eine Mischung aus beidem
Sowohl die zentrale Steuerung als auch der dezentrale Aufbau haben Vor- und Nachteile. Darum kombinieren professionelle Installateure gern beide Methoden: Sie erweitern ein dezentrales Bussystem um Bausteine mit zentralen Funktionen. Ein typisches Beispiel dafür sind die sogenannten Homeserver und IP-Gateways für KNX. Es gibt sie als Hutschienen-Modul zum Einbau in den Verteilerkasten oder als externes, PC-ähnliches Gerät mit Stromanschluss. Eine Lan-Buchse stellt die Verbindung zum Router und ins Datennetzwerk her.
Über den Netzwerkanschluss stehen dann Funktionen zur Verfügung, die ein dezentrales System normalerweise nicht bietet:
Visualisierung bringt das Smart Home auf den Bildschirm. Der Server bereitet Hausdaten grafisch auf, sodass sie auf einem Display dargestellt werden können. Als Anzeige dienen spezielle Touchscreens, wie sie zum Beispiel KNX-Anbieter im Programm haben. Alternativ kommt ein Tablet-PC oder Smartphone als Bildschirm infrage – bestückt mit der App des Serverherstellers. Diese Variante ist oft günstiger als ein spezielles Smart-Home-Display.
Fernzugriff macht die Haustechnik übers Internet erreichbar. Typisches Beispiel: Sie können mit der Visualisierungsfunktion des Servers (siehe oben) von unterwegs aus Lichter schalten oder die Heizung regeln. Gehören Tür- und Überwachungskameras zur Installation, erscheinen deren Bilder ebenfalls in der App. Hinzu kommt die Möglichkeit zur Fernwartung: Der Kundendiensttechniker loggt sich bei einer Störung ein und prüft die Lage. Das spart unter Umständen eine kostenpflichtige Anreise.
Benachrichtigungen informieren über bestimmte Ereignisse im Smart Home. So kann das System zum Beispiel eine E-Mail verschicken, wenn die Heizung ausfällt, oder Push-Nachrichten auf die Smartphones der Familie schicken. Entsprechende Hardware vorausgesetzt, ruft der Server auch eine Telefonnummer an und gibt die Statusmeldung per Sprachansage durch.
Die Kombination aus dezentraler Installation und einem Server für bestimmte Funktionen ist im Profibereich weit verbreitet.
Erweiterte Logik stattet das System mit zusätzlicher Intelligenz aus. Viele Aufgaben sind in einer dezentralen Installation auch auf der Busebene lösbar, etwa mit Logikbausteinen, die eine Aktion nur dann freigeben, wenn Bedingungen erfüllt sind. Allerdings bedeutet das viel Aufwand. Komplexe Automationen wie eine Anwesenheitssimulation mit Licht und Rollläden, die auch noch Jahreszeit und Wetterlage berücksichtigt, lassen sich ohne zentrale Intelligenz kaum realisieren.
Die Folge: In der professionellen Gebäudeautomatisierung verschwimmen die Grenzen. Hersteller zentraler, serverbasierter Systeme wie Loxone bauen Schnittstellen zum dezentralen KNX in ihre Steuerung ein. Standards wie EnOcean, KNX, LCN & Co. gehen den umgekehrten Weg. Sie integrierten IP-Server und andere zentrale Steuerlösungen in ihre verteilte Struktur. Unterm Strich gleicht sich der Funktionsumfang an. Damit besteht eine wichtige Aufgabe des Smart-Home-Planers darin, die verschiedenen Systeme und Gateways optimal miteinander zu kombinieren.
Ein KNX-System stellt per Visualisierungsserver (links) oder IP-Schnittstelle (rechts) auch den Kontakt zum Heimnetzwerk her – Voraussetzung für die Bedienung am Computer oder Smartphone.
Online- und Offlinebetrieb
Wie bereits erwähnt, kann ein zentraler Aufbau die Anschaffungskosten senken, weil er rechenintensive Aufgaben in der Systemzentrale bündelt. Statt mehrerer Minicomputer im Gebäudenetzwerk gibt es nur einen. Damit sind die Einsparpotenziale aber noch nicht ausgeschöpft. Manche Smart-Home-Anbieter reduzieren den Aufwand weiter, indem sie Rechenprozesse von der Zentrale weg auf Server im Internet verlagern. Oft handelt es sich dabei um keinen einzelnen Webserver, sondern um einen Verbund aus Rechnern. Diese können sogar an verschiedenen Orten aufgestellt sein und trotzdem übers Internet eine gemeinsame Plattform bilden. Als Synonym für so einen Datenpool hat sich der englische Begriff Cloud eingebürgert – auf deutsch übersetzt: Wolke –, weil das virtuelle Rechenzentrum wie eine Datenwolke über der realen Welt schwebt. Anbieter wie Amazon, Bosch, Google, Microsoft und die Deutsche Telekom stellen ihre Cloud-Dienste anderen Firmen zur Verfügung. Unternehmen, die selbst keine Server betreiben und warten wollen, können sich die entsprechende Kapazität also auch mieten.
Der Anschluss ans Internet hat mehrere Vorteile. Zum einen benötigt die Station zu Hause weniger Leistung. Günstige Exemplare wie der Access Point von Homematic IP sind für deutlich unter 100 Euro zu haben. Trotzdem können sie mit teureren Lösungen mithalten – auf dem Server des Anbieters steht genügend Rechenleistung zur Verfügung. Zweiter Vorteil: Über die Onlineverbindung sind Sicherheitskopien der Installation ohne Aufwand möglich. Die Home Base von Magenta Smart Home etwa legt über Nacht automatisch Back-ups in der Telekom-Cloud ab. Muss die Basis irgendwann ausgetauscht werden, zieht das Ersatzgerät seine Konfiguration aus dem Internet. Auch die Anwenderinnen und Anwender selbst können ihre Zentrale übers Menü auf einen früheren Zustand zurücksetzen und wiederherstellen: Praktisch, wenn man sich beim Einrichten vergaloppiert hat und die Eingaben des Tages rückgängig machen möchte.
Last not least erleichtert die Internetverbindung den Kontakt zu anderen cloudbasierten Diensten. Ob Sprachsteuerung mit Alexa, Unwetterwarnung oder ein Sicherheitsdienst, der im Alarmfall das Gebäude kontrolliert: Theoretisch lässt sich jeder Service, der online erreichbar ist, in so ein System integrieren. Es muss nur jemand die passende Softwareschnittstelle dafür programmieren (siehe „Vorteile von IoT“, Seite 285).
So viel zu den Vorteilen des Smart-Home-Outsourcings. Die Abhängigkeit von einer Cloud kann aber auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Mal abgesehen davon, dass Systeme, die übers Internet „nach Hause“ telefonieren, nicht jedermanns Sache sind. Um Sicherheit und Datenschutz geht es ausführlich in einem späteren Kapitel (Seite 297). Je nachdem, wie abhängig das System von der Cloud des Anbieters ist, kann auch der Funktionsumfang leiden, wenn das Internet ausfällt. Mitunter streikt dann die App oder programmierte Aktionen werden nicht mehr ausgeführt. Hinzu kommt: Eine cloudbasierte Smart-Home-Lösung macht Sie abhängig von der technischen Infrastruktur des Anbieters. Stellt dieser seinen Geschäftsbetrieb ein oder schaltet den Server ab, kann sich das auf den Funktionsumfang auswirken. Im ungünstigsten Fall wird Ihr System komplett unbrauchbar. Um das Risiko zu minimieren, empfiehlt es sich, auf große, namhafte Anbieter mit vielen installierten Anlagen zu setzen. Hier stehen die Chancen besser, dass bei Geschäftsaufgabe ein anderes Unternehmen die Kundenbasis übernimmt und den Betrieb fortsetzt.
SELBST IST DAS HAUS: DIE AUTOMATISIERUNG
Mit einem Tastendruck das Licht in der ganzen Wohnung ändern oder alle Rollläden schließen mag bequem sein – besonders smart ist es noch nicht. Auch eine Smartphone-App als Fernbedienung wird dem Begriff nur teilweise gerecht. Schließlich müssen Sie damit weiter selbst Hand anlegen, wenn etwas passieren soll. Im Wort Gebäudeautomatisierung steckt jedoch das Versprechen, dass die Technik von allein reagiert. Erst eine Automatisierung macht diesen Komfort komplett.
Das bloße Vorhandensein von Sensoren und Aktoren (siehe: „Sender und Empfänger“, Seite 22) reicht dafür häufig nicht aus. Zwischen den Geräten muss jemand vermitteln. Das Smart Home benötigt einen digitalen Hausmeister – eine Signalverarbeitung, die Eingaben oder Sensordaten nimmt und sie bestimmten Regeln unterwirft. Sind alle Bedingungen erfüllt, erhält der zuständige Aktor den Befehl zur Ausführung. Informatiker würden sagen, ein smartes Gebäude arbeitet nach dem Prinzip: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe.
Wo diese Datenverarbeitung stattfindet, spielt für das Ergebnis zunächst keine Rolle. Manche Systeme lagern sie auf Server im Internet aus, andere erledigen den Abgleich zu Hause in einer Zentrale oder direkt in den Sensor- und Aktor-Bausteinen. Auch die Programmierung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Das Grundprinzip ist aber immer gleich: Jeder Ablauf hat Ursache und Wirkung, dazwischen kann es eine oder mehrere Bedingungen geben. Als Ursache kommen verschiedene Auslöser in Frage:
Zeitauslöser sind die ursprünglichste Form der Hausautomatisierung. Schon die ersten mechanischen Schaltuhren für Steckdosen konnten Geräte zu einer bestimmten Uhrzeit ein- und wieder ausschalten. Moderne Timerfunktionen im Smart Home berücksichtigen darüber hinaus auch Wochentage sowie digitale Urlaubs- und Feiertagskalender.
Astronomische Auslöser richten sich nach dem Sonnenstand am Wohnort. Nach Eingabe der geografischen Daten weiß das Smart-Home-System, wann bei Ihnen zu Hause die Sonne auf- und wieder untergeht – praktisch, um beispielsweise Rollläden oder die Beleuchtung darüber zu steuern.
Geräteauslöser nehmen den Betriebszustand eines Smart-Home-Produkts und steuern andere damit. Bewegungssensoren, Rauchmelder, Tür- und Fensterkontakte sind typische Beispiele dafür. Allerdings ist das Prinzip nicht auf Sensoren beschränkt. Auch Aktoren können als Auslöser dienen – etwa eine vernetzte Steckdose, die beim Abschalten weitere Aktionen nach sich zieht.
Standortbasierte Auslöser machen sich die Ortungsfunktion am Smartphone zunutze. Ist diese aktiviert, erkennt das System, ob jemand das Gebäude verlässt oder nach Hause kommt – bei mehreren Haushaltsmitgliedern auch, um welche Personen es sich dabei handelt. Entsprechend kann das Smart Home dann Szenen starten oder Geräte in den gewünschten Betriebszustand versetzen.
Standortbasierte Auslöser nutzen die GPS-Funktion des Smartphones, um beim Verlassen der Wohnung oder Nachhausekommen eine Aktion zu starten.
Verknüpfungen und Regeln
Im einfachsten Fall genügt ein Auslöser, um die Automation zu starten. Ihm wird ein Aktor oder eine Gruppe von Aktoren zugewiesen. Auch komplette Szenen (siehe: „Alles hört auf ein Kommando“, Seite 25) kommen als Befehlsempfänger infrage. Wie die Geräteverknüpfung genau abläuft, hängt vom Smart-Home-System ab. Sie kann sehr einfach oder hochkomplex sein. Manche Lösungen verlangen spezielle Software oder Programmierkenntnisse. Deshalb sollten Sie sich die Art der Automatisierung ansehen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Sie werden sicher die Einstellungen im Betrieb selbst ändern wollen.
Nicht nötig, meinen Sie? Weil ein Fachbetrieb die Planung und Ausführung übernimmt? Dann kann ein System mit einfacher Bedienoberfläche trotzdem praktisch sein. So müssen Sie später nicht jedes Mal den Experten rufen (und bezahlen), um etwa eine neue Lichtszene einzurichten. Wie häufig solche Modifikationen im Alltag vorkommen – oder ob es überhaupt einen Bedarf dafür gibt – hängt von Ihren Lebensverhältnissen ab. Und natürlich vom persönlichen Spieltrieb: Sind Sie der Typ „Einrichten und vergessen“ oder haben Sie Spaß daran, die Technik in Ihrer Umgebung selbst zu konfigurieren? Das sollte auch Einfluss auf die Wahl der Haustechnik haben.
Im Wesentlichen gibt es vier Methoden, um ein Smart Home zu programmieren. Sie unterscheiden sich in der Herangehensweise und im Schwierigkeitsgrad. Manche Systeme nutzen gleich mehrere davon, was den Vorteil hat, dass die Komplexität mit den Aufgaben wächst. Einfache Verknüpfungen sind schnell hergestellt, für aufwendige Abfragen mit vielen Bedienungen stehen aber trotzdem die nötigen Softwarewerkzeuge zur Verfügung.
Zuordnung kommt ohne besondere Regeln aus. Die beteiligten Geräte wissen selbst was zu tun ist. Beispiel: Ein Fensterkontakt sendet beim Lüften ein Signal an den verknüpften Heizkörperthermostat, dass die Temperatur zu drosseln ist. Oder: Ein Wandtaster schaltet alle Lampen, die sich im selben Raum befinden. Die Verknüpfung entsteht automatisch während der Installation – sobald Sensor und Aktor demselben Raum, einem Bereich oder einer Gruppe zugewiesen werden.
Auswahlmenüs erstellen Smart-Home-Regeln nach dem Wenn-dann-Prinzip. Dazu wählt man erst einen Auslöser und legt dessen Status fest. Eine zweite Eingabe fügt die gewünschte Reaktion hinzu. Beispiel: Wenn … Infrarotsensor XY eine Bewegung entdeckt, dann … soll Aktor YZ das Licht einschalten. Meist lassen sich Bedingungen ergänzen – damit die Aktion etwa nur zu bestimmten Tageszeiten erfolgt oder wenn niemand zu Hause ist. Sind mehrere Auslöser beteiligt, entscheidet eine und-Verknüpfung, ob alle Voraussetzungen der Regel erfüllt sein müssen. Ist stattdessen oder eingestellt, reicht eine davon.
In manchen Systemen genügt die Zuordnung von Aufgaben für eine grundlegende Automatisierung. Mehr Möglichkeiten bieten Auswahlmenüs nach dem Wenn-dann-Prinzip.
Grafische Editoren funktionieren nach demselben Grundprinzip wie Auswahlmenüs, stellen ihre Regeln aber als Diagramm dar. Der Programmierer setzt Bausteine aus seiner Smart-Home-Bibliothek am Bildschirm zusammen. Dabei konstruiert er einen Ablauf, der Auslöser, Bedingungen und Aktoren über Linien oder andere grafische Elemente verbindet. Verknüpfungen mit und/oder stellt die Software ebenfalls im Bild dar. Das erleichtert den Überblick, wenn so ein Ablauf viele Bedingungen enthält. Es verlangt aber auch einiges an logischem Denken. Vor allem dann, wenn die Regel noch mathematische Elemente wie Klammern oder sogenannte Systemvariablen enthält.
Grafische Editoren wie der von Mediola stellen Elemente einer Regel als Blöcke dar. So lassen sich Abläufe nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen.
Ein System mit abgestuften Benutzerrechten hat Vorteile. So können etwa Kinder oder Gäste mit ihrem Smartphone nur auf freigegebene Funktionen zugreifen.
Script-Editoren verzichten auf optische Hilfen wie Symbole oder Auswahlmenüs. Sie legen die Programmiersprache des Systems bloß; vergleichbar mit dem HTML-Code einer Webseite: Während andere Methoden der Automatisierung eher einem Homepage-Baukasten ähneln, setzt man im Script-Editor die nackten Textbefehle hintereinander. Dabei kommen IT-Sprachen wie Javascript, Lua oder Perl zum Einsatz, exakte Wortwahl und Interpunktion sind Pflicht. Schon ein vergessenes Komma oder eine fehlende Klammer kann das Script unbrauchbar machen. Dafür bietet so ein Programmcode aber auch mehr Möglichkeiten als vorformulierte Textbausteine.
Script-Editoren arbeiten mit einer Programmiersprache, im Beispiel von Fibaro ist es LUA. Die Regeln bestehen aus Textzeilen, was Fachwissen verlangt.
Software und Zugriffsrechte
Wie zugänglich ein System für Einsteiger ist, hängt also vor allem von der Programmierung ab. Dabei kommt es neben dem reinen Ablauf auch auf die verwendete Software an. Profilösungen wie KNX, LCN und Loxone nutzen eigene Konfigurationsprogramme dafür. Sie basieren auf dem Microsoft-Betriebssystem Windows, lassen sich mit etwas zusätzlichem Aufwand jedoch genauso gut auf dem Mac installieren. Mitunter kann die Software ins Geld gehen. So kostet eine Lizenz bei KNX und LCN bis zu 1 000 Euro. Andere Hersteller wie Loxone bieten ihr Programm gratis zum Download an.
Zusätzliche Softwaregebühren entfallen auch dann, wenn die Konfiguration im Browser stattfindet. Viele Smart-Home-Systeme stellen im heimischen Computernetz eine Bedienoberfläche bereit, an der man sich wie auf einer Internetseite anmelden kann. Die Programmierung klappt dann ohne weitere Softwareinstallation von jedem Gerät mit einem Webbrowser aus. Dritte Möglichkeit: Eine App fürs Smartphone oder Tablet gewährt Zugriff auf die Automatisierungsfunktionen. Weil das Touchscreenmenü an breite Fingerkuppen angepasst sein muss, halten sich die Möglichkeiten dabei oft in Grenzen. Manche Anbieter stufen sie auch ab: Das Konfigurations-Tool am Computer stellt dann alle Funktionen zur Verfügung, während die App nur einfache Änderungen zulässt und ansonsten der Steuerung im Alltag dient.
Unter Umständen ist ein eingeschränkter Zugriff sogar wünschenswert, etwa um Kinder oder Übernachtungsgäste daran zu hindern, irrtümlich Änderungen vorzunehmen. Die Fehlersuche in einer umfangreichen Gebäudeautomatisierung kann aufwendig und zeitraubend sein. Auch Fachbetriebe, die ein Smart Home schlüsselfertig übergeben, riegeln den Kern der Installation häufig ab. Die Programmierkonsole bleibt dann Systemadministratoren vorbehalten, Kunden und Kundinnen erhalten einen Zugang mit eingeschränkten Rechten. Das hat auch mit Fragen der Haftung zu tun. Wer ist verantwortlich, wenn eine fehlerhafte Garagentorautomatik zum Beispiel den Wagen beschädigt oder Rauchmelder und Sirenen in der Nacht ohne erkennbaren Grund Alarm schlagen? Selbermacher sind in solchen Fällen auf sich allein gestellt. Ein Handwerksbetrieb steht für seine geleistete Arbeit aber mit der üblichen Gewährleistungsfrist von vier bis fünf Jahren gerade.
Für viele der Inbegriff von Smart Home: eine App auf dem Tablet oder Mobiltelefon, mit der sich das ganze Haus steuern lässt





























