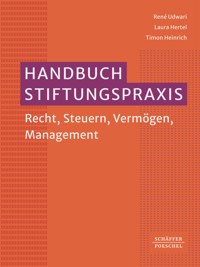
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das neue Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Stiftungsformen und beleuchtet die zivil- und steuerrechtlichen Fragen rund um den Lebenszyklus der Stiftung. Im Detail wird dabei auf die Besteuerung der gemeinnützigen Stiftung und der Familienstiftung eingegangen. Darüber hinaus werden auch die relevanten ausländischen Stiftungsformen inklusive Trust dargestellt. Weitere Abschnitte behandeln die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens, die Haftungssituation innerhalb der Stiftung, die Stellung der Stiftung als Arbeitgeber, die Stiftung im Rechtsstreit sowie schließlich die Beendigung, Veränderung und Insolvenz der Stiftung. Mit ergänzenden Materialien und Inhalten auf myBook+: Checklisten, Satzungs- und Vertragsmuster, Gestaltungshinweise. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - E-Book direkt online lesen im Browser - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumAbkürzungsverzeichnisVorwortTeil A Die Stiftung aus der Adlerperspektive1 Funktion der Stiftung in Wirtschaft und Gesellschaft2 Erscheinungsformen: Was kann die Stiftung?2.1 Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts2.1.1 Gemeinnützige Stiftung2.1.2 Familienstiftung2.1.3 Unternehmensstiftung2.1.3.1 Stiftung als Gesellschafter, Holding-Stiftung2.1.3.2 Die Stiftung & Co. KG2.1.3.3 Stiftung als Unternehmensträger und Kaufmann2.2 Stiftung des öffentlichen Rechts2.3 Kommunale Stiftung2.4 Kirchliche Stiftung2.5 Bürgerstiftung2.6 Ersatz- und Alternativformen der Stiftung2.6.1 Verein2.6.2 Kapitalgesellschaft2.6.3 Treuhand2.6.4 Schenkung unter Auflagen2.6.5 Zustiftung2.6.6 Dachstiftung und Stiftungsfonds2.7 Ausländische Rechtstypen2.7.1 Stiftung nach liechtensteinischem Recht2.7.2 Stiftung nach österreichischem Recht2.7.3 Stiftung nach schweizerischem Recht2.7.4 Trusts3 Geschichte der Stiftung3.1 Antike3.2 Christentum und Kirche3.3 Absolutismus und Aufklärung3.4 Fortentwicklung des Stiftungswesens im 19. Jahrhundert3.5 Die Stiftung im liberalen RechtsstaatTeil B Von der Stiftungsidee zum Stiftungsprojekt1 Die Stiftungsidee1.1 Motive1.2 Zweck1.3 Stiftungsvermögen1.4 Stiftungsorganisation2 Das Stiftungsprojekt2.1 Vorüberlegungen im Erstgespräch mit dem potenziellen Stifter2.2 Wahl der passenden Rechtsform für die Stiftung2.3 Vermögensanalyse2.4 Personalfragen2.5 Zeitpunkt für die Errichtung3 Vermögen, familiäre Situation des Stifters3.1 Vermögen des Stifters3.2 Familiäre Situation des Stifters3.3 Steuerliche Situation des Stifters4 Nachfolgeplanung, Familien- und Pflichtteilsrecht4.1 Familienrechtliche Gesichtspunkte4.1.1 Verfügung über das Vermögen im Ganzen, § 1365 BGB4.1.2 Zugewinnausgleich4.1.3 Unterhalt4.2 Erbeinsetzung und Vermächtnis4.2.1 Stiftung als Erbe4.2.2 Die Stiftung als Miterbin4.2.3 Die Stiftung als Vor- oder Nacherbin4.2.4 Die Stiftung als Vermächtnisnehmerin und Auflagenbegünstigte4.2.5 Die Stiftung als Ersatzerbin4.3 Stiftungserrichtung und Pflichtteilsrecht4.3.1 Pflichtteil4.3.2 Pflichtteilsergänzung4.3.3 Fazit: Die rechtsfähige Stiftung ist zur Pflichtteilsvermeidung ungeeignet4.3.4 Maßnahmen zur Vermeidung4.4 Unternehmensnachfolge durch die Gründung einer Stiftung4.4.1 Zivilrechtliche Aspekte4.4.2 Erbschaftsteuerliche Aspekte4.4.3 Ertragsteuerrechtliche AspekteTeil C Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts1 Gründung der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts1.1 Wer kann stiften?1.1.1 Jedermann als Stifter1.1.1.1 Beschränkt Geschäftsfähige und Betreute1.1.1.2 Minderjährige1.1.1.3 Vermögenslose Personen1.1.2 Juristische Personen als Stifter1.1.2.1 Kapitalgesellschaften1.1.2.2 Vereine, Genossenschaften1.1.2.3 Stiftungen1.1.2.4 Juristische Personen des öffentlichen Rechts1.1.3 Mehrere Stifter1.1.3.1 Sicherstellung des Mindestvermögens bei der Bürgerstiftung1.1.3.2 Ehegattenstiftung auf den Tod des Erstversterbenden1.1.4 Personengesellschaften1.1.5 Reif für die Stiftung?1.2 Stiftungsgeschäft1.2.1 Stiftungsgeschäft zu Lebzeiten1.2.1.1 Stiftungserklärung1.2.1.2 Vermögenswidmung1.2.1.3 Satzung1.2.1.4 Form des Stiftungsgeschäfts zu Lebzeiten1.2.1.4.1 Schriftform1.2.1.4.2 Elektronische Form1.2.1.4.3 Immobilien, GmbH-Geschäftsanteile1.2.2 Weitere Gesichtspunkte des Stiftungsgeschäfts zu Lebzeiten1.2.2.1 Bedingung und Befristung1.2.2.2 Stellvertretung1.2.2.3 Mehrheit von Stiftern1.2.3 Stiftungsgeschäft von Todes wegen1.2.3.1 Das geeignete erbrechtliche Instrumentarium1.2.3.2 Die Stiftung von Todes wegen als Erbin1.2.3.2.1 Stiftung von Todes wegen als Alleinerbin1.2.3.2.2 Stiftung von Todes wegen als Miterbin1.2.3.2.3 Stiftung von Todes wegen als Nacherbin1.2.3.2.4 Stiftung von Todes wegen als Vorerbin1.2.3.2.5 Stiftung von Todes wegen als Ersatzerbin1.2.3.2.6 Stiftung von Todes wegen als Vermächtnisnehmerin1.2.3.2.7 Stiftung von Todes wegen als Begünstigte einer Auflage1.2.3.3 Inländische Stiftung und ausländisches Testament1.2.3.4 Form des Stiftungsgeschäfts von Todes wegen1.2.3.5 Besondere Risiken: Auslegung und Anfechtung1.2.3.6 Ergänzung des Stiftungsgeschäfts von Todes wegen1.2.3.7 Testamentsvollstreckung1.2.4 Stiftungserklärung1.2.5 Vermögenswidmung1.2.5.1 Vermögensarten1.2.5.2 Zweckwidmung1.2.5.3 Mittelbeschaffungskonzept statt Widmung eigenen Vermögens1.3 Das Anerkennungsverfahren1.3.1 Zuständigkeit1.3.2 Vorprüfung1.3.3 Einbeziehung der Finanzverwaltung für gemeinnützige Stiftungen1.3.4 Antragstellung1.3.5 Entscheidung1.3.5.1 Anerkennung1.3.5.2 Ablehnung1.3.5.3 Bearbeitungsdauer1.3.5.4 Widerruf der Anerkennung1.3.5.5 Verwaltungsgebühren1.3.6 Rücknahme des Antrags1.3.7 Rechtschutz1.4 Vermögensausstattung1.4.1 Bankguthaben1.4.2 Wertpapierdepot1.4.3 Immobilien1.4.4 Gesellschaftsanteile1.4.4.1 Aktien1.4.4.2 GmbH-Geschäftsanteile1.4.4.3 Kommanditanteil1.4.4.4 Anteil an einer ausländischen Gesellschaft1.5 Die Bestellung der Organmitglieder1.6 Checkliste zur Stiftungsgründung1.7 Widerruf des Stiftungsgeschäfts1.7.1 Einleitung1.7.2 Rechtfertigung der Widerruflichkeit2 Die Begünstigten (Destinatäre) der Stiftung, Stiftungsleistungen2.1 Begünstigtenkreis2.1.1 Festlegung des Begünstigtenkreises2.1.2 Unbestimmte Angabe von Merkmalen und Zwecken2.1.3 Natürliche und juristische Personen2.1.4 Direkte oder indirekte Förderung des Stiftungszwecks2.2 Rechtsstellung der Begünstigten2.2.1 Klagbarer Anspruch2.2.2 Keine Gleichbehandlung geboten2.2.3 Kontrollrechte2.2.4 Haftung der Destinatäre2.2.5 Sicherung der Leistung beim Begünstigten3 Organisation der Stiftung3.1 Organe und Gremien3.2 Einflussmöglichkeiten des Stifters3.2.1 Lebzeitige Einflussnahme3.2.1.1 Stifter als Vorstandsmitglied3.2.1.2 Stifter als Aufsichtsorgan3.2.1.3 Berufungs- und Abberufungsrecht des Stifters3.2.2 Einflussnahme über den Tod hinaus3.3 Vorstand3.3.1 Gesetzliche Vertretung nach außen3.3.1.1 Aktivvertretung3.3.1.2 Mehrheitsvertretung3.3.1.3 Passivvertretung3.3.1.4 Mehrfachvertretung und In-Sich-Geschäfte3.3.2 Geschäftsführungsbefugnis3.3.3 Beschränkungen im Innenverhältnis und im Außenverhältnis3.3.3.1 Beschränkung im Innenverhältnis (Zustimmungsvorbehalte, Verbote)3.3.3.2 Beschränkung im Außenverhältnis (Vertretungsmacht)3.3.4 Besetzung des Vorstands3.3.4.1 Anzahl der Mitglieder3.3.4.2 Besetzung und Auswahl der Mitglieder3.3.4.3 Juristische Personen als Vorstandsmitglieder einer Stiftung3.3.5 Binnenorganisation3.3.5.1 Gesetzliche Grundlagen3.3.5.2 Gewillkürte Regelungen zur Binnenorganisation3.3.5.3 Vetorecht des Stifters3.3.5.4 Regelungen unterhalb der Satzungsebene (Geschäftsordnung)3.3.6 Besondere Vertreter3.3.6.1 Satzungsgrundlage3.3.6.2 Bestellung und Abberufung3.3.6.3 Umfang der Vertretungsmacht3.3.7 Notbestellung3.4 Aufsicht und Kontrolle3.4.1 Stiftungsrat3.4.2 Entscheidungsverfahren der Organe3.5 Beschlussmängel3.6 Amtsniederlegung3.7 Berater3.8 Compliance und Compliance Management3.9 Mitbestimmung in der Stiftung3.9.1 Mitbestimmungsarten3.9.2 Unternehmensmitbestimmung3.9.3 Betriebliche Mitbestimmung4 Die Stiftungsaufsicht4.1 Stand der Gesetzgebung in den Ländern4.2 Anerkennungsverfahren4.3 Stiftungsaufsicht für die bestehende Stiftung4.3.1 Umfang der Aufsicht4.3.2 Maßnahmen der Aufsicht4.3.2.1 Allgemeine Prüfungsbefugnisse4.3.2.2 Rechenschaftspflicht und Buchprüfung4.3.2.3 Anzeigepflicht4.3.2.4 Herausgabe von Unterlagen4.3.2.5 Eingriffsbefugnisse und Zwangsmittel4.3.2.6 Abberufung und Suspendierung von Organmitgliedern4.3.2.7 Bestellung von Organmitgliedern4.3.2.8 Satzungs- und Strukturänderung4.3.2.9 Beendigung der Aufsicht4.3.2.10 Örtliche Zuständigkeit, Forum Shopping4.3.2.11 Haftung der Aufsichtsbehörde5 Buchhaltung, Publizität und Transparenz der Stiftung5.1 Rechnungslegung5.1.1 HGB5.1.2 BGB5.1.3 Stiftungsgesetze5.1.4 Abgabenrecht5.2 Publizität der Stiftung5.2.1 Grundbuch5.2.2 Handelsregister5.2.3 Stiftungsverzeichnis5.2.3.1 Aktuelle Situation5.2.3.2 Einführung des Stiftungsregisters am 1. Januar 20265.2.3.3 Inhalt des Stiftungsregisters5.2.3.4 Was bedeutet das für schon bestehende Stiftungen?5.2.4 Transparenzregister5.2.5 Zuwendungsempfängerregister 6 Die Stiftung als Arbeitgeber6.1 Dienstverhältnisse des Vorstands6.2 Sozialversicherungspflicht der Vorstandsmitglieder6.3 Arbeitnehmer6.3.1 Allgemeines6.3.2 Mindestlohngesetz6.3.3 Einstellung, allgemeine Gleichbehandlung und Fragerecht6.3.4 Kündigungsschutz6.4 Freie Mitarbeit6.5 Rechtsverhältnisse ehrenamtlicher Mitarbeiter6.6 Stiftung und Betriebsverfassungsrecht6.6.1 Tendenzbetriebe6.6.2 Keine gesetzliche Arbeitnehmermitbestimmung7 Stiftung und Datenschutz7.1 Grundwissen DS-GVO7.2 Herausforderungen für Stiftungen7.3 Anwendung der DS-GVO auf die Stiftung8 Haftung8.1 Haftung des Stifters8.2 Haftungsmaßstab8.3 Gesamtschuldnerische Haftung, Ressortprinzip8.4 Haftung des Stiftungsvorstands8.4.1 Ermessenspielraum, Business Judgement Rule8.4.2 Innenhaftung8.4.3 Außenhaftung8.5 D&O-Versicherungen8.6 Satzungsregelung8.7 Haftung des Aufsichtsorgans und weiterer Organe9 Die Stiftung im Rechtsstreit9.1 Rechtsstreit mit Außenstehenden9.1.1 Zivilprozess 9.1.1.1 Alternativen zum Zivilprozess9.1.1.2 Die Stiftung im Zivilprozess9.1.2 Arbeitsgerichtsprozess9.1.2.1 Ablauf eines Arbeitsgerichtsprozesses9.1.2.2 Alternativen zu einem Arbeitsgerichtsprozess9.1.2.3 Die Stiftung im Arbeitsgerichtsprozess9.1.3 Finanzgerichtsprozess9.1.3.1 Ablauf eines Finanzgerichtsprozesses9.1.3.2 Die Stiftung im Finanzgerichtsprozess9.1.4 Verwaltungsrechtsstreit9.1.4.1 Ablauf eines Verwaltungsrechtsstreits9.1.4.2 Alternativen zum Verwaltungsrechtsstreit9.1.4.3 Die Stiftung im Verwaltungsrechtsstreit9.2 Rechtsstreit innerhalb der Stiftung9.2.1 Rechtsstreitigkeiten mit Organen der Stiftung9.2.2 Rechtsstreitigkeit mit Begünstigten der Stiftung9.2.3 Rechtsstreitigkeit mit dem Stifter9.2.4 Rechtsstreit mit der Stiftung9.3 Rechtsstreit mit der Stiftungsbehörde9.3.1 Rechtsstreit um die Anerkennung9.3.2 Rechtsstreit um Aufsichtsmaßnahmen9.4 Schiedsgericht10 Stiftungssatzung10.1 Notwendige Bestandteile der Stiftungssatzung10.1.1 Stiftungszweck10.1.2 Name der Stiftung10.1.3 Sitz der Stiftung10.1.4 Stiftungsorgane10.1.4.1 Vorstand10.1.4.2 Vertretungsmacht10.1.4.3 Das Aufsichtsorgan10.1.5 Stiftungsvermögen10.1.5.1 Grundstockvermögen/Stiftungsvermögen/Errichtungskapital10.1.5.2 Zustiftung10.1.5.3 Spenden10.1.5.4 Vermögensverwaltung10.1.5.5 Ertragsverwendung10.1.5.6 Umschichtung des Grundstockvermögens und Umschichtungsgewinne 10.1.6 Begünstigtenkreis/Destinatäre10.2 Satzungsänderungen11 Veränderung, Beendigung und Insolvenz der Stiftung11.1 Zulegung11.2 Zusammenlegung11.3 Ab 1.1.2026: Anmeldung zum Stiftungsregister11.4 Auflösung der Stiftung11.4.1 Voraussetzungen11.4.2 Verfahren11.4.3 Rechtsfolge11.5 Liquidation der Stiftung11.6 Aufhebung der Stiftung von Amts wegen11.7 Insolvenz11.7.1 Fortführungsprognose11.7.2 Insolvenzantrag und Haftungsgefahr11.8 SatzungsgestaltungTeil D Die unternehmensverbundene Stiftung als weiterer Typus der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts1 Begriff2 Unternehmensträger- und Beteiligungsträgerstiftung3 Gestaltungsmöglichkeiten3.1 Unternehmensveräußerung, Umschichtung3.2 Kapitalmaßnahmen, Umwandlungen3.3 Stimmrechte4 Erwerb der Anteile durch die Stiftung5 Doppelstiftung6 Stiftung & Co. KGTeil E Steuerliche Behandlung von Familienstiftungen und gemeinnützigen Stiftungen1 Grundzüge der Besteuerung der Stiftungserrichtung1.1 Besteuerung der Stiftungserrichtung1.2 Besteuerung des Stifters1.3 Besteuerung der Stiftung1.3.1 Körperschaftsteuer1.3.2 Gewerbesteuer1.3.3 Umsatzsteuer1.3.4 Weitere Steuerarten2 Gemeinnützige Stiftung2.1 Voraussetzungen der Steuerbefreiung2.1.1 Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG2.1.1.1 Beginn und Erlöschen der Steuerbefreiung2.1.1.2 Wirtschaftliche Betätigung2.1.2 Beschränkung der Steuerbefreiung2.1.2.1 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb2.1.2.2 Abgrenzung zum Zweckbetrieb und zur Vermögensverwaltung2.1.3 Anforderungen an die Stiftungssatzung nach AO2.1.3.1 Selbstlosigkeit § 55 AO2.1.3.2 Ausschließlichkeit § 56 AO2.1.3.3 Unmittelbarkeit § 57 AO2.1.3.4 Steuerlich unschädliche Betätigungen § 58 AO2.1.3.4.1 Mittelweitergabe2.1.3.4.2 Vermögensausstattung anderer Körperschaften2.1.3.4.3 Überlassung von Arbeitskräften2.1.3.4.4 Überlassung von Räumen2.1.3.4.5 Unterhalt an den Stifter und seine Angehörigen2.1.3.4.6 Gesellige Zusammenkünfte2.1.3.4.7 Förderung des bezahlten Sports2.1.3.4.8 Zuschüsse von Stiftungen an Wirtschaftsunternehmen2.1.3.4.9 Erwerb von Gesellschaftsrechten2.1.3.5 Rücklagenbildung § 62 AO2.2 Besteuerung der Stiftungserrichtung/Ausstattung der Stiftung2.2.1 Erbschaftsteuer2.2.2 Ertragsteuern2.2.3 Weitere Steuerarten2.2.4 Spendenabzug2.2.5 Rückwirkende Befreiung von der Erbschaftsteuer § 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG2.3 Laufende Besteuerung2.3.1 Laufende Besteuerung der steuerbefreiten Stiftung2.3.1.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer2.3.1.2 Körperschaftsteuer2.3.1.3 Gewerbesteuer2.3.1.4 Kapitalertragsteuer2.3.1.5 Grunderwerbsteuer2.3.1.6 Grundsteuer2.3.1.7 Umsatzsteuer2.3.1.8 Organschaft2.3.1.9 Spendenabzug für Zuwendungen an eine bestehende Stiftung2.3.1.10 Zustiftung2.3.1.11 Wegfall der Steuerbefreiung2.3.2 Besteuerung der Destinatäre2.3.2.1 Einkommensteuer2.3.2.2 Erbschaft- und Schenkungsteuer2.3.3 Freistellungsbescheid der steuerbefreiten Stiftung § 60a AO2.4 Sponsoring3 Familienstiftung3.1 Einführung3.1.1 Einsatzbereich der Familienstiftung3.1.2 Begriff der Familienstiftung3.1.3 Ausländische Familienstiftung mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland3.2 Besteuerung der Stiftungserrichtung/Ausstattung der Stiftung3.2.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer3.2.1.1 Steuerbefreiung von Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG i. V. m. § 13b ErbStG3.2.1.1.1 Begünstigungsfähiges Vermögen3.2.1.1.2 Begünstigtes Vermögen3.2.1.1.3 Verschonung3.2.1.1.4 Optionsverschonung3.2.1.1.5 Vorwegabschlag für Familienunternehmen3.2.1.2 Bemessungsgrundlage/Steuerentstehung3.2.2 Ertragsteuern3.2.3 Grunderwerbsteuer3.2.4 Umsatzsteuer3.2.5 Zustiftungen3.3 Laufende Besteuerung3.3.1 Laufende Besteuerung der Stiftung3.3.1.1 Körperschaftsteuer3.3.1.2 Gewerbesteuer3.3.1.3 Umsatzsteuer3.3.1.4 Erbersatzsteuer3.3.1.5 Kapitalertragsteuer3.3.2 Besteuerung der Destinatäre3.3.2.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer3.3.2.2 Einkommensteuer3.3.2.3 Zurechnung der Einkünfte gemäß § 15 AStG3.3.2.4 Umwandlung der Familienstiftung3.4 Besteuerung der Stiftungsaufhebung3.4.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer3.4.2 Einkommensteuer3.4.3 Körperschaftsteuer3.5 Steuergestaltung: die hybride StiftungTeil F Vermögensanlage gemeinnütziger Stiftungen1 Bedeutung der Vermögensanlage von Stiftungskapital2 Anlageziele – Das magische Dreieck ist zur Pyramide geworden2.1 Sicherheit2.2 Liquidität2.3 Rentabilität2.4 ESG2.5 Stiftungsspezifische Anlageziele3 Wege zur Zielerreichung3.1 Die Anlagerichtlinie3.1.1 Erstellung einer Anlagerichtlinie3.1.2 Asset Allocation3.1.3 Zulässige Anlageinstrumente3.1.4 ESG in der Anlagerichtlinie3.2 Selbstentscheider – mit oder ohne Beratung?3.3 Vermögensverwaltung – diskretionär oder innerhalb von Fonds?3.4 Partnerwahl bei der VermögensanlageTeil G Inländische Alternativformen1 Treuhandstiftung1.1 Nicht rechtsfähige Stiftungen1.2 BaFin-Erlaubnis erforderlich?1.3 Rechtliche Konstruktion1.4 Person des Stiftungsträgers1.5 Transparenz und Publizität1.6 Errichtung zu Lebzeiten1.7 Errichtung durch letztwillige Verfügung1.8 Satzungsgestaltung1.9 Unselbständige Verbrauchsstiftung2 Stiftungs-GmbH2.1 GmbH statt rechtsfähiger Stiftung – warum?2.1.1 Grundsätzlich keine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich2.1.2 Keine laufende staatliche Aufsicht2.1.3 Satzungsänderung, insbesondere Zweckänderung2.1.4 Kontrolle durch den Stifter2.1.5 Auflösung und Rückabwicklung durch den Stifter oder dessen Rechtsnachfolger2.2 Nachteile der GmbH gegenüber der rechtsfähigen Stiftung2.2.1 Keine Ewigkeit2.2.2 Kein endgültiger Vermögensübergang2.2.3 Insbesondere: Keine Pflichtteilsfestigkeit2.3 Rechtliche Konstruktion2.3.1 Stiftungsträger-GmbH und Stiftungskörperschaft2.3.2 Gestaltung des Gesellschaftsvertrags2.3.2.1 Firma2.3.2.2 Zweck der Gesellschaft2.3.2.3 Unternehmensgegenstand2.3.2.4 Kapitalaufbringung2.3.2.5 Selbstlosigkeit: Gewinnverwendung, Abfindung, Auflösung2.3.2.6 Geschäftsführung und Kontrolle2.3.3 Übertragung des gewidmeten Vermögens2.4 Errichtung der Stiftungs-GmbH2.5 Stiftungs-GmbH und Nachfolgeplanung, Pflichtteilsrecht2.6 Ausblick: Unternehmen im Verantwortungseigentum3 Stiftungsverein3.1 Vorteile und Nachteile3.2 Rechtliche Konstruktion3.3 Satzungsgestaltung3.4 Bezeichnung als »Stiftung«3.5 Gründung von Todes wegen3.6 FamilienvereinTeil H Ausländische Rechtsformen und Besteuerung1 Stiftung nach schweizerischem Recht1.1 Stiftungstypen1.1.1 Gemeinnützige Stiftung1.1.2 Familienstiftung1.1.3 Unternehmensstiftung1.1.4 Personalfürsorgestiftung1.2 Gründung1.3 Organisation1.3.1 Stifter1.3.2 Organe1.3.3 Stiftungsrat1.3.4 Revisionsstelle1.4 Stiftungsaufsicht1.5 Stiftungsrechtsreform2 Stiftung nach liechtensteinischem Recht2.1 Stiftungstypen2.2 Gründung2.2.1 Stiftung unter Lebenden2.2.2 Stiftung von Todes wegen2.2.3 Treuhänderische Stiftungserrichtung2.3 Organisation2.3.1 Stifter2.3.2 Organe2.3.3 Stiftungsrat2.3.4 Revisionsstelle2.4 Stiftungsaufsicht2.5 Unterschied zur deutschen Stiftung3 Stiftung nach österreichischem Recht3.1 Stiftungstypen3.2 Gründung der Privatstiftung3.3 Organisation3.3.1 Stifter3.3.2 Organe3.4 Stiftungsaufsicht4 Trusts4.1 Einleitung4.2 Die Beteiligten eines Trusts4.3 Die Gründung eines Trusts4.3.1 Intervivos Trust4.3.2 Testamentary Trust4.3.3 Discretionary Trust4.4 Der Trust im internationalen PrivatrechtDie AutorenIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6037-8
Bestell-Nr. 17218-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6038-5
Bestell-Nr. 17218-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6039-2
Bestell-Nr. 17218-0150
René Udwari/Laura Hertel/Timon Heinrich
Handbuch Stiftungspraxis
1. Auflage 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
anderer Ansicht
a. a. O.
am angegebenen Orte
a. F.
alte Fassung
Abs.
Absatz
AEAO
Anwendungserlass Abgabenordnung
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bd.
Band
Begr.
Begründung
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BStBl.
Bundessteuerblatt
BT-Drs.
Bundestags-Drucksache
Buchst.
Buchstabe
BVerwG
Bundesverwaltungsgesetz
Co. KG
Compagnie Kommanditgesellschaft
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive
d. h.
das heißt
DCGK
Deutscher Corporate Governance Kodex
DLRG
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DS-GVO
Datenschutz-Grundverordnung
eG
eingetragene Genossenschaft
EL
Ergänzungslieferung
e.S.
eingetragene Stiftung
ESG
Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance
ETF
Exchange Traded Fund
EuErbVO
Europäische Erbrechtsverordnung
EUR
Euro
e. V.
eingetragener Verein
e. VS
eingetragene Verbrauchsstiftung
f.
folgende
ff.
fortfolgende
FG
Finanzgericht
gem.
gemäß
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GG
Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVBl.
Gesetz- und Verordnungsblatt
GwG
Geldwäschegesetz
HGB
Handelsgesetzblatt
Hs.
Halbsatz
InKostV
Kostenverordnung für die innere Verwaltung
i. H. v.
in Höhe von
InsO
Insolvenzordnung
i. S. d.
im Sinne des
i. S. v.
im Sinne von
i. V. m.
in Verbindung mit
Kap.
Kapitel
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStR
Körperschaftsteuerrichtlinie
KWG
Kreditwesengesetz
Ls.
Leitsatz
m. Anm.
mit Anmerkung
m. w. N.
mit wichtigen Nachweisen
Mio.
Millionen
n. Chr.
nach Christus
n. F.
neue Fassung
Nr.
Nummer
OLG
Oberlandesgericht
OVG
Oberverwaltungsgericht
p. a.
per annum
RG
Reichsgericht
Rn.
Randnummer
S.
Satz, Seite
s.
siehe
SDGs
Sustainable Development Goals
SE
Europäische Gesellschaft
s. o.
siehe oben
Sp.
Spalte
s. u.
siehe unten
UG
Unternehmergesellschaft
Urt.
Urteil
v. Chr.
vor Christus
VG
Verwaltungsgericht
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
z. B.
zum Beispiel
z. T.
zum Teil
Ziff.
Ziffer
Vorwort
Stiftungen sind eine faszinierende und vielfältige Erscheinungsform unserer Gesellschaft und spielen eine immer bedeutsamere Rolle. Sie fordern juristische Expertise und praktische Erfahrung bei der Förderung von Bildung, Kultur, Wissenschaft, sozialen Projekten und vielem mehr. Seit einigen Jahren sind Stiftungen auch fester Bestandteil des Werkzeugkastens der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.
Das vorliegende Handbuch bietet für den Leser eine Einführung in die Stiftungspraxis aus rechtlicher, steuerlicher und finanzieller Sicht. Die Autoren haben ihr Wissen und ihre praktische Erfahrung in dieses Buch eingebracht. Sie beleuchten nicht nur die rechtlichen Grundlagen, sondern geben auch Tipps und Hinweise aus der Praxis für die tägliche Arbeit mit Stiftungen. Ob man sich bereits intensiv mit dem Stiftungsrecht beschäftigt oder erst am Anfang der Materie steht – dieses Handbuch bietet Einblicke, praktische Tipps und rechtliche Grundlagen, ergänzt durch Checklisten, Satzungs- und Vertragsmuster sowie Gestaltungshinweisen. Es mag einerseits als Ausgangspunkt für das eigene Stiftungsprojekt oder für die erste Orientierung eines Mandanten dienen, der ein Stiftungsvorhaben erwägt. Andererseits soll dieses Handbuch Stiftungsbeteiligten und ihren Beratern auch in der laufenden Verwaltung zur Orientierung dienen. Das Handbuch richtet sich daher sowohl an (zukünftige) Stifter, Stiftungsvorstände und -beiräte als auch an deren Berater.
Das Buch beinhaltet auch das neue Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, welches am 1. Juli 2023 in Kraft getreten ist, und beachtet die durch die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) vom 1. Januar 2024 entstandenen Neuerungen.
Der Prozess der Gründung einer Stiftung wird anhand von Praxisbeispielen nahegebracht und durch Checklisten und Praxistipps unterstützt. Das Handbuch berücksichtigt die neue Rechtsprechung und sämtliche Gesetzesänderungen.
Gerade in den Anfangskapiteln kann der Leser eine Art Adlerperspektive einnehmen und so aus Sicht der Stiftung Ziele und Herausforderungen beleuchten. In den wesentlichen Hauptkapiteln wird ein umfassender Überblick geboten zur konkreten Umsetzung der ersten Idee eine Stiftung zu gründen, rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen für die Gründung an sich und auch für verschiedene Varianten von Stiftungen und alternative Organisationsformen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Hier wird vor allem auf die Stiftungsgründung in Österreich, Lichtenstein und der Schweiz eingegangen und auf die Vor- und Nachteile, die eine Stiftungserrichtung im Ausland mit sich bringt. Daneben geht es auch um die steuerlichen Aspekte von (ausländischen) Stiftungen und Trusts in Deutschland und wie das Vermögen zu verwalten ist bzw. die Vermögensverwaltung gestaltet werden kann.
Als Praxishandbuch konzentriert sich die Darstellung jeweils auf die wesentlichen Hinweise zum jeweiligen Thema und zeigt offene Punkte in der juristischen Diskussion auf, ohne hier eine eigene Entscheidung für die eine oder andere Ansicht treffen zu können.
Das Stiftungsrecht hat in jüngster Zeit bereits einige Entwicklungen erfahren. Mit dem Inkrafttreten des neuen Stiftungsrechts zum 1. Juli 2023, welches sowohl neu errichtete als auch bereits bestehende Stiftungen betrifft, sollte noch mehr Rechtssicherheit geschaffen werden. Zum 1. Januar 2026 wird zudem ein zentrales Stiftungsregister eingeführt, das den Stiftungen die Teilnahme am Rechtsverkehr erleichtern soll. Bislang existiert ein bundesweit einheitliches Stiftungsregister nicht.
Das Stiftungsrecht verändert sich stetig, es ist deshalb essenziell, sich mit den bestehenden Regelungen vertraut zu machen, um die Reformen nachvollziehen zu können. Dies bietet auch die Gelegenheit, bestehende Strukturen und Ansätze zu überprüfen und zu aktualisieren.
Allen Mitwirkenden des Handbuches Stiftungspraxis sei an dieser Stelle für ihre tatkräftige Unterstützung und ihr zuverlässiges und immer bestehendes Engagement gedankt. Der besondere Dank der Autoren gilt den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Saskia Holz und Svenja Rogotzki.
Wir hoffen, dass dieses von Praktikern für Praktiker verfasste Werk eine umfassende und praxisnahe Orientierung im Bereich des Stiftungsrechts bietet. Es soll den Lesern als alltäglicher Begleiter dienen und einen Mehrwert für alle Interessierten mit sich bringen.
Die Autoren bedanken sich im Voraus für Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Kritik.
René Udwari
Laura Hertel
Timon Heinrich
Im März 2024
Teil A Die Stiftung aus der Adlerperspektive
1 Funktion der Stiftung in Wirtschaft und Gesellschaft
Deutschland ist ein StiftungslandStiftungsland Deutschland. Aktuell zählt die Statistik für Deutschland insgesamt 25.254 (Stand: 31.12.2022) rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen RechtsStiftung bürgerlichen Rechts. Allein im Jahr 2022 wurden 693 neue rechtsfähige Stiftungen errichtet. Unselbständige Stiftungen sind in diesen Zahlen noch nicht einmal enthalten. Da TreuhandstiftungTreuhandstiftungen keiner besonderen staatlichen Aufsicht unterliegen und auch nicht in ein öffentliches Verzeichnis eingetragen werden, kennt niemand deren genaue Zahl. Schätzungen gehen von etwa 20.000 unselbständigen Stiftungen in Deutschland aus.
Damit gilt Deutschland als eines der stiftungsreichsten Länder Europas. Innerhalb Deutschlands sind nach absoluten Zahlen die meisten Stiftungen (4.885) in Nordrhein-Westfalen zu finden. Die Freie und Hansestadt Hamburg führt die Statistik hingegen an bei der Stiftungsdichte in Relation zur Einwohnerschaft, hier kommen auf je 100.000 Einwohner 80 Stiftungen. Hessen verzeichnet mit 164 neu gegründeten Stiftungen das größte Wachstum innerhalb Deutschlands.
Die rechtsfähigen Stiftungen dienen in erster Linie dem Gemeinwohl. Dabei verfolgen 90 % aller rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Bei 95 % aller StiftungStiftung, Klassifizierung nach Zwecken steht der soziale Zweck an erster Stelle, sie sind also gemeinnützig im Sinne des § 52 AO (Stiftungszwecke-2022.pdf (stiftungen.org), zuletzt aufgerufen am 18.03.2024):
Auf Bildung und Erziehung ausgerichteten Stiftungen (33,1 %)
Stiftungen für Sport und Bewegung (9,4 %)
Stiftungen für Freizeit und Geselligkeit (7,8 %)
Kunst- und Kulturstiftungen (29,2 %)
die Wissenschaft und Forschung fördernden Stiftungen (22,1 %)
Stiftungen zur Förderung der Diversität und Inklusion (5,1 %)
Stiftungen zur Förderung des Gesundheitswesens (15,3 %)
Stiftungen zur Förderung sozialer Dienste (46,1 %)
die auf den Umweltschutz abzielenden Stiftungen mit (14,9 %)
Stiftungen für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (1,8 %)
Stiftungen zur Förderung der internationalen Solidarität (9,4 %)
Stiftungen zur Förderung von Bürger*innen- und Verbraucher*inneninteressen (0,9 %)
Stiftungen zur Förderung von Wirtschaftsverbänden und Berufsorganisation (0,7 %)
Stiftungen zur Förderung von gemeinschaftlichen Versorgungsaufgaben (1,8 %)
Stiftungen zur Förderung der Kirchen und religiöse Vereinigungen (10,5 %)
Stiftungen zur Förderung von Politik und politischen Interessenvertretung (4,3 %)
Stiftungen zur Förderung der Justiz und zur Bekämpfung von Kriminalitätsproblemen (1,1 %)
Die privatnützigen Stiftungen blieben deutlich darunter bei (8,8 %)
Die Idee der gemeinwohlorientierten Stiftunggemeinwohlorientierte Stiftung reicht zurück in eine Zeit, als der heutzutage scheinbar allmächtige Sozialstaat ein ferne Utopie in den Träumern kühner Denker war. Die Stiftung ist daher wie Eigentum, Ehe und Familie eine Institution, die des Staates nicht bedarf, um ihre Existenz zu rechtfertigen.
Die gemeinnützigen Stiftungen ergänzen heute das Handeln des Staates. Der Staat wird beispielsweise finanziell entlastet, wenn die privatrechtlichen Stiftungen wesentliche öffentliche Aufgaben übernehmen. Stiftungen bieten einen Mehrwert für die Gesellschaft, indem sie zusätzliche Impulse geben und in Ermangelung von Mitgliedern, z. B. Aktionären oder Wählern, unabhängig handeln können.
In Gestalt der Bürgerstiftung hat die Rechtsform der selbständigen Stiftung in den letzten Jahren einen neuen Antrieb erhalten.
Darüber hinaus können sie aber auch privatnützige Zwecke verfolgen. Ein bedeutendes Beispiel ist die Familienstiftung, die im Interesse der Familie des Stifters (oder auch anderer Personen) errichtet ist. Hintergrund einer Familienstiftung zur Versorgung der Stifterfamilie über mehrere Generationen hinweg ist oft auch der Zusammenhalt des Familienvermögens. Die Stiftung ist somit als ein möglicher Baustein der Nachfolgeplanung für größere Vermögen nicht wegzudenken.
Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts stellt die einzige gemeinnützige Organisationsform dar, die durch das Finanzamt und die Stiftungsaufsicht als staatliche Behörden überwacht wird.
Quellen
MHdB GesR V, § 77 Gesellschaftliche Bedeutung, Begriff und Arten der Stiftung Rn. 1–5 – beck-online
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Presse/Faktenblaetter/10-Fakten-Stiftungen.pdf
Zahlen, Daten, Fakten 2021, Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hrsg.)
www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungszwecke-2022.pdf
2 Erscheinungsformen: Was kann die Stiftung?
»StiftungStiftung, Erscheinungsformen« ist kein trennscharfer Begriff für eine bestimmte Rechtsform. Stiftungen können in verschiedenen Rechtsformen existieren. Am bekanntesten ist die rechtsfähige Stiftung im Sinne des BGB (»rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts«). Außerdem kennt das Privatrecht auch nicht-rechtsfähige Stiftungsformen wie die Treuhandstiftung oder die Schenkung unter Auflage, die letztlich auf Vertrag beruhen und damit ebenfalls Gebilde des bürgerlichen Rechts sind. Daneben bestehen auch Stiftungen des öffentlichen Rechts, kommunale Stiftungen sowie Stiftungen in kirchlicher Trägerschaft.
Zu den Ersatzformen einer rechtsfähigen Stiftung zählen der Verein und die Kapitalgesellschaften, die keine »Stiftungen« in eigentlichem Sinne sind, aber die gleiche Funktion wahrnehmen sollen.
2.1 Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts
Die rechtsfähige Stiftung des Privatrechtsrechtsfähige Stiftung des Privatrechts ist juristische Person. Sie kann also am Rechtsverkehr teilnehmen und Träger von Rechten und Pflichten sein. Aufgrund dessen unterscheidet sich die Gründung einer rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts maßgeblich von der Gründung anderer Rechtstypen von Stiftungen sowie von den Ersatzformen einer Stiftung.
Eine Stiftung bürgerlichen RechtStiftung bürgerlichen Rechtss im Sinne der §§ 80 ff. BGB stellt nach § 80 Abs. 1 S. 1 BGB eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person dar.
In der Gründungsphase, also zwischen dem Stiftungsgeschäft und der Anerkennung durch hoheitlichen Verwaltungsakt, existiert nach der herrschenden Meinung keine zivilrechtliche »Vor-StiftungVor-Stiftung«, welche Trägerin von Rechten und Pflichten sein könnte (Richter, Stiftungsrecht, 1. Aufl. 2019, § 4 Rn. 154 ff.). Dies stellt einen Unterscheid zum Gesellschaftsrecht dar, in welchem eine Vorgründungsgesellschaft und eine Vorgesellschaft anerkannt ist.
Eine Stiftung muss zwar nicht gemeinnützig sein. Erforderlich ist gemäß § 8 S. 1 BGB lediglich, dass ihr Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet. In diesem Rahmen sind sämtliche Stiftungszwecke für die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung erlaubt. Die Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung gemäß BGB ist eine »gemeinwohlkonforme Allzweckstiftung«. Unabhängig von der zivilrechtlichen Zulässigkeit einer Vielfalt gemeinnütziger und privatnütziger Zwecke ist jedoch die Beurteilung, ob eine Stiftung steuerlich begünstigt ist, nach den abgaberechtlichen Vorschriften vorzunehmen. Eine rechtsfähige Stiftung des Privatrechts muss außerdem fremdnützig sein, d.h., sie muss der Allgemeinheit oder anderen dienen, eine Selbstzweckstiftung ist also nicht zulässig.
Die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts ist in den §§ 80–88 BGB bundeseinheitlich geregelt. Allerdings wird dort die unselbständige Stiftung nicht geregelt, da ihre Rechtsgrundlage im Schuldrecht und Erbrecht zu finden ist. Aufgrund mangelnder Kompetenzzuweisung liegt die Zuständigkeit für die öffentlich-rechtlichen Aspekte des Stiftungsrechts gemäß Art. 70 I GG bei den Ländern. Darunter fällt z. B. das Anerkennungsverfahren (ausführlich siehe C.1.3) sowie die Stiftungsaufsicht durch die jeweilige Landesstiftungsbehörde (ausführlich siehe C.4).
2.1.1 Gemeinnützige Stiftung
Die gemeinnützige Stiftunggemeinnützige Stiftung verfolgt im Unterschied zu der privatnützigen Stiftung gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO. Einen gemeinnützigen Zweck verfolgt eine Körperschaft nach § 52 Abs. 1 AO, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Sie verfügt über die nach § 82 S. 1 BGB-neu erforderliche Gemeinwohlkonformität einer Stiftung. Die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit stellt einen steuerlichen Tatbestand dar.
Bei einer gemeinnützigen Stiftung entfallen die Körperschaft- und Gewerbesteuer gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG.
2.1.2 Familienstiftung
Die FamilienstiftungFamilienstiftung wird in der Praxis häufig als Gestaltungsmöglichkeit für die Nachfolgeplanung gewählt. Vermögende Privatpersonen können so langfristig die Versorgung ihrer Familien und deren Nachkommen absichern. Dadurch wird das Familienvermögen auch vor einer Zerschlagung oder Verschwendung geschützt. Diesbezüglich können in der Satzung sehr individuelle Gestaltungen z. B. für die Vermögensausschüttung an die Begünstigten vorgenommen werden. Allerdings sind im Rahmen der Nachfolgekonstellation auch verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Bei der Unternehmensnachfolgelösung in Form einer Stiftung kann es zu Problemen kommen, wenn die nachfolgenden Generationen nicht die gleichen Werte teilen. Dies stellt gestalterisch eine große Herausforderung dar und bietet Konfliktpotenzial.
Eine gesetzliche Definition des Begriffs Familienstiftung existiert im Zivilrecht bisher nicht. Sie stellt allerdings einen eigenen Stiftungstypus dar und keine besondere Rechtsform. Eine rechtsfähige Familienstiftung wird also nach den Regeln der §§ 80 ff. BGB errichtet. Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht definiert die Familienstiftung jedoch im Rahmen der Anwendung der Schenkungsteuerklasse.
Eine Familienstiftung kann von dem Stifter zu Lebzeiten errichtet werden oder von Todes wegen.
Die Familienstiftung ist während ihres Lebenszyklus von der Errichtung über den Betrieb bis hin zur Auflösung der Stiftung unbeschränkt steuerpflichtig. Darüber hinaus fällt alle 30 Jahre nach dem Vermögensübergang gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG, § 9 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG eine Erbersatzsteuer an. Trotzdem stellt sie unter steuerlichen Gesichtspunkten eine attraktive Gestaltungsoption dar (ausführlich siehe E.3).
2.1.3 Unternehmensstiftung
Eine weitere besondere Ausprägung der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts ist die »UnternehmensstiftungUnternehmensstiftung«, die aber ebenfalls zivilrechtlich nicht definiert ist und als Begriff auf wenigstens drei Erscheinungsformen Anwendung findet.
2.1.3.1 Stiftung als Gesellschafter, Holding-Stiftung
Zunächst kann sich die Stiftung als GesellschafterStiftung als Gesellschafter an einem Unternehmen in der Rechtsform einer Kapital- oder Personengesellschaft beteiligen. Zulässig sind sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen. Die Stiftung kann auch mehrere unternehmerische Beteiligungen bündeln. Hält die Stiftung mehrere Mehrheitsbeteiligungen oder ist sie Alleingesellschafter mehrerer Gesellschafter und übt gleichzeitig auch Leitungsfunktionen in diesen Gesellschaften aus, spricht man von einer Holding-StiftungHolding-Stiftung.
2.1.3.2 Die Stiftung & Co. KG
Die rechtsfähige Stiftung kann auch als persönlich haftender Gesellschafter in eine Kommanditgesellschaft eintreten. Nach dem gesetzlichen Leitbild der KG obliegt ihr dann auch die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts in der Gesetzesbegründung lediglich ausgeschlossen, dass die Übernahme der Komplementärstellung alleiniger Zweck einer Stiftung ist. Diese Gestaltung ist damit nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Stiftung andere Zwecke verfolgt. Ist der Stifter oder die Stifterfamilie als Kommanditist an der Stiftung & Co. KG beteiligt, ergibt sich eine Struktur ähnlich der GmbH & Co. KG. Der Vorteil der Stiftung und Co. KGStiftung & Co. KG liegt darin, dass sie von der gesetzlichen Arbeitnehmermitbestimmung nicht erfasst wird.
2.1.3.3 Stiftung als Unternehmensträger und Kaufmann
Stiftung als UnternehmensträgerSchließlich kann die Stiftung auch selbst und unmittelbar als Kaufmann ein Unternehmen betreiben, ohne dass dieses Unternehmen in einer gesonderten Rechtsform wie einer Kapital- oder Personengesellschaft eingebracht ist. Die Stiftung ist in diesem Fall als Einzelkaufmann mit ihrem Handelsgewerbe in das Handelsregister einzutragen (§ 1 HGB). In der Praxis ist diese Variante, in der die Stiftung selbst und unmittelbar unternehmerisch tätig ist, selten anzutreffen. Ein gewichtiger Nachteil dieser Gestaltung ist die unmittelbare und unbegrenzte unternehmerische Haftung, die zu einem Risiko für die Vermögenserhaltung der Stiftung führt.
2.2 Stiftung des öffentlichen Rechts
Die rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechtsrechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts entsteht durch einen öffentlich-rechtlichen Stiftungsakt und zählt zu dem Bereich der mittelbaren Staatsverwaltung. Sie stellt eine Verwaltungseinheit mit eigener Rechtspersönlichkeit dar, die regelmäßig mit besonderem Vermögen ausgestattet wird. Anders als bei der rechtsfähigen Stiftung des Privatrechts herrscht bei der Stiftung öffentlichen Rechts Formfreiheit, weshalb eine eindeutige Zuordnung zu einem Stiftungstypen schwierig erscheint.
Nicht zu verwechseln ist die rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts mit einer Stiftung die »öffentliche Zwecke« verfolgt. Dies ist der Fall, wenn die Begünstigten nicht nur eine abgrenzbare Personenanzahl darstellen wie bei einer Familienstiftung. Der potenzielle Begünstigtenkreis stellt also einen dem Grunde nach für jeden zugänglichen Personenkreis dar.
Die rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts lässt sich in Bundesstiftungen und Stiftungen des Landes sowie der Kommunen unterteilen. Eine solche Differenzierung ist im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben entscheidend, da sich auf Bundes- und Landesebene Unterschiede ergeben. Dies betrifft die folgenden Bereiche: Zulässigkeit, Verbot der Mischverwaltung, Gesetzesvorbehalt sowie die Kompetenzordnung zwischen Bund und Ländern.
Beispiele: Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Berlin), die Conterganstiftung für behinderte Menschen, die Stiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, Otto-von-Bismarck-Stiftung, Stiftung Berliner Philharmoniker (Träger: Land Berlin), kirchliche Stiftungen (z. B. Stiftung Geburtshaus Papst Benedikt XVI.).
Fraglich ist, wie sich die rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts von der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts unterscheidet. Eine Abgrenzung der Stiftungsarten erfolgt anhand einer Gesamtschau aller Umstände. Zur Entscheidung werden der Stiftungszweck und der Entstehungstatbestand herangezogen.
Bei der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts entsteht die Stiftung durch das Stiftungsgeschäft. Bei der rechtsfähigen Stiftung öffentlichen Rechts hingegen wird ein Stiftungsakt des Stifters sowie ein staatlicher Hoheitsakt für die Gründung verlangt. Dieser kann durch ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung sowie durch einen Verwaltungsakt erfolgen. Erst mit dem staatlichen Hoheitsakt entsteht die Stiftung als juristische Person des öffentlichen Rechts. Darüber hinaus kann eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts auch durch eine Umwandlung einer Stiftung bürgerlichen Rechts in eine Stiftung öffentlichen Rechts entstehen.
2.3 Kommunale Stiftung
Die kommunale Stiftungkommunale Stiftung setzt sich aus drei Elementen zusammen. Sie handelt innerhalb des Wirkkreises einer kommunalen Körperschaft, ihr Zweck ist überwiegend auf öffentliche Aufgaben einer kommunalen Körperschaft gerichtet und sie wird aufgrund der Satzung von einer kommunalen Körperschaft verwaltet. Dabei stellt die kommunale Verwaltung den entscheidenden Unterschied zu anderen Stiftungstypen dar.
Die kommunale Stiftung kann als selbstständige sowie unselbstständige Stiftungkommunale Stiftung, unselbständigekommunale Stiftung, selbständige des kommunale Stiftung, des privaten Rechtsprivaten oder öffentlichen Rechtskommunale Stiftung, des öffentlichen Rechts ausgestaltet werden. Regelmäßig wird eine solche Stiftung durch eine Gemeinde oder einen Gemeindevorstand gegründet. Aber auch eine Gründung durch eine Privatperson ist möglich. Teilweise kann es in der Praxis zu Problemen kommen, wenn die Verwaltung durch die Gemeinde ausgestaltet wird. Manche Bundesländer, z. B. Rheinland-Pfalz oder das Saarland, haben in ihren Landesstiftungsgesetzen dazu Regelungen getroffen (§ 3 Abs. 5 LStiftG; § 20 Abs. 2 S. 1 SaarlStiftG).
Der Bundesverband Deutscher StiftungenBundesverband Deutscher Stiftungen hat einen Leitfaden für die Verwaltung kommunaler Stiftungen erstellt (Empfehlungen-Verwaltung-kommunaler-Stiftungen.pdf, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024). Unabhängig von der jeweiligen Rechtsform sind kommunale Stiftungen gemeinwohlorientiert und handeln für die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Kommune. Sie zeichnen sich dabei durch eine besonderes Näheverhältnis zur Kommunalverwaltung aus. Der Tätigkeitsbereich der kommunalen Stiftung begrenzt sich regelmäßig auf eine Stadt, eine Gemeinde oder einen Landkreis. Die Stiftung kann ihren Zweck in verschiedenen Bereichen haben, z. B. in der Bildung, der Hilfe von Jugendlichen oder alten Menschen, der Gesundheit oder auch im Umweltschutz.
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat darüber hinaus zehn Empfehlungen zur Verwaltung kommunaler Stiftungen aufgestellt:
(1)
Die kommunale Stiftung ist im Gemeinwesen verankert und handelt nur in dem vom Stifter in der Satzung festgelegten Rahmen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks.
(2)
Die kommunale Stiftung soll ihre Verwaltung eigenständig regeln und kann innerhalb oder außerhalb der kommunalen Kernverwaltung erfolgen. Sie hat sich an das Neutralitätsgebot hinsichtlich weltanschaulicher und parteipolitischer Themen zu halten. Zur Kontrolle und Beratung der Beschlussorgane können weitere Gremien gebildet werden.
(3)
Der Stiftungszweck kann nur erfüllt werden, wenn sie über eine angemessene sachliche und personelle Ausstattung verfügt.
(4)
Die getätigten Personal- und Sachaufwendungen kann sich die Stiftungsverwaltung von den verwalteten Stiftungen erstatten lassen. Die Leistungen der kommunalen Stiftungsverwaltung sind außerdem angemessen zu vergüten.
(5)
Die kommunalen Stiftungen sollen durch Offenheit und Transparenz überzeugen.
(6)
Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann die kommunale Stiftungsverwaltung sich Sachverständige kommunaler Fachdienststellen zur Hilfe holen.
(7)
Die Förderung innovativer Projekte sollte im Vordergrund stehen. Das Prinzip der Nachrangigkeit gegenüber gesetzlichen Ansprüchen ist bei der Vergabe und Verwendung der Stiftungsmittel zu berücksichtigen.
(8)
Die Verwaltung des Stiftungsvermögens erfolgt getrennt vom kommunalen Vermögen. Dabei sollte die reale Substanzerhaltung des Stiftungsvermögens angestrebt werden.
(9)
Eine weitere Aufgabe der Stiftungsverwaltung ist die Beratung von Stifterinnen und Stiftern sowie die Werbung für die Gründung einer Stiftung. Hinzu kommt noch die Mitarbeit in Stiftungsnetzwerken.
(10)
Auch ein kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen der Stiftungsverwaltung und der Kommune ist wichtig.
2.4 Kirchliche Stiftung
Die kirchliche Stiftungkirchliche Stiftung ist eine Sonderform der Stiftung und ihre Voraussetzungen werden teilweise in den Landesstiftungsgesetzen der Länder definiert. Der Zweck einer kirchlichen Stiftung muss kirchlichen Belangen gewidmet sein und sie muss durch die Kirche anerkannt werden. Somit besteht der Unterschied zur weltlichen Stiftung in der Zwecksetzung und der organisatorischen Zuordnung zur Kirche. Aufgrund ihres gemeinnützigen Stiftungszwecks handelt es sich bei kirchlichen Stiftungen um öffentliche Stiftungen, die in rechtsfähige und nicht rechtsfähige kirchliche Stiftungen privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur unterteilt werden (Scheerbarth/Coenen/Krengel, Stiftungen, § 1 Einführung Rn. 29, 30 – beck-online).
Einheitlich ist geregelt, dass Stifter einer kirchlichen Stiftung einerseits die Kirche selbst sein kann, andererseits aber auch eine Privatperson. Alle darüber hinausgehenden Regelungen sind in den Landesstiftungsgesetzten unterschiedlich geregelt. Dies hat sich auch nicht durch die Stiftungsrechtsreform 2023 geändert. Der frühere § 80 Abs. 3 BGB wird nun durch den § 88 BGB n. F. ersetzt. Die Mitwirkung der Kirche bei der Errichtung und Anerkennung kirchlicher Stiftungen kann weiterhin durch das Landesstiftungsgesetz geregelt werden. Gemäß § 88 BGB n. F. bleiben die Vorschriften der Landesgesetze über die Zuständigkeit der Kirchen für kirchliche Stiftungen unberührt. Diese haben weiterhin die Zustimmung zur Errichtung einer kirchlichen Stiftung zu geben (BT-Drs. 19/28173, 47, 80).
Die Rechtsstellung der Kirche gegenüber der von ihr gegründeten Stiftung bemisst sich nach innerkirchlichem Recht. Dieses Recht hat auch Auswirkungen darauf, dass die Stiftung ggf. als privatrechtliche Stiftung gegründet wurde und nicht als öffentlich-rechtliche Stiftung. Wurde die Stiftung also von einer Privatperson als Stifter gegründet, muss man unterscheiden, ob die Stiftung nicht nur nach staatlichem Recht, sondern auch nach innerkirchlichem Recht rechtsfähig ist. Dies hat zur Folge, dass die Rechtsbeziehung zwischen der Kirche und der Stiftung dem Kirchenrecht unterliegt.
2.5 Bürgerstiftung
Die BürgerstiftungBürgerstiftung wird in der Praxis immer beliebter. Eine genaue Definition für die Bürgerstiftung existiert bisher nicht. Allerdings hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen einen Katalog mit Merkmalen für die Bürgerstiftung entwickelt (https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Verband/Was_wir_tun/Veranstaltungen/AK-Buergerstiftungen/10-Merkmale-einer-Buergerstiftung.pdf, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024). Sie stellt eine gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger dar und wird der gemischten Stiftung im weiteren Sinne zugeordnet. Sie ist regelmäßig als eine rechtsfähige Stiftung ausgestaltet, kann aber auch als unselbstständige Stiftung organisiert sein. Sie ist in ihrer Organisation grundsätzlich wirtschaftlich, politisch und konfessionell unabhängig und handelt autonom. In einem geografisch abgrenzbaren Raum ist die Bürgerstiftung organisiert. Dies kann eine Stadt, ein Stadtteil oder eine Region sein. Des Weiteren zeichnet sich eine Bürgerstiftung durch eine transparente Arbeit unter aktiver Teilnahme der Stifter aus.
Die Bürgerstiftung verfügt über einen weit gefassten Stiftungszweck, damit sie ein möglichst breites Betätigungsfeld hat. Häufig wird der gesamte Katalog der als gemeinnützig anerkannten Zwecke im Sinne des § 52 AO als Stiftungszweck in der Satzung aufgeführt. Dies ist allerdings hinsichtlich des Bestimmtheitsgebots problematisch, da der Stiftungszweck hinreichend konkret formuliert sein muss. Sie ist regelmäßig auf den künftigen Kapitalzuwachs durch Zustiftungen, Projektspenden und unselbstständige Stiftungen angelegt. Zur Verwirklichung dieses Zwecks können die Stifter Geldleistungen erbringen oder mit ihrer Zeit und ihren Ideen den Stiftungszweck unterstützen.
Im Gegensatz zu anderen Stiftungstypen, welche regelmäßig nur einen Stifter haben, wird die Bürgerstiftung »bottom up« errichtet, also durch eine Vielzahl von Stiftern gemeinsam. Dies kann hinsichtlich des stiftungsrechtlichen Trennungs- und Erstarrungsprinzips zu Problemen führen, da in bei einer Bürgerstiftung kein unveränderlich festgelegter Stiftungszweck einschlägig ist, sondern ein ständig in der Weiterentwicklung befindlicher Zweck. Das Trennungs- und Erstarrungsprinzip besagt, dass der Stifter sich endgültig von dem gewidmeten Vermögen trennt, die Stiftung und der Stifter werden zwei unabhängige Rechtspersonen und der Stifterwille erstarrt durch die Stiftungserrichtung. Demnach kann der Stifter nach der Errichtung keinen Einfluss mehr auf die Stiftung und ihr Vermögen haben (BeckOGK/Jakob/M. Uhl, 1.7.2022, BGB § 80 Rn. 5).
Zu den Aufgaben einer Bürgerstiftung gehört es z. B., dass diese Spenden entgegennimmt und für den Stiftungszweck sinnvoll einsetzt, »Themenfonds« verwaltet oder auch als Dach für organisatorisch eigenständige Unterstiftungen fungiert. Allerdings ist eine Bürgerstiftung in dieser Konstellation nicht identisch mit einer Dachstiftung, da die Zu- oder Mitstifter der Bürgerstiftung das tägliche Stiftungsleben auf der »Dachebene« mitorganisieren. Bei der klassischen Dachstiftung hingegen kümmern sich die Unterstifter jeweils nur um ihre eigene Unterstiftung. Auch bei der Bürgerstiftung sind Zustiftungen möglich. In dieser Form können z. B. Kreditinstitute, Vereine, Unternehmen oder andere Organisationen die Bürgerstiftung bei der Verwirklichung ihres Stiftungszwecks unterstützen. Sie kann darüber hinaus auch Trägerin einer treuhänderischen Stiftung sein.
Bürgerstiftungen haben wie die anderen rechtsfähigen Stiftungen einen Vorstand, welcher das operative Geschäft organisiert. Außerdem verfügen sie noch über ein Stiftungskuratorium, auch Stiftungsrat genannt. Dieser ist v.a. mit der Kontrolle des Stiftungsvorstands und der strategischen Ausrichtung betraut.
In der Praxis liegen Bürgerstiftungen im Trend. Dies zeigt ein Report von 2021 (https://www.buergerstiftungen.org/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/SAB_ReportBS2021_Faktenblatt_web.pdf, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024). In Deutschland wurden seit 1996 bereits 420 Bürgerstiftungen von 57.000 Ehrenamtlichen, Stifterinnen und Stiftern gegründet. Diese verfügen insgesamt über 503 Mio. EUR Stiftungskapital und seit 1996 eine Fördersumme in Höhe von 21 Mio. EUR. Hinzu kommen Spendeneinnahmen von 173 Mio. EUR seit 1996. Im Jahr 2020 betrug die Fördersumme 19 Mio. EUR und es wurden 17 Mio. EUR gespendet. Außerdem zählt die Statistik 867 Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen. Die Förderung der Bürgerstiftungen lässt sich mit 47 % für Bildung/Erziehung, mit 17 % für Kunst/Kultur, mit 15 % für Soziales, mit 7 % für Gesundheit/Sport und mit 14 % für Anderes unterteilen.
2.6 Ersatz- und Alternativformen der Stiftung
Neben der Stiftung kommen auch Ersatz- und Alternativformen in Betracht. Hier aufgelistet sind beispielhaft der Verein, die Kapitalgesellschaft, die Treuhand, die Schenkung, die Zustiftung sowie der Stiftungsfonds.
2.6.1 Verein
Der rechtsfähige VereinVerein ist in § 21 BGB geregelt. Das Vereinsrecht stellt für die körperschaftliche Organisation die Grundlage für das Recht der juristischen Personen des Privatrechts dar. Der Verein lässt sich aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Umstände von den Personengesellschaften abgrenzen.
Der Verein kann in besondere Vereinsstrukturen untergliedert werden. Darunter fallen der Groß- oder Gesamtverein sowie der Vereinsverband. Der Groß- oder Gesamtverein verfügt über Untergliederungen, die in der Vereinssatzung festgelegt wurden. Diese Untergliederungen lassen sich in die Vereinsform und in unselbstständige Verwaltungseinheiten unterteilen, welche jeweils Teile der Gesamtorganisation darstellen. In dieser Konstellation können sich Vereine auf Landes- oder sogar auf Bundesebene überregional zu einem Gesamtverein zusammenschließen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt mit der DLRG e.V. (Bundesverband) ein Beispiel für einen Gesamtverein dar. Er gliedert sich in 18 Landesverbände mit eigener Rechtsfähigkeit und Satzung, welche mit der Bundessatzung vereinbar sein und vom Präsidium genehmigt werden muss. Dabei verfügen die einzelnen Landesverbände über die gleichen Organe wie auf Bundesebene. Sie haben also eine Landesverbandstagung, einen -rat, einen -vorstand sowie ein Schieds- und Ehrengericht, vereinzelt kommt noch ein Kuratorium dazu. Darüber hinaus bestehen noch Bezirks-, Kreis und Stadtverbände sowie die Ortsgruppen, welche sich um die praktische Arbeit kümmern (Verbandsstruktur | DLRG DLRG Bundesverband, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024).
Dazu zählt auch der Vereinsverband, welcher aus einem Zusammenschluss von Körperschaften besteht. Er kann als »Verein der Vereine« horizontal ausgestaltet sein. Das wohl prominenteste Beispiel für einen Vereinsverband ist der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) mit 21 Landesverbänden, 24.154 Vereinen und insgesamt 7.364.775 Mitglieder (https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/286387-DFB-Statistik_2023_%281%29.pdf, Stand 31.12.2022, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024).
2.6.2 Kapitalgesellschaft
Auch eine KapitalgesellschaftKapitalgesellschaft als Alternativform zur Stiftung kann in Betracht kommen. Kapitalgesellschaften sind anders als Personengesellschaft haftungsbeschränkt. Sie zählen zu den juristischen Personen und lassen sich den Körperschaften zurechnen. Beispiele für eine Kapitalgesellschaft sind die AktiengesellschaftAktiengesellschaft (AG), die Gesellschaft mit beschränkter HaftungGesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die UnternehmergesellschaftUnternehmergesellschaft (UG), die Kommanditgesellschaft auf AktienKommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die eingetragene Genossenschafteingetragene Genossenschaft (eG) sowie die Europäische GesellschaftEuropäische Gesellschaft (SE).
Zu berücksichtigen sind aber auch die unternehmensverbundenen Stiftungen wie die Stiftung & Co. KG (siehe D).
2.6.3 Treuhand
Auch die Treuhandschaft kann eine Alternative zur Stiftung darstellen. Darunter ist ein Rechtsverhältnis zu verstehen, bei dem eine natürliche oder juristische Person (Treugeber) einer anderen Person (TreuhänderTreuhänder) ein Recht überträgt. Diese Übertragung erfolgt unter der Bedingung, dass dieses Recht nicht zum eigenen Vorteil genutzt wird (Treuhandschaft • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024). Es handelt sich also um ein Auseinanderfallen von dem wirtschaftlichen Dürfen und dem rechtlichen Können.
Es empfiehlt sich, als Treuhänder eine vertrauenswürdige Person mit Sachkunde auszuwählen. Dieser ist verpflichtet, die ihm übertragenen Aufgaben zuverlässig und ohne eigenen Nutzen auszuführen. Darüber hinaus ist er zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies betrifft v.a. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ein Treuhänder muss keine spezielle Ausbildung durchlaufen haben oder über fachspezifische Kenntnisse verfügen, allerdings sollte er sich mit der von ihm zu betreuenden Sache gut auskennen.
Im Rahmen des Treuhandverhältnisses lässt sich die rechtsgeschäftliche von der gesetzlichen Treuhand unterscheiden. Das TreuhandverhältnisTreuhandverhältnis ist v. a. im Zivilrecht sehr ausgeprägt, aber auch im öffentlichen Recht (z. B. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) oder im Strafrecht (z. B. § 266 StGB) ist es vertreten. Die Sicherungsübereignung stellt ein Treuhandverhältnis mit großer Praxisrelevanz dar, auch Sicherungstreuhand und eigennützige Treuhand.
Eine treuhänderische Beteiligung an Personengesellschaftsanteilen ist trotz mangelnder gesetzlicher Regelung in Form einer mittelbaren Unternehmensbeteiligung möglich.
2.6.4 Schenkung unter Auflagen
Eine SchenkungSchenkung ist gemäß § 516 BGB eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Auch eine Schenkung kann wie jedes andere Rechtsgeschäft auch unter eine auflösende oder aufschiebende Bedingung gestellt werden. Diese Schenkung unter Auflagen ist in den §§ 525 ff. BGB geregelt. Sie stellt eine gewöhnliche Schenkung im Sinne des § 516 BGB dar, enthält allerdings eine vertragliche Nebenabrede, wonach auch der Beschenkte eine Leistung erbringen muss, wenn er den Schenkungsgegenstand haben möchte. Auch hier ist der Formzwang des § 518 Abs. 1 BGB, also die notarielle Beurkundung des SchenkungsversprechenSchenkungsversprechens, einschlägig und erstreckt sich auch auf die Form der Auflage.
Der Beschenkte übernimmt durch die Vereinbarung einer Auflage ein eigenes Leistungsrecht gegenüber dem Schenker. Dabei kann ein Tun oder Unterlassen Gegenstand der Leistungspflicht sein. In Betracht kommt z. B. die Errichtung einer Stiftung als Auflage (Muscheler, ZEV 2018, 187 (190)). Wird ein Hofgrundstück übertragen, kommt es vor, dass der Übergeber sich ein Wohnrecht oder die Versorgung durch den Übernehmer vorbehält. Dies stellt keine Gegenleistung für die Schenkung dar, sondern eine aus dem zugewendeten Vermögen zu leistende Auflage (BGH, Urt. v. 7.4.1989 – V ZR 252/87, NJW 1989, 2122 (2123)).
Muss der Beschenkte hingegen bereits bestehende gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Einschränkungen des Schenkungsgegenstandes hinnehmen, stellt dies keine Auflage dar, sondern eine Verpflichtung, die er infolge des Erwerbs sowieso erhalten hätte. Außerdem kann die Auflage auch darin bestehen, dass die Leistung an einen Dritten erbracht wird. In dieser Konstellation handelt es sich um einen Vertrag zugunsten Dritter. Wird diese Auflage nicht vollzogen, kann der Schenker gemäß § 527 Abs. 2 BGB nicht die Rückgewähr des Geschenks verlangen.
In Betracht kommt zunächst ein Widerrufsvorbehalt, auch Potestativbedingung genannt. Dies ist z. B. der Fall bei der Übertragung von Grundbesitz. Ein solcher Widerrufsvorbehalt kann aber auch in der Konstellation eines Rückforderungsrechts ausgestaltet sein.
Hierbei gilt es den benannten und den unbenannten Widerrufsvorbehalt zu unterscheiden. Der benannte Widerrufsvorbehalt ist für den Eintritt einer bestimmten Situation gedacht, z. B. eine Schenkung unter Eheleuten mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall einer Scheidung oder eine Schenkung an Abkömmlinge im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge mit einem Widerrufsvorbehalt, falls bei einer etwaigen Eheschließung keine Gütertrennung vereinbart wird. Darüber hinaus ist auch der unbenannte, also uneingeschränkt gültige Widerrufsvorbehalt zulässig.
2.6.5 Zustiftung
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das Stiftungsvermögen durch eine ZustiftungZustiftungen aufzustocken. Dies geschieht im Wege einer Zuwendung, die demjenigen Teil des Stiftungsvermögens zugeordnet wird, welcher dauerhaft erhalten bleibt. Auch eine Zustiftung stellt eine besondere Form der Schenkung dar und muss die Form des § 518 Abs. 1 BGB einhalten (ausführlich zur Zustiftung siehe auch C.1.2.5.2 und C.10.1.5.2).
2.6.6 Dachstiftung und Stiftungsfonds
Die Bündelung mehrerer Stiftungsmotive ist durch Stiftungsfonds oder Dachstiftungen möglich.
Ein Stiftungsfonds wird durch die Zuwendungen Dritter an eine bestehende Stiftung getragen. Diese erhalten dafür Vorschlags- und Kontrollrechte hinsichtlich der zu fördernden Projekte. Sie kommt in der Praxis häufig in Form einer unselbstständigen Stiftung vor. Die Zuwendungen sind in der Praxis häufig Geldleistungen, es können aber auch andere Vermögensgegenstände wie Immobilien oder Wertpapiere in Stiftungsfonds eingebracht werden.
Dachstiftungen und Stiftungszentren sind Phänomene der Rechtswirklichkeit und unterstützen Stiftungen bei der Mittelverwaltung und -verwendung mit bestimmten Dienstleistungen und Beratung bei Aufgaben des Stiftungsmanagements.
Dachstiftungen werden für unselbstständige Stiftungen als Dienstleister tätig und stellen die dauerhafte und erforderliche Organisationsform der Stiftung sicher.
Auch für selbständige Stiftungen kann eine Dachstiftung von Vorteil sein, da diese die Verwaltung kostengünstig übernehmen kann.
Stiftungszenten werden häufig als GmbH oder als Verein tätig.
Es wird zwischen Dachstiftungen, die rechtsfähige Stiftungen sind, sowie Stiftungszentren in anderer Rechtsform unterschieden.
Kundenstiftungen nehmen dabei als rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Stiftung die Dienstleistung eines Stiftungszentrums als ihre Kunden in Anspruch. Die Unterstiftung steht dagegen unter dem Dach einer Dachstiftung und je nach Ausgestaltung zu dieser in einem bestimmten engeren Organisationsverhältnis. Dies gilt auch für nicht rechtsfähige Kundenstiftungen, wenn das Stiftungszentrum selbst ihr Träger sein sollte.
Beispiele:
Die wohl bekannteste Dachstiftung ist die „Dachstiftung Diakonie“. Sie ist ein modernes diakonisches Unternehmen und hat mehr als 5.000 Beschäftigte in verschiedenen Berufen, dazu zählen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese Dachstiftung setzt sich in den Bereichen Altenpflege, Eingliederungshilfe und Rehabilitation sowie Bildung und Ausbildung und vieles mehr für Menschen ein. Sie fungiert regelmäßig als Ansprechpartnerin und Beraterin für In-Not-Geratene und Hilfesuchende (Die Dachstiftung Diakonie | Dachstiftung Diakonie (dachstiftung-diakonie.de, zuletzt aufgerufen am 18.03.2024).
Das Deutsche Stiftungszentrum (DSZ) ist ein Dienstleistungszentrum des Stifterverbandes, welcher seit 1920 die Gemeinschaftsinitiative von Unternehmen und Stiftungen fördert, für Stifter und Stiftungen. Es verfügt über 670 Stiftungen und betreut Stifter im Bereich der Errichtung von Stiftungen sowie bei der Verwirklichung der Aufgaben von gemeinnützigen und mildtätigen Stiftungen.
2.7 Ausländische Rechtstypen
Auch ausländische RechtsordnungenRechtstypen, ausländische kennen die Rechtsform der Stiftung, jeweils in unterschiedlicher Ausprägung. Zum Überblick werden die Stiftung nach liechtensteinischem Recht, österreichischem Recht und nach schweizerischem Recht sowie Trusts dargestellt.
2.7.1 Stiftung nach liechtensteinischem Recht
Eine Stiftung nach liechtensteinischem RechtRechtstypen, ausländische, Stiftung nach liechtensteinischem Recht stellt zunächst einmal ein verselbstständigtes Zweckvermögen dar. Sie ist darüber hinaus eine juristische Person im Sinne des BGB und verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird wie in Deutschland auch durch eine einseitige Willenserklärung des Stifters errichtet.
Auch hier kann dem Grunde nach jeder Zweck, der nicht gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstößt, einen Stiftungszweck darstellen. Selbstzweckstiftungen, die nur das Ziel verfolgen, das Stiftungsvermögen zu erhalten und zu vermehren, beinhalten jedoch keinen geeigneten Stiftungszweck.
In der Praxis ist v. a. die Familienstiftung sowie die gemeinnützigen Stiftungen sehr beliebt. Bei der Gründung ist wie in Deutschland auch zwischen der Stiftung unter Lebenden und der Stiftung von Todes wegen zu unterscheiden (ausführlich zur Stiftung nach liechtensteinischem Recht siehe H.2).
2.7.2 Stiftung nach österreichischem Recht
Auch die Bundesrepublik ÖsterreichRechtstypen, ausländische, Stiftung nach österreichischem Recht kennt Privatstiftungen, welche eine eigenständige Organisation darstellen. Privatstiftungen verfolgen das Ziel, den Stiftungszweck zu verwirklichen, und verwenden dafür das gewidmete Vermögen. Vor allem Familienstiftungen sind in Österreich sehr beliebt. Daneben bestehen aber auch rund 10 % gemeinnützige Stiftungen, die sich für Zwecke der Allgemeinheit einsetzen (ausführlich zur Stiftung nach österreichischem Recht siehe H.3).
2.7.3 Stiftung nach schweizerischem Recht
In der SchweizRechtstypen, ausländische, Stiftung nach schweizerischem Recht sind privatrechtliche Stiftungen weit verbreitet, v. a. werden die Familienstiftung, die kirchliche Stiftung und die Personalfürsorgestiftung als rechtliche Sonderformen häufig errichtet. Auch hier gilt der Grundsatz der Stifterfreiheit wie im deutschen Recht auch. Jeder kann also bei der Errichtung einer Stiftung frei wählen, in welcher Form diese ausgestaltet werden soll, welchen Zweck sie verfolgen soll sowie den Umgang mit dem gewidmeten Vermögen und die Organisation innerhalb der Stiftung (ausführlich zur Stiftung nach schweizerischem Recht siehe H.1).
2.7.4 Trusts
Unter dem Begriff »TrustTrusts« ist ein Treuhandverhältnis im anglo-amerikanischen Rechtskreis zu verstehen. Dabei hält der Trustee ihm übertragene Vermögensgegenstände in eigenem Namen im Eigentum. Er ist dazu jedoch nur berechtigt, wenn er diese nur zugunsten eines begünstigten Dritten verwaltet und ausübt.
In der Praxis kommt ein Trust v. a. in der Nachlassplanung zum Einsatz. Der Investor kann einen Trust zu Lebzeiten errichten oder durch ein Testament im Zeitpunkt des Todes des Erblassers (ausführlich zu Trusts siehe H.4).
Quellen
Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts:
BeckOK BGB, § 80 Rn. 1–2.1 – beck-online
BeckOK BGB, § 80 Rn. 12–22 – beck-online
Richter, Stiftungsrecht, § 4 Die Entstehung der Stiftung Rn. 1–159 – beck-online
Familienstiftung:
Stiftungsrecht nach der Reform | Rn. 49–53 – beck-online
BeckOGK, BGB § 80 Rn. 558–562.3 – beck-online
Stiftung öffentlichen Rechts:
BeckOGK, BGB § 89 Rn. 30, 30.1 – beck-online
Stiftungsrecht nach der Reform, Rn. 41–45 – beck-online
Richter, Stiftungsrecht, § 13 Stiftungen des öffentlichen Rechts Rn. 1–82 – beck-online
Kommunale Stiftung:
Empfehlungen-Verwaltung-kommunaler-Stiftungen.pdf
Schauhoff/Mehren, Stiftungsrecht nach der Reform | Rn. 49–53 – beck-online
Kirchliche Stiftungen:
MüKoBGB, § 80 Rn. 160–166 – beck-online
BT-Drs. 19/28173 (bundestag.de), 47, 80
MüKoBGB, § 80 Rn. 167, 168 – beck-online
Bürgerstiftung:
BeckOGK, BGB § 80 Rn. 567, 568 – beck-online
ZEV 2020, 529 – beck-online
BeckOGK, BGB § 80 Rn. 3–7 – beck-online
Scheerbarth/Coenen/Krengel, Stiftungen, § 1 Einführung Rn. 35–37 – beck-online
Was ist eine Bürgerstiftung? | Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands (buergerstiftungen.org) SAB_ReportBS2021_Faktenblatt_web.pdf (buergerstiftungen.org)
Verein:
BeckOK BGB, § 21 Rn. 1–133 – beck-online
npoR 2020, 186 – beck-online
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/286387-DFB-Statistik_2023_%281%29.pdf, Stand 31.12.2022, zuletzt abgerufen am 18.03.2024.
Verbandsstruktur | DLRG DLRG Bundesverband
Kapitalgesellschaft:
Kapitalgesellschaften >> Definition, Erklärung & Beispiele + Übungsfragen (bwl-lexikon.de)
Treuhand:
Treuhandschaft • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
MüKoHGB, § 105 Rn. 384 – beck-online
Treuhänder – Bedeutung, Definition und Aufgaben (juraforum.de)
JuS 2022, 204 – beck-online
Schenkung unter Auflagen:
MüKoBGB, § 516 Rn. 13 – beck-online
MüKoBGB, § 525 Rn. 1 – beck-online
BeckOGK, BGB § 525 Rn. 5–8 – beck-online
ZEV 2018, 187 – beck-online
NJW 1989, 2122 – beck-online
Stiftungsfonds:
MüKoBGB, § 80 Rn. 302 – beck-online
MVHdB VI BürgerlR II, Form. XV. 8. Anm. 1, 2 – beck-online
Winheller/Geibel/Jachmann-Michel, Gesamtes Gemeinnützigkeitsrecht, Teil 1 3. 3.2 Stiftungen Rn. 1–122 – beck-online
Richter, Stiftungsrecht, § 17 Die unselbständige Stiftung Rn. 1–163 – beck-online
Trusts:
Wegen/Spahlinger/Barth, GesR Ausland, USA – Allgemeiner Teil Rn. 26–30 – beck-online
3 Geschichte der Stiftung
Wer heute stiftet, reiht sich ein in eine Tradition des Stiftungswesens, die bis in die Antike zurückreicht.
3.1 Antike
Der Begriff »Stiftung« leitet sich in der deutschen Sprache von dem althochdeutschen Wort »stiftungha« ab, das die Tätigkeit des Bauens, Gründens, Schaffens Veranlassens, Anstiftens und Schenkens beschreibt.
Der Stiftungsgedanke begleitet die Menschheit in unterschiedlichen Ausprägungen und unter unterschiedlichen Begriffen, seit sich Gesellschaften und Kulturen gebildet hatten. Totengedenken und Gottesverehrung führten bereits »im alten Ägypten« zu dauerhaft angelegten Rechtsgebilden, die heutigen Stiftungen nahekommen. Die griechisch-römische Antike genauso wie die frühe islamische Welt kannte unselbständige Treuhandgestaltungen, die einem dauerhaften religiösen Zweck dienen sollten.
Doch bereits in der Antike war der StiftungsgedankeStiftungsgedanke in der Antike so weit entwickelt, dass das Konzept Stiftung auch zur Förderung nicht rein religiöser Zwecke diente: Platon erwarb um 388 v. Chr. einen Olivenhain vor den Toren Athens, auf dem er seine Akademie errichtete. Damit seine Schule erhalten bleiben konnte, widmete PlatonPlaton das Grundstück auch über seinen Tod hinaus der Beherbergung seiner Akademie. Im ersten mithtridatischen Krieg eroberte im Jahr 86 v. Chr. ein römisches Heer unter dem Feldherrn Sulla Athen und zerstörte die Akademie. Die Neuplatoniker errichteten im 5. Jahrhundert n. Chr. noch einmal ein bedeutendes philosophisches Zentrum in Athen. Der Gründer der neoplatonischen Akademie, Plutarch von Athen, stellte der Akademie wiederum eine eigene Immobilie zur Verfügung, die er nach seinem Tod dem dauerhaften Weiterbetrieb der Akademie widmete.
Eigen war allen antiken Stiftungsvorläufern, dass es sich um Treuhandgestaltungen handelte, also nicht um Stiftungen im heutigen Sinn als rechtsfähige juristische Personen, die die Rechtsordnung als Träger ihres eigenen Vermögens anerkennt. Der Stifter behalf sich regelmäßig mit rituellen Verfluchungen gegenüber dem Stiftungstreuhänder, sollte dieser das ihm übertragene Vermögen veruntreuen.
3.2 Christentum und Kirche
Die ersten rechtsfähigen StiftungenStiftungen im Christentum als Träger eigenen Vermögens brachte die christliche Spätantike hervor, indem die Widmung eines Vermögens zur Förderung einer bestimmten Kirchengemeinde, eines Kirchengebäudes oder zur Förderung des Gebetes für lebende und verstorbene Angehörige einer Familie als dauerhafte rechtliche Einrichtung anerkannt wurde.
Die Kirchenväter fordern den Christen dazu auf, Christus wie einem eigenen Abkömmling Vermögen von Todes wegen zu vermachen. Die Lehre vom »Sohnesteil Christi« führte dazu, dass vermögende Christen testamentarisch Teile ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spendeten, um so die Armen zu unterstützen und dem Seelenheil des Stifters zu dienen (donatio pro salute animae). So baute die Kirche über Jahrhunderte Vermögen auf, mit welchem sie Klöster, Kirchen und Altenheime betreiben und finanzieren konnte. Im Mittelalter wird von »einer Blüte des Stiftungswesens« gesprochen, auch wenn die Rechtsform der Stiftung als solche noch nicht existierte.
Der christlichen Spätantike verdankt auch die administrative Stiftungsaufsicht ihre »Entdeckung«. Die Gesetzgebung Kaiser JustinianKaiser Justinians unterstellte diese frühen kirchlichen Stiftungen der Aufsicht und Kontrolle des jeweiligen Ortsbischofs. Ebenfalls erstmals ausdrücklich schriftlich fixiert hat Kaiser Justinian auch die Steuerbefreiung kirchlicher Stiftungen (Codex Iuris, 1,2,22).
Die älteste deutsche Stiftung, die bis heute noch besteht, ist die Hospitalstiftung in Wemding in Bayern. Sie wurde vor dem Jahr 917 n. Chr. als Hospital für Kranke und Reisende (hospitium) gegründet. Der Gedanke war so attraktiv, dass sich »Pfründner« quasi durch Zustiftungen einkauften, indem sie dem Hospital ihr Vermögen von Todes wegen vermachten, wenn sie dafür in Alter und Krankheit bis zum Tod dort gepflegt würden. Dadurch hat die Hospitalstiftung Wemding im Laufe der Zeit ausreichend Vermögen erworben, um dauerhaft fortbestehen zu können. Die Stiftung hat das Vermögen nachhaltig und langfristig orientiert investiert. Sie ist heute aufgrund ihres Forstbesitzes vor Wirtschaftskrisen und Inflation geschützt.
Das Stadtwesen führte ab dem Hochmittelalter dazu, dass die Betreuung von Hospitälern, Armenstiften usw. in die Hand weltlicher Bruderschaften überging.
3.3 Absolutismus und Aufklärung
Die Verwaltung von Stiftungen durch nicht-kirchliche Stellen gewann in der frühen Neuzeit erheblich an Bedeutung. Gleichzeitig begann der sich nach und nach formierende Staat, sich wohltätigen Belangen zu widmen. Insbesondere im Bereich der Armenfürsorge traten die Verwaltungen der Fürsten und Patrizier in Konkurrenz zu den weltlich und kirchlich verwalteten Stiftungen. Erste Stiftungen finanzierten und unterstützten nun auch den Bau von Straßen und Brücken. Der frühe Staat strebte nach Machtkonzentration, die Vermögen der Stiftungen unter seine Kontrolle zu bringen, war ein wichtiges Anliegen. Die 1415 veröffentlichte Sammlung des Stadtrechts der Stadt Florenz, die Statutensammlung, ordnete die Verwaltung sämtlicher Stiftungen durch die Stadt an. Selbstverständlich beinhaltete diese Verwaltung auch die Kontrolle der Einnahmen der Stiftungen.
Die Reformation selbst ließ die meisten Stiftungen in den reformierten Gebieten unberührt. Diese Stiftungen wurden nun als protestantische Stiftungen fortgeführt. Der Augsburger Reichs- und ReligionsfriedeAugsburger Reichs- und Religionsfrieden hatte den Landesherrn auch bischöfliche Rechte (iura episcopalia) übertragen, in deren Rahmen die Landesherren fortan die kirchlichen Stiftungen ihres Gebiets kontrollieren konnten.
Der staatliche Allmachtsanspruch des AbsolutismusAbsolutismus und das Zeitalter der AufklärungAufklärung bedeuteten für das Stiftungswesen stattdessen einen Einschnitt. Allgemein bekannt sind die Aufhebung von Klöstern und die Verstaatlichung von Kirchenvermögen durch die Französische Revolution sowie durch die Reformen Kaiser Josephs II. im ausgehenden 18. Jahrhundert in Österreich. Gemein war sämtlichen gegen die Stiftungen gerichteten Bestrebungen eine kirchenfeindliche Stellung, die die Verwaltung weltlichen Vermögens durch die »tote Hand« ablehnte (Ogris, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Art. Tote Hand, Bd. 5, 1998, Sp. 281). Dies führte zu einer »Verweltlichung« der Stiftungen, welche auch durch die Aufklärung verstärkt wurde. Das allgemeine Landrecht für preußische Staaten gab dem Staat die Möglichkeit, Stiftungen nach seinen eigenen Richtlinien aufzulösen sowie die »Oberaufsicht« über die bestehenden Stiftungen (ALR II 19 § 17).
3.4 Fortentwicklung des Stiftungswesens im 19. Jahrhundert
Ausgehend vom Bildungs- und Erziehungsideal entstanden ab dem 18. Jahrhundert viele neue Stiftungen, die die Förderung von Bildung und Kultur bezweckten.
Der Frankfurter Händler und Bankier Johann Friedrich Städel (1728–1816) war kunstbegeistert. Er sammelte bereits seit den 1760er-Jahren Gemälde, Zeichnungen und Drucke und häufte so eine beträchtliche Kunstsammlung aus etwa 500 Gemälden und 2.000 Drucken an. Städel war zeitlebens Junggeselle und kinderlos geblieben. Für die Verwendung dieser Sammlung hatte er folgende Pläne für die Zeit nach seinem Ableben: »Meine Sammlung von Gemälden, Handzeichnungen, Kupferstichen und Kunstsachen, sammt dazu gehörigen Büchern, soll die Grundlage eines zum Besten hiesiger Stadt und Bürgerschaft hiermit von mir gestiftet werdenden Städelschen Kunstinstituts sein. Diese Städelsche Kunstinstitut setze ich zu meinem Universal-Erben in meinen gesammten dereinstigen Nachlaß an beweglichem und unbeweglichem Vermögen […] ein« (Stiftungs-Brief des Städelschen Kunst-Instituts, enthalten in dem Testament des … Herrn Johann Friedrich Städel hiesigen Handelsmanns und gewesenen Mitglieds löbl. Bürgercolleges (http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-1412802, zuletzt abgerufen am 18.03.2024).
Städel bemühte sich zu Lebzeiten um eine staatliche Genehmigung für sein Stiftungsvorhaben, die er durch den Großherzog von Frankfurt Karl Theodor von Dalberg 1811 auch erhielt. Die Genehmigung fiel in eine politisch und administrativ unruhige Zeit. Das Großherzogtum Frankfurt bestand nicht lange. Der durch den Großherzog 1811 eingeführte napoleonische Code Civil wurde als Quelle des bürgerlichen Rechts alsbald wieder abgeschafft. Städels Erbe war neben der Kunstsammlung so beträchtlich, dass entfernte Verwandte sich bemühten, das Testament anzufechten, um einen Anteil am Nachlass nach gesetzlichem Erbrecht zu erstreiten. Sie bestritten die Wirksamkeit der Genehmigung der Stiftung und in der Folge auch, dass eine noch nicht existente, weil noch nicht genehmigte Stiftung Erbe sein könne.
Ein langer Rechtsstreit führte schließlich einerseits zur Anerkennung der Erbfähigkeit einer noch nicht errichteten Stiftung. Das war die Grundlage für den sogenannten Städel-Paragrafen im späteren BGB (§ 80 Abs. 2 S. 2 BGB). Andererseits führte der Rechtstreit auch zur Klarheit darüber, dass eine Stiftung auch andere als religiöse Zwecke haben kann.
3.5 Die Stiftung im liberalen Rechtsstaat
Stiftung im liberalen RechtsstaatKrieg, Inflation, Sozialismus und Diktaturen brachten in Deutschland bis 1945 bzw. bis 1990 noch einmal das Aus für viele bis dahin blühende Stiftungen.
Andererseits entwickelten sich in Deutschland unter der Geltung des Grundgesetzes zahlreiche neue Stiftungen, und man kann heutzutage von einer Blüte des Stiftungswesen sprechen. Dazu beigetragen haben Rechtssicherheit und wirtschaftliche Prosperität in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Stiftungen haben sich so zu einer bedeutenden Komponente bürgerlichen Engagements in der Gesellschaft entwickeln können.
Gleichzeitig hat die vorletzte Stiftungsrechtsreform im Jahr 2002 klargestellt, dass rechtsfähige Stiftungen nicht zwingend einen gemeinnützigen Zweck verfolgen müssen, sondern auch privatnützig sein können, wenn sie gleichzeitig »gemeinwohlkonform« sind. Das hat dem Einsatz der Stiftung für die private und unternehmerische Nachfolgeplanung Auftrieb gegeben.
Zum 1.7.2023 ist die jüngste Reform des Stiftungsrechts in Kraft getreten. Die Reform zielt v. a. auf eine Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts ab, das in der Bundesrepublik Deutschland bis dahin durch die seit 1950 erlassenen Landesstiftungsgesetze neben dem BGB stark zersplittert war.
Quellen
Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kapitel 1: Einleitung Rn. 4–6 – beck-online
Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kapitel 1: Einleitung Rn. 7–10 – beck-online
Das Städel, Städel Museum (staedelmuseum.de)
Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kapitel 1: Einleitung Rn. 18 – beck-online
Teil B Von der Stiftungsidee zum Stiftungsprojekt
Anders als die Gründung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft erfordert die Errichtung einer Stiftung mehr Vorbereitungszeit. Das gilt gleichermaßen für die gemeinnützige Stiftung wie für die privatnützige Stiftung (z. B. die Familienstiftung). Zunächst muss sich der Stifter im Klaren sein, welchen Zweck er fördern möchte, welche Mittel er dazu zur Verfügung stellt und wer die Tätigkeit der Stiftung im Alltag leiten soll. In einem zweiten Schritt muss der Stifter die Details zur Umsetzung seines Projekts festlegen.
1 Die Stiftungsidee
ZweckStiftungszweck, Stiftungsvermögen und Stiftungsorganisation bilden gemeinsam die drei konstitutiven Elemente der Stiftung. Die allerersten GedankenStiftungsidee des Stifters werden also notwendigerweise um diese drei Aspekte kreisen müssen.
Der Stifter muss alle drei Aspekte bedenken und später im Stiftungsgeschäft auch genau ausformulieren können. Was will ich mit der Stiftung erreichen? – Das ist die grundlegende Frage für jeden Stifter. Diese Überlegungen fließen v. a. in die Definition des Stiftungszwecks ein. Er bildet die »Seele der Stiftung« (so v. Werthern, Unternehmensverfassungsrecht und Stiftung, Ordnungspolitische Gesichtspunkte einer Neuregelung unter besonderer Berücksichtigung des Stiftungsunternehmens, 1996, 110).





























