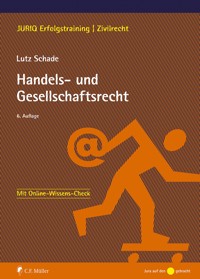
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt: Das Skript behandelt die im Pflichtfachstudium relevanten Grundlagen und Prüfungsschwerpunkte des Handels- und des Gesellschaftsrechts. Der Vermittlung wiederkehrender Grundprinzipien beider Rechtsgebiete gilt ein besonderes Augenmerk, da hierdurch das Verständnis einzelner Regelungen und der Rechtsprechung erleichtert wird. Die Neuerungen durch das MoPeG und KöMoG sind eingearbeitet. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: - Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; - begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; - im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; - Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; - Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; - ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Handels- und Gesellschaftsrecht
von
Lutz SchadeRechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Köln
6., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9078-9
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2024 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
•
ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout
•
optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und
•
wiederkehrende Symbole am Rand
[Bild vergrößern]
[Bild vergrößern]
[Bild vergrößern]
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre Kenntnisse im Handels- und Gesellschaftsrecht!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht. Das Handels- und Gesellschaftsrecht gehört zu den Rechtsgebieten, die in weiten Teilen durch richterliche oder rechtswissenschaftliche Rechtsfortbildung geprägt sind. Insbesondere im Kapitalgesellschaftsrecht lassen sich Falllösungen nur noch eingeschränkt anhand der gesetzlichen Bestimmungen entwickeln. Daher werden im Skript neben den teils neuen gesetzlichen Grundlagen auch die Ansichten der Rechtsprechung und der Wissenschaft dargestellt. Berücksichtigt und erläutert sind schließlich die ab dem 1.1.2024 geltenden Neuregelungen gemäß Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Herrn Rechtsanwalt Philipp Decker danke ich für seine Mitarbeit am Skript und den regen Austausch zu den neuen Normen.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser unter [email protected].
Köln, im April 2024
Lutz Schade
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müller mit Online-Wissens-Check
[Bild vergrößern]
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Littenstraße 11, 10179 Berlin zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilHandelsrecht
A.Systematik und Zweck des Handelsrechts1 – 6
I.Handelsrecht als Sonderprivatrecht1, 2
II.Kodifikation3, 4
III.Zur Geschichte des Handelsgesetzbuches5
IV.Die Handelsgerichtsbarkeit6
B.Handelsstand7 – 164
I.Handelsrecht und Unternehmensrecht7 – 9
1.Subjektive Anknüpfung des Kaufmannsbegriffs7
2.Unternehmensbezogener Kaufmannsbegriff8, 9
II.Der Kaufmann10 – 45
1.Der Kaufmann kraft Gewerbebetrieb, § 1 HGB11 – 26
a)Das Gewerbe13 – 21
b)Der Betrieb22
c)Das Handelsgewerbe23
d)Die Eintragung im Handelsregister24
e)Übungsfall Nr. 125, 26
2.Der Kaufmann kraft Eintragung, § 2 HGB27, 28
3.Land- und Forstwirte, § 3 HGB29 – 31
4.Der Fiktivkaufmann, § 5 HGB32 – 35
5.Übungsfall Nr. 236, 37
6.Der Formkaufmann, § 6 HGB38
7.Der Scheinkaufmann39 – 45
a)Die Lehre vom Rechtsschein41 – 44
b)Rechtsfolgen45
III.Die Firma46 – 89
1.Firmenbegriff46 – 49
a)Die Firma des Kaufmanns46
b)Die Firma bei Handelsgesellschaften47
c)Die Geschäftsbezeichnung48
d)Die Marke49
2.Firmenbildung50 – 61
a)Bestandteile der Firma50 – 55
b)Die Firmengrundsätze56 – 61
3.Firmenschutz62 – 66
a)Schutz der Firma durch das Registergericht62
b)Schutz der Firma durch den Firmeninhaber63, 64
c)Übungsfall Nr. 365, 66
4.Firmenfortführung67 – 89
a)Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung, § 25 HGB68 – 77
b)Haftung bei Firmenfortführung durch den Erben, § 27 HGB78 – 83
c)Eintritt in das Geschäft eines Einzelkaufmanns, § 28 HGB84 – 89
IV.Das Handelsregister90 – 106
1.Anmeldung und Eintragung92 – 97
a)Das Verfahren der Anmeldung92
b)Die anzumeldenden Tatsachen93, 94
c)Prüfung durch das Registergericht95
d)Eintragung und Bekanntmachung96, 97
2.Die Publizität des Handelsregisters98 – 106
a)Die negative Publizität99 – 102
b)Die positive Publizität103, 104
c)Wirkung eingetragener und bekanntgemachter Tatsachen105
d)Sonderregelung im Insolvenzrecht106
V.Die kaufmännischen Hilfspersonen107 – 164
1.Überblick107, 108
2.Unselbstständige kaufmännische Hilfspersonen109 – 129
a)Prokura109 – 119
b)Die Handlungsvollmacht120 – 127
c)Ladenangestellte128, 129
3.Selbstständige kaufmännische Hilfspersonen130 – 164
a)Abschlussbevollmächtigte, § 55 HGB130
b)Vermittlungsbevollmächtigte, § 75g HGB131
c)Handelsvertreter, § 84 HGB132 – 143
d)Handelsmakler144 – 151
e)Vertragshändler152
f)Franchisenehmer153
g)Kommissionär154 – 164
C.Handelsgeschäfte165 – 199
I.Begriff des Handelsgeschäfts165 – 168
1.Kaufmannseigenschaft167
2.Rechtsgeschäft des Handelsgewerbes168
II.Handelsbräuche169
III.Das Kaufmännische Bestätigungsschreiben170 – 180
1.Begriff170 – 172
2.Voraussetzungen und Rechtsfolge173
3.Funktionen174 – 180
a)Beweisfunktion175
b)Modifikationsfunktion176
c)Abschlussfunktion177
d)Anfechtbarkeit178
e)Geltung im nichtkaufmännischen Verkehr179
f)Sich kreuzende Bestätigungsschreiben180
IV.Schweigen auf Anträge181 – 183
1.Begriff181
2.Voraussetzungen und Rechtsfolgen182, 183
V.Der Handelskauf, §§ 373 ff. HGB184 – 194
1.Allgemeines184 – 186
2.Sachmängelrecht187 – 191
a)Untersuchung und Mängelrüge187 – 190
b)Die Rechtsfolge191
3.Hinterlegung bei Verzug192
4.Fixgeschäft193
5.Spezifikationskauf194
VI.Handelsrechtlicher Sorgfaltsmaßstab195
VII.Gutgläubiger Erwerb im Handelsrecht196, 197
VIII.Überblick über weitere Einzelregelungen198, 199
2. TeilGesellschaftsrecht
A.Einführung200 – 216
I.Das Gesellschaftsrecht in der Rechtsordnung200 – 203
II.Die Ordnung des Gesellschaftsrechts204 – 215
1.Die Rechtsquellen des Gesellschaftsrechts204
2.Unterscheidung zwischen Gesamthand und juristischer Person205 – 207
3.Unterscheidung zwischen Personengesellschaft und Körperschaft208 – 212
a)Die Personengesellschaften im Einzelnen211
b)Die Körperschaften im Einzelnen212
4.Die Typik und die Auswirkungen der Unterscheidung213 – 215
III.Die Wahl der Rechtsform216
B.Allgemeines Gesellschaftsrecht217 – 257
I.Die Gründung der Gesellschaft217 – 227
1.Der Gesellschaftsvertrag217 – 223
a)Die Parteien des Gesellschaftsvertrages218 – 220
b)Die Form des Gesellschaftsvertrages221
c)Die Anwendbarkeit allgemeiner Vorschriften222
d)Entstehung in anderer Weise223
2.Der Gesellschaftszweck224, 225
3.Die Beitragspflicht226
4.Die gesellschafterliche Treuepflicht227
II.Die Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft228 – 240
1.Der Zweck der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft229
2.Die Voraussetzungen für die Anwendung230 – 240
a)Vorliegen eines fehlerhaften Gesellschaftsvertrages231
b)Invollzugsetzung der Gesellschaft232
c)Keine entgegenstehenden überwiegenden Individual- oder Allgemeininteressen233
d)Rechtsfolgen234 – 240
III.Die Scheingesellschaft241, 242
IV.Die Treuhand243 – 245
1.Der Zweck der Treuhand243
2.Die Ausgestaltung der Treuhand244
3.Treuhänder und Treugeber245
V.Die innere Organisation der Gesellschaft246 – 250
1.Die Grundlagengeschäfte246
2.Sozialansprüche und Sozialverbindlichkeiten247, 248
3.Die actio pro socio249, 250
VI.Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft251 – 256
1.Eintritt neuer Gesellschafter251
2.Ausscheiden von Gesellschaftern252
3.Die Vererbung von Gesellschaftsanteilen253 – 256
a)Die Fortsetzungsklausel254
b)Die einfache Nachfolgeklausel255
c)Die qualifizierte Nachfolgeklausel256
VII.Die Auflösung der Gesellschaft257
C.Besonderes Gesellschaftsrecht258 – 639
I.Die Personengesellschaften258 – 436
1.Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts258 – 315
a)Grundlagen und Erscheinungsformen258 – 264
b)Rechtsfähigkeit265 – 277
c)Entstehung278
d)Name der GbR279
e)Geschäftsführung und Vertretung280, 281
f)Rechte und Pflichten der Gesellschafter282 – 289
g)Die Haftung der Gesellschaft290, 291
h)Die Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der GbR292 – 305
i)Gesellschafterwechsel und Gesellschafterkündigung306 – 314
j)Beendigung der Gesellschaft315
2.Die offene Handelsgesellschaft316 – 360
a)Grundlagen und Erscheinungsformen317 – 320
b)Entstehung321 – 328
c)Rechtsfähigkeit329
d)Geschäftsführung330 – 332
e)Die Vertretung333 – 337
f)Rechte und Pflichten der Gesellschafter338 – 343
g)Die Haftung344 – 353
h)Änderungen im Gesellschafterbestand354 – 359
i)Die Beendigung360
3.Die Kommanditgesellschaft361 – 387
a)Grundlagen und Erscheinungsformen362
b)Entstehung363 – 387
4.Die stille Gesellschaft388 – 401
a)Grundlagen und Erscheinungsformen389, 390
b)Entstehung391
c)Rechtsnatur und Abgrenzung392
d)Rechte und Pflichten des Stillen393 – 396
e)Die Haftung des Stillen397
f)Rechte und Pflichten des Inhabers des Handelsgeschäfts398
g)Die Haftung des Inhabers des Handelsgeschäfts399
h)Die Beendigung400, 401
5.Die Partnerschaftsgesellschaft402 – 416
a)Grundlagen und Erscheinungsformen403
b)Entstehung404
c)Geschäftsführung und Vertretung405
d)Gewinn- und Verlustbeteiligung406
e)Haftung407 – 411
f)Änderungen im Partnerbestand412 – 415
g)Beendigung416
6.Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung417 – 436
a)Grundlagen und Erscheinungsformen418
b)Entstehung419
c)Der Gesellschaftszweck420
d)Die Beschlussfassung421
e)Geschäftsführung und Vertretung422
f)Rechte und Pflichten der Mitglieder423 – 431
g)Die Haftung432 – 435
h)Beendigung436
II.Die Körperschaften437 – 639
1.Der Verein437 – 447
a)Grundlagen und Erscheinungsformen437, 438
b)Der nichtwirtschaftliche eingetragene Verein (e. V.)439 – 445
c)Der wirtschaftliche Verein446
d)Der nichtrechtsfähige Verein447
2.Die GmbH448 – 518
a)Grundlagen und Erscheinungsformen449, 450
b)Rechtsfähigkeit451
c)Entstehungsphase452 – 466
d)Inhalt und Form des Gesellschaftsvertrages467 – 475
e)Die Einmann-GmbH476
f)Kapitalaufbringung und -erhaltung477 – 486
g)Organe der GmbH487 – 504
h)Rechte und Pflichten der GmbH-Gesellschafter505 – 508
i)Übertragung von Geschäftsanteilen509 – 512
j)Haftung der Gesellschafter513 – 515
k)Beendigung516 – 518
3.Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)519 – 523
a)Keine eigene Rechtsform519
b)Gründung520
c)Firma521
d)Geschäftsführung und Vertretung522
e)Gewinnrücklage523
4.Die Aktiengesellschaft524 – 575
a)Grundlagen und Erscheinungsformen525
b)Rechtsfähigkeit526
c)Entstehung527 – 533
d)Aktie und Grundkapital534 – 542
e)Organe der AG543 – 562
f)Rechte und Pflichten der Aktionäre563 – 572
g)Beendigung573 – 575
5.Die KGaA576 – 586
a)Grundlagen und Erscheinungsformen576
b)Entstehung577
c)Komplementäre578 – 581
d)Kommanditaktionäre582, 583
e)Aufsichtsrat584
f)Beendigung der Gesellschaft585, 586
6.Die Genossenschaft587 – 603
a)Grundlagen und Erscheinungsformen587 – 590
b)Rechtliche Einordnung591
c)Entstehung592
d)Organe593 – 596
e)Rechte und Pflichten der Mitglieder597 – 601
f)Kleinstgenossenschaften602
g)Europäische Genossenschaft603
7.Die Societas Europaea604 – 617
a)Grundlagen und Erscheinungsformen604
b)Entstehung605 – 610
c)Organe611 – 616
d)Beendigung617
8.Die private limited company by shares618 – 639
a)Grundlagen und Erscheinungsformen618
b)Entstehung619 – 621
c)Satzung622 – 628
d)Companies House629
e)Funktionsweise630 – 635
f)Rechte und Pflichten der Gesellschafter636, 637
g)Zweigniederlassungen638
h)Beendigung, Insolvenz639
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Altmeppen
GmbHG, 11. Aufl. 2023
Brox/Henssler
Handelsrecht, 23. Aufl. 2020
Bülow/Artz
Handelsrecht, 7. Aufl. 2015
Canaris
Handelsrecht, 24. Aufl. 2006
Fezer
Klausurenkurs im Handelsrecht, 6. Aufl. 2013
Frodermann/Jannott
Handbuch des Aktienrechts, 9. Aufl. 2016
Glanegger/Stuhlfelner/Cordes
HGB, 8. Aufl. 2023
Heidel/Hirte
Das neue Personengesellschaftsrecht, 1. Aufl. 2024
Henssler/Streck
Handbuch Sozietätsrecht, 2. Aufl. 2011
Hopt
HGB, 43. Aufl. 2024
Hölters/Weber/Bearbeiter
Aktiengesetz, 4. Aufl. 2022
Hübner
Handelsrecht, 5. Aufl. 2008
Windbichler/Bachmann
Gesellschaftsrecht, 25. Aufl. 2024
K. Schmidt
Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002
K. Schmidt
Handelsrecht, 6. Aufl. 2014
K. Schmidt
Münchener Kommentar zum HGB, 5. Aufl. 2021
Koller/Kindler/Drüen
HGB, 10. Aufl. 2023
Martinek/Bergmann
Fälle zum Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht, 4. Aufl. 2008
MüKoBGB/Bearbeiter
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 9. Aufl. 2021 ff.
MüKoHGB/Bearbeiter
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 5. Aufl. 2020 ff.
MüKoZPO/Bearbeiter
Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 6. Aufl. 2020 ff.
Noack/Servatius/Haas
GmbH-Gesetz, 23. Aufl. 2022
Pentz
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 6. Aufl. 2024
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 1Lernprozesse und Lernmotivation
Gerade beim Lernen setzen wir uns schnell unter hohen Leistungsdruck, haben hohe Erwartungen an uns. Das Ziel, also die Prüfung, ist weit entfernt, wir sehen häufig nicht, was wir schon erreicht haben, sondern nur das, was wir noch nicht geschafft haben – gemessen an der noch großen Distanz bis zum Ziel „Examen“. Es dauert häufig viele Wochen bis Monate bis wir eine Rückmeldung in Form einer Zensur erhalten. Das fördert leider nicht unsere unmittelbare Lernmotivation und unser aktuelles Lernverhalten.
Unser Gehirn lernt durch Erfolge und durch Misserfolge und möchte gerade in unangenehmen Stresssituationen (langweiliger Stoff, Leistungsdruck) „pfleglich“ behandelt werden. Durch positive Rückmeldungen, Anerkennung und Belohnungen werden wir darin bekräftigt, bestimmte Tätigkeiten weiter (intensiver, besser) auszuüben. Diesen Umstand können Sie nutzen.
Durch entsprechende Zielsetzungs-, Feedback- und Verstärkungsmechanismen kann man sich motivieren bzw. auch neu eingeübte Lernprozesse verstärken. Sie können Lernfortschritte und Erfolge auch nach kurzen Lernphasen und Zeitabschnitten deutlicher wahrnehmen.
Lerntipps
Planen Sie herausfordernde aber realistische Ziele!
Ein Ziel befindet sich am Ende eines Weges. Am besten Sie planen Etappenziele. Stellen Sie sich z. B. vor, was genau Sie nach vier Wochen, einer Woche, an diesem Tag, bis zur ersten Pause erreicht haben wollen. Fragen Sie sich, woran Sie Ihr erfolgreiches Lernen festmachen wollen. Und wie Sie den Erfolg überprüfen (lassen) wollen. Setzen Sie sich klare, anspruchsvolle aber realistische Lernziele anhand eines individuellen Lernplanes. Fordern Sie sich ruhig (positiver leistungsförderlicher Stress), aber erzeugen Sie keinen zu hohen Erwartungsdruck und damit so genannten leistungshemmenden Dis-Stress. Nutzen Sie einen Wochenplaner – mit Stundenplan wie in der Schule – und machen Sie sich eine Tagesplanung einschließlich Pausen, Freizeitaktivitäten, Haushalt etc.
Setzen Sie sich positive Anreize!
Da Sie sich gut kennen, werden Sie recht leicht eigene Vorstellungen zur Belohnung entwickeln. Sie können sich materiell verstärken, z. B. mit dem Download eines neuen Songs oder dem Kauf neuer Schuhe, die Sie schon immer haben wollten. Da diese Art von Verstärkern schnell an finanzielle Grenzen stoßen können, sollten Sie sie für besondere Gelegenheiten nutzen. Andere Verstärker können Lesen, Fernsehen, Klavier spielen, Musik hören, ein Nickerchen, der Kneipenbesuch, das Kino, Sport und sogar der ungeliebte Abwasch sein. Machen Sie doch erst einmal eine Ideensammlung, welche Verstärker für Sie attraktiv sein könnten.
Körperliche Betätigung ist ein optimaler Verstärker!
Körperliche Aktivitäten sind für Lernende eine optimale Verstärkungsmöglichkeit. Als Ausgleich zum langen Sitzen braucht es in besonderem Maße Bewegung. Bewegung ist dann Abwechslung, Erholung und Ausgleich. Wenn Sie sich körperlich bewegen, wird einerseits das Stresshormon Adrenalin abgebaut, andererseits wird das „Glückshormon“ Serotonin verstärkt ausgeschüttet. Sportliche Betätigung führt zu körperlicher Ermüdung und fördert einen besseren Schlaf.
Belohnen Sie sich mit Konzept!
Mit Ihren Verstärkern und Belohnungen sollten Sie am besten abwechslungsreich und erfinderisch sein. Es sollte kleine und größere Belohnungen geben, gemessen an dem Anspruchsniveau der Zielsetzungen oder der Dauer der Lernphasen. Hier orientieren Sie sich an der Zielplanung. Das Anspruchsniveau ist ganz individuell zu betrachten. Die Belohnungen sollten direkt nach Zielerreichung erfolgen können, also z. B. nach eineinhalb Stunden, fünf geschriebenen Seiten, sieben bearbeiteten Fällen, am Ende eines erfolgreichen Tages.
Überprüfen Sie Ihren Erfolg und verhalten Sie sich konsequent!
Ist das angestrebte Ziel erreicht, muss sofort die Belohnung eingetauscht werden, damit das Gehirn den Zusammenhang zwischen Zielerreichung in der Sache und gutem Gefühl abspeichert. Ist das Ziel nicht erreicht, dann darf es keine Belohnung geben. Es ist dann wichtig, sich genauer damit zu beschäftigen, warum Sie das Ziel nicht erreicht haben. Dadurch nehmen Sie eine Analyse vor, aus der Sie die erforderlichen Veränderungen ableiten können.
Keine Belohnung – was dann?
Falls Sie sich über längere Zeit (mehrere Tage) nicht mehr belohnen konnten, dann sollten Sie eine Analyse vornehmen. Wahrscheinlich werden Sie sehr schnell merken, an welchen Stellen Schwächen oder Stärken Ihres Lernsystems zu finden sind. Die Analyse sollte sich sachlich an Ihrem Lernsystem und auch an Ihrem Lernverhalten orientieren. Es sollte keine „persönliche Selbstgeißelung“ sein. Das setzt Ihr Gehirn unter negativen emotionalen Stress, und das können Sie beim Lernen und in der Phase der Prüfungsvorbereitung am wenigsten gebrauchen.
Reflektieren Sie Ihr Lernverhalten bei Misserfolg!
Eine Kurzanalyse und Reflexion soll Ansatzpunkte für mögliche Veränderungen liefern. Dafür einige Leitfragen:
•
Ist mein eigener Leistungsanspruch zu hoch?
•
Habe ich insgesamt (zeitmäßig) zu wenig gearbeitet?
•
Zuviel an Ablenkung?
•
Wie habe ich es geschafft, das Lernen zu vermeiden?
•
Nehme ich mein Lernen ernst genug?
•
Mache ich es mir zu bequem?
•
Mangelnde Konsequenz in der Planung und im Einhalten des Lernpensums, der Belohnung?
•
Bin ich zu großzügig im Belohnen?
•
Gab es unerwartete Ereignisse, die mich behindert haben?
•
Habe ich zuviel gearbeitet? Warum?
•
Bin ich zu erschöpft? Woran liegt das?
•
Habe ich zu wenig behalten und verstanden trotz vieler Arbeit?
•
Ist der Stoff zu schwer?
•
Gab es (emotional) hemmende Gründe (in der Familie, bei Freunden, wegen Geldsorgen)?
•
Wer oder was könnte mir bei Schwierigkeiten helfen?
Erkennen Sie Ihr persönliches Vermeidungsverhalten!
Sie kennen das vielleicht: Bevor es mit dem Lernen losgeht – Zeitung lesen, noch einmal zur Toilette gehen, Blumen gießen, etwas aus dem Kühlschrank holen, noch schnell etwas einkaufen gehen . . . Wir versuchen unangenehme Tätigkeiten vor uns her zu schieben. Hierdurch vermeiden wir, uns in eine vermeintlich aversive Situation zu begeben. Durch das Vermeidungsverhalten entziehen wir uns der Arbeit und belohnen uns für Verzögerungen. Das hat zur Folge, dass wir lernen, die primär angestrebte Tätigkeit immer öfter zu vermeiden. Betrachten Sie Ihr Vermeidungsverhalten und seine Auswirkungen einmal genauer! Kurzfristig hilft es, vermeintlichen Stress (Aversion) abzubauen, langfristig kann das Ganze Ihnen wirklich über den Kopf wachsen.
Bauen Sie Vermeidungsverhalten Schritt für Schritt ab!
Der riesige Berg an Arbeit, der vor uns liegt, lässt uns häufig ausweichen. Man geht Dinge nicht an, weil man die Befürchtung hat, den Überblick zu verlieren oder sie insgesamt nicht bewältigen zu können („Wie soll ich das denn alles schaffen?“). Hier entsteht negativer Stress für unser Gehirn. Damit ist Vermeidungsverhalten erst einmal (emotional) vernünftig. Nur in der Sache kommen Sie nicht weiter.
Folgende Tipps können weiterhelfen:
•
Bei Lernproblemen das Pensum anfänglich bewusst reduzieren.
•
Den Lernstoff in für Sie überschaubare Lerneinheiten portionieren.
•
Die einzelnen Lerneinheiten in angenehme Mengen- und Zeiteinheiten unterteilen.
•
Besonders angenehme Anfangstätigkeiten finden.
•
Strenge Disziplin, d. h. striktes, selbst auferlegtes Verbot von Vermeidungsverhalten.
•
Sitzen bleiben. Wenn Sie nicht mit der Arbeit beginnen können, notieren, was Sie eigentlich arbeiten wollen, was Ihnen schwierig erscheint, welche Aspekte behindern, welche vielleicht sogar Freude machen könnten.
1. TeilHandelsrecht
A.Systematik und Zweck des Handelsrechts
I.Handelsrecht als Sonderprivatrecht
1
Handelsrecht ist das Sonderprivatrecht der Kaufleute.[1] Dies bedeutet zweierlei: Es ist Teil des Privatrechts, obwohl es vereinzelt auch öffentlich-rechtliche Vorschriften, so zum Handelsregister in §§ 8 ff. HGB, enthält. Als Teil des Privatrechts ist es gleichzeitig Sonderprivatrecht, weil Normadressaten des Handelsrechts nur Kaufleute sind.
Als Sonderprivatrecht ist das Handelsrecht nicht vollständig eigenes Recht, sondern enthält spezielle Vorschriften im Hinblick auf diejenigen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Daher gilt das allgemeine bürgerliche Recht subsidiär, insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch dann, wenn das Handelsrecht keine eigenen Regeln getroffen hat.
[Bild vergrößern]
2
Das Sonderprivatrecht für Kaufleute ist notwendig, weil die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches den Bedürfnissen des Wirtschaftsverkehrs nicht ausreichend Rechnung tragen. So dient das Handelsgesetzbuch
•
der Berücksichtigung von Handelsbräuchen, insbesondere aus vorkodifikatorischer Zeit (§ 346 HGB),
•
der Flexibilität und Schnelligkeit bei Handelsgeschäften durch eine erweiterte Formfreiheit (§ 350 HGB) bis hin zur Bedeutung des Schweigens als Zustimmung,[2] kurze Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 HGB) und kurze Fristen bei der Verwertung (§ 368 HGB),
Die Bürgschaft eines Kaufmanns ist nach § 350 HGB formlos möglich, während die private Bürgschaft nur in schriftlicher Form gültig ist (§ 766 S. 1 BGB).
•
der besonderen Rechtsklarheit und Rechtssicherheit, etwa durch den Schutz des guten Glaubens an die Verfügungsbefugnis (§ 366 HGB)[3] und durch strenge Rechtsfolgen beim Fixgeschäft (§ 376 HGB),
•
der Betonung eigenverantwortlichen Handelns, etwa durch Regelungen zu erhöhten Sorgfaltspflichten nach § 347 HGB gegenüber denen einer Privatperson gemäß § 276 BGB, Vertragsstrafen ohne richterliche Korrektur der Höhe (§ 348 HGB statt § 343 BGB), dazu zählt auch, dass der Kaufmann nicht wie der private Bürge die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB) hat, also die Befriedigung des Gläubigers nicht verweigern kann, solange dieser nicht erfolglos eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner versucht hat (§ 349 HGB),
•
schließlich dem Prinzip der Entgeltlichkeit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung (§ 354 HGB) einschließlich eines höheren Zinses (§ 352 HGB statt § 246 BGB) und Fälligkeitszinsen (§ 353 HGB).
Diese Grundsätze prägen das gesamte Handels- und weitestgehend auch das Gesellschaftsrecht (vgl. dazu Teil 2 Rn. 200 ff.).
II.Kodifikation
3
Das Handelsrecht ist im Handelsgesetzbuch kodifiziert. Das HGB schafft ganz überwiegend kein neues Recht, sondern modifiziert lediglich die allgemeinen privatrechtlichen Regelungen.
Es ist wie das Bürgerliche Gesetzbuch in fünf Bücher mit folgenden Inhalten gegliedert:
[Bild vergrößern]
•
das erste Buch (§§ 1–104a HGB) behandelt den Handelsstand und damit die Kaufmannseigenschaft, das Handelsregister, die Firma, die Prokura als Vollmacht des Kaufmanns, die Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge als Hilfspersonen der Kaufleute, den Handelsvertreter und den Handelsmakler;
•
das zweite Buch (§§ 105–236 HGB) enthält mit den Regelungen zu den Handelsgesellschaften und der stillen Gesellschaft den Kernbereich des Gesellschaftsrechts. Kodifiziert sind als Personenhandelsgesellschaften die offene Handelsgesellschaft (§ 105 ff. HGB) und die Kommanditgesellschaft (§ 161 ff. HGB);
•
das dritte Buch (§§ 238–342r HGB) regelt die Handelsbücher und enthält damit die Grundregeln der handelsrechtlichen Buchführung. Dieses Buch ist immer wieder geändert worden und hat mit den Regelungen zur Handelsbilanz unmittelbar Auswirkungen auf das Bilanzsteuerrecht;
•
das vierte Buch (§§ 343–475h HGB) knüpft an die Systematik einer Aufteilung in einen allgemeinen und besonderen Teil an. Es stellt allgemeine Vorschriften zum Handelsgeschäft voran und regelt sodann u.a. den Handelskauf, das Kommissions-, Fracht-, Speditions- und das Lagergeschäft;
•
das fünfte Buch (§§ 476–619 HGB) enthält die Regeln zum Seehandelsrecht.
4
Daneben bestehen Sondergesetze, die in ihrem Regelungsbereich sowohl dem Bürgerlichen Gesetzbuch als auch dem Handelsgesetzbuch vorgehen. Dies sind vor allem das Wechsel- und das Scheckgesetz, das gesamte Wertpapierrecht, die Gesetze betreffend den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, der gesamte Bereich des Bank- und Börsenrechts, das Wettbewerbsrecht und das Versicherungsvertragsrecht. Diese Rechtsgebiete sind wie die Handelsbücher und das Seehandelsrecht nicht Gegenstand dieser Abhandlung. Soweit im Folgenden von Handelsrecht die Rede ist, sind damit das erste Buch und das vierte Buch des Handelsgesetzbuches gemeint.
III.Zur Geschichte des Handelsgesetzbuches
5
Das Handelsrecht ist mindestens ebenso alt wie das allgemeine Privatrecht, da der Handels- und Geschäftsverkehr seit jeher die Ausgestaltung von Rechtsnormen prägt.
Vorläufer des heutigen HGB ist das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861.
In das ADHGB flossen Erfahrungen mit älteren Kodifikationen ein, vor allem die §§ 475 ff. des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794, der französische Code de commerce von 1807, den Baden als Anhang zum Badischen Landrecht übernommen hatte und der darüber hinaus in weiten Teilen der bis 1815 französisch besetzten Gebiete fortgalt, und die Allgemeine Deutsche Wechselordnung von 1848, bei deren Ausarbeitung auch allgemeine handelsrechtliche Grundsätze berücksichtigt worden waren.[4] Zur Entwicklung des Handelsrechts hat zudem die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts wesentlich beigetragen, insbesondere der Rechtswissenschaftler Levin Goldschmidt (1829–1897).
Mit der länderübergreifenden Kodifikation in Deutschland ging die Schaffung einer handelsrechtlichen Gerichtsbarkeit einher.[5]
Das heute gültige Handelsgesetzbuch wurde am 10.5.1897 verabschiedet[6] und trat gemeinsam mit dem BGB am 1.1.1900 in Kraft. Die zeitliche Übereinstimmung ist nicht zufällig, sollte das HGB das ADHGB doch vor allem zur Anpassung des Handelsrechts an das Bürgerliche Gesetzbuch ersetzen.[7] Im Jahr 1937 ist das vormals im HGB enthaltene Aktienrecht aus dem HGB in ein eigenes Gesetz entnommen worden[8], das bis zum heutigen Tag Bestand hat.
IV.Die Handelsgerichtsbarkeit
6
Die Besonderheiten des Handelsrechts spiegeln sich bis zum heutigen Tage im Bestehen einer besonderen Gerichtsbarkeit.
Dies hat, wie gesehen, zum einen historische Gründe.
Zum anderen liegt es an den Besonderheiten des Handelsverkehrs.
Lesen Sie zu den zivilprozessualen Besonderheiten §§ 96–100 GVG.
Rechtsstreitigkeiten zwischen Kaufleuten sind seither im Regelfall Handelssachen nach §§ 94, 95 GVG und werden von einer Kammer für Handelssachen am Landgericht in erster Instanz verhandelt. Die Kammern für Handelssachen sind als besondere Spruchkörper nach §§ 93 ff. GVG mit einem Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei Handelsrichtern – juristische Laien, die entweder im Handelsregister eingetragene Kaufleute oder Organe von Handelsgesellschaften sind, § 109 GVG – als Beisitzern besetzt. Entweder der Kläger richtet sein Begehren sogleich an eine Kammer für Handelssachen, § 96 GVG, oder der im Handelsregister eingetragene Beklagte beantragt Verweisung an die Kammer für Handelssachen, § 98 GVG.
Im Einzelfall kann zur Klärung von Streitigkeiten auf nichtstaatliche Schiedsgerichte ausgewichen werden, die allein durch die Abrede der Parteien, der Schiedsvertrag gemäß §§ 1025 ff. ZPO, nach Eintritt von Streitigkeiten zusammentreten.
Angelegenheiten des Handelsregisters sind solche der freiwilligen Gerichtsbarkeit und werden daher von den Amtsgerichten verhandelt, die auch das Handelsregister führen (§§ 1, 374 Nr. 1, 376 FamFG).
B.Handelsstand
I.Handelsrecht und Unternehmensrecht
1.Subjektive Anknüpfung des Kaufmannsbegriffs
7
Lesen Sie § 345 HGB: Er knüpft daran an, ob das Rechtsgeschäft Handelsgeschäft „für einen der beiden Teile“, d.h. der Vertragsparteien ist.
Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind zum einen die Träger eines handelsrechtlichen Unternehmens nach §§ 1–5 HGB, zum anderen die Handelsgesellschaften nach § 6 HGB. Das Handelsrecht als Sonderprivatrecht der Kaufleute knüpft daran an, ob jemand als Kaufmann im Rechtsverkehr auftritt oder ein Handelsgewerbe oder Handelsgeschäft betreibt. Voraussetzung für die Anwendung des HGB ist damit, dass mindestens ein Beteiligter (§ 345 HGB), in anderen Fällen beide Beteiligten (§§ 346, 352 f., 369, 377 HGB) Kaufleute sind. Das Handelsrecht basiert somit auf einem subjektiven System. Demgegenüber orientiert sich das objektive System an der Art der Rechtsgeschäfte, so etwa der französische Code de commerce, der den Kaufmann als diejenige Person definiert, die Handelsgeschäfte vornimmt. Ausnahmen vom subjektiven System kennt das Handelsgesetzbuch für den Kaufmann für sein privates Handeln und in verschiedenen Rechtsvorschriften, die eine Kaufmannseigenschaft der Handelnden nicht voraussetzen.
2.Unternehmensbezogener Kaufmannsbegriff
8
Das HGB geht von einem unternehmensbezogenen Kaufmannsbegriff aus, so dass nicht nur der Einzelkaufmann, sondern auch Gesellschaften als Unternehmensträger, etwa die Personenhandelsgesellschaften, Kaufmann sind, und zwar so genannter Formkaufmann nach § 6 HGB. Eine gesetzliche Definition des Begriffs des Unternehmens fehlt jedoch, weil ihm je nach Regelungszusammenhang unterschiedliche Bedeutung zukommt. Unternehmen ist zum einen die Gesamtheit aller personellen und sachlichen Mittel und aller Rechte zum Zwecke der wirtschaftlichen Betätigung, zum anderen eine Organisation mit interner Kompetenzverteilung nach personalgeprägten Strukturen, Geschäftswissen und -erfahrungen, Bezugsquellen und Kundenstamm. Diese Organisationsverfassung ist weit mehr als die Gesamtheit der Gegenstände charakteristisch für das Unternehmen und Indikator seines Geschäftswertes, der selbst mehr ist als die Differenz der Aktiva und Passiva.[9] In Kombination der beiden Betrachtungen lässt sich das Unternehmen wie folgt definieren:
Unternehmen ist jede organisatorische Einheit, die auf einer Verbindung personeller und sachlicher Mittel beruht, um einen wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.
9
Aus dieser organisatorischen Einheit des Unternehmens folgt jedoch nicht, dass etwa das Unternehmen als solches Rechtsfähigkeit besäße. Rechtsträger ist vielmehr der Unternehmer als die natürliche oder juristische Person bzw. Handelsgesellschaft.
Der in diesem Zusammenhang diskutierte Unternehmensbegriff ist ein anderer als derjenige des § 14 BGB, der zur Umsetzung von mehreren europäischen Richtlinien zum Verbraucherschutz in das BGB eingefügt worden ist.[10] Gleichwohl ist der Kaufmann, soweit er als Kaufmann handelt, gewerblich tätig, daher Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und damit dem Verbraucherschutzrecht zu Lasten der Unternehmer unterworfen.[11] Anderes gilt, wenn der Kaufmann ohne Zusammenhang zu seiner gewerblichen Tätigkeit privat tätig ist.[12]
II.Der Kaufmann
10
Zu unterscheiden ist zunächst der Kaufmann vom Nichtkaufmann als demjenigen, der weder einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unterhält (§ 1 Abs. 2 HGB), noch im Handelsregister eingetragen ist.
Kaufleute lassen sich wie folgt unterscheiden:
•
kraft Gewerbebetrieb;
•
kraft Rechtsschein;
•
kraft Rechtsform.
[Bild vergrößern]
1.Der Kaufmann kraft Gewerbebetrieb, § 1 HGB
11
12
§ 1 Abs. 1 HGB bestimmt zum Kaufmann kraft Gewerbebetrieb denjenigen, der ein Handelsgewerbe betreibt. Handelsgewerbe ist nach der gesetzlichen Vermutung des § 1 Abs. 2 HGB jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.
Beachten Sie die Negativformulierung des § 1 Abs. 2 HGB. Er enthält eine gesetzliche Vermutung, dass ein Gewerbe im handelsrechtlichen Sinne auch Handelsgewerbe ist. Im Streitfall wird also vermutet, dass ein Gewerbetrieb eine kaufmännische Einrichtung erfordert. In der Klausur ist eine gestaffelte Prüfung erforderlich: Zunächst ist der Gewerbebegriff im handelsrechtlichen Sinne zu prüfen, sodann, ob das Gewerbe auch Handelsgewerbe im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB ist. Dabei genügt der Hinweis auf die Vermutungswirkung allein regelmäßig nicht.
a)Das Gewerbe
13
Lesen Sie § 7 HGB: Eine häufig übersehene Vorschrift.
Der Begriff des Gewerbes im Handelsgesetzbuch ist ein anderer als der öffentlich-rechtliche Gewerbebegriff. Das Bundesverwaltungsgericht[13] definiert das Gewerbe für das öffentliche Recht als „jede nicht sozial unwertige, auf Gewinnerzielung gerichtete und auf Dauer angelegte selbstständige Tätigkeit, ausgenommen Urproduktion, Freiberufe und bloße Verwaltung eigenen Vermögens“.
Nach § 7 HGB sind die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach welchen die Befugnis zum Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder von gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht ist, für den handelsrechtlichen Gewerbebegriff unerheblich.
Im HGB ist der Begriff des Gewerbes nicht bestimmt. Eine Anknüpfung findet sich in § 15 Abs. 2 EStG. Gewerbe im handelsrechtlichen Sinne lässt sich wie folgt definieren:
Gewerbe ist jede
1.
äußerlich erkennbare
2.
planmäßige
3.
selbstständige
4.
nicht freiberufliche Betätigung, die
5.
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt.
aa)Äußerliche Erkennbarkeit
14
An einer äußerlichen Erkennbarkeit fehlt es zunächst, wenn die beabsichtigte Tätigkeit noch nicht aufgenommen worden ist. Dieses Merkmal deutet § 1 Abs. 1 HGB an, der ein „Betreiben“ des Gewerbes verlangt.
Nicht äußerlich erkennbar ist zudem eine Tätigkeit, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt.
Handwerker H spekuliert abends vom heimischen Computer aus über einen Onlinebroker an der Börse.
Im Bereich der Gesellschaften fehlt es vor allem den allein vermögensverwaltenden Gesellschaften regelmäßig an einer äußerlichen Erkennbarkeit.[14]
bb)Planmäßigkeit
15
Planmäßigkeit setzt ein Betreiben für eine gewisse Zeitdauer aufgrund eines vorgefassten Entschlusses voraus.[15] Der Handelnde muss eine Vielzahl von Geschäften als Ganzes tätigen wollen.[16] Es genügt nicht, dass das einzelne Geschäft aufgrund eines jeweils neuen Entschlusses vorgenommen wird. Einer lediglich gelegentlichen Tätigkeit fehlt es an dem erforderlichen inneren Zusammenhang, sie ist daher nicht planmäßig. Eine bestimmte Zeitdauer ist nicht maßgeblich, so dass auch so genannte „Saisonbetriebe“ planmäßig betrieben werden, also solche, die nur zeitweise unterhalten werden.
Der Italiener I betreibt in den Sommermonaten in Deutschland ein Eiscafé, das er zwischen Oktober und April jeden Jahres schließt, um in Neapel zu überwintern.
cc)Selbstständigkeit
16
Selbstständig handelt, wer nach außen im eigenen Namen auftritt, im Innenverhältnis die Verantwortung und die Kosten trägt, wer also auf eigene Rechnung und Gefahr handelt und in persönlicher und sachlicher Hinsicht nicht weisungsgebunden ist. Maßgeblich ist eine rechtliche, nicht eine wirtschaftliche Selbstständigkeit. Anhaltspunkt für die Abgrenzung ist § 84 Abs. 1 S. 2 HGB, der die inhaltliche und zeitliche Weisungsfreiheit nennt.
Die bei Steuerberater S angestellte Steuerfachgehilfin F arbeitet dem S nach dessen Weisungen zu.
Da F in ihrer Zeit- und Arbeitseinteilung nicht frei ist, sondern S ihr die zu erledigenden Arbeiten vorgibt, ist sie nicht selbstständig tätig und betreibt daher kein Gewerbe. Als Arbeitnehmer ist sie nicht Kaufmann.
dd)Keine freiberufliche Tätigkeit
17
Die so genannten freien Berufe betreiben kein Gewerbe.
Freiberufler sind u.a.
•
Rechtsanwälte (§ 2 Abs. 2 BRAO),
•
Notare (§ 2 S. 3 BNotO),
•
Wirtschaftsprüfer (§ 1 Abs. 2 S. 1, 2 WiPrO),
•
Steuerberater (§ 32 Abs. 2 S. 1, 2 StBerG),
•
Ärzte (§ 1 Abs. 2 BundesärzteO),
•
Zahnärzte (§ 1 Abs. 4 ZahnheilkG),
•
Architekten,
•
Künstler,
•
Dolmetscher und
•
Schriftsteller.
Die Unterscheidung hat zum einen historische, zum anderen soziale Gründe.
Seit dem Mittelalter ist für die freien Berufe eine weitgehende Selbstverwaltung typisch, die sich noch heute in einem eigenen Standesrecht mit eigenen Aufsichtsgremien (Rechtsanwaltskammern, Steuerberaterkammern, Ärztekammern, Apothekerkammern) und in einer eigenständig organisierten Eigenversorgung und Fürsorge (Versorgungswerke, Künstlersozialkassen) widerspiegelt.
Die freien Berufe zeichnen sich dadurch aus, dass intellektuelle Leistungen, nicht körperliche Arbeitsleistungen erbracht werden. Typisch ist ein Zurücktreten des Erwerbszweckes hinter einem höheren Interesse an Fortbildung und Ausprägung von Wissenschaft und Kunst. Aus historischer Sicht lässt sich zugespitzt formulieren: Freiberufler sind diejenigen, die mit dem Kopf arbeiten, im Unterschied zu den Gewerbetreibenden, die mit den Händen arbeiten.
Steuerberater S berät eine Kölner Werbeagentur. Ist S Kaufmann?
Nach § 32 Abs. 2 StBerG übt S einen freien Beruf aus und betreibt daher kein Gewerbe. Als Freiberufler ist er kein Kaufmann.
Die freiberufliche Tätigkeit endet indes dort, wo die Tätigkeit nicht mehr dem klassischen Berufsbild entspricht. Jenseits der klassisch freiberuflichen Tätigkeit kann der Gewerbebegriff erfüllt sein.
Schönheitschirurg C betreibt neben seiner Arztpraxis eine private Schönheitsklinik. Die Klinik ist Gewerbebetrieb.
§ 1 Abs. 2 PartGG enthält einen nicht abschließenden Katalog der freien Berufe. Dieser ist allerdings weiter gefasst als der handelsrechtliche Begriff des freien Berufes.
ee)Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
18
Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr liegt nur dann vor, wenn der Handelnde die Grenzen des privaten Handelns überschreitet, insbesondere nicht nur privates Vermögen verwaltet oder aus privaten Geldern Kapitalanlagen tätigt. So soll die Anschaffung einzelner Wohnungen zur Vermietung nicht Gewerbe sein, anders eine vermietende oder verpachtende Tätigkeit, wenn sie marktgerichtet planmäßig betrieben wird, denn die Leistung des Vermieters oder Verpächters stelle eine werthaltige anbietende Leistung dar.[17]
ff)Erlaubte Tätigkeit
19
Ob der Gewerbebetrieb erlaubt sein muss, ist umstritten. So wird vertreten, die Geschäfte müssten zivilrechtlich wirksam und einklagbar sein, der Gesetzgeber wolle für gesetzes- oder sittenwidrige Tätigkeiten (§§ 134, 138 BGB) nicht die Rechte eines Kaufmannes gewähren.[18] Dem wird entgegengehalten, es bestehe kein Grund, denjenigen nicht als Kaufmann zu behandeln, der als Kaufmann gegenüber anderen auftritt, nur weil er verbotene Geschäfte betreibt.[19] Teilweise wird für die Anwendung der Grundsätze über den Scheinkaufmann plädiert.
Der Ansicht, die auch den nicht erlaubt Handelnden dem Kaufmannsrecht unterwerfen will, ist zugute zu halten, dass die den Kaufmann treffenden Sondervorschriften des HGB insbesondere im Bereich der Handelsgeschäfte regelmäßig Verschärfungen gegenüber den allgemeinen Regelungen des BGB enthalten. Es ist nicht einzusehen, weshalb der unerlaubt Handelnde entgegen seinem Auftreten im Geschäftsverkehr aus diesen Regeln gerade wegen der fehlenden Erlaubnis entlassen werden soll. Der handelsrechtliche Begriff des Gewerbes ist wertneutral, so dass eine gesetzes- bzw. sittengemäße Tätigkeit nicht Voraussetzung für die Anwendung des HGB ist.
Ein regelmäßiges Argument bei Meinungsstreitigkeiten: Derjenige, der gesetzes- oder sittenwidrig handelt, soll im Ergebnis nicht besser gestellt sein als derjenige, der sich normgemäß verhält. Dies wäre jedoch zu weiten Teilen der Fall, entließe man den nicht erlaubt Handelnden aus den Vorschriften des HGB. Im Einzelfall können diese allerdings auch einen Vorteil gegenüber den allgemeinen Regelungen des BGB darstellen.
Nochmals: Auch in diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob für die Tätigkeit eine nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderliche Erlaubnis besteht (§ 7 HGB).
gg)Absicht der Gewinnerzielung
20
Auch die Absicht einer Gewinnerzielung ist als Voraussetzung des handelsrechtlichen Gewerbebegriffes umstritten. Die Rechtsprechung sieht in der Gewinnerzielungsabsicht seit langem ein konstitutives Merkmal des Gewerbebegriffs,[20] lässt aber die Absicht genügen, so dass auch solche Betriebe dem Gewerbebegriff unterfallen, die tatsächlich keinen Gewinn erwirtschaften. Dagegen soll nach anderer Ansicht eine entgeltliche Tätigkeit ausreichen.[21]
Die Ansichten werden meist zum gleichen Ergebnis kommen, da der Unterschied zwischen der Absicht der Gewinnerzielung und einem entgeltlichen Anbieten vor allem in der Perspektive liegt: Dem Kriterium der Gewinnerzielungsabsicht liegt eine Gesamtbetrachtung im Sinne einer Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben zugrunde, das Kriterium des entgeltlichen Angebotes betrachtet hingegen das einzelne Geschäft.
Drucker D stellt auf eigene Kosten Schriften seiner Religion her und verkauft sie zum Selbstkostenpreis. D betreibt nach beiden Ansichten kein Gewerbe, da er weder mit der Absicht der Gewinnerzielung, noch entgeltlich handelt.
21
Bei privaten Wirtschaftsunternehmen vermutet die Rechtsprechung die Gewinnerzielungsabsicht, ein Gegenbeweis dürfte kaum gelingen.
Relevanz hat der Streit allenfalls noch für die Unternehmen der öffentlichen Hand, für die die Vermutung nicht gilt. Dabei ist jedoch zu unterscheiden:
•
Unternehmen der öffentlichen Hand in privatrechtlicher Form, die bei Energieversorgungsunternehmen oder sonstigen Leistungsträgern der öffentlichen Hand üblich sind, sind Kaufleute nach § 6 HGB.
•
Juristische Personen des öffentlichen Rechts, also Bund, Länder, Gemeinden und Kommunalverbände, können durch Betrieb eines Handelsgewerbes Kaufleute nach Handelsgesetzbuch ein, so etwa beim Betrieb von Mineralquellen, Brauereien oder Bergwerken.
Die Rechtsprechung tendiert allerdings für Betriebe, bei denen die Gewinnerzielungsabsicht fehlt, zu einer Verneinung der Gewerbeeigenschaft, hier vor allem für städtische Versorgungsbetriebe. Es solle nicht darauf ankommen, ob die öffentlich-rechtliche Körperschaft neben der Verfolgung der Erwerbsabsicht auch zugleich in Erfüllung gemeinnütziger öffentlich-rechtlicher Aufgaben tätig werde, da Voraussetzung für den Gewerbebegriff nur das Betreiben eines wirtschaftlichen Unternehmens ist, also eine Tätigkeit, die nicht allein und herkömmlich mit der Zielrichtung einer öffentlichen Aufgabe betrieben wird.[22]
Der steuerrechtliche Gewerbebegriff stellt auf einen engeren Terminus der Gewinnerzielungsabsicht ab als das Handelsrecht. Deshalb heißt es zum Handelsrecht, dass bloße Entgeltlichkeit genügt.
b)Der Betrieb
22
Das Gewerbe betreibt gemäß § 1 Abs. 1 HGB derjenige, in dessen Namen die Geschäfte abgeschlossen werden und der aus ihnen berechtigt und verpflichtet wird. In seiner Person treten die Rechtsfolgen ein.
Einzige Ausnahme ist der Handelsvertreter, der ein Gewerbe auch dann betreibt, wenn er als sogenannter Abschlussvertreter Geschäfte im Namen des Unternehmens abschließt.
So betreibt der Minderjährige im Fall des § 112 BGB selbst das Gewerbe, nicht aber sein gesetzlicher Vertreter, ebenso bei einer Betriebspacht der Pächter und nicht der Verpächter. Das zivilrechtliche Eigentum an den Betriebsmitteln, das beim Verpächter verbleibt, ist unerheblich, da ein Betreiben im Sinne von § 1 Abs. 1 HGB keine Verwendung ausschließlich eigener Gegenstände voraussetzt.
Unerheblich ist auch, für wessen Rechnung die Geschäfte geführt werden, so dass der Treuhänder das Gewerbe betreibt, nicht aber der Treugeber, denn berechtigt und verpflichtet wird der Treuhänder. Deshalb ist auch der Kommissionär Betreiber des Handelsgewerbes, nicht der Kommittent, obwohl er Waren für dessen Rechnung kauft und verkauft (§ 383 HGB).
Betreiber des Handelsgewerbes ist der Einzelkaufmann, bei den Personenhandelsgesellschaften die oHG und die KG, nicht jedoch deren Gesellschafter, da die Personenhandelsgesellschaften insoweit rechtsfähig sind.[23] Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die rechtsfähig ist, wenn sie nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll (§ 705 Abs. 2 Hs. 1 BGB), gilt gleiches. Daneben sind die persönlich haftenden Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft regelmäßig selbst Gewerbetreibende,[24] nicht aber Kommanditisten, da sie gemäß § 171 Abs. 1 HGB nur beschränkt für die Verbindlichkeiten der KG haften.[25]
Nicht Betreiber des Handelsgewerbes sind organschaftliche Vertreter bei Kapitalgesellschaften wie der Geschäftsführer der GmbH[26] oder der Vorstand einer AG.
c)Das Handelsgewerbe
23
Steht fest, dass es sich um ein Gewerbe im handelsrechtlichen Sinne handelt, wird nach der Formulierung des § 1 Abs. 2 HGB das Erfordernis einer kaufmännischen Einrichtung und damit das Vorliegen eines Handelsgewerbes vermutet. Der Begriff des Handelsgewerbes stellt über das Erfordernis einer kaufmännischen Einrichtung auf das Gesamtbild des Geschäftsbetriebes nach Art und Umfang ab.
Für eine kaufmännische Einrichtung typisch sind
•
der Art nach solche Einrichtungen, die eine ordnungsgemäße Geschäftsführung ermöglichen, vor allem eine kaufmännische Buchführung, eine Kassenführung und regelmäßige Inventarisierungen, die Vielfalt der Leistungs- und Geschäftsbeziehungen und der Zahlungswege, die organisatorische Strukturierung der Angestellten;
•
dem Umfang nach die Größe von Umsatz und Kapitaleinsatz und die Zahl der Betriebsstätten und der Angestellten.
Der Handelnde entgeht den Vorschriften des HGB nicht dadurch, dass er eine kaufmännische Einrichtung vermeidet. Entscheidend ist das Erfordernis einer kaufmännischen Einrichtung.
Der Maschinenbaubetrieb M aus Köln erzielt einen jährlichen Umsatz von 400 000 €, hat zehn Angestellte sowie regelmäßig zehn bis fünfzehn Kunden pro Monat. M beschäftigt zur Abwicklung der Geschäftsvorfälle den Buchhalter B, der Stammkunden kulanzweise Ratenzahlung gewähren darf. Jeweils weitere fünf Mitarbeiter arbeiten an Standorten in Bonn und in Düsseldorf.
Angesichts des Umsatzes und der Anzahl der Mitarbeiter ist der Umfang des Betriebs groß. Die Leistungsbeziehungen sind nach ihrer Zahl und im Hinblick auf eine zeitlich versetzte Zahlung bei Stammkunden komplex. Eine kaufmännische Buchhaltung wird von B vorgenommen.
Nach Art und Umfang kann hier daher davon ausgegangen werden, dass ein kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich ist. Damit betreibt M ein Handelsgewerbe.
Buchhalter B kündigt bei M und eröffnet einen eigenen Maschinenbaubetrieb. Mangels technischen Sachverstands des B laufen die Geschäfte schleppend. Im ersten Jahr liegt der Umsatz aus nur zwei Verkäufen an einen einzigen Kunden bei 10 000 €, die bei Anlieferung in bar gezahlt wurden.
Angesichts des geringen Waren- und Geldumsatzes, mangels Angestellten und der einfachen Zahlungswege (Barzahlung) ergibt eine Gesamtwürdigung, dass ein kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist. B betreibt daher kein Handelsgewerbe.
d)Die Eintragung im Handelsregister
24
Die Eintragung des Handelsnamens, der Firma (§ 17 HGB), in das Handelsregister ist nach § 29 HGB verpflichtend, hat aber nur deklaratorische (= rechtsbekundende), nicht konstitutive (= rechtsbegründende) Bedeutung. Der Kaufmann, dessen Geschäftsbetrieb – wie regelmäßig – einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, ist schon deshalb und nicht wegen der Handelsregistereintragung Kaufmann, weshalb er auch als „Istkaufmann“ bezeichnet wird.
Die Kaufmannseigenschaft nach § 1 HGB hat damit folgende drei Voraussetzungen:
1.
Es muss ein Gewerbe im handelsrechtlichen Sinne
2.
betrieben werden,
3.
das Handelsgewerbe ist, weil es einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.
e)Übungsfall Nr. 1
25
„Der unschlüssige Stahllieferant“
Der Betrieb von Stahllieferant S entwickelt sich prächtig. S hat 50 Mitarbeiter im Lager und weitere 8 in der Verwaltung. Er erwirtschaftet einen Umsatz von 2 500 000 € pro Jahr. S fragt sich, ob er eine Eintragung im Handelsregister herbeiführen muss.
26
Lösung
§ 29 HGB schreibt die Eintragung für alle Vollkaufleute vor. S muss daher die Eintragung herbeiführen, wenn er ein Handelsgewerbe im Sinne des § 1 HGB betreibt. Dies ist gemäß § 1 Abs. 2 HGB jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.
I.Gewerbe
Bei dem Stahlhandel müsste es sich zunächst um ein Gewerbe handeln.
Gewerbe ist jede
1.
äußerlich erkennbare
2.
planmäßige
3.
selbstständige
4.
nicht freiberufliche Betätigung, die
5.
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt.
S tritt mit dem Stahlhandel am Markt auf, der damit äußerlich erkennbar ist. Er handelt außerdem planmäßig, da der fortgesetzte Betrieb des Stahlhandels auf einem einheitlichen Willensentschluss des S beruht. S ist weisungsungebunden und daher selbstständig tätig. Der Betrieb eines Stahlhandels stellt auch keine Ausübung eines freien Berufes dar. Mit dem Betrieb beteiligt sich S schließlich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, da er die Grenzen der privaten Vermögensverwaltung überschreitet.
Damit liegt ein Gewerbe vor.
II.Gewerbebetrieb von S
Das Gewerbe wird von S betrieben, da in seinem Namen die Geschäfte abgeschlossen werden und er aus ihnen berechtigt und verpflichtet wird.
III.Handelsgewerbe
Dieses Gewerbe müsste auch Handelsgewerbe sein.
§ 1 Abs. 2 HGB vermutet, dass ein Gewerbe im Sinne des § 1 Abs. 1 HGB Handelsgewerbe im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. § 1 Abs. 2 HGB setzt das Erfordernis einer kaufmännischen Einrichtung voraus. Diese bestimmt sich nach Art und Umfang des Betriebs, Kriterien sind nach der Art des Betriebes u.a. eine kaufmännische Buchführung, eine Kassenführung, die Vielfalt der Leistungs- und Geschäftsbeziehungen, schwierige Zahlungswege und eine komplexe organisatorische Struktur, nach dem Umfang die Größe von Umsatz und Kapitaleinsatz und die Zahl der Betriebsstätten und der Angestellten. Je nach Branche wird das Erfordernis einer kaufmännischen Einrichtung ab einem Umsatz von 250 000 € pro Jahr angenommen.
S beschäftigt eine Vielzahl von Mitarbeitern, die zudem organisatorisch auf Lager und Verwaltung aufgeteilt sind, und erwirtschaftet einen erheblichen Jahresumsatz, so dass eine kaufmännische Einrichtung erforderlich ist. Bei einer derartigen Betriebsgröße kann nicht mehr von einem Kleingewerbebetrieb gesprochen werden.
IV.Ergebnis
Da S somit Istkaufmann gemäß § 1 HGB ist, ist er zur Eintragung nach § 29 HGB verpflichtet.
2.Der Kaufmann kraft Eintragung, § 2 HGB
27
28
Ist bei einem gewerblichen Unternehmen eine kaufmännische Einrichtung im Sinne von § 1 Abs. 2 HGB nicht erforderlich, handelt es sich um ein so genanntes Kleingewerbe. Dies ist nur dann Kaufmann, wenn der Handelnde gemäß § 2 HGB die Eintragung im Handelsregister herbeiführt. Sein Gewerbe gilt erst mit der Eintragung als Handelsgewerbe nach § 2 HGB mit allen Rechten und Pflichten. Der Gesetzgeber überlässt es also dem Kleingewerbetreibenden, die Kaufmannseigenschaft zu wählen. Daher ist die Handelsregistereintragung in diesem Fall konstitutiv (= rechtsbegründend) für die Kaufmannseigenschaft.
Ist der Kleingewerbetreibende im Handelsregister eingetragen, kann er sich nicht auf die fehlende kaufmännische Unternehmenseinrichtung berufen (§ 5 HGB). Er kann jedoch jederzeit die Löschung der Registereintragung beantragen (§ 2 S. 3 HGB). Erst mit Vornahme der Löschung endet die Kaufmannseigenschaft.





























