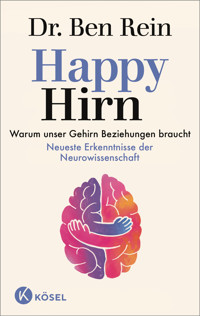
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Verbindung ist alles: Eine neue Sicht auf unser sozialstes Organ
»Ein hervorragendes Buch, das uns daran erinnert, dass unser Gehirn kein Solist, sondern Teil eines Symphonieorchesters ist: Wir sind auf Verbindung programmiert.«
Dr. David Eagleman, Bestseller-Autor und Neurowissenschaftler
Wir befinden uns in einer Krise der Einsamkeit und das ist gefährlich: Denn unsere Gehirne sind evolutionär auf Verbindung angelegt! Der Neurowissenschaftler Ben Rein taucht in die Forschung zu sozialer Interaktion ein und zeigt, wie unsere Interaktionen unsere Hirngesundheit beeinflussen, warum wir unsere digitalen Kontakte überdenken sollten oder warum manche Gehirne sich »synchronisieren« können. Vom Small Talk bis hin zu tiefgründigen Gesprächen mit Freunden: Dr. Rein weiß, wie wir die »Wissenschaft der Likeability« nutzen können, um besser zu interagieren, und warum es höchste Zeit ist, unser sozialstes Organ ganz neu kennenzulernen.
Und wenn Sie keine Menschen mögen … es gibt auch ein Kapitel über Haustiere.
In diesem Buch erklärt Ben Rein ...
•warum wir alle ein Bedürfnis nach sozialer Interaktion haben und wie wir andere besser verstehen.
•warum das Gehirn virtuelle Interaktionen anders verarbeitet als persönliche Begegnungen.
•das Geheimnis der Sympathie und neurowissenschaftliche Tipps, mit denen wir einen positiven Eindruck hinterlassen können.
•was tiefe emotionale Verbindungen in unserem Gehirn verändern und welche Rolle Empathie dabei spielt.
•warum Einsamkeit das Sterblichkeitsrisiko erhöht und welche negativen Auswirkungen sie auf die Gesundheit hat.
•wie Beziehungen zu Tieren unsere körperliche und mentale Gesundheit fördern.
•warum bestimmte Drogen wie etwa MDMA unsere sozialen Beziehungen stärken können, während andere, etwa Schmerzmittel, sie beeinträchtigen.
•welche praktischen Strategien helfen können, soziale Interaktionen für mehr Wohlbefinden zu nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»Ein hervorragendes Buch, das uns daran erinnert, dass unser Gehirn kein Solist, sondern Teil eines Symphonieorchesters ist: Wir sind auf Verbindung programmiert.«
Dr. David Eagleman, Bestseller-Autor und Neurowissenschaftler
Wir befinden uns in einer Krise der Einsamkeit und das ist gefährlich: Denn unsere Gehirne sind evolutionär auf Verbindung angelegt! Der Neurowissenschaftler Ben Rein taucht in die Forschung zu sozialer Interaktion ein und zeigt, wie unsere Interaktionen unsere Hirngesundheit beeinflussen, warum wir unsere digitalen Kontakte überdenken sollten oder warum manche Gehirne sich »synchronisieren« können.
Vom Small Talk bis hin zu tiefgründigen Ge-sprächen mit Freunden: Dr. Rein weiß, wie wir die »Wissenschaft der Likeability« nutzen können, um besser zu interagieren, und warum es höchste Zeit ist, unser sozialstes Organ ganz neu kennenzulernen.
Und wenn Sie keine Menschen mögen … es gibt auch ein Kapitel über Haustiere.
Dr. Ben Rein ist Neurowissenschaftler an der Stanford Universität mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Erforschung sozialer Interaktionen. Er hat neue Erkenntnisse über die genetischen Grundlagen von Autismus-Spektrum-Störungen gewonnen und herausgefunden, wie Verbindungen zwischen Gehirnzellen unser Sozialverhalten regulieren. Außerdem hat er untersucht, warum die psychoaktive Substanz MDMA Empathie und Verbundenheit zwischen Individuen fördert.
In den Sozialen Medien erklärt er seinen Followern komplexe Themen verständlich und entlarvt Fehlinformationen. Er ist ein gefragter Wissenschaftskommunikator und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die Kluft zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu überwinden und die Wissenschaft für alle zugänglich zu machen.
Dr. Ben Rein
Happy
Hirn
Warum unser Gehirn Beziehungen braucht
Neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaft
Aus dem Englischen von Dr. Gabriele Würdinger
Für alle, die schon einmal unter Einsamkeit gelitten haben und diejenigen, die ihnen halfen, sie zu überwinden.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Why Brains Need Friends. The Neuroscience of Social Connection. Diese Ausgabe wurde in Vereinbarung mit Avery, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einem Unternehmensbereich von Penguin Random House LLC, veröffentlicht.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: www.zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Caroline Johnson und Vivian Lopez Rowe
Umschlagillustration: Vivian Lopez Rowe unter Verwendung von Bildmaterial Shutterstock/DeawS
Innenteilabbildungen: © stock.adobe.com (Gehirn: wowow; Emojis: Cali6ro)
Redaktion: Sabeth Ohl, Hamburg
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN978-3-641-32827-6V002
www.koesel.de
Inhalt
»Keine komplizierte Sprache«-Regel
Einleitung
I. Wie Interaktion und Isolation die Hirngesundheit beeinflussen
1. Seien Sie nicht schüchternDie versteckten Vorteile sozialer Interaktion
2. Das einzige Organ, das sich einsam fühltWie soziale Isolation zum Abbau der Gehirnfunktion führt
II. Wie Sie Ihr Gehirn in einer Post-Interaktions-Welt gut versorgen
3. Soziale Gewohnheiten pflegenSo umschiffen Sie die natürlichen Beschränkungen Ihres Gehirns
4. Empathie und ApathieEine Frage der Perspektive
5. Egal, was du tust, ich kann es besserTierinteraktionen und was wir von ihnen lernen können
6. Eine virtuelle WeltWas bringen uns Online-Interaktionen?
7. Auf derselben WellenlängeWie Liebe, Berührungen und tiefe Verbindung das Gehirn anregen
8. Wie man besser interagiertDie Wissenschaft der Likeability
9. Unter EinflussWie Drogen unser soziales Gehirn manipulieren
10. Des Menschen bester FreundWarum die Liebe zu Hunden gut für das Gehirn ist
Gemeinsam nach vorne schauen
Social Journal
Danksagung
Über den Autor
»Keine komplizierte Sprache«-Regel
Mich stört es, wenn Leute sich unnötig kompliziert ausdrücken. Es einfach zu formulieren, funktioniert fast immer besser. Warum hochtrabende Begriffe »utilisieren«, wenn man einfache verwenden kann? Sicher, es ist schön, sein »elaboriertes« Vokabular zu »exhibieren«, aber auch jemand, der eine einfache Sprache verwendet, kann ein guter Autor sein. Eine gehobene Ausdrucksweise »camoufliert« oft das Gemeinte – es ist weniger klar. Manchmal helfen komplexe Formulierungen, ein Argument anzubringen, aber sie können Leser auch ausschließen.
In der Wissenschaft passiert Ähnliches. Der akademische Jargon verunklart die Aussage von Fachpublikationen, sodass die breite Öffentlichkeit nicht mehr folgen kann. Wir müssen besser werden im Kommunizieren. Anstatt davon auszugehen, dass Leser wissen, was ein »synaptisches Vesikel« ist, können wir es einfach als »kleines Säckchen mit Neurotransmittern« bezeichnen und schon sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist viel konstruktiver, die Dinge auf einfache Weise zu erklären, als Sätze mit Fachjargon zu überfrachten und auf das Beste zu hoffen. Wenn wir Wissenschaftler etwas in der Welt bewirken wollen, müssen wir die Tore zur akademischen Welt offenlassen. Mit diesem Buch möchte ich Sie alle hereinbitten. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir werden darin tonnenweise seriöse Neurowissenschaft behandeln, aber ich will es so schreiben, dass alle etwas mitnehmen können. So wie Ärzte den hippokratischen Eid ablegen, keinen Schaden anzurichten, lege ich den Eid ab, keinen Fachjargon zu verwenden.
Natürlich ist ein gewisser Jargon unvermeidlich. Bestimmte Begriffe müssen einfach verwendet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, »GABA« (kurz für Gamma-Aminobuttersäure) zu sagen als »GABA«. Aber Fachbegriffe können immer erklärt werden. Beim Schreiben dieses Buches habe ich einige wissenschaftliche Begriffe verwendet. Damit niemand auf der Strecke bleibt, habe ich einen Anhang verfasst, der auf meiner Website zu finden ist (www.benrein.com/book). Im Anhang erkläre ich, was die verschiedenen Begriffe wirklich bedeuten, und gebe manchmal auch einen aktuellen Kommentar dazu ab. Wenn Sie ein Pluszeichen an einem Wort sehen wie dieses+, bedeutet das, dass es im Anhang etwas dazu gibt. Ich hoffe, Sie werden fündig.
Einleitung
Drei bittere Wahrheiten über unser Sozialleben
»Hallo?«
Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist 16 Uhr an einem Donnerstag, und Sie sitzen mit hochgezogenen Schultern gestresst und ängstlich vor dem Computer. Diese Woche war ein Albtraum: Sie machen Überstunden für ein riesiges Projekt, das Sie total nervt und der Abgabetermin rückt bedrohlich näher. Mit zunehmendem Stress fällt es Ihnen immer schwerer, sich zu konzentrieren. Sie können das Ende dieses Projekts kaum erwarten, wissen aber nicht, wie Sie es bis dahin durchhalten sollen.
Erschöpft lehnen Sie sich in Ihrem Stuhl zurück, schließen die Augen und atmen durch. Ihr Körper bettelt um eine Pause, aber Sie überzeugen sich, dass Sie sich morgen besser fühlen werden, wenn Sie heute noch ein paar Stunden arbeiten. Sie lehnen sich nach vorne und richten Ihre müden Augen wieder auf den Bildschirm. Es fühlt sich falsch an, gegen Ihr Bauchgefühl zu handeln, aber es ist das einzig Vernünftige, oder?
Gerade als Sie zu dieser Entscheidung kommen, fängt Ihr Handy auf dem Schreibtisch an zu summen und zu leuchten. Überrascht stellen Sie fest, dass es eine alte Freundin ist, mit der Sie schon seit Jahren nicht mehr gesprochen haben. Worum es wohl geht? Sie blicken zwischen Ihrem Handy und Ihrem Computer hin und her und wägen ab. Sollen Sie sich weiter durch das Projekt quälen oder drangehen? Versuchen Sie kurz, sich in diese Situation hineinzuversetzen und seien Sie ehrlich: Würden Sie den Anruf annehmen?
Es ist eine vertrackte Situation. Einerseits wollen Sie unbedingt dieses Projekt zu Ende bringen. Eine Ablenkung wäre jetzt eine Katastrophe. Auf der anderen Seite sind Sie neugierig, warum Ihre Freundin anruft. Vielleicht hat sie eine gute Nachricht? Oder … was, wenn sie eine schlechte hat? Will sie Sie um einen Gefallen bitten? Was, wenn es ein peinliches Gespräch wird, durch das Sie sich durchlavieren müssen?
Trotz Ihrer Bedenken sagt Ihnen irgendetwas, dass Sie abheben sollten. Der Impuls nimmt überhand und Sie greifen zum Handy.
»Hallo?«
»Hey!«
Was folgt, ist eine überraschend anregende und angenehme Unterhaltung. Sie wurden um keinen Gefallen gebeten, es gab keine schlechten Neuigkeiten und es kam auch zu keiner peinlichen Situation. Ihre Freundin hatte einfach an Sie gedacht und wollte hören, wie es Ihnen geht. Gemeinsam schwelgen Sie in Erinnerungen, lachen und erzählen sich Geschichten aus der Vergangenheit. Es dauert nicht lange, bis Sie sich von Ihrem Computer abwenden, sich ganz auf das Gespräch einlassen und der Stimme am anderen Ende der Leitung Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Nach fast einer Stunde verabschieden Sie sich und versprechen, sich bald wieder zu melden. Sie meinen es wirklich ernst.
Als Sie sich wieder Ihrem Computer zuwenden, fühlen Sie sich unerwartet erfrischt und gestärkt. Ihr Geist ist klar und Sie sind bereit, das Projekt in Angriff zu nehmen. Plötzlich wirkt es nicht mehr so überwältigend oder beängstigend. Sie arbeiten noch ein, zwei Stunden gemütlich weiter und schaffen dabei viel mehr als erwartet.
So etwas Ähnliches haben wir alle schon einmal erlebt, oder? Manchmal ist eine gute Unterhaltung die beste Medizin gegen schlechte Laune, besonders wenn man schon ein paar Tage lang keine erfüllende Begegnung mit einem anderen Menschen hatte. Tatsächlich ist das hier mehr als nur eine anschauliche Anekdote: Sie ist wissenschaftlich belegt. Studien zeigen, dass Menschen nach Gesprächen in der Regel besser gelaunt und weniger gestresst sind. Diese Effekte können sich langfristig verstärken: Menschen mit mehr Interaktionen berichten über ein größeres Wohlbefinden, während Personen mit unerfüllten sozialen Bedürfnissen schlechter abschneiden.
Bewiesenermaßen sind Begegnungen ganz natürliche Stimmungsaufheller, aber sie haben noch mehr Vorteile für uns. Menschen, die mehr mit anderen interagieren, haben ein geringeres Risiko für Demenz, Herzerkrankungen, Diabetes, Depressionen und Angststörungen. Die Unterstützung, die wir durch unsere sozialen Systeme bekommen, reduziert nachweislich unsere Stressanfälligkeit und erhöht unsere Schmerztoleranz. Auf der anderen Seite ist soziale Isolation einer der stärksten bekannten Prognosefaktoren für Selbstmord. Unser Sozialleben hat eindeutig einen sehr großen Einfluss sowohl auf unsere Gesundheit als auch unser Wohlbefinden.
Aber das ist noch nicht alles. Studien weisen darauf hin, dass unser Sozialleben unsere Lebenserwartung beeinflusst. Es mag lächerlich klingen, aber ob Sie diesen Anruf annehmen oder warten, bis er an die Mailbox weitergeleitet wird, könnte Einfluss darauf haben, wie viel Zeit Sie hier auf der Erde haben. In einer Studie wurden mehr als 300 000 Menschen über einen Zeitraum von durchschnittlich 7,5 Jahren beobachtet, in denen einige der Probanden natürlich verstarben. Bemerkenswerterweise zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, während der Studie zu sterben, bei Menschen mit schwachen sozialen Beziehungen um 50 Prozent höher war. Zum Vergleich: Soziale Isolation ist etwa doppelt so schädlich wie Fettleibigkeit und viermal so schädlich wie in einem stark von Umweltverschmutzung betroffenen Gebiet zu leben.
Lassen Sie uns zum Telefondilemma zurückkehren: Haben Sie bei der Entscheidung, ob Sie den Anruf annehmen oder nicht, an Ihre Gesundheit gedacht? Wahrscheinlich nicht, und das wäre auch völlig normal. Wir denken einfach nicht so über unser Sozialleben … aber das sollten wir. Als Neurowissenschaftler, der die Biologie des Sozialverhaltens erforscht, glaube ich, dass zwischenmenschliche Beziehungen genauso wichtig sind wie andere Säulen der Gesundheit, etwa Bewegung, Schlaf und Ernährung. Aber wir schaffen es nicht, ihnen die entsprechende Priorität einzuräumen.
Genau das ist die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Unsere Welt steht derzeit vor einem sozialen Problem, und je eher wir diese Realität anerkennen, desto eher können wir damit beginnen, dagegen anzugehen. Das bringt mich zur Bitteren Wahrheit Nr. 1: Wir leben in einer gespaltenen Welt. Es gibt viele Sündenböcke, auf die wir mit dem Finger zeigen können: die verstärkte Nutzung von Social Media, die COVID-19-Pandemie, der Vormarsch des Homeoffice, die politische Polarisierung und unzählige andere. Unabhängig davon, wer oder was die Schuld daran trägt, müssen wir realisieren und anerkennen, dass unser Sozialleben immer weiter schrumpft – und das ist ein großes Problem.
Zum Glück wird das meiner Meinung nach allmählich erkannt. Ich war erleichtert zu sehen, dass die öffentliche Debatte über soziale Isolation in den letzten Jahren zugenommen hat. Unser soziales Problem schafft es immer öfter in die Schlagzeilen, es gibt inzwischen jede Menge Podcasts zum Thema. Und das Beste ist, dass es eine sehr offensichtliche und einfache Lösung für das Problem gibt: Mehr soziale Kontakte knüpfen! Aber haben wir auf diese Erkenntnis wirklich Taten folgen lassen? Hat sich etwas geändert? Ich persönlich finde, dass wenig passiert ist in puncto sozialem Miteinander und sich die Spaltung unserer Gesellschaft fortsetzt. Warum tun wir nicht genug, um das zu ändern? Ich vermute, dass den meisten noch nicht ganz klar ist, welche Folgen sich daraus ergeben, wenn wir nicht interagieren. Die bittere Wahrheit, auch wenn wir sie vielleicht nicht hören wollen, ist: Wir müssen dieses Problem ernst nehmen! Der Grund dafür ist die Bittere Wahrheit Nr. 2: Spaltung ist die Feindin der Hirngesundheit.
Das menschliche Gehirn wurde im Laufe der Evolution so geformt, dass es uns belohnt, wenn wir Verbindungen aufbauen und uns bestraft, wenn wir einsam sind oder uns isolieren. Deshalb können wir durch soziale Kontakte viel gewinnen und ohne sie wohl noch mehr verlieren. Wir alle wissen, dass wir eigentlich öfter ans Telefon gehen und uns mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen sollten, aber anscheinend fehlt uns die Motivation. Ich glaube, dass ein Grund, warum wir nicht handeln, darin besteht, dass die derzeitige Diskussion über Einsamkeit unvollständig ist. Wir haben gehört, dass Interaktion gut und Isolation schlecht für uns ist, aber was bedeutet das konkret für Gehirn und Körper?
Die meisten Artikel und Podcasts haben die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema zu wenig beachtet, dabei zeigen gerade diese, was wirklich auf dem Spiel steht. Und dazu gibt es eine Menge zu sagen. Soziale Verbundenheit wirkt bis tief in unser Innerstes und beeinflusst unzählige unserer inneren Systeme und Abläufe. Wenn wir unseren zwischenmenschlichen Bindungen keine Priorität einräumen, können wir auf biologischer Ebene auf eine Weise leiden, die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Erst wenn wir wirklich wissen, was auf dem Spiel steht, steigt meiner Meinung nach auch unsere Handlungsbereitschaft. Denn wie soll man motiviert sein, etwas zu tun, wenn man nicht weiß, wofür?
Eine letzte bittere Wahrheit gibt es noch, und die ist am schwersten zu schlucken. Wir machen zwar gerne externe Faktoren wie COVID-19 oder das isolierte arbeiten im Homeoffice für unser soziales Problem verantwortlich, müssen aber auch unsere eigene Rolle anerkennen. Die Art und Weise, wie wir uns als moderne Menschen verhalten, spaltet uns, aber es ist nicht allein unsere Schuld.
Das menschliche Gehirn bildete sich in einer Welt heraus, die ganz anders war als die, in der wir heute leben. Deshalb tut es nicht immer das, was wir in der heutigen Gesellschaft für gut und richtig halten. Beispielsweise streiten wir manchmal mit Fremden im Internet, empfinden weniger Empathie für Menschen, die anders sind als wir, und unterschätzen, wie wertvoll es ist, anderen ein Kompliment zu machen. Diese sozialen Fallstricke sind nicht hilfreich, um Beziehungen aufzubauen, aber sie resultieren aus der Art und Weise, wie unser Gehirn verdrahtet ist. So intelligent und fähig es auch sein mag, es ist kein perfektes Organ. Es hat Schwächen, die uns beim Knüpfen von Bindungen im Wege stehen können. Das bringt uns zur Bitteren Wahrheit Nr. 3: Das Gehirn hat interne Unzulänglichkeiten, die uns auseinandertreiben.
Wenn wir eine Gesellschaft gestalten wollen, in der wir uns bewusst für zwischenmenschliche Bindungen entscheiden und diese priorisieren, müssen wir meiner Meinung nach diese Hindernisse identifizieren und direkt angehen. In diesem Buch werden wir darüber sprechen, welch skurrile Dinge unser Gehirn macht, die uns weiter auseinandertreiben. Wir werden untersuchen, warum diese Fallen in unseren Köpfen eingebaut sind und diskutieren, was wir dagegen tun können. Mein Ziel ist es, unsere Scheinwerfer auf diese Schlaglöcher in unseren sozialen Gehirnen zu richten, sodass wir ausweichen und sie durch bewusstes und bedachtes Handeln umfahren können.
In der heutigen Welt haben alle Menschen einen gemeinsamen Feind: Spaltung. Die Menschheit führt einen leisen Krieg gegen einen Gegner, der unsere Hirngesundheit und die Zukunft unserer Spezies bedroht. Es gibt nur einen Weg, diesen Gegner zur Strecke zu bringen, und er ist denkbar einfach: indem wir Zeit miteinander verbringen.
Dieses Buch verschafft Ihnen Zugang zu Bergen von neurowissenschaftlicher Forschung und hilft Ihnen zu verstehen, worum es in diesem Kampf eigentlich geht. Gemeinsam werden wir fragen: Was bieten Interaktionen dem Gehirn auf biologischer Ebene? Was passiert, wenn wir mit anderen zusammen sind und was, wenn wir zu lange allein gelassen werden? Bringt die Interaktion mit Menschen im Internet dem Gehirn etwas? Zählt es, mit seinem Hund zusammen zu sein? Und welche heimtückischen Kräfte lauern unter der Oberfläche und warten nur darauf, an unseren Gehirnen herumzupfuschen und unsere Bindungen zu sabotieren? Bestimmt werden Sie die erstaunlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse manchmal verblüffen oder sogar schockieren. Sie werden lange Geglaubtes infrage stellen, und ich hoffe, dass die unglaublichen Systeme, die in uns ihre Wirkung entfalten, Sie faszinieren.
Vor allem aber hoffe ich, dass Sie, wenn ich meinen Job gut mache, motiviert sind, sich mit anderen zusammentun und den Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind aufnehmen.
Schon als Kind war ich fasziniert von sozialen Interaktionen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich mich in der Cafeteria meiner Grundschule umsah und völlig gebannt war von den vielen Tischen mit Kindern, die um mich herum zu Mittag aßen. An manchen Tischen saßen die schüchternsten Schüler, die nur deshalb in Gruppen saßen, weil man das eben so machte. Sie lasen Bücher oder starrten auf ihre Sandwiches, um sich nicht unterhalten zu müssen. Und wenn es doch einmal zu einem Gespräch kam, war es unbeholfen und unangenehm. Da ich zu den Kindern gehörte, die viel lasen, saß ich oft an diesen Tischen. Aber ich fühlte mich sozial ausgegrenzt. Ich verbrachte meine Mittagspause damit, mich umzusehen und mir vorzustellen, ich säße bei meinen lebhafteren und beliebteren Mitschülern. An ihren Tischen ging es lauter und lustiger zu. Es war eine komplett andere soziale Umgebung … eine, zu der ich gehören wollte.
Nachdem ich als Kind jahrelang Menschen beobachtet hatte, erkannte ich, dass sie alle möglichen sozialen Gewohnheiten haben. Ich stellte mir vor, dass Kontaktfreudigkeit auf einem Kontinuum existiert – von extremer Schüchternheit bis zu äußerst ausgeprägter Extrovertiertheit. Wo würden Sie sich einordnen?
Dieser Gedanke kam mir im Lauf der Jahre immer wieder in den Sinn, weil ich verstehen wollte, warum wir alle so verschieden sind. Glücklicherweise saß ich irgendwann an den Tischen der Extrovertierten, aber ich hörte nie auf, mich umzusehen. Ich hörte nie auf, die wunderbare Vielfältigkeit sozialen Verhaltens zu beobachten und mich nach den Systemen zu fragen, die unserer Einzigartigkeit zugrunde liegen.
Als ich aufs College kam, wählte ich Psychologie als Hauptfach in der Hoffnung, eines Tages vielleicht diese Unterschiede in unserem Sozialverhalten untersuchen zu können. Aber irgendwie hatte ich bei meiner Ausbildung kein gutes Gefühl. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht vollständig war, als ob ich das Falsche studieren würde. Es machte nicht so viel Spaß wie erwartet. Und während ich mich weiter durch meine Kurse arbeitete, wurde mir langsam klar, woran es lag: Ich lernte etwas über Verhalten und darüber, warum Menschen etwas tun. Aber eigentlich interessierte ich mich mehr für das Gehirn. Als ich an das soziale Kontinuum, meine Vorstellung aus Kindertagen, zurückdachte, erkannte ich, dass die einzigartige Weise, wie sich jeder einzelne Schüler gab, unsichtbare Unterschiede in der Funktionsweise seines Gehirns widerspiegelte! Ich fixierte mich darauf, diese Unterschiede genau zu bestimmen. Warum fühlen sich die Gehirne mancher Schüler an ruhigen Tischen wohler, während andere lieber mehr interagieren? Können wir diese sozialen Gewohnheiten auf bestimmte Gehirnsysteme zurückführen? Es schien, als hätte ich in der Erforschung des Gehirns meine wahre Leidenschaft entdeckt, aber es gab ein großes Problem … die Neurowissenschaften machten mir eine Heidenangst.
Das Fach schüchterte mich komplett ein. Der Wechsel auf Neurowissenschaften als Hauptfach hätte bedeutet, Kurse wie Biochemie, Genetik und Molekularbiologie belegen zu müssen und ich dachte, nicht das Zeug dazu zu haben. Da ich schon in jungen Jahren mit meinem Selbstvertrauen zu kämpfen hatte, glaubte ich nicht an mich. Statt meinen Traum zu verwirklichen, studierte ich weiter Psychologie und hoffte, dass am Ende alles gut gehen würde. So sehr ich auch befürchtete, einen Fehler zu machen, hatte ich das Gefühl, keine andere Wahl zu haben. Ich hatte einen guten Notendurchschnitt und wollte nicht riskieren, ihn durch einen Wechsel auf Neurowissenschaften zu ruinieren. Mit gesenktem Kopf bummelte ich auf eine Zukunft zu, von der ich nicht sicher war, ob ich sie wollte.
Dann änderte sich alles. Nur drei Semester vor meinem Abschluss hatte ich einen Albtraum, der mein Leben veränderte. In dem Traum war ich erwachsen. Ich hatte eine Familie und ein Zuhause. Oberflächlich betrachtet war alles normal, aber ich wurde von einer unsichtbaren, bösen Macht verfolgt, die mein Leben kontrollierte. Wenn ich ihr nicht gehorchte, machte ich eine grauenvolle Verwandlung durch: Meine Arme und Beine verrenkten sich, mein Gesicht quoll auf, bis die Haut fast aufplatzte, und mein Körper war von Wunden übersät. Es war genau so schrecklich, wie es sich anhört. An einem entscheidenden Punkt des Traums rief mich die dämonische Kraft in den Keller meines Hauses. Bisher war sie unsichtbar geblieben, aber nun würde sie sich jeden Moment offenbaren. Ich spürte eine unglaubliche, furchtbare Macht, die mich mit Grauen erfüllte. Meine Angst war unbeschreiblich. Und als die Kraft übermächtig wurde, wachte ich auf.
Das Gefühl beim Aufwachen war noch genauso intensiv. Mit einem Ruck setzte ich mich in meinem quietschenden, schmalen Bett auf. Der Raum war dunkel und still. Es war zwar mitten in der Nacht, aber durch meinen Körper pumpte das Adrenalin. Ich legte mich wieder hin und versuchte, mich zu beruhigen, aber der Albtraum hallte in mir nach. Von all den Gedanken, die mir hätten kommen können, hatte ich nur den einen: Wie zum Teufel hat mein Gehirn das gemacht? Ich war fasziniert, dass ein einziges Organ einen so komplexen Albtraum mit blühenden Landschaften, unberechenbaren Akteuren und einer fesselnden Geschichte entwickeln und gleichzeitig erleben konnte, indem es mit den Figuren interagierte und Entscheidungen traf. Wie konnte das alles in meinem Gehirn passieren?
Diese Neugierde war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich drehte offiziell durch. Es war klar, dass ich meinen wahren Wunsch, Neurowissenschaften zu studieren, nicht länger unterdrücken konnte. Ich blieb die ganze Nacht auf und plante meinen Wechsel. Gleich am nächsten Tag sprach ich mit meiner Studienberaterin, trat dem Studentenclub für Neurowissenschaften bei und bewarb mich bei neurowissenschaftlichen Labors als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ich hatte vor, weiterhin soziales Verhalten zu studieren, jetzt aber aus einem neurowissenschaftlichen Blickwinkel. Ich hoffte, dass ich vielleicht, nur vielleicht, eines Tages herausfinden würde, warum die Gehirne mancher Schüler lieber auf ihre Sandwiches starren, während andere lieber laut und rüpelhaft sind.
Wenn ich an meinen Albtraum zurückdenke, frage ich mich, ob diese böse »Kraft« für meine Karriere stand. Vielleicht wollte mich mein Unterbewusstsein davor warnen, dass ich auf eine unangenehme Zukunft zusteuerte, in der mein Job mein Leben beherrschen würde. Hätte ich den falschen Beruf gewählt, ich hätte Dinge tun müssen, die ich nicht hätte tun wollen. Ich hätte mich in eine Version meiner selbst verwandelt, mit der ich mich nicht hätte identifizieren können.
Vielleicht hätte diese Erkenntnis sich mir aber nie im Traum offenbart. Vielleicht sollte sie mir vielmehr im wirklichen Leben kommen, in diesen Momenten nach dem Aufwachen, als ich nicht aufhören konnte, über das Gehirn nachzudenken. Ich frage mich, ob die Kraft, der ich im Traum beinahe begegnet wäre, vielleicht mein Unterbewusstsein war, das mir einen Schrecken einjagen wollte, um mich auf den Fehler hinzuweisen, den ich im Begriff war zu machen.
Natürlich hat diese Geschichte ein glückliches Ende. Ich promovierte in Neurowissenschaften an der SUNY Buffalo und absolvierte meinen Bachelor-Abschluss und meine Promotion in nur 7,5 Jahren. In den beängstigenden Kursen mit den langen Namen, von denen ich dachte, ich würde sie niemals bestehen, schlug ich mich sehr gut. Nach meiner Promotion bekam ich eine Anstellung als Neurowissenschaftler an der Stanford University. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich mehr als zwanzig wissenschaftliche Artikel zur Frage veröffentlicht habe, wie das soziale Gehirn funktioniert. In meiner Forschung habe ich untersucht, wie unsere Gene unser soziales Verhalten formen, wie Drogen wie MDMA (auch bekannt als Molly oder Ecstasy) Empathie verstärken, wie soziale Motivation durch Umweltfaktoren beeinflusst werden kann, warum Menschen in sozialen Medien brutal miteinander umgehen, wie zwischenmenschliche Interventionen Selbstmorde verhindern und sogar, wie man soziale Interaktionen bei Mäusen messen kann. Ich bin stolz auf mein jüngeres Ich, weil ich den Mut hatte, eine Herausforderung anzunehmen, die mir zwar Angst einjagte, sich aber notwendig anfühlte.
Durch meine Arbeit auf dem Gebiet der Neurowissenschaften bin ich zu erstaunlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen über zwischenmenschliche Interaktion gelangt, die ich in diesem Buch unbedingt mit Ihnen teilen möchte. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es Ihnen wie mir geht und Sie Neurowissenschaften einschüchternd finden. Dieses Buch ist für Sie. Neben meiner Arbeit im Labor habe ich das Vergnügen, auf Social Media mit allen Interessierten meine Faszination für die rätselhafte Schönheit des Gehirns zu teilen. Ich arbeite daran, wissenschaftliche Themen einfach zu kommunizieren, da ich glaube, dass jeder etwas über das Hirn lernen kann, wenn die Information richtig aufbereitet ist. Wir alle haben eines, und es ist unser Recht zu verstehen, wie es funktioniert. Deshalb habe ich dieses Buch so geschrieben, dass jeder Zugang zu diesem Wissen hat.
Es ist keine Neuigkeit, dass wir ein soziales Problem haben. Ich bin sicher, dass in vielen Büchern, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden, die Diagnose gestellt wird, wie isoliert wir inzwischen sind. Zu dieser Sorte Buch gehört dieses nicht. Hier geht es nicht nur darum, Ihnen Dinge zu erzählen, die Sie bereits wissen: dass unsere Isolation in der sich verändernden Welt voranschreitet. Ich möchte tiefer in die geheimnisvolle Biologie des Gehirns vordringen und Ihnen die Bedeutung dieser Veränderungen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden erläutern. Auf diesen Seiten erkläre ich Ihnen nicht nur, dass Sie zwischenmenschliche Bindung brauchen, sondern auch warum.
Wir werden unzählige Fragen über die rosafarbene, schwammige Maschine in Ihrem Kopf beantworten, die unbedingt Gesellschaft will. Wir werden uns mit einer enormen Menge an wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigen, die über mehrere Jahrzehnte und auf mehreren Kontinenten gewonnen wurden. Und obwohl Sie wahrscheinlich noch nie von diesen Studien gehört haben, haben sie das Potenzial, Ihr Leben maßgeblich zu verändern.
Das Wichtigste im Überblick
Sozialkontakte sind entscheidend für unser Wohlbefinden. Sie sind nicht nur eine nette Option, sondern genauso wichtig wie Bewegung, Schlaf und Ernährung. Dennoch neigen wir dazu, sie als Schlüsselkomponente unserer Gesundheit zu vernachlässigen.Sozialkontakte haben tiefgreifende gesundheitliche Vorteile. Sie stehen in Verbindung mit einem geringeren Risiko für Demenz, Herzversagen, Diabetes, Depressionen, Angststörungen und sogar mit einer höheren Schmerztoleranz und längeren Lebenserwartung.In der öffentlichen Diskussion über Einsamkeit wurde bislang versäumt, die zugrunde liegenden neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Dieses Buch wird klären, was tatsächlich auf dem Spiel steht. Wir müssen drei bittere Wahrheiten über soziale Interaktion anerkennen: Wir leben in einer gespaltenen Welt. Äußere Faktoren wie Social Media, die Pandemie und die politische Polarisierung haben uns weiter auseinanderrücken lassen. Spaltung ist die Feindin der Hirngesundheit. Das Gehirn ist so verdrahtet, dass es Verbindung belohnt und Isolation bestraft, was Vereinsamung zu einer ernsthaften Bedrohung für unser Wohlbefinden macht.Das Gehirn hat interne Unzulänglichkeiten, die uns auseinandertreiben.Unsere neuronale Verdrahtung weist Fehler und bestimmte Tendenzen auf, die Beziehungen erschweren. Das Verständnis dieser natürlichen Schwächen kann uns helfen, ein wirkungsvolleres Sozialleben zu führen.* Alle in diesem Buch zitierten Quellen habe ich online für Sie zusammengestellt. Sie finden sie unter benrein.com/book.
I
Wie Interaktion und Isolation die Hirngesundheit beeinflussen
1
Seien Sie nicht schüchtern
Die versteckten Vorteile sozialer Interaktion
Eine Post-Interaktions-Welt
Ihr Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Während es still und leise hinter Ihren Augen liegt, sammelt es unablässig Informationen aus Ihrer Umwelt und schätzt ab, was als nächstes passieren wird. Das ist gut: Dadurch können Sie schneller Entscheidungen treffen und sich einer sich verändernden Umwelt anpassen. Denken Sie an Tom Hanks im Film Cast Away – Verschollen. Erst hat Hanks Probleme, mit einem Speer Fische zu jagen, aber im Lauf der Zeit schafft er es. Nachdem er die Fische lange genug von oben beobachtet hatte, lernte sein Gehirn ihre Schwimmmuster und wurde besser darin, ihre nächste Bewegung vorherzusagen. Das ermöglichte es ihm schließlich, sie mit dem Speer zu erlegen. So etwas geschieht in allen Bereichen des Lebens: Ihr Gehirn passt sich ständig an die sich verändernde Umwelt an und aktualisiert seine Vorhersagen, um immer genauer zu werden.
Normalerweise ist das hilfreich, aber was passiert mit unseren Prognosen in einer Welt, in der unsere sozialen Kontakte abnehmen? Ob absichtlich oder nicht, die Menschheit scheint immer tiefer in die Isolation abzurutschen. Es ist inzwischen üblicher, durch Social Media zu scrollen als das Telefon zu nehmen und einen Freund anzurufen. Anstatt mit dem Verkäufer zu plaudern, ordern wir unsere Lebensmittel per App. Wir bestellen online unser Essen, anstatt ins Restaurant zu gehen und den Kellner zu fragen, was auf der Tageskarte steht. Sogar einen Nine-to-five-Arbeitstag kann man ohne jegliche Sozialkontakte zu Hause im Bett vor dem Computer verbringen.
Diese Veränderungen haben sich im Laufe der Jahre schleichend und fast unbemerkt vollzogen. Daher glaube ich, dass unser Gehirn seine Erwartungen an Sozialkontakte nach unten geschraubt hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin nicht mehr schockiert, wenn ein Sprachautomat meinen Anruf entgegennimmt. Vielmehr bin ich überrascht, wenn ich einen echten Menschen erreiche. Mein Gehirn hat sich auf unsere veränderte Welt eingestellt und seine Vorhersagen entsprechend aktualisiert: Es erwartet jetzt, mit einer Maschine statt mit einem Menschen zu sprechen. Dieses Beispiel steht stellvertretend für das, was überall in der Gesellschaft geschieht. Ohne es zu merken, passt sich unser Gehirn an eine Welt an, in der wir weniger mit anderen interagieren.
Erschwerend kommt hinzu, dass eine weitere dramatische Veränderung im Jahr 2020 unser Sozialleben einschränkte und schrumpfen ließ. Die COVID-19-Pandemie, vermutlich das Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das die Vereinsamung am stärksten befeuert hat, stürzte Milliarden von Menschen in die dunklen Tiefen der Isolation. Während wir zu Hause festsaßen, zogen düstere Einsamkeitswolken heran und warfen ihre Schatten auf unser Wohlbefinden. Wir saßen in der Stressfalle fest.
Nach und nach kehrten wir in unsere geliebte Welt zurück, nur um festzustellen, dass sie sich drastisch verändert hatte. Bei sozialen Interaktionen schwang nun immer die Sorge mit, sich möglicherweise seltsamen, neuartigen Krankheitserregern auszusetzen. Bewegten wir uns im öffentlichen Raum, begleitete uns jetzt immer eine ungewohnte Angst, die sich wie eine Schicht über alles legte. Wir wollten nicht mehr mit dem Metzger sprechen, besser, wenn er unser Essen gar nicht erst anfasste. Egal, ob Arbeit, Sport oder Lebensmitteleinkäufe, wir gewöhnten uns daran, alles von zu Hause aus zu erledigen. Folglich passte sich unser Gehirn daran an, dass wir unsere Kolleginnen, Sportkameraden und Nachbarn seltener sahen. Für eine Spezies mit einem sehr sozialen Gehirn ist das schlecht.
Diese sozialen Veränderungen haben unser Gehirn vermutlich dazu gebracht, neue Vorhersagen zu berechnen und immer weniger soziale Kontakte zu erwarten. Aber nur weil das Gehirn seine Erwartungen zurückgeschraubt hat, heißt das nicht, dass es seine Bedürfnisse zurückgeschraubt hat. Stellen Sie sich zum Vergleich vor, dass unsere Schlafgewohnheiten von ähnlichen Veränderungen betroffen wären, sodass wir nur drei oder vier Stunden Schlaf pro Nacht bekämen. Was würde passieren? Natürlich würden wir uns einfach an diese neue Norm gewöhnen, unseren Lebensstil anpassen und wahrscheinlich viel mehr Kaffee trinken. Wir würden uns daran gewöhnen, müder zu sein. Aber nur weil sich unsere Psyche an den Schlafmangel gewöhnt hat, bedeutet das nicht, dass unser Gehirn nicht mehr volle acht Stunden braucht, um optimal zu funktionieren. Wir wären weniger glücklich und hätten ein höheres Risiko für Krankheiten wie Alzheimer – und das alles nur, weil die Bedürfnisse unseres Gehirns nicht befriedigt werden.
Ich glaube, dass sich Ähnliches in unserem Sozialleben abspielt. Eine gespaltene Welt treibt uns dazu, uns voneinander zurückzuziehen und uns der sozialen Stimulation zu berauben, die für unser Dasein so elementar wichtig ist. Das menschliche Gehirn hat ein tiefes, grundlegendes Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, und in einer Post-Interaktions-Welt geraten seine steinzeitlichen sozialen Systeme durcheinander.
Allerdings wird der Abstand zwischen uns tatsächlich immer größer. Von 2013 bis 2021 sank die Zeit, die die Amerikaner mit Freunden verbrachten, um etwa fünfzehn Stunden pro Monat, während die Zeit, die sie allein verbrachten, um über sechsunddreißig Stunden anstieg.
Laut Statista fühlt sich etwa ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland zumindest teilweise einsam, knapp 20 Prozent fühlen sich sogar sehr einsam. Im Jahr 2018 gaben 32 Prozent der Deutschen an, weniger Freunde zu haben als 5 Jahre zuvor. Die damalige Bundesfamilienministerin Lisa Paus bezeichnete 2024 Einsamkeit als eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Ja, es ist richtig schlimm.
Aber mal ehrlich: Spielt das wirklich eine Rolle? Brauchen wir tatsächlich den Umgang mit anderen Menschen, um glücklich und gesund zu sein? Wie stark beeinflusst soziale Verbundenheit unser Wohlbefinden wirklich?
Die Antworten auf diese Fragen lauten, Ja, Ja und sehr stark. Eine Fülle wissenschaftlicher Daten zeigt, dass Interaktion einen enormen Einfluss auf unser Gehirn hat.
Um dies zu erklären, werden wir einen Weg einschlagen, der überraschenderweise mit der Psychologie der Interaktion beginnt, bevor wir zu den neurowissenschaftlichen Grundlagen übergehen. So wie mich mein akademischer Weg über die Psychologie zu den Neurowissenschaften geführt hat, werden wir die gleiche Route nehmen, da sie hilft, das große Ganze zu sehen. Sich zunächst mit den psychologischen Hintergründen zu befassen, schafft eine Grundlage, die dann von der Neurowissenschaft gestützt (und erklärt) wird. Dies hilft Ihnen, Ihre Gedanken und Neigungen nicht nur aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht zu verstehen, sondern auch die Frage zu beantworten, was im Inneren des Gehirns auf Zellebene passiert. Im Zusammenspiel von Psychologie und Neurowissenschaft besteht der eigentliche Zauber. Wenn wir eine Verbindung zwischen menschlichem Handeln und bestimmten Molekülen herstellen können, kratzt unser Wissen nicht mehr nur an der Oberfläche, sondern stößt tief in unbekannte, neuronale Welten vor, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.
Seien Sie nicht schüchtern
Seit es uns gibt, suchen wir Menschen nach Antworten auf die Frage: Was macht uns glücklich? Ist es Geld? Ruhm? Ein schnelles Auto? Dicke Muskeln? Ein riesiger Eisbecher an einem sonnigen Tag? Oder könnte es etwas so Einfaches sein wie … Beziehungen zu anderen Menschen?
Natürlich erzähle ich Ihnen jetzt, dass soziale Interaktionen gut für Sie sind. Aber Sie werden vielleicht überrascht sein, wie wirkungsvoll sie Stimmung und Wohlbefinden verbessern können. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass soziale Kontakte und Dankbarkeit die wirksamsten Mittel sind, um unser Glücksgefühl zu steigern – sogar noch vor Sport, Meditation und Aufenthalten in der Natur. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Fühlen wir uns unmittelbar nach einer Interaktion besser?
Eine Studie der University of Washington in St. Louis legt dies nahe. Die Forscher baten etwa 250 Studierende, eine Woche lang eine Abhörwanze auf dem Campus zu tragen … für die Wissenschaft! Natürlich war es nicht wirklich eine Wanze. Es handelte sich um ein Tonaufnahmegerät, das die Forscher als »electronically activated recorder« bezeichneten und im Paper als »E.A.R.« abkürzten. Sie benutzten es, um die Gespräche der Studierenden aufzuzeichnen und Informationen über ihre Interaktionen zu sammeln. Okay, ich schätze, im Grunde war es doch eine Wanze.
Während der ganzen Woche dokumentierten die Studierenden außerdem viermal am Tag, wie glücklich sie waren. Ziel war es, herauszufinden, ob eine soziale Interaktion ihre Stimmung beeinflusst. Die Forscher sammelten über 150 000 Audioaufnahmen à dreißig Sekunden. Dann machte sich eine Gruppe von »extrem glücklichen« Forschungsassistenten daran, diese Mitschnitte anzuhören und auszuwerten. Du meine Güte … das sind fast 53 ganze Tage als Aufzeichnungen. Aber was haben sie herausgefunden?
Generell waren die Studierenden in den ersten Stunden nach einem Gespräch deutlich besser gelaunt, und je länger das Gespräch gedauert hatte, desto glücklicher waren sie! Die größte Stimmungssteigerung trat ein, wenn sie mit Menschen zu tun hatten, die sie mochten und besser kannten – keine Überraschung. Ein nicht absehbares Ergebnis zeigte sich jedoch bei der Analyse der Aufnahmen (Gott sei Dank waren die 53 Tage nicht umsonst). Die Studierenden, die im Gespräch mehr von sich preisgaben, hatten die stärksten Stimmungsspitzen. Für mich klingt das nach einem guten Grund, in unseren Interaktionen offener und transparenter zu sein.
Klar ist, dass organische Interaktionen, die natürlich zustande kommen – indem wir uns bewusst entscheiden, mit anderen in Kontakt zu treten – die Menschen glücklicher machen. Aber wie steht es mit Interaktionen, die nicht organisch sind? Würden die Studierenden es genauso genießen, wenn sie gezwungen wären, mit einer zufälligen Person zu interagieren? Diese Frage ist wichtig, weil wir wahrscheinlich neue Interaktionen in unserem täglichen Leben etablieren müssen, wenn wir unser soziales Problem lösen wollen. Könnten auch diese nicht-organischen Gespräche unsere Stimmung heben, oder ist das nur eine sinnlose Übung?
Zum Glück ist uns Dr. Nicholas Epley, Professor an der University of Chicago, einige Schritte voraus. Epleys Labor hat untersucht, was passiert, wenn Menschen gezwungen werden, mit einer unbekannten Person zu sprechen. Ich bin ein großer Fan seiner Forschung, weil er seine Studien im echten Leben durchführt. So forderte sein Team beispielsweise einmal britische Pendler, die mit dem Zug nach London fuhren, auf, sich während der Fahrt mit einer zufälligen Person zu unterhalten, um zu sehen, wie sich dies auf ihre Stimmung auswirkt. Am Ende bewerteten die Pendler, die sich mit einer unbekannten Person unterhalten hatten, ihre Fahrt als mehr als doppelt so angenehm wie die Kontrollgruppe+, die stattdessen schweigend dasaß. Genau wie in der Studie mit College-Studenten bewerteten die Teilnehmer ihre Fahrt umso besser, je mehr Zeit sie mit einem Gespräch verbrachten. Alter, Geschlecht oder Ethnie der unbekannten Person, mit der sie sich unterhielten, spielten dabei keine Rolle. Die kontaktfreudige Gruppe genoss ihre Fahrt immer mehr.
Es scheint, als würden sogar erzwungene Interaktionen die Stimmung aufhellen und Epleys Team konnte zeigen, dass dies auch in Bussen, Taxis und Wartezimmern der Fall ist. Unabhängig davon, wo Menschen sind, machen sie offenbar bessere Erfahrungen, wenn sie mit den ihnen unbekannten Personen in ihrer Umgebung sprechen.
Was also verraten uns all diese Forschungsergebnisse aus der Psychologie? Kurz gesagt: Sozialkontakt gibt Menschen ein gutes Gefühl. Unabhängig davon, ob unsere Interaktionen organisch zustande kommen (z. B. wenn wir in einem Laden einen Freund treffen) oder eher erzwungen und »künstlich« sind (z. B. wenn wir eine unbekannte Person im Zug oder Bus ansprechen), scheinen sie immer die Stimmung zu heben. Natürlich gibt es Unterschiede im psychologischen Wert einer Interaktion, abhängig von ihrer Qualität und den beteiligten Personen (z. B. führt die Interaktion mit Freunden zu den größten Stimmungsspitzen). Aber selbst kurzzeitige Interaktionen – wie ein Dankeschön für den Busfahrer beim Aussteigen – steigern erwiesenermaßen das Wohlbefinden. Vielleicht reichen schon ein paar gemurmelte Worte im Vorbeigehen, um unsere Stimmung zu heben.
Langfristig erweist es sich als sehr vorteilhaft, solche sozialen Gewohnheiten zu priorisieren. Die Wissenschaft zeigt, dass Menschen, die einen eher kontaktfreudigen Lebensstil führen, glücklicher sind. Menschen fühlen sich sogar dann besser, wenn sie extrovertierter auftreten. Als College-Studenten aufgefordert wurden, sich eine Woche lang extrovertiert zu verhalten (d. h. »gesprächig, selbstbewusst und spontan«) und eine weitere Woche lang introvertiert (»bedächtig, ruhig und zurückhaltend«), steigerte sich ihre Stimmung wesentlich, als sie sich extrovertiert verhielten, und fiel deutlich ab, als sie sich introvertiert gaben.
Mit diesen Erkenntnissen im Kopf ermutige ich Sie dazu, einen Blick auf Ihr Leben zu werfen und zu schauen, inwieweit Sie Ihr Sozialleben ausweiten könnten. Angesichts der Bitteren Wahrheit Nr. 1: Wir leben in einer gespaltenen Welt verpassen Sie vielleicht jede Woche Dutzende Gelegenheiten, mit anderen in Kontakt zu treten. Anstatt zu warten, bis der Anruf eines Familienmitglieds an die Mailbox weitergeleitet wird, nehmen Sie ab. Wenn Sie versucht sind, ein Abendessen oder einen Drink mit Freunden abzusagen, denken Sie bitte daran, welchen Einfluss diese Entscheidung auf Ihr Wohlbefinden haben könnte. Wir sollten uns vornehmen, Interaktionen mit anderen Menschen einen hohen Stellenwert im Leben einzuräumen, genauso wie wir uns vornehmen, uns gut zu ernähren, mehr Sport zu treiben und ausreichend zu schlafen, wenn wir das Beste für unsere Gesundheit tun wollen. Und ganz im Ernst – ich mache keine Witze – versuchen Sie mal, sich mit einer unbekannten Person zu unterhalten und schauen Sie, wie es sich anfühlt. Ich wette, Sie werden überrascht sein. Soziale Kontakte sind wie eine leckere Frucht, die nur darauf wartet, geerntet zu werden – eine Frucht, die die seltene und wertvolle Fähigkeit besitzt, sich positiv auf Ihre Hirngesundheit und Ihre Stimmung auszuwirken. Deshalb ermutige ich Sie, über Ihr Leben nachzudenken und sich die folgenden Fragen zu stellen:
Wie oft treffen Sie Freunde und Familie? Wie sieht es im Vergleich zu den vergangenen Jahren aus?Treffen Sie Entscheidungen, die Sie isolieren, wie z. B. Anrufe zu ignorieren, Lebensmittel online zu bestellen oder lieber zu Hause zu bleiben, statt der Einladung von Freunden zu folgen?Hätten Sie ein gutes Gefühl dabei, eine Unterhaltung mit einer unbekannten Person anzufangen?Öffnen Sie die Motorhaube
Bevor wir weitermachen, ist es Zeit, ein paar wichtige Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft einfließen zu lassen, um das Ganze umfassender zu erklären. Warum geben uns soziale Interaktionen überhaupt ein gutes Gefühl?
Lassen Sie uns zunächst ein Grundprinzip festlegen: Bei jeder psychologischen Erfahrung, die Sie machen, findet ein entsprechendes Ereignis in Ihrem Gehirn statt, das diese Erfahrung auslöst. Das ist das magische Zusammenspiel zwischen Psychologie und Neurowissenschaft, auf das ich vorhin angespielt habe.
Wenn Sie beispielsweise beim Streicheln eines Hundes ein Gefühl der Freude empfinden, laufen bestimmte Teile Ihres Gehirns auf Hochtouren, um dieses Gefühl der Freude zu erzeugen (wahrscheinlich Bereiche im Belohnungszentrum). Wenn der Hund sich umdreht und laut in Ihre Richtung furzt, könnten diese Bereiche im Belohnungszentrum ihre Aktivität herunterfahren, was zu etwas weniger Freude führt. Unterdessen schalten sich andere Bereiche ein, z. B. diejenigen, die für Ekel zuständig sind. Wenn Sie verstehen, wie sich die Zahnräder in Ihrem Inneren drehen, bekommen Sie ein tieferes Verständnis für Ihre Empfindungen. Wenn Sie sich den menschlichen Körper als Auto vorstellen, ist das Gehirn der Motor, der uns antreibt. Manchmal lohnt es sich, die Motorhaube zu öffnen und einen Blick ins Innere zu werfen.
Lassen Sie uns nun dieses Prinzip auf soziale Interaktionen anwenden. Im ersten Teil dieses Kapitels stellten wir fest, dass es ein psychologisches Phänomen gibt: Soziale Interaktionen geben uns ein gutes Gefühl. Nun stellt sich die Frage: Was passiert da im Gehirn? Um sie zu beantworten, wenden wir uns etwas zu, das tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt ist: dem neurowissenschaftlichen Konzept der sozialen Belohnung.
Während meines Studiums der Naturwissenschaften kam ich zu der Erkenntnis, dass fast jeder Bestandteil des Körpers einen coolen evolutionären Ursprung hat. Ist es zum Beispiel nicht seltsam, dass Sie eine Nase haben? Seltsame Frage, ich weiß, aber muss die da wirklich sein? Natürlich braucht man Nasenlöcher zum Atmen, wenn der Mund nicht zur Verfügung steht (z. B. beim Essen), aber warum die ganze Nase? Könnten Sie nicht einfach zwei Nasenlöcher im Gesicht haben wie Voldemort? Tatsächlich aber hat die Nase viele Funktionen. Zum einen fungiert sie als Filter. Sie ist eine mit Haaren und Schleim ausgekleidete Falle, die verhindert, dass unerwünschte Dinge in Ihre Atemwege gelangen. Zweitens sorgt sie dafür, dass die Nasenlöcher nach unten gerichtet sind. So wird verhindert, dass ständig Wasser und Schmutz in sie hineintropfen. Unsere Nase hilft uns beim Überleben, so unförmig sie auch sein mag. Voldemort würde ein starkes Immunsystem brauchen, das ihn vor all dem Mist schützt, den er ins Gesicht bekommt.
Auch die innere Funktionsweise des Gehirns hat einen zweckmäßigen, in der Evolution verwurzelten Ursprung. So wie es eine gute Erklärung dafür gibt, dass wir eine Nase haben, gibt es auch einen guten Grund dafür, dass sich das Gehirn bei Interaktion gut fühlt. Es läuft darauf hinaus: In der Vorzeit hatten wir in Gruppen bessere Überlebenschancen. Vor Jahrtausenden wäre es total ätzend gewesen, allein zu sein. Stellen Sie sich einen Einzelkampf mit einem Säbelzahntiger vor. Das hört sich nach dem sicheren Tod an (und nach einem nicht gerade angenehmen). Mit 15 oder 20 Gleichgesinnten hatte man vielleicht eine Chance. Wenn es um »survival of the fittest« (also das Überleben der am besten angepassten Individuen) ging, waren die am besten angepassten oft die sozialsten Menschen. Wir sind vielleicht nicht die stärksten oder bösartigsten Tiere auf der Erde, aber wir sind verdammt schlau und können unglaublich gut kommunizieren. Das macht uns gefährlich effektiv, wenn wir im Team arbeiten. Um unser Überleben zu sichern, zielte unsere Verdrahtung auf soziales Verhalten ab.
Was aber bedeutet es eigentlich, »verdrahtet zu sein, um sich sozial zu verhalten«? Nun, vielleicht hilft hier eine kleine Übung. Stellen wir uns vor, Sie wurden geboren, um für die Erde zu arbeiten und den vielen Arten zu dienen, die hier leben – keine kleine Aufgabe. Ihr Job besteht darin, dafür zu sorgen, dass alle Tiere am Leben bleiben, und das machen Sie, indem Sie die hilfreichen Anpassungen auswählen, die ihr Überleben fördern. Ihre Chefin, Mutter Natur höchstpersönlich, hat eine neue Aufgabe für Sie: die Menschen. Sie müssen sie am Leben halten, indem Sie sie so formen, wie es nötig ist. Während Sie sie beobachten, stellen Sie fest, dass sie bei der Jagd und Selbstverteidigung dann besonders erfolgreich sind, wenn sie zusammenarbeiten. Um sie am Leben zu erhalten, beschließen Sie daher, eine neue Eigenschaft zu entwickeln, die sie dazu bringt, in Gruppen zu leben. Sie können an ihren Gehirnen und Körpern nach Belieben herumbasteln. Für welche Eigenschaft würden Sie sich entscheiden?





























