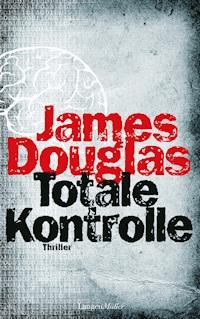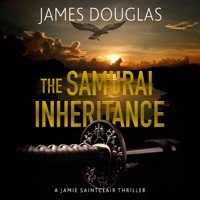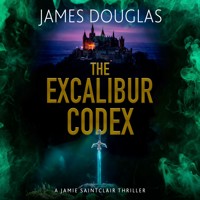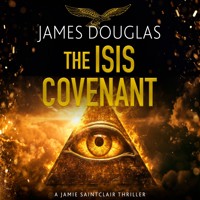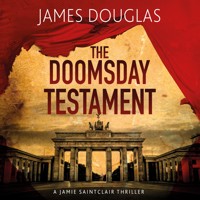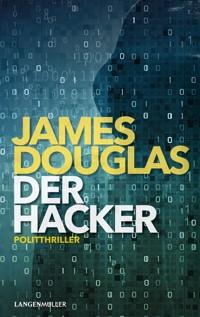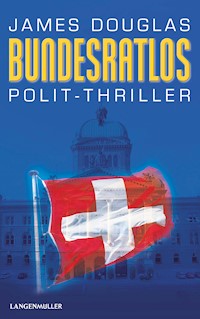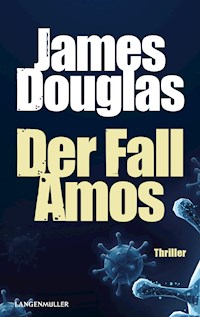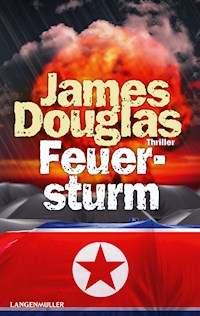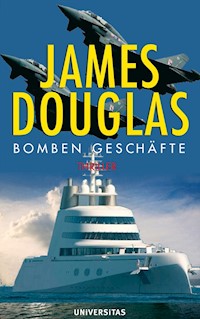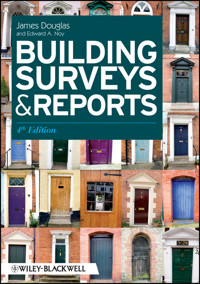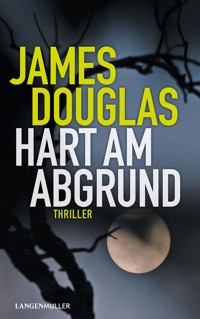
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Atomwissenschaftler verunglückt mit seinem Auto tödlich, gefunden wird er an einem Baum aufgehängt. Offensichtlich eine Warnung, aber an wen? Kurz darauf verschwindet auf mysteriöse Weise ein Container der Europäischen Organisation für Kernforschung. Der Inhalt: hochgefährliche Antimaterie. Neben Polizei und Geheimdiensten geht auch eine private Spezialeinheit auf die Jagd nach den Dieben, einer islamistischen Terrorzelle, wie sich bald herausstellt. Deren Ziel ist die Ausradierung Tel-Avivs. Auf einem Schweizer Militärflughafen kommt es zum Showdown: Gelingt es den Terroristen, den Container auszufliegen und ein Inferno zu entfesseln?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
auch von James Douglas
Der Hacker
Der Fall Amos
Feuersturm
Zu Früh zum Sterben
Totale Kontrolle
Goldauge
Bundesratlos
Eiskalt
Atemlos nach Casablanca
Englisch und mehr: james-douglas.ch
© 2025 Langen Müller Verlag GmbH,
Thomas-Wimmer-Ring 11, 80539 München
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns auch die Nutzung von uns veröffentlichter Werke für Text und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlag: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: Stagsiva/Shutterstock
Satz und E-Book Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding
ISBN 978-3-7844-8536-2
www.langenmueller.de
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Vorbemerkung
Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Personen, Orte und Begebenheiten sind entweder der Fantasie des Autors entsprungen oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen lebenden oder toten Personen, Ereignissen oder Orten ist rein zufällig.
Aus dem Sonntagsblick vom 29. Dezember 2024:
CERN-Forschende planen ein waghalsiges Experiment: Antimaterie soll im Lastwagen durch Europa reisen.
Dieses Vorhaben wäre eine wissenschaftliche Premiere – und ein gewagtes Unterfangen. Denn: Antimaterie ist laut Schätzungen eine der teuersten Substanzen auf der Erde. Sie lässt sich als eine Art Spiegelbild der gewöhnlichen Materie verstehen … Ganz ungefährlich ist sie nicht: Kommt Antimaterie mit Materie in Kontakt, löschen sie sich gegenseitig aus, und Energie wird freigesetzt. Je ein Viertel Gramm würde ausreichen, um die Wucht der Hiroshima-Bombe zu erzeugen.
Für den Transport der Antimaterie haben die Forschenden einen speziellen Container entwickelt, der die Antimaterie sicher aufbewahrt. Er hält die Antimaterie in einem stabilen Schwebezustand. »Ursprünglich wollten wir einen Container, der in einen Kofferraum passt«, sagt S. »Er ist zwar etwas größer geworden als geplant, aber er passt noch immer durch Labortüren und auf die Ladefläche eines Lastwagens.«
Das Ziel des Transports ist ein spezialisiertes Labor in Düsseldorf (D), wo die Antimaterie genauer untersucht werden soll. Aber weshalb betreibt man überhaupt diesen Aufwand?
»Wir wollen eines der größten Rätsel des Universums lösen«, erklärt S. »Wir gehen davon aus, dass beim Urknall gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sind. Diese hätten sich jedoch gegenseitig auslöschen müssen. Dennoch besteht unser Universum fast ausschließlich aus Materie – warum, wissen wir nicht.«
Prolog
Deubel hatte schlechte Laune. Er wartete bereits seit über einer Stunde in seinem Toyota. Nichts bewegte sich auf dem Parkplatz. Langsam stieg die Wut in ihm auf, und er schwor sich, es ihm heimzuzahlen – dem arroganten Akademiker mit seinem protzigen Luxusschlitten.
Im Restaurant selbst konnte er durch den dichten Regenschleier hindurch nichts erkennen, doch der Schlemmer saß bestimmt irgendwo an einem Tisch und stopfte sich voll. Vielleicht ahnte er schon, dass es eine Henkersmahlzeit sein würde.
Deubel warf die Zigarette aus dem Fenster, blickte auf die Uhr am Armaturenbrett. Es war 23.45 Uhr. Innerlich fluchend steckte er sich eine neue Zigarette an und sah zur Sonnenblende auf das dort angeklemmte Foto. Im schwachen Innenlicht erkannte er das Gesicht, das er sich längst eingeprägt hatte. Darunter stand der hingekritzelte Name: Francis W. Higgins.
Endlich regte sich im Restaurant etwas schemenhaft. Der Regen hörte auf. Zwei Männer traten aus dem Restaurant, blieben stehen. Sie waren stämmig. Der im schwarzen Pullover begann zu rauchen, der andere zog die Kapuze tiefer ins Gesicht und schlenderte zu den geparkten Wagen. Er schlich zum weißen Kastenwagen, etwa zehn Meter entfernt, und rüttelte an der Klinke. Deubel beobachtete interessiert. Der Kapuzentyp ging von Wagen zu Wagen, prüfte die Türgriffe. Beim letzten in der Reihe, einem Ford Pick-up, verweilte er länger. Er rüttelte am Türgriff. Offenbar konnte er die Tür öffnen, jedenfalls pfiff er mit zwei Fingern im Mund seinen Kumpel heran.
Deubel war froh über die Abwechslung und fragte sich, ob es dem Schelm gelingen würde …
Plötzlich wechselte die Szene. Francis Higgins tauchte aus dem Restaurant auf. In dunklem Anzug, weißem Hemd und Krawatte schritt er zum Mercedes, dessen Fernbedienung in der Hand. Die Positionslichter am Wagen blinkten. Die beiden Kerle verharrten, denn womöglich war das eine neue Gelegenheit. Sie sprangen heran, als der Mann die Fahrertür öffnete. »Los, Schlüssel her, wir brauchen dein Auto …« Deubel sah zu, wie sie ihn dazu zwingen wollten.
Es kam zu einer Rauferei. Sollte Deubel eingreifen? Seine Hand war schon am Türöffner, als sich die Situation schlagartig änderte.
Ein breitschultriger Typ, wie aus dem Nichts erschienen, überraschte die Angreifer. Er sprach sie an, gestikulierte unmissverständlich, dass sie die Finger von ihm lassen sollten. Vergeblich. Deubel hörte, wie die Männer höhnisch lachten und und sich auf »den Neuen« stürzen wollten. Doch das vermeintliche Opfer machte kurzen Prozess. Mit gestreckten Fausthieben warf er die Lümmel hintenüber. Sie lagen eine Weile gekrümmt am Boden, dann schimpften sie wüst und schlichen kleinlaut davon.
Händereibend begrüßte der Sieger den Angegriffenen, auf den Deubel gewartet hatte und der ihm als Professor Higgins bekannt war. Der zeigte sich erleichtert und streckte den Arm einladend aus. Deubel dachte, die kennen sich. Der große, breite Mann ging ums Heck zum Beifahrersitz. Der Motor startete leise, die Scheinwerfer flammten auf, und der schwarze Mercedes mit Higgins und dem Breitschultrigen fuhr langsam zur Ausfahrt.
»Action«, rief sich Deubel zu und nahm die Verfolgung auf – nicht ganz nach Plan. Den Passagier hatte er nicht auf der Rechnung. Wie so oft kam alles anders als gedacht. Aber er würde damit fertig.
Max Deubel musste sich anstrengen. Die Sicht war schlecht, die Straße schwarz und nass. Der Regen prasselte nieder und peitschte auf die verschmierte Windschutzscheibe. Die Wischerblätter hätten längst ersetzt werden müssen. Er hielt den Abstand zum Mercedes kurz. Die roten Rücklichter verschwammen vor seinen Augen. Nach etwa einer halben Stunde wusste er, dass sie die geplante Stelle bald erreichen würden.
Plötzlich blitzte ein Verkehrsschild auf, das vor Kurven warnte. Deubel beschleunigte, holte auf und klebte dicht am Heck des Mercedes. Der Fahrer schien das eklige Drängen zu bemerken und wollte ihn abschütteln, beschleunigte aber zu spontan. Er rutschte durch die erste Kurve. Deubel umklammerte das Lenkrad fester. Die zweite Kurve war enger. Er gab Vollgas, sein Toyota ruckte vorwärts. Der Frontschutzbügel prallte wuchtig auf das Heck des Mercedes. Der Fahrer hatte keine Chance. Durch den Aufprall wurde er aus der Kurve katapultiert und prallte heftig gegen den breiten Baum am Straßenrand. Deubel bremste scharf, hielt schleudernd an, holte tief Luft und stieg aus.
Die Straße war menschenleer. Den Mercedes hatte es schlimm zusammengestaucht, der Motor war abgestorben, Rauch quoll Deubel entgegen, als er zum Wrack eilte. Die Fahrertür ließ sich öffnen. Deubel knurrte zufrieden. Schnell zerrte er an Higgins’ schlaffem Körper. Sein Kopf war grotesk verdreht. Genickbruch, dachte Deubel, besser konnte es nicht gehen. Der Passagier auf dem Beifahrersitz bewegte sich nicht, auch nicht, als Deubel ihn mit der Faust heftig stupste. Vielleicht hat’s ihn auch erwischt. Wen kümmert’s?
Es dauerte nur wenige Minuten, bis Deubel den leblosen Higgins draußen hatte, ihn schulterte, nach hinten trug und ins Heck des Toyota warf. Dann manövrierte er das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und fuhr ungehindert davon.
Auf der geraden Strecke zog er sein Smartphone hervor und telefonierte. Carl Stentz, sein Boss, nahm ab und erfuhr, dass Higgins tot war.
Die nächste Phase seines Plans war Max Deubels ureigener Entschluss: Die Leiche würde er auf abschreckende Art entsorgen. Schließlich war Max Deubel kein gewöhnlicher Verbrecher. Er sah sich als kriminelles Genie. Sein Exempel, das er mit Francis W. Higgins statuieren wollte, würde der Polizei mit schaurigem Entsetzen in die Glieder fahren …
1
Der Traum
Es war ein böser Traum. Ein Traum mit Geschmack, als hätte er einen Veloflicken im Mund. Doch er war gar nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Er ging am Rande einer unbefestigten Straße entlang, die irgendwann einmal grob geteert wurde, um die Staubentwicklung einzudämmen. Es war Nacht. Der Viertelmond sah Herbert mit einem schiefen Grinsen an. Er kam an einem Schild vorbei: EIGERSTRASSE. Doch das G war mit einem großen T übersprüht, sodass nun EITERSTRASSE dort stand.
Der Traum hielt Herbert weiter im Bann. Auf beiden Seiten der Straße stand Mais, über einen Meter hoch – es musste Frühsommer sein. Die Eigerstraße führte eine leichte Steigung hinauf. Oben erkannte er die Umrisse eines riesigen, dunklen Baums. Irgendwo klapperte ein Blechding: Klingekling. Herbert wollte stehen bleiben und nichts mit diesem unheimlichen Baum zu tun haben, aber seine Beine trugen ihn weiter. Er konnte sie nicht aufhalten. Eine Brise ließ den Mais rauschen. Es war kühl auf seiner Stirn und er merkte, dass er schwitzte. Schwitzen im Traum!
Als er die Anhöhe erreichte, war noch genug Licht da, um ein Schild an einer Eisenstange zu erkennen: ein Wegweiser zum Hotel. Beklommen ging Herbert weiter.
Das graue Gebäude stand auf einer Kuppe, schwarze Lettern an der Fassade verkündeten LUSTHÖHE. Alles wirkte baufällig, die Fensterläden waren geschlossen. In der Ferne leuchteten die Schneegipfel. Der Eiger, dachte Herbert.
Das Klingekling stammte von Aluminiumstangen, die an Drähten hingen – ein Windspiel.
Plötzlich stand er vor dem Baum, der ihm übermächtig wie ein gewaltiger Felsbrocken den Weg verbaute. Das Mondlicht schimmerte durch die dichten Blätter der uralten Eiche. Ein Flüstern im Wind berührte sein Gemüt unheilvoll.
Herbert wollte umkehren, aber er konnte nicht. Er hatte keine Kontrolle über sich.
Ich will das nicht sehen, dachte er. Seine Füße trugen ihn weiter. Was er plötzlich sah, ließ ihn erstarren, ein Stich fuhr ihm ins Herz, der Atem stockte.
Eine Gestalt hing an einem dicken Ast, in dunkler Kleidung, die Füße zwei Meter über dem Boden. Das Gesicht des Erhängten war so blass wie der Strick und das fahle Mondlicht, das die Szenerie gespenstisch illuminierte.
Herbert holte tief Luft, öffnete den Mund und schrie. Im Traum wie in der Wirklichkeit, in der er sich plötzlich befand. Er saß aufrecht im Bett, schweißgebadet – so etwas war ihm noch nie passiert. Zum Glück lebte er allein, niemand hatte ihn hören können. Zuerst wusste er nicht, wo er war – die große Eiche schien realer zu sein als das Morgenlicht, das durch die Vorhänge fiel. Er rieb sich über das Nike-T-Shirt, denn Gänsehaut überzog seinen ganzen Körper. Dann erkannte er sein Schlafzimmer und begriff, dass nichts vom Traum real war, so echt es sich auch anfühlte. Nur die Zeit auf seiner Apple Watch war Wirklichkeit: 06.02 Uhr.
Er zog das T-Shirt aus, ließ die Boxershorts fallen und ging ins Badezimmer, um den Traum abzuduschen. Schlechte Träume, so dachte er, dauern glücklicherweise nie lange und sind wie Schnee im März – sie schmelzen einfach dahin.
Nur seiner wollte nicht schmelzen. Er war wie traumatisiert, alles drehte sich um das gerade Erlebte, während er sich anzog, den Schlüsselbund griff und mit seinem alten Toyota Pick-up, der immer noch zuverlässig lief, zur Schule fuhr. Die Lehrerparkplätze waren fast alle frei, weil die Schule schon vor einer Woche zu Ende gegangen war. Herbert parkte trotzdem wie immer ganz hinten, am Rande der Parkfläche.
Für ihn waren die Sommerferien eine schöne Sache – denn in ihnen hatte er den Computerraum der Bibliothek ganz für sich.
2
Recherche
Herbert schaltete einen Rechner ein und entsperrte ihn mit seinem Admin-Code. Damit konnte er, im Gegensatz zu den Schülern, unbeschränkt surfen, wobei Herbert nicht vorhatte, Pornhub zu besuchen. Er öffnete Google Maps und tippte »Lusthubel« ein. Sein Finger schwebte schon über der Eingabetaste, dann fügte er noch schnell und zur Sicherheit »Lusthöhe« und »Eigerstraße« hinzu.
Er hoffte insgeheim, dass es keine Treffer geben würde, doch wenige Augenblicke später sah er schon ein Bild des Wegweisers. Auf dem Foto war er noch nicht alt, und das Schild zur LUSTHÖHE war noch sauber. Das Gebäude auf der Anhöhe wirkt allerdings so heruntergekommen wie im Traum und war scheinbar geschlossen. Herbert öffnete die Karten-App und zoomte heran: Die Fassade war grau, die Anschrift in schwarzen Buchstaben – genau wie im Traum.
Eine Eigerstraße zeigte Google Maps in einer entfernten Ortschaft. Herbert kannte sie nicht, aber das wunderte ihn auch nicht – das Welschland war groß, es gab Hunderte kleine Orte, von denen er nie gehört hatte.
Herbert betrachtete seinen wahr gewordenen Traum mit Bestürzung. Verdammt, nein, mit beklemmender Angst. Er musste sich davon überzeugen, dass die Lusthöhe – und der riesige Baum mit dem Toten am Strick – nur ein Hirngespinst seines schlafenden Geistes war.
»Ich bin in Scheiße getaucht.« Dieser Satz raste in seinem Kopf und wurde nur von den Gedanken an den Baum mit der Leiche unterbrochen. Er war jetzt sechsunddreißig Jahre alt, Fan des Berner Sport Club Young Boys, Hausmeister an der Sekundarschule, verrichtete seine Arbeit gewissenhaft, kassierte seinen Lohn, genoss ab und zu einen Film auf Netflix, verfolgte keine Nachrichten, war unpolitisch und hatte kein Interesse an Übersinnlichem. Er hatte noch nie ein Gespenst gesehen, hielt Dämonenfilme für Zeitverschwendung und würde ohne Zögern nachts über einen Friedhof gehen. Er ging nicht in die Kirche, war auch nicht hinter Frauen her. Es gab eine in seinem Quartier, Anita, die er gelegentlich besuchte – eine lockere Freundschaft. Manchmal übernachtete er bei ihr oder passte auf ihre Tochter auf, wenn Anita abends einen Friseurtermin hatte. Die beiden verstanden sich gut, aber Liebe war das nicht. Aber jetzt war diese unspektakuläre Normalität gestört, verschwammen die Grenzen von Traum und Wirklichkeit. Plötzlich schien alles fraglich …
Das Knallen eines Autos mit schlechtem Auspuff (oder gar keinem) riss ihn aus einem Zustand, der einer Hypnose nahekam.
Herbert blickte auf die Uhr: Viertel vor acht. Behalte die Nerven, dachte er. Ein guter Rat, denn sein Temperament hatte ihn schon öfter in Schwierigkeiten gebracht. Deshalb hatte er auch vor einiger Zeit mit dem Trinken aufgehört. Schließlich verließ er das Schulgebäude.
3
Die Vögel
Zu Hause packte Herbert seinen Rucksack: ein paar Sandwiches und ein Stück Kuchen, das Anita mitbrachte, nachdem er den Auspuff ihres alten Honda Civic repariert hatte. Ja, gestern war die Welt noch in Ordnung …
Er füllte seine Thermoskanne mit schwarzem Kaffee, stieg in den Pick-up und machte sich auf den Weg nach Westen.
Das Navi zeigte ihm, dass er in knapp einer Stunde die Lusthöhe erreichen würde. Der Tag war warm, klar, und zumindest das Wetter versprach, sich erst einmal nicht zu ändern.
Er erreichte die Ortschaft. Nach einem Verkehrskreisel mit abstrakter Skulptur fuhr er an einem Café und einem kleinen Laden vorbei, weiter auf eine Nebenstraße.
Sein Magen war flau, das Herz klopfte so heftig, dass er es im Nacken spürte. Das Maisfeld kam in Sicht. Wie im Traum war der Mais erst schulterhoch, aber für Ende Juni sah er gut aus. Die Straße war geteert – anders als im Traum, dachte er –, aber zwei Kilometer weiter endete der Belag, und es folgte harter Schotter.
Direkt vor ihm auf der rechten Seite tauchte ein Straßenschild auf, er hielt mitten auf der Straße an: Eigerstraße, mit Sprühfarbe verunstaltet, sodass es Eiterstraße hieß.
Unmöglich, dass er das in seinem Traum gesehen hatte – aber er hatte es gesehen. Die Straße stieg an. Wenn er noch einen Kilometer weiterführe, vielleicht weniger, würde er wahrscheinlich das heruntergekommene Lusthöhe-Gebäude sehen können, dahinter den Todesbaum.
Dreh um, schrie es in ihm. Du willst da nicht hin, niemand zwingt dich – also dreh einfach um und fahr nach Hause.
Aber er konnte nicht anders. Seine Neugier war zu stark. Und er musste immer an den Erhängten denken, dessen Bild ihm seit seinem Traum nicht mehr aus dem Kopf ging.
Er hielt an, trank zwei Becher Kaffee aus der Thermosflasche und biss ins Sandwich. Dann fuhr er weiter. Bis ein Wegweiser ihn zum Halten zwang: ZUR LUSTHÖHE stand auf dem Schild, haargenau wie im Traum.
Oben angekommen stieg er aus, schlug die Wagentür zu – und zuckte bei dem Geräusch zusammen. Dumm, aber er konnte nicht anders. Er hatte sich von dem Geräusch, das er selbst verursachte, erschrocken. Irgendwo in der Ferne knatterte ein Traktor. Er konnte sich nicht erinnern, sich je so allein gefühlt zu haben.
Die letzten Schritte zur Eiche waren für ihn wie ein Wiedereintritt in den Traum; seine Beine bewegten sich wie von selbst. Er ging mechanisch um die Ecke des Hotelgebäudes, wollte nicht weiter, aber seine Beine trugen ihn unerbittlich voran.
Da – da hing er am hellen Strick, wie im Traum. Der große Schlanke, kein Junge. Im Geschäftsanzug baumelte er an der gewaltigen, alten Eiche.
Ein Krächzen ließ ihn erschaudern. Drei Bussarde stritten sich um ihre Beute. Die Vögel hatten dem armen Teufel am Strick die Wange zerhackt.
Sie hüpften herum, stießen sich gegenseitig an, pickten am Gesicht. Nur, picken war nicht das richtige Wort. Sie rissen mit ihren großen Schnäbeln Fleisch heraus.
Nach einem Moment schockierter Lähmung stürzte sich Herbert auf sie, fuchtelte mit den Armen und schrie. Einer floh tapsig, die anderen sprangen plump auf die Straße zurück.
Er sah einen heruntergefallenen Ast, brach ihn zu einem Stock und wedelte damit. »Haut ab! Haut ab, verfickte Arschgeier!«
Es stand außer Frage, dass der Mann am Strick tot war. Herbert würde wohl nie vergessen, was die Aasvögel mit ihm gemacht hatten.
Bevor er den Ort des Grauens verließ, versuchte er, sich alles genau einzuprägen.
Die Bussarde hatten die Hälfte der Nase abgehackt und ein Auge erwischt. Die blutgeränderte Augenhöhle starrte ihn an.
Er ging auf die andere Straßenseite und erbrach Sandwich und Morgenkaffee. Dann kehrte er zum Erhängten zurück. Er wollte zwar viel lieber zurück zum Auto rennen, aber dann würden die Bussarde zurückkommen und ihr Mahl fortsetzen. Und das konnte er nicht zulassen. Sie hockten in den Ästen wie Geier in einem Horrorfilm. Er wünschte, er hätte etwas, um das verstümmelte Gesicht zu bedecken – und fand es just während des Gedankenganges. An den Zweigen seines abgebrochenen Astes hingen Blätter wie an einem Besen. Zurück am Baum benutzte er die Leiter, die im Gras lag, und kletterte hoch, den Blätterast in der rechten Hand. Auf der letzten Sprosse blickte er dem Toten ins Gesicht – oder was die Bussarde davon übrig gelassen hatten. Er musste würgen. Warum tat er sich das an? Es gelang ihm, den Blätterast über den Kopf zu legen und die Zweige am Seil einzuhaken. Die Jacke war an der Schulter zerfetzt, das Revers aufgerissen, Blut und Hautfetzen … furchtbar. Er verfluchte sich selbst, verfluchte die verdammten Viecher. Wenigstens war das Gesicht jetzt geschützt, die Wunden verdeckt.
Er wollte schon herabsteigen, da bemerkte er unter dem aufgerissenen Jackenstoff etwas, das weder Haut noch Stoff war. Er schaute näher hin, griff schließlich mit zwei Fingern in die äußere Brusttasche des Sakkos und zog den Gegenstand heraus, mitsamt dem blauen Poschettli, dem teuren Einstecktuch. Es fand darin ein längliches Plastikstück, schwarz und dünn – ähnlich einem Datenspeicher. Er drehte es in der Hand, sah keine Marke. Ließ es sich öffnen? Herbert steckte den Fund einfach in die Hosentasche, kletterte hinunter und legte die Leiter wieder auf den moosigen Boden.
»Shit happens«, entfuhr es ihm. »Passiert eben – wie auf diesem Aufkleber an manchen Stoßstangen. »Shit happens … Konfuzius soll das gesagt haben …«
4
So What
Als Herbert zu seinem Pick-up kam, war sein Kopf etwas klarer. Er hatte eine Idee, einen Plan. Er ließ den Motor an und fuhr langsam die Straße hinunter. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Holz auf dem Anhänger kam ihm entgegen.
Vor dem Kreisel hielt er an, betrat den Laden mit den im Schaufenster angepriesenen Technikgeräten. Er fragte den Verkäufer, ob sie Prepaid-Telefone hätten, die in einigen der Fernsehsendungen als »Burner« bezeichnet wurden. Er hatte so etwas noch nie gekauft und dachte, dass der Verkäufer ihn wahrscheinlich in ein Fachgeschäft schicken würde, aber der junge Angestellte zeigte auf das Schild »Wir sind ein Handy-Shop« und wies ihn nach hinten zu einem Regal. Da gab es viele »Burner«, Herbert entschied sich für das billigste, es gab keine Aktivierungsgebühr, und eine ausführliche Anleitung war beigelegt worden.
Er nahm sein Portemonnaie aus der Hosentasche, bereit, mit seiner Karte zu bezahlen, und fragte sich gleichzeitig, wie er so dumm sein könnte. Er steckte die Karte zurück und nahm stattdessen zwei Banknoten aus der Brusttasche. Damit bezahlte er. Der Angestellte, ein junger Mann mit Akne, grinste Herbert an und fragte, ob er neu auf Tinder einsteigen wolle. Herbert hatte keine Ahnung, wovon er redete, und sagte dem Verkäufer einfach, dass er keine Tüte brauche. Der junge Mann sagte nichts mehr, sondern gab Herbert seine Quittung.
Draußen vor der Tür warf Herbert die Quittung in den Mülleimer. Er wollte keine Aufzeichnungen über diese Transaktion. Er wollte nur die Leiche an der Eiche melden. Der Rest wäre Sache von Leuten, die für ihren Lebensunterhalt Nachforschungen anstellen mussten. Je schneller er diese Angelegenheit hinter sich bringen konnte, desto besser. Der Gedanke, die Sache ganz fallen zu lassen, kam ihm nicht in den Sinn. Die Raubvögel würden nicht vom Toten ablassen, und das konnte er nicht zulassen.
Nach wenigen Minuten sah er eine Bushaltestelle mit genügend Platz zum Anhalten, er fuhr aber weiter bis zu einem kleinen Rastplatz mit Picknicktisch und einer mobilen Toilette. Herbert hielt an, öffnete die Plastikhülle, in der das Handy steckte, und las die Anweisungen. Sie waren einfach zu verstehen und das Telefon war zu vierzig Prozent aufgeladen – perfekt! Auf »Maps« fand er die genaue Ortsangabe des Lusthügels mit der Eiche und speicherte die Info ab. Herbert überlegte, ob er sich seinen Text aufschreiben sollte, entschied sich dann aber dagegen. Er würde sich kurzfassen, damit niemand den Anruf zurückverfolgen konnte. Und so tippte er 117 ein.
Das Anrufzeichen tönte ein einziges Mal. »Kantonspolizei, haben Sie einen Notfall?«
»Ich will eine Leiche melden.«
»Wie heißen Sie, bitte?«
Beinahe hätte er es gesagt. Stupid. »Die Leiche hängt an einer großen Eiche hinter dem Hotel, ich gebe Ihnen die Koordinaten.«
»Moment, ich brauche Ihren …«
»Hören Sie, hier sind die Koordinaten, da finden Sie den Toten, okay? Die Leiche wird von Raubvögeln geschändet.« Er schaute auf seine Notizen und gab hastig die genaue Ortsangabe durch.
»Sie müssen sich identifizieren und sagen, von wo Sie anrufen.«
»Eiterstraße … eh, Eigerstraße. Machen Sie schnell.«
Er beendete den Anruf. Sein Herz hämmerte wie wild in seiner Brust. Sein Gesicht war schweißnass. Er fühlte sich, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen und hätte nun ein radioaktives Wegwerfhandy in seiner Hand. Er warf es hastig in den Mülleimer hinter dem Picknicktisch, überlegte es sich dann doch anders, fischte es heraus, wischte es mit seinem Hemd ab, warf es wieder hinein und setzte seine Fahrt fort. Wenige Kilometer weiter fiel ihm ein, dass er vielleicht die SIM-Karte hätte herausnehmen sollen. Zu spät. Außerdem glaubte er nicht, dass die Polizei Anrufe von Wegwerfhandys zurückverfolgen könnte.
Polizei? Um Himmels willen, du hast doch bloß einen Todesfall gemeldet, sagte er sich. Wie auch immer: Alles, was er jetzt wollte, war nach Hause kommen und vergessen, was passiert war.
Doch auch in seiner Wohnung fand Herbert keine Ruhe. Im Gegenteil, er spürte das kantige Teil aus der Brusttasche des Toten in seiner Hosentasche, fingerte es erschreckt heraus und legte es auf den Tisch. Das Hightech-Ding kam ihm unheimlich vor, vermutlich beinhaltete es leistungsfähige Chips unter seiner harten Hülle. Vielleicht waren dort auch Geheiminfos und Codes gespeichert, seine Fantasie ging mit ihm durch. Herbert konnte seine wirren Gedanken nicht ordnen. Aber wenn es tatsächlich etwas Topgeheimes wäre? Sollte er damit vielleicht zum Geheimdienst?
Der Nachrichtendienst des Bundes, NDB, fiel ihm ein. Oder einfach zur Polizei? Er lief umher und stöhnte.
So eine Scheiße. Wieso war gerade mir so etwas passiert?
Er nahm die Whiskeyflasche, die er seit ewiger Zeit nicht mehr angefasst hatte, aus dem Sideboard, schraubte den Deckel ab, führte die Flasche an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck.
Stiff Drink, wie sie im Fernsehen sagen. Wohltuend ächzend schmiss er sich auf die Couch und ließ über seinen mit dem Smartphone gekoppelten Boomer den Song So What von Miles Davis laut erklingen. Miles, der Coole. Der legendäre Sound ging ihm unter die Haut, er stand unvermittelt auf und schrie: »So what! Ja, was soll’s, bleib cool, pfeif drauf!«
Die Therapie nützte. Vorläufig.
Wenigstens schien der Druck auf sein Gemüt etwas nachzulassen.
5
Farah
Eine Frauenstimme meldete sich. Sie war leise und etwas zittrig, wollte aber bewusst stark klingen: »Ist es wahr? Higgins ist verschwunden?«
»Ja, das ist er. Er ist tot.«
»War es ein Unfall?«
Rüdiger Spindler antwortete nicht.
Farah Hammur ließ nicht locker: »Ich habe gehört, er sei mit seinem Auto verunglückt.«
»Sie haben richtig gehört.«
»Sie haben es gesehen?«
»Ja, habe ich, alles, aber erst viel später«, sagte Spindler.
Mit Zweifel in der Stimme antwortete Farah: »Ich kann nicht anders, als zu denken – Ivan Vidic ist verschwunden, und kurz darauf passiert ein mysteriöser Unfall. Seltsam, oder nicht?«
»Manchmal passieren eben Zufälle.«
»Vielleicht. Oder vielleicht will Vidic das Chips-Geschäft allein durchziehen. Uns in den Rücken fallen.«
»Vidic, nein … Das ist nicht seine Art«, widersprach Spindler.
»Wo ist er dann? Er hat uns reingelegt.«
»Warum sollte er das tun? Die Sache läuft noch. Was mich mehr irritiert, ist etwas Mysteriöses.«
Farah blieb einige Herzschläge still, dann fragte sie, was denn das Mysteriöse sei.
»Dass Higgins verschwunden ist.«
»Wie verschwunden? Sagten Sie nicht, Higgins’ Leiche sei weg?«
»Doch, das ist sie.« Mehr wollte Spindler nicht verraten.
Farah stammelte ein wenig: »Gibt es … doch nicht … und Sie sagen noch, kein Grund zur Sorge. Wie konnte das passieren?«
»Hören Sie, da ist noch etwas …«
»Also doch. Was ist es?«
»Es ist verrückt. Als ich nach dem Crash zu Higgins’ Wagen kam, fand ich auf dem Beifahrersitz einen Typ, reglos, lebte noch, aber verletzt.«
»Ich weiß es von Stentz«, sagte Farah, jetzt ziemlich aufgebracht.
Er sei zurückgefahren, erklärte Spindler verhalten, um Leute von der Crew zu holen und um Higgins’ Schrottwagen zu beseitigen.
Er schwieg. Farah blieb ebenso still. Nur statisches Rauschen war hörbar.
»Den Unbekannten auf dem Passagiersitz hat Stentz mit Handschellen gefesselt und ins Lagerhaus gebracht.«
Farah konnte es nicht fassen. »Spindler, ihr habt dicke Scheiße gebaut, nein, Sie haben uns, Sie haben unser Projekt gefährdet …«
»In Ordnung, Farah, atmen Sie tief durch. Vertrauen Sie uns. Stentz weiß, was zu tun ist.«
»Nichts ist in Ordnung«, rief sie erbost, »Higgins ist verschwunden. Mit ihm die Ware, die er uns abliefern sollte. Was ist das für ein Schlamassel? Schlimmer geht es kaum. Großartige Leistung, Spindler.«
Stentz und Spindler waren ihr direkt unterstellt. Sie nannten sich Agenten. Farah wusste aus ihren Lebensläufen, zu was sie fähig waren. Sie schätzte ihre kriminelle Energie, wusste, dass die arroganten Kerle straffe Führung gewohnt waren und dass sie als Frau ihre Loyalität nur gewann, wenn sie gescheit, überzeugend und mit Härte voranging.
Spindler sagte ruhig: »Stentz hat den Unbekannten gefilzt, er fand …«
Farahs schneidende Stimme ließ ihn verstummen. »Hören Sie, Spindler, der Unbekannte heißt Cooper, Stentz hat es erfahren, ich will wissen, wer Cooper ist. Ich will seine Ausweise, die Kreditkarten, seine Telefonnummer … Stentz muss alles haben … in einer Stunde will ich es sehen.«
Stentz wäre ein Vollpfosten, wenn er ihn nicht vollständig gefilzt hätte …
Spindler bestätigte kleinlaut den Auftrag.
»Noch Folgendes, Spindler, ich will einen Bericht, wie der Unfall passiert ist. Higgins war kein schlechter Fahrer. Er würde nicht einfach mit seinem Auto einen Unfall bauen.«
»Verstanden, Boss, Sie bekommen den Bericht. Sind wir fertig?«
Farah Hammur brach das Gespräch ab, lehnte sich ins Polster des Chesterfield-Sofas.
Carl Stentz und Rüdiger Spindler hatten das Projekt sorgfältig aufgegleist. Mit Higgins hatte sie am Vortag noch telefoniert. Er befand sich im Institut und sagte, er käme in der Nacht zum Haus, habe die Ware bei sich. Nun hatte die Geschichte die denkbar schlechteste Wendung genommen. Ein Unfall würde unweigerlich herumschnüffelnde Polizei nach sich ziehen … Es müsste möglich sein, sich abzuschirmen… Farah ging ihre Kontakte durch … Dann warf sie sich im Schlafzimmer auf das breite Bett. Das Haus, das sie gemietet hatte, war mit Designermöbeln luxuriös eingerichtet, und Farah mochte nicht daran denken, dass sie es wegen Higgins’ Tod womöglich abrupt verlassen müsste.
Seufzend erhob sie sich wieder, ging nach unten in das elegante Studio, trat unschlüssig herum, setzte sich an den Laptop, öffnete ihn und sah die verschlüsselte E-Mail. Sie öffnete sie mit dem Code. Der Absender war Abu Hadi Hammur … Sie hatte die Nachricht ihres Vaters erwartet, trotzdem war sie überrascht. Der Zeitpunkt war nach vorne verschoben worden, das war eine Herausforderung.
Sie las den Text nochmals: ABFAHRT CERN-TRANSPORT MI. 24.00 UHR.
Farah löschte die Mail. Der Transport vom Europäischen Zentrum für Kernforschung, CERN, würde übermorgen um Punkt Mitternacht in Meyrin bei Genf abfahren … Die Zeit, rechnete sie, war knapp, aber ihr Bruder Khaled hatte bestimmt gut geplant … Sie stellte sich im Geist den Ablauf der Aktion vor … Aber Farah hatte mittlerweile einen ganz anderen Plan, und der mysteriöse Fall Higgins gehörte nicht mehr zu ihrer Priorität.
Sie suchte im Browser nach Cooper. Erstaunlich, was sie über Michael Cooper alles fand … Seine Ausbildung … Er war wohl ein Spitzenagent, besser als ihre einstigen Speznas-Soldaten …
Sie klappte den Laptop zu.
Abu Hadi und Khaled werden mich noch kennenlernen …
6
Am Tatort
Kriminalkommissar Reto Burri hatte einen schlechten Morgen. Er schnitt sich zuerst beim Rasieren und hatte Mühe, die Blutspur an seinem Kinn zu säubern, dann streckte Elsa ihren Kopf herein und ermahnte ihn, dass er wieder einmal den Toilettensitz oben gelassen und die Zahnpastatube nicht zugemacht hatte. Beim hastigen Frühstück träufelte Saft auf seine Krawatte, die gewechselt werden musste. Dann erspähte Elsa unglücklicherweise mehrere Bierflaschen im Restmüll, eine doppelte Sünde, und schlussendlich hatte er die nicht ausgespülte Müslischale mit Körnerresten einfach in den Geschirrspüler gestellt. Eine Belehrung folgte der anderen, aber die gingen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder hinaus.
Aber die Häufung der Vorkommnisse war schon merkwürdig. War er vielleicht in letzter Zeit tatsächlich vergesslich und ein wenig nachlässig geworden? Oder war Elsa in den letzten Monaten zur Kratzbürste mutiert? Er wusste es nicht, es war noch zu früh für solche Fragen.
Als er im Auto saß und die Quartierstraße hinunterfuhr, hatte er eine Erkenntnis, die seine Stimmung sofort verbesserte. Denn wenn es so etwas wie schlechtes Karma gab, dann hatte er vielleicht das seinige für den heutigen Tag aufgebraucht. »Also: Entwarnung«, sagte er zu sich und gönnte sich eine Zigarette aus der Packung im Handschuhfach. Dieser optimistische Gedanke hielt eine Viertelstunde. Dann kam der Anruf, der ihn zur Eigerstraße in dieses Kaff führte, wo man die Eigernordwand so wenig sieht wie die Rückseite des Mondes. Man sagte ihm, er solle sich dort mit Beamten der Fahndung treffen, was nie ein gutes Karma war.
Am Treffpunkt, außerhalb der Ortschaft, knapp an der Kantonsgrenze, vertraten sich zwei Kollegen die Beine. Der eine rauchte eine Zigarette, die er mit der Fußspitze zerdrückte, als Burri aus dem Wagen stieg, sich streckte und um sich schaute. Hier war nichts los.
»Morgen«, begrüßte er die beiden Polizisten. Sie stellten sich pflichtgemäß dem Höheren vor.