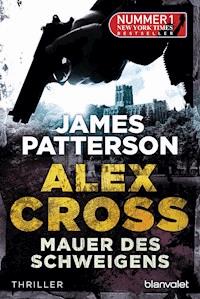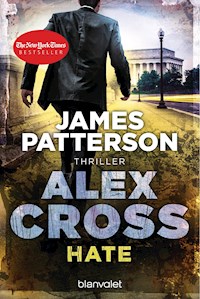
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Detective Alex Cross steht der Prozess des Jahrhunderts bevor – auf der Anklagebank!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Alex Cross befindet sich plötzlich auf der falschen Seite des Gesetzes. Er wird beschuldigt, zwei Gefolgsleute seiner Nemesis, des skrupellosen Verbrechers Gary Soneji, kaltblütig erschossen zu haben. Die Presse startet eine Hetzkampagne gegen ihn: Er soll in der Öffentlichkeit als Paradebeispiel eines schießwütigen Cops dargestellt werden und muss bald schon damit zurechtkommen, dass ihm blanker Hass entgegenschlägt, sobald er die Straße betritt. Cross selbst weiß, dass es Selbstverteidigung war. Doch wenn sogar seine Familie anfängt, an seiner Unschuld zu zweifeln, welche Chance hat er dann, eine Jury auf seine Seite zu bringen?
Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Alex Cross befindet sich plötzlich auf der falschen Seite des Gesetzes. Er wird beschuldigt, zwei Gefolgsleute seiner Nemesis, des skrupellosen Verbrechers Gary Soneji, kaltblütig erschossen zu haben. Die Presse startet eine Hetzkampagne gegen ihn: Er soll in der Öffentlichkeit als Paradebeispiel eines schießwütigen Cops dargestellt werden und muss bald schon damit zurechtkommen, dass ihm blanker Hass entgegenschlägt, sobald er die Straße betritt. Cross selbst weiß, dass es Selbstverteidigung war. Doch wenn sogar seine Familie anfängt, an seiner Unschuld zu zweifeln, welche Chance hat er dann, eine Jury auf seine Seite zu bringen?
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N. Y.
Die Titel der Alex-Cross-Reihe:
Panic · Justice · Devil · Evil · Run · Dark · Cold · Storm · Heat · Fire · Dead · Blood · Ave Maria · Und erlöse uns von dem Bösen · Vor aller Augen · Mauer des Schweigens · Stunde der Rache
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
Hate
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The People vs. Alex Cross« bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2017 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Jon Bilous; G-Stock Studio)
DN · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25596-1V002
www.blanvalet.de
Für Carole, meine kleine Schwester und auf jeden Fall eine meiner Liebsten. Außerdem eindeutig die klügste aller Pattersons.
Prolog EIN HEISSER SOMMERABEND
1
Aus einem weitläufigen weißen Haus im Kolonialstil in einer schattigen Straße, umweht vom Duft blühender Hornsträucher, ertönte eine Frauenstimme mit einem angenehmen Südstaatenakzent: »TW-Zwo? Wo steckst du denn? Du musst für Mama in den Laden gehen.«
Nach einer kurzen Pause rief sie noch einmal: »TW-Zwo? Deuce?«
Timmy Walker junior, auch TW-Zwo oder Deuce genannt, war zwölf Jahre alt und stand am Rand des Wäldchens, der an seinen Garten grenzte.
In den Laden?, dachte Deuce. Er hatte Besseres zu tun, als für seine Mom die ganze Strecke hin- und wieder zurückzuradeln. Sehr viel Besseres, um genau zu sein.
Ein leises Knarren signalisierte ihm, dass die hintere Terrassentür geöffnet wurde.
»Deuce«, rief seine Mutter. »Jetzt komm schon. Ich geh auch nachher mit dir ein Eis essen. Was sagst du dazu?«
Das war ein verlockendes Angebot, aber Deuce hielt sich an seinen Plan und schlich davon. Er folgte dem vertrauten Pfad bergab, bis er zu dem alten Ziehweg neben dem Bach gelangte, der sich durch den Wald schlängelte. Es war schon ziemlich spät, und die tief stehende Sonne tauchte die Umgebung in ein kupferfarbenes Licht. Die Luft war heiß und schwül.
Deuce hob das alte, verschrammte Fernglas hoch, das sein Großvater ihm geschenkt hatte, und dachte: Heiß und schwül, das ist gut. Anscheinend ist immer viel mehr los, wenn es am Abend noch heiß und schwül ist.
Er betrachtete sein T-Shirt und die kurze Hose, beides in Tarnfarben, und dachte: Perfekt. So müsste ich richtig dicht rankommen, und ich hab alles dabei, was ich brauche.
Moskitos summten. Er erschlug einen der Quälgeister, der ihn ins Ohr gestochen hatte, hörte das stetig lauter werdende Zirpen der Zikaden in den Bäumen und roch den Rauch eines Feuers in der Ferne. Er steckte die Hand in die Hosentasche und holte eine Zigarette heraus, die er aus dem geheimen Päckchen seiner Mutter stibitzt hatte.
Er zündete sie an, zog und blies den Rauch in Richtung der Moskitos. Das half.
Rauchend überquerte Deuce den Bach und folgte dem Ziehweg, der neben dem Wasserlauf entlangführte, noch etwa anderthalb Kilometer, bevor er sich nach links wandte und den Hang hinaufkletterte. Alle paar Sekunden blieb er stehen und lauschte. Nichts.
Trotzdem blieb der Junge zuversichtlich, dass er heute noch etwas zu sehen bekommen würde. Es war Freitagabend. Die beste Zeit. Spätsommer. Noch bessere Zeit. Und manchmal konnte man sie vorher gar nicht hören. Die Erfahrung hatte er schließlich schon gemacht …
Kurz vor der oberen Kante streifte Deuce sich ein Tarnnetz über den Kopf. Vorsichtig schob er sich über die Kante und spähte im Schein der letzten goldenen Sonnenstrahlen durch das Gewirr der Ranken und Blätter. Nichts.
Er ging einen Schritt weiter. Nichts. Noch einen Schritt.
Da!
Deuce lächelte, bückte sich und schlich hügelabwärts auf eine Lichtung am Ende eines holperigen Waldwegs zu. Überall lagen Bierdosen und Einwickelpapier herum, dazu ein großer Haufen mit Ästen, und am hinteren Ende der Lichtung stand ein einsamer blauer Toyota Camry.
Der Motor war abgestellt. Die Fenster waren offen. Keine Musik. Deuce wusste genau, warum dieses Auto hier stand. Er hob das Fernglas an die Augen und spähte über die Lichtung hinweg auf die Rückbank des Wagens, wo sich zwei Menschen hin- und herwälzten.
Deuce sah einen nackten Rücken. Das war das Mädchen!
Perfekt.
Und blond! Noch besser.
Plötzlich richtete sie sich auf. Sie war siebzehn, achtzehn Jahre alt – wunderschön! Und dann … tauchte noch eine Blondine mit entblößten Brüsten neben ihr auf, noch jünger und sehr hübsch. Sie fingen an, sich zu küssen und zu streicheln.
2
Der zwölfjährige Junge schnappte nach Luft und hatte das Gefühl, als würde ihm gleich das Herz stehen bleiben. Mit zitternden Fingern ließ er das Fernglas sinken und holte ein iPhone 4 aus der Tasche, das er sich gebraucht über das Internet besorgt hatte. Er drückte auf das Kamerasymbol.
Das wird der absolute Hammer, dachte Deuce. Das wird niemand je wieder vergessen.
Behutsam machte er einen Schritt nach vorn und dann noch einen, sodass er nun am Rand der Lichtung stand. Er starrte zu den beiden leidenschaftlichen Mädchen auf dem Rücksitz des Autos hinüber, aber ohne das Fernglas zu heben.
Jetzt befand er sich auf einer Mission. Deuce stellte die Kamera auf Videomodus und drückte die Aufnahmetaste.
Er hielt sich unter den Bäumen, im Schatten, und umkreiste die Lichtung, schlich hinter einem Asthaufen entlang auf den Camry zu und kam dann von rechts hinten näher. Er stellte sich vor, er wäre ein Panther, und pirschte sich langsam und vorsichtig an, bis das Auto mit den Mädchen sich etwas unterhalb am Fuß einer kleinen Böschung vor ihm befand, und zwar keine zwanzig Meter entfernt.
Aus diesem Winkel war deutlich zu erkennen, dass die beiden splitternackt waren. Er war aufgeregt und fasziniert zugleich. Am liebsten wäre er noch näher herangerückt, wenn möglich bis auf den Rücksitz. Aber das hätte ihm vermutlich nichts gebracht.
Jetzt hatte er sie perfekt im Blick, und auch das Licht war alles andere als schlecht. Er war sich sicher, dass das sein bislang bestes Video werden würde. Zwei Blondinen? Die werden mich feiern!
Deuce hätte beinahe laut gelacht, doch dann starrte er wie hypnotisiert auf die Hand des einen Mädchens, die sich jetzt von der Brust der anderen löste und tiefer glitt, in Richtung …
Der Junge hörte das Brummen eines Motors und blickte sich um. Es klang, als würde sich ein Wagen in hohem Tempo der Lichtung nähern. Die Mädchen hörten es auch und suchten hastig nach ihren Kleidern.
Das kann doch nicht wahr sein … Deuce stöhnte auf.
Ein spitzer Schrei ertönte, und er wandte sich wieder dem Auto der Mädchen zu. Eine der beiden starrte ihn zum Fenster heraus an.
»Da draußen steht so ein perverser Knirps mit Tarnklamotten!«, schrie sie. »Der filmt uns!«
Der Schreck fuhr Deuce durch alle Glieder, und er rannte weg, stürmte tiefer in den Wald hinein und schlug dann einen Bogen, um zu dem Pfad zu gelangen, auf dem er gekommen war. Er sprang über umgestürzte Stämme hinweg, wich Bäumen aus und grinste, als sei er gerade aus einem Verlies entkommen, und zwar mitsamt den Kronjuwelen.
Was in gewisser Weise ja auch stimmte, oder etwa nicht? Er warf einen Blick auf das Handy in seiner Hand, hielt es gut fest und lief dabei unentwegt weiter. Es war zwar nicht das Hammervideo geworden, das er sich erhofft hatte, aber immerhin …
Deuce hörte, wie ein Wagen mit röhrendem Motor auf die Lichtung fuhr und ruckartig zum Stehen kam. Eines der Mädchen stieß einen lauten Schrei aus.
Deuce blieb stehen und drehte sich um. Schweißtropfen liefen ihm übers Gesicht, und er blickte angestrengt durch den dichten Blätterwald in Richtung Lichtung.
Der Junge wollte weiter, wollte so schnell wie möglich nach Hause und das Video auf seinen Computer laden, wollte die Nacht nutzen, um diesen Sieg wieder und wieder zu durchleben und sich anschließend zu überlegen, an welche Website er den Film am besten verkaufen sollte. Doch seine natürliche Neugier war stärker und trieb ihn wieder zurück an den Rand der Lichtung.
Die Sonne ging gerade unter. Schatten nahmen die freie Stelle im Wald in Besitz. Ein weißer Kleintransporter mit aufgemotztem Motor stand im Leerlauf neben dem Camry und versperrte Deuce die Sicht auf die beiden Mädchen.
Er griff nach seinem Fernglas und sah, dass die Scheiben des Transporters dunkel getönt waren. An der Seitenwand haftete ein magnetisches Schild mit der Aufschrift DISHNETWORK.
Satellitenschüsseln? Hier draußen? War das nicht …?
»Nein!«, war jetzt die kreischende Stimme eines der Mädchen von jenseits des Transporters zu vernehmen. »Bitte! Nicht! Hilfe! Kleiner! Hilf uns, Kleiner!«
Deuce war klar, dass sie ihn meinte, aber er wusste nicht, was er jetzt machen sollte.
Ein weiterer Schrei ertönte, noch lauter, noch entsetzter. Eines der Mädchen schluchzte, stammelte, flehte um Gnade.
Deuce fing an, vor Angst zu zittern. Eine Stimme in seinem Kopf brüllte: Lauf los!
Jetzt wurde eine Autotür zugeknallt. Die Seitentür des Transporters wurde zugeschoben, sodass die Schreie der Mädchen nur noch gedämpft zu hören waren.
Klar, das mit dem Video hätte ich wahrscheinlich echt nicht machen dürfen, dachte Deuce, aber das, was da jetzt, passiert, ist bestimmt noch viel schlimmer. Ich muss was unternehmen.
Hastig durchwühlte er seine Tasche und brachte schließlich einen kleinen, magnetischen Linsenadapter zum Vorschein, den er vor dem Objektiv seiner Handykamera befestigte. Dann wechselte er in den Fotomodus, um eine bessere Auflösung zu bekommen, und zoomte an das beleuchtete Nummernschild des Transporters heran, der rund fünfzig Meter von ihm entfernt stand.
Die Scheinwerfer flammten auf. Der Motor heulte. Sie wollten losfahren.
Deuce drückte die Lautstärketaste seines iPhones, sodass die Kamera ohne Blitz und ohne Autofokus fotografierte. Klick, klick, klick. Er machte fünf Aufnahmen, bevor der Transporter losfuhr, schneller wurde und die Lichtung hinter sich ließ.
Der Junge sah dem Transporter nach. Dann griff er nach seinem Fernglas und beobachtete den Camry im allerletzten Tageslicht. Er war leer. Keine Bewegung. Die beiden Mädchen waren verschwunden.
Der Junge fing an zu zittern, und ihm wurde übel. Diese Mädchen … sie hatten in den höchsten Tönen gekreischt.
Deuce beschloss, dass er etwas unternehmen musste. Er musste die Pornoteile rausschneiden, sich irgendeine Geschichte ausdenken, wieso er das Ganze beobachtet hatte, und dann zur Polizei gehen. Sie würden den Camry finden, die Mädchen identifizieren und rauskriegen, wem dieser Satellitenschüsseltransporter gehörte.
Und zwar so schnell wie möglich.
Er warf einen Blick auf sein Handy, wählte die Notrufnummer, bekam aber keine Verbindung. Kein Mobilfunknetz, stand auf dem Display. Er musste zuerst den Bach überqueren. Auf der anderen Seite war der Empfang besser.
Deuce blickte sich um, riss sich zusammen und steuerte den Ziehweg an. Gleich würde es völlig dunkel werden, aber er kannte sich aus. Er war schon seit seinem vierten Lebensjahr in diesen Wäldern unterwegs.
Als er den Ziehweg erreicht hatte, ging hinter ihm der Dreiviertelmond auf. Er fing an zu laufen und gelangte schließlich bis zur Hügelspitze.
An der Stelle, wo der Weg wieder steil bergab führte, sah Deuce unvermittelt etwas Dunkles, Schweres, Langes auf sich zukommen.
Er wollte sich noch ducken, aber da war es schon zu spät.
Ein Unterarm schlug mit voller Wucht gegen den Hals des Jungen und brachte ihn zu Fall. Seine Beine gaben nach, während sein Oberkörper, die Arme und der Kopf ungebremst nach hinten gerissen wurden und er mit voller Wucht der Länge nach auf dem Ziehweg landete.
Der Junge spürte mehrere Knochen brechen und dann einen heftigen Schlag gegen den Kopf. Er sah Sterne und spürte, wie seine Finger und Arme erschlafften. Sein iPhone segelte in hohem Bogen in den Wald, und sämtliche Luft wurde ihm aus der Lunge gepresst.
Eine Sekunde lang, vielleicht auch zwei, war Deuce benommen und sah nur Schatten und Dunkelheit. Er hörte nichts bis auf sein eigenes Röcheln und spürte nichts als einen allgegenwärtigen Schmerz.
Doch dann ertönte direkt neben ihm eine männliche Stimme. »So, so, so«, sagte die Stimme. »Wo willst du denn hin, junger Mann?«
ERSTER TEIL PLATIN IST SCHLECHT FÜRS GEHIRN
1
Ich blickte in meinen Schlafzimmerspiegel und versuchte, mir den perfekten Krawattenknoten zu binden.
Eigentlich war das lächerlich einfach, ein Ritual, das ich tagtäglich vor der Arbeit zelebrierte, aber trotzdem bekam ich es einfach nicht vernünftig hin.
»Na, komm, Alex, lass mich dir helfen«, sagte Bree und schob sich neben mich.
Ich ließ die Krawatte los und sagte: »Die Nerven.«
»Absolut verständlich«, meinte Bree und stellte sich vor mich, um die Krawattenenden zurechtzuzupfen.
Ich bin gut fünfzehn Zentimeter größer als meine Frau und starrte bewundernd zu ihr hinab. Wie selbstverständlich sie den Knoten band.
»Männer können das nicht«, sagte ich. »Wir müssten uns dazu immer hinter den Typen stellen.«
»Ist ja bloß eine andere Perspektive«, erwiderte Bree, zurrte den Knoten über meinem Adamsapfel fest und legte den gestärkten Kragen um. Sie zögerte und sah mich mit großen, angsterfüllten Augen an. »Jetzt bist du so weit.«
Ich hatte ein mulmiges Gefühl. »Meinst du wirklich?«
»Ich glaube fest an dich.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und legte den Kopf in den Nacken. »Wir alle glauben fest an dich.«
Ich küsste sie und drückte sie fest an mich.
»Ich liebe dich«, sagte ich.
»Für immer und ewig«, erwiderte Bree.
Als wir einander losließen, glänzten ihre Augen.
»Aber jetzt …«, sagte ich und berührte mit den Fingerspitzen ihr Kinn. »Pokermiene. Denk daran, was Marley und Naomi gesagt haben.«
Sie nahm sich ein Papiertuch und tupfte sich die Augen, während ich in mein Jackett schlüpfte.
»Besser?«, wollte Bree wissen.
»Perfekt.« Ich machte unsere Schlafzimmertür auf.
Die drei anderen Zimmer im ersten Stock waren dunkel und leer. Wir gingen nach unten in die Küche, wo sich meine Familie bereits versammelt hatte: Nana Mama, meine über neunzigjährige Großmutter, Damon, mein Ältester, der an der Johns Hopkins studierte und gerade zu Besuch war, Jannie, Elftklässlerin und Laufwunder, und dann noch Ali, mein geliebter, neun Jahre alter Sohn. Sie machten alle den Anschein, als wollten sie gleich zu einer Beerdigung.
Ali sah mich und brach sofort in Tränen aus. Er lief zu mir und umklammerte meine Beine.
»Ist ja gut, ist ja gut«, sagte ich und strich ihm über den Kopf.
»Das ist so ungerecht«, schluchzte Ali. »Das stimmt doch nicht, was die alle behaupten.«
»Natürlich nicht«, pflichtete Nana Mama ihm bei. »Wir dürfen sie gar nicht beachten. Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Worte bringen keine Pein.«
»Worte können auch sehr wehtun, Nana«, wandte Jannie ein. »Ich weiß genau, was er meint. Du solltest mal sehen, was in den sozialen Medien los ist.«
»Einfach nicht beachten«, sagte Bree. »Wir stehen zu eurem Vater. Familie ist das Wichtigste.«
Sie drückte mir die Hand.
»Also dann, gehen wir«, sagte ich. »Erhobenen Hauptes. Und lasst euch nicht provozieren.«
Nana Mama griff nach ihrer Handtasche und sagte: »Ich würde mich sehr gerne provozieren lassen. Ich würde am liebsten eine Bratpfanne einstecken und einen von denen damit verprügeln.«
Ali hörte auf zu schniefen und fing an zu lachen: »Soll ich dir eine holen, Nana?«
»Nächstes Mal. Und ich würde sie wirklich nur dann benützen, wenn ich provoziert werde.«
»Gott steh ihnen bei, wenn es so weit kommt, Nana«, sagte Damon, und dann lachten wir alle gemeinsam.
Ich fühlte mich gleich ein bisschen besser und sah auf meine Armbanduhr. Viertel vor acht.
»Los geht’s.« Ich stapfte zur Haustür.
Dort blieb ich stehen und lauschte, bis meine Familie sich hinter mir versammelt hatte.
Ich holte einmal tief Luft, nahm die Schultern nach hinten wie ein Marinesoldat in Habtachtstellung, drückte die Klinke, riss die Tür auf und trat hinaus auf meine Eingangsterrasse.
»Da ist er!«, schrie eine Frau.
Grelle Scheinwerfer erwachten zum Leben, und aus der kleinen Schar der Mediengeier und Hassbotschafter, die sich auf dem Bürgersteig vor unserem Haus in der Fifth Street im Südosten von Washington, D. C., eingefunden hatten, ertönten zahlreiche Schreie.
Es waren vielleicht fünfzehn, zwanzig Menschen. Manche waren mit Kameras oder Mikrofonen bewaffnet, andere mit Transparenten, auf denen ich beschimpft wurde, und alle schleuderten sie Fragen oder Verwünschungen in meine Richtung. Es war ein solches Durcheinander, dass ich kein einziges Wort verstehen konnte. Dann setzte sich eine laute Baritonstimme gegen all den anderen Lärm durch.
»Sind Sie schuldig, Dr. Cross?«, rief der Mann. »Stimmt es, dass Sie diese Menschen kaltblütig erschossen haben?«
2
Ein schwarzer Chevrolet Suburban mit dunkel getönten Fensterscheiben hielt vor meinem Haus.
»Dicht zusammenbleiben«, sagte ich, ohne auf die lautstarken Fragen einzugehen. Dann zeigte ich auf Damon. »Hilfst du bitte Nana Mama?«
Mein Ältester schob sich neben meine Großmutter, und dann gingen wir als geschlossene Gruppe die Treppe hinab und betraten den Bürgersteig.
Ein Reporter hielt mir ein Mikrofon unter die Nase und rief: »Dr. Cross, wie oft haben Sie schon die Waffe gezogen, wenn Sie im Dienst waren?«
Ich hatte keine Ahnung, darum beachtete ich ihn nicht, aber Nana Mama fauchte: »Wie oft haben Sie schon eine dämliche Frage gestellt, wenn Sie Dummheiten unters Volk bringen wollten?«
Danach brauchte ich meine gesamte Energie, um den Rest auszublenden. Ich verfrachtete meine Familie vollständig ins Innere des SUV, setzte mich auf den Beifahrersitz und schloss die Tür.
Nana Mama atmete tief aus.
»Ich hasse die«, sagte Jannie beim Losfahren.
»Als ob sie Dad aussaugen wollen«, sagte Ali.
»Blutegel«, sagte der Fahrer.
Viel zu schnell hatten wir das Gerichtsgebäude des District of Columbia in der Indiana Avenue 500 erreicht. Das Gebäude aus glattem Kalkstein besitzt zwei Flügel, und über dem Foyer spannt sich eine Dachkonstruktion aus Stahl und Glas, während die große Plaza davor in eine Parklandschaft eingebettet ist. Vor meinem Haus hatten zwanzig Aasgeier auf mich gewartet, aber hier gierten sechzig Schakale danach, meine Begegnung mit der unbestechlichen Justitia mitzuverfolgen.
Anita Marley, meine Rechtsanwältin, war auch da und erwartete mich am Straßenrand.
Sie war groß und sportlich, mit kastanienbraunem Haar, Sommersprossen und intensiven smaragdgrünen Augen. Sie hatte an der University of Texas Schauspiel studiert und war im Volleyballteam der Hochschule gewesen, später hatte sie ein Jurastudium an der Rice University in Houston absolviert und als eine der Besten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Sie war elegant, besaß ein loses Mundwerk, war rasend komisch und außerdem als knallharte Prozessanwältin bekannt. Genau aus diesem Grund hatten wir sie engagiert.
Sie machte mir die Tür auf.
»Ab sofort übernehme ich das Reden, Alex«, sagte sie in gebieterischem Tonfall, während gleichzeitig eine Welle aus Anfeindungen, Hohn und Spott über mich hereinbrach, viel schlimmer als das, was ich zu Hause erlebt hatte.
Ich hatte schon öfter mitbekommen, wenn ein großer Haufen lokaler, regionaler und überregionaler Journalisten vor einem spektakulären Prozess pausenlos damit beschäftigt war, das Vierundzwanzig-Stunden-Nachrichtenmonster mit rohem Fleisch zu füttern. Nur war ich bisher noch nie das rohe Fleisch gewesen.
»He, Cross, sagen Sie was!«, riefen sie. »Sind Sie das Problem? Stehen Sie und Ihre Cowboymethoden für das, was aus der Polizei in Amerika geworden ist? Stehen Sie über dem Gesetz?«
Ich hielt es nicht mehr länger aus und erwiderte: »Niemand steht über dem Gesetz.«
»Sie sagen kein Wort«, zischte Marley mir zu, nahm meinen Ellbogen und schob mich über die Plaza in Richtung Haupteingang.
Der Schwarm folgte uns summend und stichelnd.
Hinter den Journalisten hatte sich eine Menschenmenge versammelt, aus der jetzt die angsterfüllte Stimme eines Mannes ertönte: »Nicht schießen, Cross! Bitte, nicht schießen!«
Andere fielen in seinen Sprechgesang mit ein. »Nicht schießen, Cross! Bitte, nicht schießen!«
Obwohl ich mir alle Mühe gab, konnte ich nicht anders, als mich zu ihnen umzudrehen. Etliche Demonstranten hatten Schilder dabei, auf denen mein mit einem roten X durchgestrichenes Konterfei zu sehen war. Darunter stand SCHLUSSMITDERPOLIZEIGEWALT oder SCHULDIGIMSINNEDERANKLAGE!
Marley blieb vor der kugelsicheren Tür des Gerichts stehen und bedeutete mir, mich umzudrehen, sodass ich nun die Scheinwerfer, Mikrofone und Kameras direkt vor mir hatte. Ich spreizte die Schultern und reckte das Kinn nach vorn.
Meine Rechtsanwältin hob die Hand und sagte mit lauter, fester Stimme: »Herr Dr. Cross ist ein unschuldiger Bürger und ein unschuldiger Polizeibeamter. Wir sind sehr froh, dass er nun endlich Gelegenheit bekommt, seinen guten Ruf wiederherzustellen.«
3
Beim Betreten des Gerichts blickten mir die Polizeibeamten an der Sicherheitskontrolle entgegen. Hinter mir war immer noch die brodelnde Medienmeute zu sehen.
Sergeant Doug Kenny, Chef der Wachmannschaft des Gerichtshofs und ein guter, alter Bekannter, sagte: »Wir stehen auf deiner Seite, Alex. Guter Schuss, nach allem, was ich gehört habe. Ein verdammt guter Schuss.«
Die anderen drei nickten und lächelten mir zu, während ich durch den Metalldetektor ging. Draußen fiel die wilde Horde über meine Angehörigen her, sodass sie sich den Weg zum Eingang regelrecht freikämpfen mussten.
Nana Mama, Damon und Jannie hatten es als Erste geschafft. Die Erschütterung war ihnen deutlich anzusehen. Kurz danach waren auch Bree und Ali im Inneren angelangt. Als die Tür ins Schloss fiel, drehte Ali sich zu den gaffenden Journalisten um und zeigte ihnen den gestreckten Mittelfinger – eine Geste, die nirgendwo auf der Welt einer Erklärung bedurfte.
»Ali!«, schrie Nana Mama und packte ihn am Kragen. »Das gehört sich nicht!«
Doch da die Wachmannschaft ihn kichernd anblickte und ich ihm zulächelte, zeigte er keinerlei Bedauern.
»Taffes Bürschchen«, sagte Anita und lenkte mich zu den Fahrstühlen.
»Schlaues Bürschchen«, sagte die junge Afroamerikanerin, die jetzt neben mir auftauchte. »War er schon immer.«
Ich legte ihr den Arm um die Schultern, drückte sie an mich und küsste sie auf den Scheitel.
»Danke, dass du gekommen bist, Naomi«, sagte ich.
»Du hast mich schließlich auch immer unterstützt, Onkel Alex.«
Naomi Cross ist die Tochter meines verstorbenen Bruders Aaron, eine angesehene Strafverteidigerin mit eigener Kanzlei, und sie hatte die Gelegenheit, mir zu helfen und gleichzeitig mit der renommierten Anita Marley zusammenzuarbeiten, ohne zu zögern, beim Schopf gepackt.
»Wie stehen meine Chancen, Anita?«, wollte ich wissen, nachdem die Fahrstuhltüren sich geschlossen hatten.
»Das interessiert mich nicht«, gab sie kurz angebunden zurück und strich die Manschetten ihrer weißen Bluse glatt. »Wir informieren die Geschworenen über die Tatsachen und lassen sie entscheiden.«
»Aber Sie kennen doch die Indizien, die die Anklage vorbringen wird.«
»Und ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, was sie vorhaben. Ich glaube, dass unsere Geschichte die überzeugendere ist, und ich habe vor, sie überzeugend darzulegen.«
Ich glaubte ihr aufs Wort. In den vergangenen sechs Jahren hatte Anita Marley acht aufsehenerregende Mordprozesse für sich entschieden. Nachdem die Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlichen Doppelmordes Anklage gegen mich erhoben hatte, hatte ich mich bei ihr gemeldet, auch wenn ich fest mit einer Absage oder einem »zu viel zu tun« gerechnet hatte. Doch dann war sie bereits am nächsten Tag von Dallas nach Washington geflogen und hatte mich seither bei sämtlichen juristischen Angelegenheiten begleitet.
Ich mochte Anita. Sie war offen und geradeheraus, besaß einen blitzschnellen Geist und war sich nicht zu schade, ihren Charme, ihr gutes Aussehen oder ihre Schauspielkünste einzusetzen, wenn es ihren Mandanten nützte. Ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie sie diese Mittel im Lauf der Vorverhandlungen angewandt und sich in fast allen Punkten, abgesehen von einigen wenigen, beunruhigenden Ausnahmen, mühelos durchgesetzt hatte.
Allerdings war dieser Prozess gegen mich, wie sie selbst sagte, außerordentlich komplex und reichte bis weit in meine persönliche Vergangenheit zurück.
Vor ungefähr fünfzehn Jahren hatte ich mit einem Psychopathen namens Gary Soneji zu tun, der mehrere Menschen entführt und ermordet hatte. Ich hatte ihn damals verhaftet und ins Gefängnis gebracht, aber etliche Jahre später war er entkommen und hatte sich aufs Bombenbasteln verlegt.
Erst nachdem zahlreiche Menschen seinen Attentaten zum Opfer gefallen waren, gelang es uns, ihn in einem riesigen, unterirdischen Tunnelsystem unter den Straßen von Manhattan zu stellen. Dabei hätte er mich um ein Haar getötet, aber ich war schneller und schoss zuerst. Verletzt war er davongehumpelt und in der Dunkelheit verschwunden, bevor seine Sprengweste explodiert war.
Springen wir nun zehn Jahre nach vorn in die jüngere Vergangenheit. Mein Partner bei der Metropolitan Police, John Sampson, und ich waren gerade in der Suppenküche einer Kirchengemeinde bei der Essensausgabe behilflich, als ein Ebenbild Sonejis zur Tür hereingestürmt kam und den Koch sowie eine Nonne unter Beschuss nahm. Dabei erhielt Sampson eine Kugel in den Kopf.
Wie durch ein Wunder überlebten alle drei das Attentat, doch der Soneji-Doppelgänger blieb verschwunden.
Es stellte sich heraus, dass sich um den toten Gary Soneji ein Kult entwickelt hatte, der im Darknet finstere Blüten trieb. Nach etlichen Verwirrungen führten mich die Ermittlungen zu einer verlassenen Fabrikhalle im Südosten von Washington. Dort wurde ich von drei Bewaffneten mit Soneji-Masken in Empfang genommen. Ich schoss, traf alle drei und tötete zwei von ihnen.
Doch als schließlich die Verstärkung eintraf, die ich angefordert hatte, waren bei den Opfern keine Waffen mehr zu finden gewesen, und ich wurde wegen zweifachen Mordes und einfachen Mordversuchs unter Anklage gestellt.
Die Fahrstuhltüren im zweiten Stock des Gerichtsgebäudes glitten beiseite. Wir steuerten auf direktem Weg den Saal Nummer 9 B an, umgingen die Schlange der Zuschauer, die einen Sitzplatz ergattern wollten, ignorierten das wütende Geflüster in unserem Rücken und betraten den Saal.
Der Zuschauerraum war fast schon voll. Die Medien allein belegten vier Reihen auf der linken Seite. Die erste Reihe hinter dem Tisch der Staatsanwaltschaft, die für die Opfer und ihre Angehörigen reserviert war, war leer, genau wie die Reihe für meine Familie auf der rechten Seite.
»Stehen bleiben«, murmelte Marley, nachdem wir durch die Schranke gegangen und bei unserem Tisch angelangt waren. »Ich will, dass alle Sie sehen können. Demonstrieren Sie Selbstbewusstsein und Stolz auf ihre Tätigkeit als Polizeibeamter.«
»Ich versuch’s«, flüsterte ich.
»Da kommen die Ankläger«, sagte Naomi.
»Nicht hinschauen«, ordnete Marley an. »Die gehören mir.«
Ich sah sie nicht an, aber aus den Augenwinkeln registrierte ich, wie zwei US-Bundesanwälte ihre Aktenkoffer unter dem Tisch der Anklagevertretung verstauten. Nathan Wills, der leitende Staatsanwalt, sah aus, als sei er noch nie einem Donut begegnet, ohne ihn unverzüglich zu verspeisen. Er war Mitte dreißig, hatte ein teigiges Gesicht und an die vierzig Kilo Übergewicht. So erklärte sich vermutlich auch sein Hang zu schwitzen. Sehr stark zu schwitzen.
Aber Anita und Naomi hatten mich ermahnt, diesen Kerl auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Er hatte ein Jurastudium in Berkeley als Jahrgangsbester abgeschlossen und anschließend beim Bundes-Appellationsgericht mit Sitz in San Francisco gearbeitet, bevor er ins Justizministerium gewechselt war.
Seine Assistentin, Athena Carlisle, hatte einen nicht weniger beachtlichen Werdegang aufzubieten. Aufgewachsen auf einer Pachtfarm, entstammte sie einem ärmlichen Milieu in Mississippi und hatte als Erste in ihrer Familie einen Highschool-Abschluss geschafft. Anschließend hatte sie ein Vollstipendium am Morehouse College erhalten, als Jahrgangsbeste abgeschlossen und dann an der Georgetown University ein Jurastudium begonnen, wo sie schließlich auch Herausgeberin des renommierten Law Review geworden war.
Vor einer Woche hatte die Washington Post Kurzbiografien der beiden Anklagevertreter veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Wills und Carlisle außergewöhnlich ehrgeizig und geradezu versessen darauf waren, in dem Prozess gegen mich die Position der US-Staatsanwaltschaft zu vertreten.
Aber warum die höchste Anklagebehörde des ganzen Landes? Warum die mächtige Bundesanwaltschaft der USA? So läuft es nun einmal in Washington, D. C., und zwar schon seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts. Wer in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten des Mordes angeklagt wird, der soll auch im Namen der gesamten Vereinigten Staaten verurteilt werden.
Hinter mir ertönte leises Scharren und Flüstern. Ich drehte mich um und sah, wie meine Familie ihre Plätze einnahm. Bree lächelte mich tapfer an und formte mit den Lippen die Worte Ich liebe dich.
Ich wollte ihr gerade dasselbe sagen, doch dann sah ich einen finster dreinblickenden Teenager in Kakihose und blauem Hemd mit zu kurzen Ärmeln den Gerichtssaal betreten. Dieser Teenager hieß Dylan Winslow und war Gary Sonejis Sohn. Seine Mutter war eines der beiden Todesopfer gewesen. Dylan trat bis an die Abschrankung, keine drei Meter von mir entfernt, strich sich die öligen, dunklen Haare glatt und starrte mich hasserfüllt an.
»Die Hölle wartet schon auf dich, Cross«, sagte er mit arrogantem, bösartigem Lächeln. »Ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, dich brennen zu sehen.«
Ali sprang auf und sagte: »So wie dein Vater?«
Ich glaubte schon, dass Winslow sich gleich wutentbrannt auf meinen Jüngsten stürzen würde. Damon auch, darum stellte er sich hinter Ali.
Doch anstatt Ali anzugreifen, lächelte der junge Mann nur noch bösartiger als zuvor.
»Ganz genau, Kleiner«, erwiderte er kühl. »Genau so wie mein Vater.«
»Bitte erheben Sie sich«, rief jetzt der Gerichtsdiener. »Der Oberste Gerichtshof des District of Columbia ist bereit, die heutige Versammlung zu eröffnen. Den Vorsitz führt Richterin Priscilla Larch.«
Die Richterin, eine Frau Mitte fünfzig mit einer dicken Brille und schwarz gefärbten, aufwendig hochgesteckten Haaren, war gerade mal einen Meter achtundvierzig groß. Zu sehen, wie sie hinter das Richterpult kletterte, war ein beinahe lächerlicher Anblick.
Aber ich lachte nicht. Larch hatte sich den Ruf einer unerbittlichen Vorsitzenden erworben.
Sie knallte ihren Hammer zweimal auf das Pult, blickte durch ihre dicken Brillengläser in den Saal und knurrte mit heiserer Raucherstimme: »Das Volk der Vereinigten Staaten gegen Alex Cross. Ruhe im Saal.«
4
Sechs Wochen zuvor …
John Sampson versuchte, ruhig zu bleiben, versuchte, sich einzureden, dass er mit jeder Entscheidung leben konnte, die ihn auf der anderen Seite der hölzernen Doppeltür im vierten Stockwerk des Daly Building in der Innenstadt von Washington erwartete.
Aber er konnte nicht ruhig bleiben. Er nahm den Geruch seines eigenen Schweißes wahr. Die Nervosität brachte ihn beinahe um.
Als die Sekretärin ihm dann gegen 17.00 Uhr endlich zunickte, krampfte sein Magen sich zusammen. »Er kann Sie jetzt empfangen, Mr. Sampson.«
»Danke«, erwiderte Sampson. Er stand auf und stellte sich breitbeinig hin, genau wie die Therapeuten es ihm geraten hatten, um den Schwindelanfällen entgegenzuwirken, die ihn seit diesem Kopfschuss gelegentlich überfielen.
Sampson setzte sich in Bewegung und versuchte, Selbstbewusstsein auszustrahlen. Er machte die Tür auf, trat ein und sah Bryan Michaels an seinem Schreibtisch sitzen. Er war gerade dabei, ein paar Schriftstücke zu unterzeichnen. Der Polizeichef von Washington, D. C., hatte silbergraue Haare und war für einen Mann Mitte fünfzig in blendender körperlicher Verfassung. Er hob den Blick, lächelte flüchtig und bat Sampson mit einer Handbewegung, sich zu setzen.
»Ich würde lieber stehen bleiben, Sir, wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte Sampson.
Chief Michaels’ Lächeln erlosch, und er legte seinen Stift beiseite, während Sampson näher kam und bequem stand. Der Chief ließ sich gegen seine Stuhllehne sinken und betrachtete seinen hünenhaften Mitarbeiter stumm und lang. Beunruhigend lang. Mehr als einmal ging sein Blick zu der Narbe an der linken Stirnseite des Detectives.
»Ihre Schießergebnisse können sich sehen lassen«, sagte der Chief schließlich.
»Nicht gerade überragend, aber so, dass ich bestanden habe, Sir.«
»Das stimmt«, erwiderte Michaels. »Und was die Fitnessprüfung angeht, haben Sie beinahe Ihren persönlichen Bestwert erreicht.«
»Ich habe sehr hart gearbeitet, um hier stehen zu dürfen, Sir.«
Sampson merkte, dass Michaels erneut auf seine Narbe starrte.
»Sie haben in der Tat hart gearbeitet, John.« Michaels’ Tonfall machte Sampson sofort nervös. Er fühlte sich allein gelassen und, nun ja, als würde er im nächsten Atemzug ausrangiert werden.
Der Chief fuhr fort. »Aber ich bin verpflichtet, sehr genau abzuwägen, ob ich einen meiner Beamten nach einem Trauma, wie Sie es erlitten haben, wieder an die Front schicke. Und ich muss mir die Frage stellen, ob Sie möglicherweise in Krisensituationen für Ihre Kollegen zur Belastung werden könnten.«
Genau diese Frage hatte Sampson sich auch schon gestellt, aber er sagte kein Wort, sondern blickte den Chief nur ausdruckslos an. Zwei Sekunden vergingen, dann noch einmal zwei.
Ein breites Grinsen legte sich auf Chief Michaels’ Miene, dann erhob er sich und streckte die Hand aus. »Herzlich willkommen zurück, Detective Sampson. Wir haben Sie sehr vermisst.«
Sampson grinste ebenfalls, ergriff die Hand des Polizeichefs und schüttelte sie heftig. »Vielen Dank, Chief. Sie werden es nicht bereuen.«
»Ich weiß, ich weiß. Sie sind für viele Ihrer Kollegen ein Vorbild. Ich möchte, dass Sie das wissen.«
»Ja, Sir. Danke, Sir.«
»Sie werden einen neuen Partner brauchen«, fuhr der Chief fort, und sein Gesichtsausdruck wurde ein kleines bisschen weniger fröhlich.
Nach einem kurzen, etwas peinlichen Schweigen erwiderte Sampson: »Damit habe ich gerechnet.«
Chief Michaels musterte ihn eine ganze Weile, bevor er sagte: »Warum habe ich die ganze Zeit das unangenehme Gefühl, als wären wir nicht ganz allein hier im Zimmer?«
»Geht mir auch so, Sir. Aber ich glaube, letztendlich wird Alex sich durchsetzen.«
Michaels Miene wurde etwas sanfter. »Hoffentlich. Wie geht es ihm?«
»Er hat sein Praxisschild wieder rausgehängt, um sich die Wartezeit bis zur Verhandlung ein bisschen zu vertreiben«, antwortete Sampson.
»Richten Sie Alex meine besten Wünsche aus. Von ganzem Herzen.«
Ein lautes Klopfen ertönte an der Tür, dann betrat eine hagere, höchst aufgeregte rothaarige Frau den Raum. Eine Dienstmarke hing an einer Kette um ihren Hals.
»Fox?«, sagte Michaels verärgert. »Ich habe Sie noch nicht reingebeten.«
Fox blickte zuerst Sampson und dann wieder den Chief an: »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sir, aber Detective Sampson und ich … also, wir müssen wirklich umgehend los. Schüsse und Geiselnahme an der Washington Latin.«
»Was sagten Sie gerade? An der Latin?«, sagte Sampson. »Das ist die Schule von Ali Cross.«
5
Tief erschüttert, aber körperlich unversehrt, hockte Ali auf der Eingangstreppe der Washington Latin Public Charter School, als Sampson ihn erblickte. Er hatte seinen Schulranzen zwischen die Knie geklemmt und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ein Streifenpolizist berichtete, dass Ali den ganzen brutalen Vorfall mit angesehen hatte, genau wie fünf andere Schüler auch. Sie alle hatten nach dem offiziellen Schulschluss noch an einem Debattierkurs teilgenommen.
»Alles in Ordnung, Kumpel?«, fragte Sampson, faltete seinen mächtigen Körper neben Ali zusammen und legte ihm den Arm um die Schultern. Es war Mitte Oktober und ziemlich kühl so kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Ali zitterte.
»Mein Dad kommt gleich«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme. »Und Bree auch.«
»Erzähl mir mal, was passiert ist.«
Doch bevor er anfangen konnte, meldete sich Detective Ainsley Fox zu Wort. »Detective Sampson. Kann ich kurz mit dir sprechen?«
Sie stand am unteren Ende der Treppe und blickte ihn mit gerunzelter Stirn an.
»Bin gleich wieder da«, sagte Sampson, klopfte Ali auf die Schultern, stand auf und ging nach unten zu seiner Kollegin.
Leise und in tadelndem Tonfall sagte Fox: »Vielleicht hast du ja während deiner Fehlzeit vergessen, dass wir in Bezug auf den körperlichen Kontakt mit Minderjährigen klare Vorschriften haben.«
Sampson kniff die Augen zusammen. »Der Junge ist für mich wie mein eigener Sohn, Fox.«
»Aber er ist es nicht, und Vorschrift ist Vorschrift. Kopfschuss oder nicht, du musst dich an die Vorschriften halten, sonst hast du die gleichen Konsequenzen zu ertragen wie dein ehemaliger Partner.«
Sampson biss die Zähne zusammen und sagte: »Fox, hier gibt es noch fünf andere Kinder, die du genau nach Vorschrift befragen kannst. Da drüben.«
Fox zögerte kurz, hielt inne, doch dann reckte sie das Kinn vor und steuerte das kleine Grüppchen verschreckter Kinder an. Sampson ging zurück zu Ali und sah, wie Alex Cross und Bree Stone gerade unter dem Absperrband hindurchschlüpften. Alex hob Ali hoch und drückte ihn fest an sich. Ali erwiderte die Umarmung genauso fest und brach in Tränen aus.
Als die beiden sich wieder ein bisschen gesammelt hatten, bat Sampson Ali, ihm noch einmal zu schildern, was er gesehen hatte.
Ali sagte, dass es schon dunkel gewesen sei, als er das Schulgebäude verlassen hatte, als Letzter einer ganzen Gruppe, die alle in den Debattierkurs gingen. Er war bei Weitem der Jüngste und Kleinste aus der Gruppe, darum hatte er nichts gesehen, sondern nur die Schreie gehört. Anschließend waren sie alle in unterschiedliche Richtungen davongerannt. Ali hingegen war stehen geblieben und hatte sein Handy gezückt.
»Du hast die Notrufnummer angerufen?«, wollte Bree wissen.
»Nein, ich habe sie gefilmt.«
»Du hast sie gefilmt?« Sampsons Stimme klang beeindruckt.
»Ich wollte sie nicht angreifen«, erwiderte Ali, holte sein Handy aus der Tasche und spielte das Video ab.
Zuerst waren die Aufnahmen ziemlich verwackelt, aber dann wurden sie ruhiger. Drei Männer in dunklen Overalls und Masken zerrten ein laut kreischendes blondes Mädchen über die Terrasse vor dem Schulgebäude in Richtung Second Street.
»Das ist Gretchen Lindel, Dad«, sagte Ali. »Sie ist in der elften Klasse, glaub ich.«
Mittlerweile hatten die Kidnapper Gretchen Lindel fast bis zum Bürgersteig geschleift. Da kam eine Frau von links ins Bild geschossen. Wutschnaubend attackierte sie die maskierten Männer.
»Ms. Petracek«, sagte Ali leise. »Sie leitet den Debattierkurs.«
Jetzt war zu sehen, wie einer der Männer Gretchen Lindel losließ, sich um die eigene Achse drehte und Ms. Petracek, ohne zu zögern, aus nächster Nähe ins Gesicht schoss. Sampson zuckte zusammen. Was für ein kaltblütiger Mord!
Die tapfere Lehrerin für Englisch und Rhetorik an der Washington Latin brach auf der Stelle tot zusammen. Der Schütze wandte sich an Gretchen, die mit Gewalt zwischen zwei parkenden Autos festgehalten wurde.
Ali sagte: »Und jetzt kommt das Schlimmste.«
Mit heulender Sirene und blinkenden Lichtern kam ein Streifenwagen der Metro Police die Straße entlanggerast und hielt mit einer Vollbremsung direkt vor den Kidnappern an. Die Männer rissen die Türen auf, schubsten Gretchen auf die Rückbank und sprangen hinterher, dann verschwand der Streifenwagen mit quietschenden Reifen und heulender Sirene aus dem Blickfeld.
6
Kurz nachdem Nana Mama mich im Anschluss an den Tod meiner Mutter zu sich in den Norden geholt hatte, sah sie mich auf ihrer Eingangsterrasse herumlungern. Ich war traurig und träge und konnte mich zu nichts aufraffen.
Ich war zehn Jahre alt. Nana fragte mich, was ich gerade machte, und ich gab ihr eine ehrliche Antwort.
»Ich atme«, sagte ich.
»Zu wenig«, erwiderte Nana Mama. »Ich weiß, dass es dir hier nicht gefällt, Alex, aber gib dir noch ein bisschen Zeit. Das wird schon. Und bis es so weit ist, will ich, dass du etwas machst. Du hast außer Atmen nichts anderes vor? Komm mit. Ich gebe dir etwas zu tun.«
»Aber wenn ich gar keine Lust habe, was zu tun?«
Meine Großmutter zog die Augenbrauen in die Höhe, stemmte die Arme in die Hüften und sagte: »In meinem Haus ist das keine Option. Und weißt du was? Wenn du erwachsen bist und nicht mehr hier wohnst, hast du diese Option auch nicht, es sei denn, du heiratest eine reiche Frau oder gewinnst im Lotto.«
Wie das Schicksal es wollte, gewann meine Großmutter mit über neunzig dann tatsächlich im Lotto – in der Powerball-Lotterie, um genau zu sein. Sie entschied sich für die Sofort-Auszahlung, musste einen fetten Batzen an das Finanzamt abführen und gründete mit dem Rest eine Stiftung für Leseförderung und Armenhilfe, mit der sie zum Beispiel die Frühstücksausgabe in mehreren lokalen Kirchengemeinden finanzierte.
Außerdem stellte sie sicher, dass meinen Kindern jede Ausbildung, die sie sich wünschen konnten, offenstand. Und selbst danach hätte die Familie Cross immer noch genügend Geld übrig gehabt, um den ganzen Tag lang auf der Terrasse zu sitzen und nichts zu tun, so lange, bis wir uns die Radieschen von unten anschauen durften.
Aber das kam für meine Großmutter nicht infrage. Sie war fest überzeugt, dass jeder Mensch eine Aufgabe brauchte, etwas, womit er anderen zu einem besseren Leben verhelfen konnte. Und nachdem ich in Erwartung meines Mordprozesses monatelang vom Dienst suspendiert gewesen war – obwohl ich in dieser Zeit Anita und Naomi bei der Ausarbeitung meiner Verteidigungsstrategie behilflich gewesen war –, hatte Nana Mama das Gefühl gehabt, dass ich mehr tun musste, als mir zu überlegen, wie ich am besten dem Gefängnis entging. Sie hatte recht. Ich hatte zu oft nichts anderes getan, als »zu atmen«, und fühlte mich damit selbst nicht mehr wohl.
Also beschloss ich, da ich ja nicht als Polizist arbeiten konnte, mir wieder einen Grund zum morgendlichen Aufstehen zu verschaffen, eine Möglichkeit, jemand anderem zu helfen als nur mir selbst. Und darum nahm ich meinen ersten Beruf wieder auf und bot psychologische Beratungen an.
Ich richtete mir im Keller meines Hauses ein Sprechzimmer mit einem separaten Eingang ein, hängte meine gerahmten Zeugnisse von der Johns Hopkins an die Wand und befestigte draußen an der Hauswand mein Praxisschild – nachdem ich fast zwei Jahrzehnte lang nur für die Strafverfolgungsbehörden gearbeitet hatte.
Ich rief jede soziale Einrichtung im Stadtgebiet an, schilderte meine Kompetenzen und meinen Tätigkeitsbereich und bat sie, potenzielle Interessenten darüber zu informieren. Zum Glück hatten sich schon bald die ersten Klienten gemeldet, und dann noch ein paar weitere, sodass ich allmählich immer mehr zu tun hatte.
Zwei Tage nachdem Ali an der Washington Latin mit eigenen Augen eine Entführung und einen Mord beobachtet hatte, saß ich unten in meinem Büro, als ein leises Klopfen an der Außentür ertönte.
Ich warf einen Blick in meinen Terminkalender: Paul Fiore. Erste Sitzung. Pünktlich auf die Minute.
Ich ging zur Tür, machte auf und sagte: »Herzlich willkommen, Mr. Fio…«
Der untersetzte Mann, der da vor mir stand, war knapp einen Meter achtzig groß und vielleicht neunzig Kilo schwer. Er hatte lockige, dunkle Haare, braune Augen, olivenfarbene Haut und ein Babyface. Sein Alter war nur schwer zu schätzen, aber angesichts seiner Kleidung konnte es zumindest hinsichtlich seiner Berufung keine Zweifel geben.
»Entschuldigen Sie bitte, Pater Fiore«, sagte ich. »Bitte, treten Sie näher.«
7
Der katholische Priester betrat mit zerknirschter Miene mein Sprechzimmer. »Ich hätte es Ihnen schon am Telefon sagen müssen, Dr. Cross. Aber ich wusste nicht, was Sie dazu sagen würden.«
»Ich würde sagen, dass ich sehr erfreut bin, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Mit diesen Worten zog ich die Tür hinter ihm ins Schloss. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Pater Fiore lächelte mich an, aber es wirkte angestrengt.
»Bitte, Pater.« Ich zeigte auf einen bequem gepolsterten Sessel.
»Ich komme mir sehr merkwürdig vor«, sagte der Priester, während er sich setzte und den Blick durch den Raum schweifen ließ.
»Wieso denn?«
»Weil normalerweise ich es bin, der Geständnisse zu hören bekommt.«
Ich lächelte und setzte mich ebenfalls. »Bitte entschuldigen Sie die Frage, aber bietet die Kirche ihren Mitarbeitern nicht auch die Möglichkeit einer Beratung?«
»Das ist richtig.« Pater Fiore seufzte. »Aber ich fürchte, es handelt sich um eine etwas delikate Angelegenheit, Dr. Cross. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich stark, dass ich bei meiner Kirche auf viel Verständnis stoßen würde, selbst unter einem aufgeklärten Oberhaupt wie Seiner Heiligkeit Papst Franziskus.«
»Also gut.« Ich griff nach einem gelben Notizblock. »Dann fangen wir am besten von vorne an.«
Fiore berichtete, dass er im Alter von vierzehn Jahren den Ruf ins Priesteramt vernommen hatte. Mit zweiundzwanzig war er ordiniert worden und hatte in den Armenvierteln Chicagos gearbeitet. Dort hatte er einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die Kirche ihn nach Washington, D. C., versetzt hatte, wo er einerseits in der Kirchengemeinde St. Anthony of Padua tätig war und sich andererseits im Auftrag des Kardinals um die finanzielle Unterstützung für verschiedene Armenhilfsprogramme kümmerte.
»Meine Großmutter hat eine Stiftung gegründet, die auch solche Förderprogramme unterstützt«, sagte ich.
Fiores Lächeln wirkte durch und durch aufrichtig. »Was glauben Sie, wie ich auf Sie gekommen bin?«
Ich musste lachen. Das war wieder einmal typisch Nana Mama: mir einen Priester als Klienten zu besorgen.
»Ihre Großmutter ist eine außergewöhnliche Frau«, sagte Fiore. »Absolut unnachgiebig und gleichzeitig unglaublich großherzig.«
»Eine Beschreibung, der ich nichts hinzuzufügen habe. Aber kommen wir wieder auf den eigentlichen Grund Ihres Besuchs zurück.«
Die Miene des Priesters verdunkelte sich ein wenig, und er setzte seine Geschichte fort. Anfang des Jahres hatte er zusammen mit dem Kardinal eine Wohltätigkeitsveranstaltung in einem Hotel in Georgetown besucht. Dort war er in einem etwas abgelegenen Flur auf eine weinende junge Frau namens Penny Maxwell getroffen. Er war stehen geblieben, um sie zu trösten.
Mrs. Maxwell war Witwe, und an jenem Tag hatte sich der Todestag ihres Mannes, der in Afghanistan ums Leben gekommen war, zum zweiten Mal gejährt. Sie bemühte sich zwar sehr, ihre Gefühle im Zaum zu halten, aber es gelang ihr nicht.
»Sie war ein leidender, trauernder Mensch«, sagte Fiore. »Also habe ich getan, was ein Priester eben tut. Ich habe ihr zugehört, mit ihr gesprochen und mit ihr gebetet.«
Nach der Veranstaltung war er mit ihr am Georgetown Canal entlangspaziert, und sie hatte ihm im Verlauf der folgenden drei Stunden ihr anstrengendes Leben als Witwe eines hochtalentierten Militärchirurgen und Mutter zweier wunderbarer Jungen geschildert.
Fiore war voller Bewunderung und Faszination gewesen für Pennys Mut, ihre Entschlossenheit, die beiden Jungen richtig zu erziehen und ihren festen Willen, das Andenken an ihren verstorbenen Mann jederzeit in Ehren zu halten. Und dann hatte er zu seiner Verblüffung erfahren, dass Penny ab und zu den Gottesdienst in St. Anthony’s besuchte.
»Danach hat sie angefangen, ihre beiden Söhne mit in die Messe zu bringen, und ich habe sie auch kennengelernt. Wir haben ab und zu etwas gemeinsam unternommen, eine Wanderung oder einen Ausflug ans Meer, und ich habe dabei eine Dimension des Lebens erfahren, die ich immer geglaubt hatte zu kennen. Aber da hatte ich mich geirrt.«
»Und um welche Dimension handelt es sich dabei?«, wollte ich wissen.
»Liebe.« Fiore beugte sich vor, ließ den Kopf hängen und rieb die Handflächen aneinander. »Ich habe mich nicht einfach nur verliebt, Dr. Cross. Penny wurde meine beste Freundin, und ich wurde ihr bester Freund. Und die beiden Jungen … jedes Mal, wenn ich sie verlassen muss, Dr. Cross, kommt es mir vor, als würde sich ein weiteres Loch in meinem Herzen auftun.«
»Weiß Penny, wie Sie empfinden?«
Er nickte. »Und ihr geht es genauso.«
»Haben Sie miteinander geschlafen?«
»Nein«, erwiderte er mit fester Stimme. »Wir glauben beide an das Sakrament der Ehe.«
»Aber die Kirche hält nichts von verheirateten Priestern«, erwiderte ich.
Er nickte niedergeschlagen. »Und was soll ich jetzt machen, Dr. Cross? Soll ich die einzige Berufung, die ich jemals gespürt habe, verlassen, oder die einzige Frau, die ich je geliebt habe?«
8
Eine Frau mit aschfahlem Gesicht näherte sich einem Wald aus Mikrofonen.
»Bitte«, sagte Eliza Lindel mit bebender Stimme. »Als Mutter mit einem gebrochenen Herzen flehe ich Sie an, melden Sie sich bei der Polizei oder dem FBI, falls Sie irgendetwas über die Entführung meiner Tochter wissen. Schenken Sie mir bitte ein wenig Hoffnung. Gretchen ist eine liebenswerte, unschuldige, junge Frau. Bitte helfen Sie uns, Sie zu finden, bevor es zu spät ist.«
Jetzt war wieder das Nachrichtenstudio eines Lokalsenders zu sehen, und der Ansager fing an, über die Entführung zu schwadronieren.
Bree saß in ihrem Büro in der Innenstadt und stellte den Fernseher stumm. Sie hatte keine Lust, sich das ganze Geschwätz anzuhören. Sie wusste genau, was los war.
Die entscheidenden ersten achtundvierzig Stunden waren ohne nennenswerten Fortschritt verstrichen. Das lag natürlich auch daran, dass das FBI den Fall übernommen hatte, weil Gretchen entführt und höchstwahrscheinlich in einen anderen Bundesstaat verschleppt worden war. An diesem Punkt waren Bree und die Metropolitan Police dann weitgehend aus der aktuellen Ermittlungsarbeit ausgeschlossen worden, besonders, nachdem das FBI sich die Videoaufnahme der Entführung noch einmal angesehen und den Streifenwagen registriert hatte. Aber soweit Bree wusste, hatte es keine Lösegeldforderung und keinerlei Kontaktaufnahme vonseiten der Entführer gegeben.
»Chief?«, sagte Sampson, noch während er an ihre Tür klopfte. »Wir haben was.«
Bevor Bree reagieren konnte, schob sich Detective Fox vor Sampson und sagte: »Ich finde, wir sollten dem FBI Bericht erstatten. Die sind jetzt schließlich die höhere Instanz.«
Brees Miene wurde härter. Für Ainsley Fox war jede noch so unbedeutende Vorschrift wie das reinste Evangelium.
»Detective Fox«, erwiderte Bree. »Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, da stand auf Ihrer Dienstmarke noch DCMP, und das bedeutet, dass ich Ihre Vorgesetzte bin. Also los, raus mit der Sprache. Was ist los?«
»Jetzt lass endlich den Quatsch, Fox«, schaltete Sampson sich ein, als seine Kollegin immer noch zögerte. »Wenn du’s ihr nicht sagst, dann sag ich’s ihr eben.«
Sampson setzte sich, klappte einen Aktenordner auf und fing mit der Feststellung an, dass alle Streifenwagen der Metro Police einen GPS-Tracker besaßen, der ihren Standort jederzeit an eine Datenbank meldete. Diese Datenbank hatte jedoch zum Zeitpunkt der Entführung und des Mordes kein einziges registriertes Fahrzeug in der Nähe der Washington Latin erfasst.
Dann fuhr er fort: »Aber auf dem Video, das Ali Cross gemacht hat, ist eindeutig ein Streifenwagen zu erkennen, der bis ins kleinste Detail unseren Fahrzeugen gleicht. Also hat irgendjemand sich die Mühe gemacht, eine sehr präzise Kopie herzustellen, bis hin zu den Sirenen und dem Blauton, den nur wir verwenden.«
»Und was fangen wir damit an?«, wollte Bree wissen. »Klappern wir sämtliche Karosseriewerkstätten ab? Oder Firmen, die Stuntfahrzeuge an Filmproduktionen vermieten?«
Sampson warf seiner neuen Partnerin einen Blick zu und sagte missmutig: »Irgendwann vielleicht, ja, aber Detective Fox hat in der Tat eine Spur aufgetan, die mehr verspricht.«
Fox zeigte beinahe den Ansatz eines Lächelns. Sie strich ihre strähnigen Haare zurück, klappte ihren Laptop auf, tippte ein paar Tasten an und drehte ihn dann um, sodass Bree den Bildschirm sehen konnte. Darauf war das Foto einer blonden Frau zu erkennen. Sie war vielleicht Ende zwanzig, Anfang dreißig, ungeschminkt, ungekünstelt, aber sehr attraktiv. Sie war so etwas wie eine natürliche Schönheit. Und sie kam Bree irgendwie bekannt vor.
»Cathy Dupris«, sagte Fox. »Vor zehn Wochen ist sie aus ihrem Haus in einer Kleinstadt im Süden von Pennsylvania verschwunden.«
Jetzt fiel es Bree wieder ein. »Die Nachbarn haben gesagt, dass plötzlich ein Notarztwagen vorgefahren sei, und dass Sanitäter in ihr Haus gelaufen und sie dann auf einer Trage weggebracht hätten. Aber nirgendwo war ein Notruf registriert worden, weder bei der Polizei noch bei einem privaten Krankentransportdienst.«
»Und Lösegeldforderung gab es auch keine.« Fox nickte.
»Wo ist da die Verbindung?«
Fox holte ein weiteres Foto einer hübschen Blondine auf den Bildschirm, Delilah Franks, Bankangestellte aus Richmond, Virginia. Sie war vor ungefähr sechs Monaten spurlos verschwunden.
»Aber steckte da nicht ihr Freund dahinter?«, erkundigte sich Bree.
»Sie hatte eine Affäre mit einem anderen, das stimmt«, erwiderte Fox. »Aber vielleicht ist das nur Zufall. Vielleicht ist Delilah ja aus einem ganz anderen Grund entführt worden.«
»Und Sie glauben, dass Sie diesen Grund kennen?«, wollte Bree wissen.
»Zeig ihr zuerst das Pärchen«, sagte Sampson.
Fox gab zum dritten Mal einen Befehl ein und holte zwei Fotos auf den Bildschirm. Es handelte sich um die Schulporträts zweier Teenagermädchen, beide blond und sehr hübsch.
»Das da links ist Ginny Krauss, siebzehn Jahre alt«, sagte Fox. »Und das rechts Alison Dane, sechzehn. Die beiden stammen aus Hillsgrove, einer ländlichen Gemeinde in Pennsylvania, und sind vor etwa sieben Monaten ebenfalls spurlos verschwunden.«
Bree zog die Stirn kraus. »Davon habe ich gar nichts mitbekommen.«
»Weil die Familien und die Polizei das Ganze sehr diskret behandelt haben«, erwiderte Fox. »Die Eltern der beiden Mädchen sind sehr fromme Christen. Und sie glauben, genau wie die zuständigen Ermittler, dass die Mädchen weggelaufen sind, weil ihre Eltern strikt gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen sind und so etwas für Teufelswerk halten.«
»Die Mädchen sind lesbisch?«, hakte Bree nach.
»Und verliebt, allem Anschein nach«, erwiderte Fox und machte sich erneut an ihrer Tastatur zu schaffen.
Als Nächstes tauchte ein blauer Toyota Camry auf ihrem Bildschirm auf. Er stand auf einer schlammigen Waldlichtung. Die Heckscheibe und die Windschutzscheibe waren zersplittert, die Fahrertür stand offen, und die Glasscherben auf den Sitzen waren deutlich zu erkennen.
»Nachdem die Mädchen in der Nacht nicht nach Hause gekommen waren, haben die Ermittler des Sheriffbüros Alisons Auto im Staatsforst auf einer Lichtung entdeckt, die sich bei Jugendlichen, die mal ein bisschen feiern oder rumknutschen wollen, einer gewissen Beliebtheit erfreut«, sagte Fox und tippte weiter. »Und jetzt kommt etwas, was nicht ins Bild passt.«
Als der hübsche, kleine Junge auf dem Monitor auftauchte, beugte Bree sich ein Stück nach vorn.
»Timmy ›Deuce‹ Walker«, sagte Fox. »Zwölf Jahre alt. Er ist genau am gleichen Tag verschwunden wie die beiden Mädchen. Von seinem Elternhaus bis zu der Lichtung mit dem Auto sind es gerade mal anderthalb Kilometer. Einen ganzen Monat später hat ein Wanderer die sterblichen Überreste des Jungen im Wald gefunden, ungefähr zehn Kilometer entfernt.«
»Und Sie glauben, dass es zwischen all diesen Fällen eine Verbindung gibt?«
»Ich glaube nicht an Zufälle.« Fox tippte schon wieder.
Als Nächstes öffnete sie eine Webseite, auf der Fotos von den vermissten Frauen und Mädchen zu sehen waren. Den Hintergrund bildeten Kreideumrisse von Leichnamen auf einem Bürgersteig. Und am oberen Rand der Seite war eine platinblonde Perücke abgebildet, die genauso aussah wie Marilyn Monroes Frisur an dem Abend, als sie für Präsident Kennedy »Happy Birthday« gesunden hatte.
Unter der Perücke war, mit Buchstaben, die aussahen wie schmelzendes Wachs, der Name der Website zu lesen: www.killingblondechicks4fun.org.co.
9