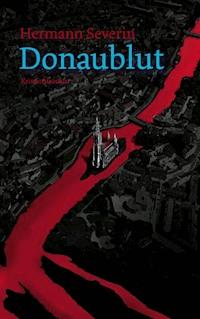4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spielende Kinder erschrecken über einen grausigen Fund. In ihrem Badesee treibt ein Mann mit durchschnittener Kehle. Der Afghane lebte als anerkannter Asylant in einer zu einem Wohnheim umfunktionierten ehemaligen Kaserne. Eigentlich eine klare Sache: Ein Mord in dem gestressten Milieu junger Syrer, Iraker, Iraner und Afghanen, die zu einem ungewollten Zusammenleben auf engstem Raum gezwungen sind. Zu einfach für den Leiter der Mordkommission. Als die Kommissare in das Leben des Getöteten eintauchen, stoßen sie auf eine Welt, vor der selbst sie ihre Augen am liebsten verschlössen. Das Schicksal einer jungen Frau aus dem verachteten Stamm der Hazara, ihr Weg vom Kabul zur Donau und vom Elend in die vermeintliche Freiheit ergibt den Stoff, aus dem der Autor der Thriller Heuschreckentanz, Donaublut und Raupensicht eine faszinierende Story webt, in der die Grenze zwischen Recht und Unrecht verschwimmt. Hermann Severin greift nach einem heißen Thema, verpackt es in eine mitreißend spannende Handlung, zieht Vorhänge auf und hält mit überraschenden Wendungen die Leser in Atem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Meiner tapferen Gefährtin Ute Weile
Dieses Buch ist ein Roman, also ein Produkt der Fantasie des Autors. Fiktive Personen und Schicksale sind in tatsächliche Ereignisse und Orte hineingewoben. Sollte jemand sich selbst oder andere wiedererkennen, so wäre dies rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.
H.S.
Um die Welt zu ruinieren, genügt es, dass jeder seine Pflicht tut.
Sir Winston Churchill
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Epilog
Prolog
Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):
Mann, 35 Jahre alt, Afghane. Rizah Sawari
Frau, 27Jahre alt, Afghanin. Zohra Sawari
Wir haben Ihre Personalien aufgenommen. Sie haben jetzt Gelegenheit, uns zu erklären, wie und warum Sie nach Deutschland geflohen sind. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es Ihnen freisteht, sich zu äußern. Auf der Grundlage dessen, was Sie uns sagen, werden wir die Entscheidung treffen, ob Sie hierbleiben können oder unser Land wieder verlassen müssen. Eine zweite Anhörung wird es nicht geben. Wenn Sie uns anlügen, brechen wir das Verfahren ab und entscheiden sofort.
»Wir haben uns im Iran kennengelernt. Wir sind beide schiitische Hazara und deshalb besonders rechtlos. Auf die Hazara schauen alle anderen herunter. Sie schimpfen uns Mongolen, weil wir so ähnlich aussehen. Man erkennt uns schon äußerlich. Ausweispapiere haben wir nicht. Wir haben uns Ende des Sommers 2014 vom Iran aus auf den Weg gemacht und sind am 23.12.2014 in Deutschland angekommen. Wir haben zwanzig Tage vom Iran nach Griechenland gebraucht. An der griechisch-mazedonischen Grenze wurden wir zwei Monate aufgehalten. Bis zur serbischen Grenze sind wir siebzig Stunden zu Fuß gelaufen. Wir wissen nicht mehr genau, durch welche Länder wir gekommen sind. Irgendwann wurden wir in einen Zug gesetzt und nach Deutschland gefahren. An die Schleuser haben wir 12.000 Euro bezahlt. Einen Teil hatten wir, den Rest haben wir uns von anderen Hazaras geliehen. Wir möchten über das, was jeder von uns erlebt hat, gerne getrennt sprechen. Wir haben uns gegenseitig nicht alles gesagt. Das würde uns sehr schwerfallen. Wir sind ja unabhängig voneinander von Afghanistan in den Iran gegangen und haben uns erst dort kennengelernt. (Der Mann steht auf und geht vor die Tür. Die Frau erzählt.)
Ich lebte in Afghanistan mit meiner Mutter und zwei Brüdern zusammen. Mein Vater war gestorben. Ich war ein junges Mädchen. Mein großer Bruder war zwei Jahre älter und mein kleiner Bruder fünf Jahre jünger als ich. Wir hatten keinen Schutz durch ein erwachsenes männliches Familienmitglied. Als Frau konnten weder meine Mutter noch ich arbeiten gehen. Wir konnten uns nicht einmal draußen aufhalten aus Angst vor den Taliban. Sie müssen wissen, dass in Afghanistan zwei Frauen ohne männlichen Schutz so sind wie zwei Schafe in einem Wolfsrudel. In dieser Zeit durchsuchten Männer jedes Haus und ließen Gebete aufsagen. So konnten sie erkennen, ob jemand Sunnit war oder Schiit. Die Gebete unterscheiden sich. Damals kam ein Talib in Begleitung von drei Paschtunen und einem Tadschiken. Sie klopften und meine Mutter und ich versteckten uns. Unsere Nachbarn waren Tadschiken. Diese wurden in Ruhe gelassen. Man versprach, ihnen nichts zuzufügen, wenn sie preisgäben, wo sich Hazara befänden. In den ersten Tagen der Kämpfe durchsuchten die Kämpfer oft die Häuser. Wir versteckten uns bei den Nachbarn, die uns anfangs Zuflucht gaben. Doch dann sagten sie, sie brächten sich selbst in Gefahr, wenn sie uns weiterhin helfen würden. An einem Tag, mittags, als sie wieder klopften, habe ich mich im Keller versteckt. Als sie mich fanden – es waren drei Paschtunen – zogen sie mich in den Hof, lachten und riefen, dass sie das Hazaraküken gefunden hätten. Sie fragten: »Wo sind nun die Männer der Familie, die deine Ehre verteidigen werden?« Mein älterer Bruder kam heraus, um mir zu helfen. Zwei von ihnen hielten ihn fest. Sie fragten, warum man mich nicht schon verheiratet hätte. Wir seien doch auch Muslime. Sie warfen ihm vor, er habe mich keinem anderen Mann gegeben, um selbst mit mir zu schlafen. Sie verspotteten meinen Bruder und riefen die Nachbarn herbei. »Schaut her, wir haben das Hazaraküken gefunden!« Ein älterer Mann wollte dazwischengehen. Er sagte, sie sollten uns in Ruhe lassen. Sie stießen ihn mit dem Gewehr zurück. Dann zogen sie mich aus. Einer näherte sich meinem Körper. Als er fertig war, lag ich am Boden und er urinierte auf mich. Meinen älteren Bruder, den sie immer noch festhielten, schlugen sie und nahmen ihn mit. Meine Nachbarn sagten später, sie hätten Schüsse gehört. Er sei vermutlich umgebracht worden. Mein kleiner Bruder war bei mir. Der alte Mann, der mir hatte helfen wollen, sagte, wir sollten weggehen, die Männer würden wiederkommen. Als es dunkel wurde, schickte er uns zu einer ihm bekannten tadschikischen Familie. Einige Monate blieben wir dort. Meine Mutter arbeitete als Haushälterin für diesen Mann, der wohlhabend war. Er half uns später finanziell, damit wir in den Iran gehen konnten. Erst ist der jüngere Bruder gegangen. Den älteren haben wir nie mehr wiedergesehen. Einige Monate später sind meine Mutter und ich gegangen.
Im Iran wurden wir als dreckige Afghanen beschimpft. Die Leute hatten eine Wut auf uns, weil sie glaubten, wir würden ihnen die Arbeit wegnehmen. Das ging so weit, dass sie behaupteten, das Brot sei deshalb teurer geworden, weil wir Afghanen so viel kauften.
Nachdem ich meinen Mann kennengelernt und geheiratet hatte, bin ich schwanger geworden. Zur Geburt bin ich ins Krankenhaus gegangen. Ohne Papiere. Sie haben mir mein Kind nicht mitgegeben. Sie ließen mich nicht einmal schauen, ob es am Leben war. Sie haben es mir nicht gezeigt, sondern nur gesagt, dass es gestorben sei.
Mein Wunsch ist, dass ich in Deutschland ein Handwerk lernen könnte. Am liebsten Schreiner. Ich arbeite gerne mit Holz. (Die Frau beendet ihren Bericht. Der Mann wird hereingerufen.)
Ich habe im Iran auf dem Bau und in der Landwirtschaft gearbeitet. Nachdem ich meine Frau geheiratet hatte, wurde uns ein Kind geboren. Meine Frau brachte es im Krankenhaus zur Welt. Es wurde dort misshandelt. Uns wurde die Leiche nicht ausgehändigt, weil wir keine Papiere hatten. Als ich gearbeitet habe, fanden viele Kontrollen statt. Die Sicherheitskräfte nahmen uns an der Arbeitsstelle willkürlich fest. Wenn sie uns auf die Wache brachten, mussten wir für die Freilassung eine Million Tuman (ca. 250 €) zahlen. Meist ließ es sich an Ort und Stelle unter der Hand regeln. Dann kostete es einhunderttausend Tuman. Meine Frau und ich haben Geld damit verdient, Haselnüsse zu entkernen. Dazu wurden 50 kg-Säcke vor unserem Haus gelagert. Jugendliche haben einmal zwanzig Säcke gestohlen. Wir haben den Diebstahl dem Rat der Stadt gemeldet. Man hat uns gesagt, die Polizei würde nichts unternehmen. Die Diebe waren Kinder aus Familien, die in diesem Viertel den Drogenhandel beherrschten. Diese Jugendlichen haben sich damit gebrüstet, dass sie zwei afghanische Jungen vergewaltigt haben. Sie sagten zu mir, ich solle das mit den Haselnüssen vergessen. Irgendwann würde auch ich Jungen haben. Am besten sei es für uns, wir würden wegziehen.
Im Iran sind wir rechtlos. Wir haben auch keine Papiere. Afghanistan ist für uns Hazara die Hölle. Vor einigen Tagen fand eine Demonstration für die Rechte der Hazara statt. Es wurden vierhundert Menschen getötet. Deshalb wäre ich aber nicht weggegangen. Entscheidend war, dass Männer der iranischen Regierung gekommen sind und von mir verlangten, dass ich als Soldat nach Syrien gehen solle. Wenn ich dann nach drei Jahren wieder zurückkäme, würde ich Aufenthaltspapiere bekommen. Wenn ich mich weigere, käme ich in das Gefängnis im Iran. Das wäre mein Tod. Würde ich als Afghane in den Krieg nach Syrien gehen, wäre dies auch mein Tod. Ich habe gewusst, dass in Deutschland Minderheiten durch das Grundgesetz geschützt sind. Deshalb bin ich mit meiner Frau hierhergekommen. Mein Wunsch mit Gottes Willen ist, dass meine Familie hier in Frieden leben kann. Ich liebe Blumen und Pflanzen. Vielleicht kann ich als Gärtner arbeiten. Zurzeit nehme ich an Sprachkursen teil.«
Kapitel 1
Michael Plum geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er plaudert mit Frauen. Nicht mit einer, nein, mit allen. Eigentlich ist das nicht richtig beschrieben. Er redet nämlich fast nichts, und meist hört er auch nicht, was sie sagen. Vielmehr sieht er ihnen beim Sprechen zu. Er beobachtet, wie sich ihre Lippen bewegen, ihre Augen, ja ihr ganzer Körper die Worte begleiten und ist nach ganz kurzer Zeit abgestoßen, gelangweilt oder erotisiert. Aus seinem stickigen Redaktionsbüro ist er an diesem außergewöhnlich heißen Hochsommertag an den Pfuhler See geflohen. Im Laufe von fünf Jahrzehnten hat sich ein wüstes Baggerloch im Kiesbett der Donau zum angesagten Mittelpunkt eines gepflegten Naherholungsgebietes gemausert. Nur wenige Kilometer vor der Stadt gelegen ist der Badesee auf Radwegen gut erreichbar und folglich an Tagen wie diesen gut besucht.
Plum ist in der Stadt ein bekanntes Gesicht. Er schreibt in den lokalen Zeitungen und platziert gelegentlich auch mal einen Beitrag in überörtlichen Medien. Wegen seiner manchmal grenzwertig indiskreten Hintergrundberichte über das Geschehen in der Stadt wird er geliebt und gefürchtet. Die Linien zwischen Klatschkolumne und ernsthafter Berichterstattung verfließen ihm öfters. Was manche nicht wissen: Michael Plum macht das mit Kalkül. Er erweitert dadurch nicht nur seinen Leserkreis, sondern erschließt sich auch Informationsquellen, die ihm bei nur seriöser Arbeit verschlossen blieben.
Am Ufer des Sees betreibt Mario einen Kiosk, der in zwei Bereiche geteilt ist. Auf der einen Seite bietet er auf rohen Holzplanken Bier, Eis, Bratwurst und Schnitzel an, und auf der anderen Seite mixt er an einer aufgehübschten Bartheke alle möglichen Cocktails mit und ohne Alkohol.
Plum lehnt lässig an diesem Tresen. Zu seiner Linken wird er von einer jungen Frau im schwarzen Bikini unter einem roten Seidentuch, das mit exotischen Vögeln bedruckt ist, beflirtet. Ihr blonder Haarschopf ist kess auf dem Kopf zu einem Knoten gebändigt. Irmi beabsichtigt, in einigen Tagen eine kleine Boutique in der Innenstadt zu eröffnen und erhofft sich von Plum einen Artikel darüber in der lokalen Presse. Zur Rechten sticht eine schon etwas ältere Dame mit ihrem Zeigefinger auf seinen Oberarm ein und verlangt Aufmerksamkeit für ihren Plan, bei der kommenden Stadtratswahl eine parteiübergreifende Frauenliste aufzustellen. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Menschen mit dem zufälligen Geschlechtsmerkmal Mann im Gemeinderat sei fatal und undemokratisch. Die Presse müsse mithelfen, diesen Zustand zu beenden. Plum heuchelt für beide Erwartungen Sympathie und stellt sich Irmi ohne Bikini nur mit Seidentuch vor.
Plötzlich wird das seichte Geplätscher ihres Gesprächs und der gleichförmige Badelärm durch das Gekreisch hoher Kinderstimmen gestört. Etwa einhundert Meter vom Kiosk entfernt, wo der feinkörnige Uferstreifen an einer binsenartigen Bewachsung endet, stiebt ein Knäuel Mädchen und Buben schreiend auseinander. Sie rennen einige Meter, bleiben dann stehen und zeigen mit ausgestreckten Armen auf einen angeschwemmten Gegenstand. Plum tätschelt die beiden Frauen beruhigend auf ihre Rücken und geht zu der Stelle. Weitere Badegäste schließen sich ihm an. Als der Reporter merkt, dass es sich um einen leblosen Mann handelt, der da im Wasser liegt, holt er sein Smartphone aus der Tasche und beginnt zu fotografieren. Andere wählen die 112, und schon nach wenigen Minuten hält ein Polizeifahrzeug vor Marios Kiosk. Dort sind mehrere Badegäste versammelt, die aufgeregt durcheinanderreden und mit wilden Gesten die Polizisten an den Fundort führen. Plum ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zurück in seine Redaktion. Die Bilder hat er, und den Text dazu wird er noch erfahren.
Hauptkommissar Horst Leicht vermeidet es soweit als irgendwie vertretbar, bei dieser Hitze sein Büro zu verlassen. In dem alten Gemäuer des Polizeipräsidiums im Schatten des Münsterturms hinter zwei Meter dicken Steinmauern und Schießscharten als Fensterluken ist es selbst bei einer solchen Bruthitze erträglich kühl. Seine Körperfülle, gegen die er permanent und vergeblich ankämpft, verlangt an solchen Tagen möglichst umfassende Untätigkeit. Deshalb nimmt er nur missmutig das Gespräch an, als sein Handy summt. Er ahnt eine unangenehme Störung.
Michael Plum klingt provokativ gut gelaunt. »Bist du noch in deinem schattigen Bau, Horst? Am Pfuhler See wartet Arbeit auf dich.«
Leicht versteht kein Wort und sagt es auch.
»Du bist noch gar nicht informiert?«, fragt der Redakteur süffisant. »Freut mich, dass ich die Reihenfolge unseres Informationsaustausches mal umdrehen kann. Bei Mario am Pfuhler See liegt eine männliche Leiche.«
Der Kommissar sieht Plums satt zufriedenes Gesicht vor sich. Normalerweise erhält der Journalist Informationen von der Polizei, nicht umgekehrt.
Zwischen Plum und dem Hauptkommissar hat sich im Laufe der Jahre eine gute, manchmal sogar vertrauliche Symbiose entwickelt. Leicht nutzt Plum, um ab und zu einen Stein ins Wasser zu werfen, wenn er mit seinen Ermittlungen feststeckt. Im Gegenzug versorgt er den Reporter mit Informationen, die der Öffentlichkeit bislang verborgen waren. Man versteht sich und kann sich sogar aufeinander verlassen.
»Für ertrunkene Nichtschwimmer bin ich nicht zuständig und für besoffene Schwimmer erst recht nicht«, antwortet Leicht und will das Gespräch beenden.
»Auch wenn einem der Kopf nur noch fast am Hals hängt?«, fragt Plum.
Zu Leichts Arbeitszimmer wird die Tür aufgerissen und Oberkommissar Müller kommt mit einer offensichtlich dringenden Nachricht. Der Hauptkommissar bremst ihn mit einer abwehrenden Geste und fragt Plum, woher er das wisse.
»Ich habe es selbst gesehen«, antwortet Plum. »Wir sprechen uns später. Du schuldest mir was.«
»Wir müssen los«, drängt Oberkommissar Otto Müller, nachdem Leicht das Handy weggesteckt hat, »am Pfuhler See liegt ein Toter. Die Polizei sagt, ihm sei die Kehle durchgeschnitten worden.«
»Ich weiß«, brummt Leicht ohne weitere Erklärung. »Sagen wir der Frau Doktor Bescheid.«
Die Gerichtsmedizinerin Dr. Ute Werr diktiert gerade ein Obduktionsprotokoll, als sie durch einen Anruf von Otto Müller gestört wird. Sie solle bitte zusammen mit den Leuten der Spurensicherung an den Kiosk am Pfuhler See kommen. Dort erwarte sie eine Überraschung, kündigt er an.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kommissaren und Dr. Werr verläuft reibungslos. Die Ermittler wissen um die unstrittige Kompetenz der Medizinerin. Selbst an den skurrilen Humor der resoluten Frau, mit dem sie sich gegen die Grausamkeiten schützt, die ihr in ihrem Beruf begegnen und deren Ergebnisse auf ihrem Tisch landen, haben sie sich gewöhnt. Ihre Frage, ob sie einen Badeanzug brauche und wenn ja, ob die Herren besondere Wünsche hätten, lässt Otto deshalb unbeantwortet.
Als die beiden Kommissare am Kiosk eintreffen, hat die Polizei den Uferabschnitt bereits mit rotweißen Bändern abgesperrt. Davor drängen sich etwa achtzig neugierige Badegäste und jede Menge Kinder. Leicht bahnt sich und Otto einen Weg durch die Umstehenden, hebt das Band hoch und geht auf die uniformierten Polizisten am Wasser zu.
»Wir haben ihn etwas herausgezogen. Der Mann heißt Farid Diba und ist Afghane«, erklärt ein Polizist und reicht Leicht eine scheckkartengroße Aufenthaltsgenehmigung. »Mehr hatte er nicht bei sich.« Der Kommissar bedankt sich und gibt die Anweisung, die Finger von der Leiche zu lassen, bis die Spurensicherung ihre Arbeit abgeschlossen habe.
Am Ufer liegt ein mit einer schwarzen langen Hose und einem weißen Hemd bekleideter Körper, dessen pausbackiger Kopf ziemlich verdreht vom Rumpf absteht. Seine unter den Hosenbeinen herausragenden Füße sind nackt.
Vom Waldweg her kommt ein Konvoi aus Krankenwagen, SpuSi und Notarzt. Die Fahrzeuge halten beim Kiosk. Dr. Werr hat bereits ihren weißen Mantel angezogen und streift sich beim Näherkommen die Latexhandschuhe über. Neben dem Toten geht sie in die Hocke und betrachtet ihn zunächst genau, ohne ihn zu berühren. Nach einer Weile schaut sie zu den beiden Kommissaren hoch und zeigt auf die Fußknöchel. Im weißen Fleisch zeichnen sich deutlich zwei bläuliche Ringe ab. Sie greift der Leiche an Kinn und Stirn und kippt den Kopf vorsichtig nach hinten. Am Hals klafft ein Schnitt, der fast bis zum Wirbel reicht und die Luft- und Speiseröhren offenlegt.
»Hier kann ich nichts mehr tun. Packen Sie ihn ein wie er ist und bringen Sie ihn mir in die Anatomie.« Sie klopft Leicht, der die Ausweiskarte an einen Beamten der Spurensicherung übergibt, auf die Schulter. »Lust zu schwimmen? Wäre gut für Ihre Figur. Der See gehört Ihnen jetzt ganz allein.« Leicht folgt ihrem Blick, und tatsächlich ist die Wasserfläche menschenleer.
»Was denkst du?«, fragt Leicht auf der Rückfahrt seinen Kollegen Otto.
»Verdammte Scheiße, ein Asylant. Wir haben die ganze Pressemeute am Hals. Woher hast du von dem Toten gewusst?«
»Plum hat mich informiert. Er hat seine Nase bereits in der Spur. Da können wir uns auf was gefasst machen. Wir sollten möglichst schnell zum Mähringer Weg fahren. Vielleicht erfahren wir dort etwas mehr. Kennst du das Asylantenheim?«
Otto zuckt mit den Schultern. »War nie dort. Alte Kaserne. Sollen wir Polizei mitnehmen?«
Leicht schaut überrascht auf. »Meinst du, es gibt Probleme?«
Vor dem langgestreckten, dreigeschossigen Altbau lehnen mehrere junge Männer wie aufgereiht an der Hauswand, tragen dunkle, lange Hosen und helle Hemden, rauchen und sehen auf die Smartphones in ihren Händen. Ihre bloßen Füße stecken in ziemlich abgetretenen Sandalen. Als die beiden Kommissare auf die Haustür zugehen, zeigen sich einige uninteressiert und andere blicken ihnen misstrauisch entgegen. Müller fragt den nächststehenden nach einem Herrn Farid Diba. Der Mann zuckt verständnislos mit den Achseln. Zögernd kommen die anderen hinzu und bilden einen Kreis um Leicht und Müller.
»Versteht jemand Deutsch?«, fragt Leicht und wiederholt Ottos Frage. »Kennt einer Farid Diba?« Die Männer schauen sich gegenseitig stumm an und sehen aus, als hätten sie keine Ahnung, was die Kommissare wissen wollten.
»Sie nicht verstehen, Farid Diba?«, versucht Leicht es nochmal. »Afghane«, schiebt er präzisierend nach. Die Männer scheinen tatsächlich nicht zu verstehen, schieben sich aber gemeinsam näher an die Kommissare heran. Männer, aus deren Augen ihnen Misstrauen entgegenfunkelt.
»Das hat keinen Zweck«, sagt Leicht, als er sich in einem Ring eingeschlossen fühlt. »Otto, wir gehen.«
Wie durch Zauberhand öffnet sich nach seinen Worten eine Gasse. »Wir kommen wieder«, ruft Leicht den Männern zu, bevor er ins Auto steigt und wütend den Motor aufheulen lässt.
Auf seinem Schreibtisch findet er die Nachricht vor, Frau Dr. Werr habe Neuigkeiten.
»Das ging aber schnell«, kommentiert Otto. Sie machen sich auf den Weg in die Obduktion. Die Ärztin lehnt rücklings am Seziertisch und schaut ihnen sichtlich aufgekratzt entgegen.
»Sie sind wirklich immer wieder für eine Überraschung gut, meine Herren. Schauen Sie diesen Ihren Geschlechtsgenossen an!«
Mit theatralischer Geste schlägt sie das weiße Laken über dem Leichnam zurück. Nach einem kurzen Blick wendet Otto entsetzt seinen Blick ab, und Leichts Lippen flabbern wie ein losgelassener Luftballon.
Ute Werr zieht das Tuch wieder hoch und lädt die beiden Männer ein, an ihrem kleinen Schreibtisch Platz zu nehmen. Sie holt drei Wassergläser und eine Flasche Grappa und schüttet die Gläser ziemlich voll. Stumm stoßen sie an und nehmen einen kräftigen Schluck.
»Sie haben gesehen, dass dem Toten nicht nur der Hals durchtrennt wurde, sondern dass er auch seiner Genitalien beraubt worden ist. Ich habe sie übrigens an anderer Stelle gefunden. Skrotum und Penis waren tief in seinen Mund gestopft. Dabei habe ich festgestellt, dass der Herr in seiner Kindheit Mittelpunkt einer Beschneidungszeremonie gewesen ist. Noch interessanter dürfte für Sie sein, dass der Mann geschächtet wurde.«
Ute Werr hält inne, nutzt die Pause zu einem weiteren Schluck aus dem Wasserglas und prüft, ob die beiden Kommissare den Sinn ihrer Worte verstehen.
»Adern und Venen sind leer. Daher wohl die blauen Ringe an den Knöcheln. Der Mann wurde mit dem Kopf nach unten aufgehängt und sein Blut lief aus. Der Schnitt in den Hals ist wahrlich tief genug.« Im typischen Pathologenstakkato erklärt sie weiter. »Etwa fünf Liter. Der Rest ist noch im Körper verteilt. Wenn Sie mich fragen, können Sie einen Mitteleuropäer als Täter ausschließen. Die Tatwaffe könnte ein Khukuri-Messer sein, ein orientalischer Krummdolch. Tatzeit ungefähr minus fünfzig Stunden. Im Wasser lag die Leiche mindestens dreißig Stunden. Der Täter muss sich ziemlich mit Blut besudelt haben. An der Leiche werden sich nach diesem Bad wohl keine Spuren von ihm finden lassen. Etwa vierzig Jahre alt, 1,77 Meter groß und mit Blut achtundsiebzig Kilo schwer. Der Fleck an der rechten Stirn ist ein unbedeutendes Muttermal.«
»Wie lange ist er tot? Das habe ich nicht ganz verstanden«, fragt Leicht.
»Er wurde vor etwa fünfzig Stunden geschlachtet, also am letzten Sonntag«, wiederholt die Medizinerin, was sie herausgefunden hat.
»Ein Streit unter Asylanten«, vermutet Otto, und Leicht ergänzt, dass so eine Abschlachtung nicht heimlich ausgeführt worden sein könne. »Da muss es jede Menge Zeugen geben.« »Oder Täter«, gibt die Werr zu bedenken. Der Hauptkommissar trinkt sein Glas leer.
»Nächstes Mal bringe ich Ihnen so eine Flasche italienischen Tresterfusel mit, Frau Doktor, damit Sie da herunten nicht trübsinnig werden. Vielen Dank nochmal.«
Leicht und Müller zerbrechen sich ihre Köpfe, weswegen der oder die Täter sich die Mühe gemacht haben, den Toten mit Hose und Hemd zu bekleiden, bevor sie ihn ins Wasser warfen. »Interessant ist, dass sie ihm seinen Ausweis mitgegeben haben. Sie wollen, dass wir wissen, wer er ist. Warum?«
Im Büro erwartet der Kommissaranwärter Bruno seine Ausbilder. Aufgeregt berichtet er, dass die Oberstaatsanwältin schon dreimal angerufen habe. »Sie ist stinksauer. Sie wurde von der Presse um eine Stellungnahme gebeten und hat keine Ahnung, um was es geht. Sie möchte wissen, was wir am Pfuhler See zu suchen haben und ob wir nicht wüssten, dass der in Bayern liegt.«
Die Aufforderung, sich mit der Staatsanwaltschaft in Person der Oberstaatsanwältin Dr. Rossmann in Verbindung zu setzen, löst bei Leicht einen für ihn nicht vermeidbaren Verzögerungsreflex aus. Unabhängig davon, was die Ursache dieser Aufforderung ist. In diesem Fall scheint die Angelegenheit jedoch kompliziert. Die Staatsanwältin hat nämlich Recht. Tatsächlich liegt der Fundort der Leiche außerhalb der örtlichen Zuständigkeit der Mordkommission.
Leicht möchte den Fall, nachdem er das interessante Obduktionsergebnis kennt, bei sich behalten und braucht dringend Rückendeckung. Er weiß auch, wo er sie bekommt.
In seiner Jugend, vor etwa zwanzig Jahren, war er nicht nur zwanzig Kilo leichter, sondern auch ein erfolgreicher Ruderer.
Die Treue zu seinem Ruderclub hat er gehalten und die Verantwortung für die Geräte und die Nachwuchsruderer übernommen. Ehrenvorsitzender des Rudervereins ist der Präsident des Landgerichts. Dr. Anton Zeiss ist ein jovialer Mann, der in Kürze das Pensionsalter erreicht, das Gericht seit über zehn Jahren dominiert und den angesehensten Vereinigungen der Stadt ehrenhalber vorsteht. Seine mündlichen Urteilsbegründungen würzt er häufig mit moralisierenden und erzieherischen Belehrungen. Die Presse rühmt ihn dafür, weil es möglich wird, eine kurze Nachricht zu einem voluminösen Artikel aufzublasen. Die Anwälte und andere beruflich am Gericht beschäftigte Personen sehen darin das Ausleben seiner ungezügelten Eitelkeit und verspotten seine Amtsführung als aus der Zeit gefallenes Gottesgnadentum. Der Oberbürgermeister der Stadt hat beim Empfang anlässlich des sechzigsten Geburtstags des Gerichtspräsidenten in einer launigen Ansprache seine Amtsführung unter ironischem Beifall als nach Gutsherrenart charakterisiert. Bei den Beamten und Angestellten des Gerichts ist Dr. Zeiss mehrheitlich beliebt, weil er sich väterlich wohlwollend um deren Karrieren kümmert. Nur mit der Oberstaatsanwältin ist das Verhältnis ziemlich angespannt. Der Gerichtspräsident liebt es, Prozesse mit einem gewissen Öffentlichkeitspotential an sich zu ziehen. Vor einigen Jahren erregte der Attelmann-Prozess Aufsehen, bei dem ein über die Grenzen der Stadt hinaus bekannter Unternehmer wegen Mordes an seinem Finanzchef angeklagt worden war. Zeiss als Vorsitzender Richter hatte sich frühzeitig auf einen Schuldspruch festgelegt und nimmt es der Oberstaatsanwältin bis in alle Ewigkeit übel, dass sie damals in illoyalem Zusammenwirken, wie er es bezeichnete, mit einem charismatischen alten Verteidiger einen Freispruch beantragte. Er fühlte sich damals in seiner Autorität beschädigt und beschloss, ihr dieses Fehlverhalten innerhalb der Gerichtsbarkeit seines Hauses bei jeder Gelegenheit zu vergelten. Hauptkommissar Leicht war damals der ermittelnde Beamte und kennt diese Seelenlage von Dr. Zeiss.
Entschlossen durchquert er die Altstadt, steigt im altehrwürdigen Justizpalast die Treppe zum ersten Stock hinauf und klopft an die Flügeltür zu den Amtsräumen des Präsidenten. Im Vorzimmer weist ihn die Sekretärin darauf hin, dass er ohne Terminabsprache Dr. Zeiss nicht sprechen könne, als sich die innere Tür öffnet. Ein bulliger Mann, der Energie und Überlegenheit ausstrahlt – Eigenschaften, die sich mit zur Schau gestellter gelassener Ruhe zu einer stattlichen Persönlichkeit vereinen – füllt den Türrahmen. »Leicht, was machen Sie denn bei mir?«
Freundlich mustert der oberste Richter dieses Gerichts den Mann, der ihm bei der Auszeichnung erfolgreicher Sportler die Ehrenurkunden zur Verleihung zureicht.
»Kann ich Sie einen Moment sprechen, Herr Präsident?«, fragt Leicht höflich und wirft der Sekretärin einen triumphierenden Blick zu. »Ich habe ein Problem.«
Leicht kennt die Antwort von Anton Zeiss, und wie erwartet tönt sein sonorer Bass: »Nicht mehr lange, mein Lieber, kommen Sie rein.«
Der Richter lässt sich hinter seinem blank polierten Schreibtisch in einen bequemen Sessel fallen, fordert Leicht auf, ebenfalls Platz zu nehmen und sieht ihn mit hellwachen, braunen Augen erwartungsvoll an. Der Hauptkommissar berichtet über den Leichenfund am Pfuhler See und gibt die Erkenntnisse der Gerichtsmedizinerin detailgetreu wieder.
»Ein Mord unter Asylanten?«, fragt Zeiss nachdenklich.
»Vermutlich«, nickt Leicht. »Das Problem ist, dass unsere Staatsanwältin meint, wir seien nicht zuständig, obwohl der Fundort sicher nicht der Tatort ist und das Opfer in einem Asylantenheim bei uns in der Stadt wohnte. So steht es wenigstens in seiner Aufenthaltsgenehmigung.«
Dr. Zeiss schiebt seine Unterlippe vor und massiert seine ausgeprägten Ohrläppchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Ein Mordprozess im Asylantenmilieu der Stadt wäre ein spektakuläres Verfahren. Ein großer Auftritt am Ende seiner Richterlaufbahn. Ein Verfahren mit politischer Brisanz! Er sieht sich auf der Richterbank im überfüllten großen Saal des Schwurgerichts, in dem sich die Pressevertreter drängen. Die letzte große Bühne vor seiner Pensionierung!
»Waren Sie schon in dieser Asylantenunterkunft?«, fragt er, und Leicht berichtet von der bedrohlichen Mauer des Schweigens, auf die Müller und er gestoßen waren. Nach einer kurzen Überlegung hat sich der Gerichtspräsident entschieden. »Natürlich sind wir zuständig. Da dürfen wir uns nicht wegducken. Ermitteln Sie gründlich, Leicht. Ich will glasklare Beweise und eine lückenlose Aufklärung der Hintergründe. Lassen Sie die Rossmann meine Sorge sein. An die Arbeit!« Der Präsident steht auf und reibt sich die Hände.
Auf dem Rückweg genehmigt sich der Hauptkommissar eine Kaffeepause. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis des Gesprächs. Seine Rechnung ist aufgegangen. Zeiss hat angebissen, und die örtliche Zuständigkeit ist nicht mehr sein Problem. Er hat sich eine Kaffeepause unter freiem Himmel verdient. Als er das Café am Rand des Münsterplatzes erreicht, sieht er Otto Müller an einem der kleinen Tische sitzen. Vor einigen Jahren war der Platz mit einer Unzahl von Einstein-Figuren vollgestellt und man musste einen Slalom laufen, um ihn zu überqueren. Mit einer ausladenden Geste lädt er den Hauptkommissar ein, sich zu ihm zu setzen.
»Ich wusste, dass du hier vorbeikommst«, sagt er schelmisch. »Du kannst dir Zeit lassen. Die Rossmann hat auf deinen Rückruf für heute verzichtet. Wie hast du das mit dem Zeiss so gut hingekriegt?«
»Meine Sache«, brummt Leicht und disponiert von Kaffee zu Weißbier um. »Der Präsident freut sich auf den Prozess.«
»Dachte ich mir. Gibt einen großen Auftritt. Die Ausländerbehörde hat bestätigt, dass der Tote hier gemeldet ist. Ich habe vom BAMF die Unterlagen des Farid Diba angefordert. Die haben sich quergestellt und von Vertraulichkeit ihrer Akten gefaselt, bis ich der Dame am Telefon den derzeitigen Zustand ihrer Karteileiche genauestens beschrieben habe. Diba war als Flüchtling anerkannt und brauchte keine Angst zu haben, abgeschoben zu werden.«
Leicht nimmt einen Schluck, wischt sich den Schaum vom Mund und knurrt nur, dass ihm das jetzt auch nichts mehr nütze und es gescheiter gewesen wäre, wenn er in Afghanistan geblieben wäre.
»Hast du was gegen Flüchtlinge?«, fragt Otto erstaunt über den Unterton, den er zu hören glaubt.
»Ach was, arme Schweine«, wischt Leicht Ottos Tiefgang zur Seite und holt sein Handy aus der Tasche. Er ruft eine gespeicherte Nummer auf. »Hallo Judith, kommst du am Wochenende?«
Otto lächelt und beobachtet amüsiert, wie sich Erwartung und Enttäuschung in Leichts Gesicht abwechseln. »Schade. Ich habe interessante Neuigkeiten und könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber wenn es nicht geht, ist das auch okay.« Leicht steckt sein Handy weg und greift nach dem Glas.
»Probleme?«, fragt Otto.
»Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit. Tunnelblick«, sagt Leicht und zuckt mit den Achseln.
Seit fünf Jahren geht das zwischen den beiden, und für Otto ist es unmöglich, die Amplitudenausschläge dieser Beziehung nicht mitzubekommen. Zusammengetroffen sind Leicht und Judith bei einer Exkursion zu den archäologischen Fundorten auf der Schwäbischen Alb. Judith war Studentin der Archäologie und Kunstgeschichte, und der Kriminalkommissar ging seinem Hobby nach. Er hätte gerne Archäologie studiert, aber seine Eltern, die das Risiko der Arbeitslosigkeit am eigenen Leibe verspürt hatten, drängten ihn zu einem sicheren Beruf, und so wurde aus ihm so schnell als möglich ein Beamter auf Lebenszeit. Er beneidete damals die Studenten, die am Hohlenstein bei Lindenau der Geschichte des Löwenmenschen nachspürten und nahm an einer öffentlichen Veranstaltung teil, in der dieses vierzigtausend Jahre alte Artefakt wissenschaftlich am Fundort vorgestellt wurde. Ihn faszinierte, dass die nachweisbare Besiedlung seiner engsten Heimat viel weiter zurückreichte als das, was er von Sumerern und Ägyptern in der Schule gelernt hatte. Später, als Judith ihm ganz nebenbei erzählte, dass sie am Löwenmenschen arbeite, dieser aus Elfenbeinsplittern eines Mammuts zusammengesetzt und das älteste bekannte Kunstwerk der Welt sei, war er nahe daran, seinen Beruf als Kriminalkommissar aufzugeben und sich seinen Traum zu erfüllen. Schließlich siegte aber doch seine Vernunft. Judith nannte es Bequemlichkeit, und er begnügte sich damit, dass sie ihm von ihrer Arbeit erzählte und ihn zumindest in seiner Fantasie daran teilhaben ließ. Im Gegenzug freute es ihn, dass sie sich für seine Arbeit interessierte. Ergaben sich spektakuläre Fälle, dann schloss er Judith in seine Ermittlungen ein und erhielt gelegentlich nützliche Anregungen, die ihn weiterbrachten. Wenn sie ihrem Temperament entsprechend neugierig zuhörte und skeptisch gegenüber seinen Schlussfolgerungen ihre oft originellen, eigenen Gedanken beisteuerte, dann verlor er sein Unterlegenheitsgefühl, das ihn quälte und gelegentlich zu der Frage veranlasste, was diese hübsche, intelligente, junge Frau an ihm finde. Er ist über zehn Jahre älter als sie und mit einem Body-Mass-Index von Dreißig schon etwas behäbig. Sein Elternhaus war von Geld- und Existenzsorgen geplagt, das ihre kannte diese Ängste nicht. Sein Geschenk zum bestandenen Abitur war eine gemeinsam mit Vater und Mutter am Küchentisch getrunkene Flasche Sekt, das ihre ein nagelneues, rotes Peugeot-Cabrio. Keine ideale Voraussetzung für eine dauerhafte Beziehung. Trotzdem hat sich ihr Miteinander erstaunlich eingespielt. Anfängliche Neugier und Leidenschaft haben sich zu selbstverständlicher Vertrautheit gewandelt, und wenn sie es irgendwie einrichten kann, besucht sie ihn am Wochenende in seiner Junggesellenwohnung am Judenhof. Dass sie das Thema ihrer Doktorarbeit, die Bestimmung des Castel del Monte in Apulien, im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen in einem Mordfall vor einem Jahr, gefunden hat, verschaffte ihm eine besondere Genugtuung. Er hatte es damals mit einem ziemlich undurchsichtigen Arzt zu tun, der mit der Bundeswehr in Afghanistan gewesen war. Wohl wegen seiner dort erlittenen Traumata hat er sich nach seiner Rückkehr in eine Hütte ins Donauried zurückgezogen und ist etwas wunderlich geworden.
Judith war an den Lippen dieses interessanten Mannes gehangen, als er von seinen Abenteuern als Student erzählte, wie er und einige Kommilitonen dem Geheimnis dieser Festung Kaisers Friedrich II. auf die Spur gekommen waren. Mit seinem Einverständnis hatte sie sich dafür entschieden, diese Erkenntnisse zum Ausgangspunkt ihrer kunstgeschichtlichen Dissertation zu machen. Es kommt sehr selten vor, dass sie ein Besuchswochenende auslässt. Trotz ihrer Absage bleibt Leicht zuversichtlich. Heute ist Mittwoch, und bis Freitagabend kann in Judiths etwas sprunghafter Entscheidungswelt noch viel geschehen.
»Zeiss geht von einem Mord im Asylantenmilieu aus«, informiert Leicht seinen Kollegen. »Er will hieb- und stichfeste Ergebnisse, damit er vor der Öffentlichkeit glänzen kann. Ich fürchte, wir werden nicht nur der Rossmann berichten müssen. Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Sie darf davon keinen Wind bekommen.«
»Mensch Horst, wie naiv bist du eigentlich? Der Zeiss ruft die Bayern an, regelt mit denen die örtliche Zuständigkeit, diese geben unserer Staatsanwaltschaft grünes Licht, und du meinst, die Rossmann riecht den Braten nicht. Die weiß genau Bescheid und schaut uns penibel auf die Finger. Am besten lassen wir Bruno das Schreiben von Berichten üben.«
»Hier treffe ich euch. Das hätte ich mir denken können. Dankbarkeit ist eure Stärke nicht. Seit Stunden warte ich auf euren Anruf. Was gibt es Neues? Exklusiv für euren Freund Plum.« Der Journalist ist auf der Suche nach weiteren Schlagzeilen und hat dabei die beiden Kommissare beim Bier entdeckt. Er zieht einen Stuhl an ihren Tisch. »Ihr wollt doch sicher eine wohlwollende Presse. Ich höre.«
»Zeig erst deine Bilder. Dann reden wir weiter.«
Plum scrollt auf seinem Handy eine Bildserie herunter.
»Langsamer! Gib mir mal her!« Leicht greift nach dem Smartphone und Plum versteckt es hinter seinem Rücken.
»Finger weg, lieber Herr Hauptkommissar. Mein ist mein und dein ist dein. Sehen ja, berühren nein! Wie in einem guten Nightclub.«
Auf den Fotos ist der Fundort der Leiche wiederzuerkennen. Den Mann in weißem Hemd und schwarzer Hose hat Plum aus mehreren Perspektiven aufgenommen. Die Halswunde ist grausam deutlich abgelichtet.
»Hast du den Toten bewegt?«, fragt Leicht, und Plum antwortet süffisant, selber habe sich dieser leider nicht mehr gedreht.
»Ist dir außer der riesigen Wunde am Hals noch etwas aufgefallen?«, fragt Leicht verärgert
Für den ersten Artikel sei das Sensation genug, und wenn es weitere Einzelheiten gibt, dann werde er diese sicher gleich erfahren, denn eine Hand wasche bekanntlich die andere.
»Wie sieht es mit eurem Spesenkonto aus? Ist noch ein Weißbier drin?«, witzelt der Reporter. Leicht winkt der Bedienung und bestellt.
»Der Tote ist ein anerkannter afghanischer Asylant«, gibt er preis. »Er ist bei uns gemeldet und lag zwanzig bis dreißig Stunden im Wasser. Umgebracht wurde er am Sonntag, sagt die Werr.«
»Wenn die Werr das sagt, dann stimmt es auch.« Ihr legendärer Ruf hat sich bis zu ihm herumgesprochen. »Sonst noch was?«
»Nein, mehr wissen wir noch nicht«, behält Leicht die schauerlichen Details für sich.
Im Büro empfängt sie Bruno mit der Nachricht, die elektronische Akte vom BAMF sei eingetroffen. »Sehr interessant«, fügt er hinzu und zeigt, dass er sich bereits damit befasst hat.
»Was ist Ihnen aufgefallen?«, fragt Otto, während Leicht den PC hochfährt.
»Der Farid Diba ist kein unbeschriebenes Blatt. Wissen Sie, warum er Asyl bekommen hat? Weil sie ihn einen Kopf kürzer machen, wenn er nach Afghanistan abgeschoben wird.«
Leicht blättert in der Akte auf seinem Monitor. Eine Menge Formulare, Dublin-Abgleiche, Fotos und Fingerabdrücke, vorläufige Aufenthaltserlaubnisse und schließlich das Anhörungsprotokoll mit der amtlichen Entscheidung des BAMF. Als er die Anhörung aufgeblättert hat, winkt er Otto zu sich. Gemeinsam lesen sie den Text.
Anhörung Mann, 36 Jahre alt, Afghane. Farid Diba.
Ich bin Moslem sunnitischen Glaubens und Paschtune. Ich wurde in Afghanistan geboren. Meine Eltern flüchteten mit mir und meinen Geschwistern wegen des Einmarsches der sowjetischen Truppen zu Verwandten nach Pakistan. Wir entstammen einer wohlhabenden Familie und litten keine Not. Ich besuchte die Koranschule in Peshawar. Im Jahre 1417 kehrten wir nach Afghanistan zurück. (Anm. des Anhörenden: 1996). Ich war siebzehn Jahre alt und schloss mich einer Talibangruppe an. Unser Ziel war, Afghanistan für unseren Glauben zurückzuerobern. Im Jahre 1437 (Anm. des Anhörenden: 2016) habe ich mich entschlossen, Afghanistan zu verlassen und nach Deutschland auszureisen. Mir war bekannt, dass Deutschland seine Grenzen für afghanische Flüchtlinge geöffnet hat. Meine Familie hat für die Ausreise 15.000 US$ bezahlt. Ich habe in München Asylantrag gestellt. Zurzeit bin ich einem Asylantenheim in Ulm zugewiesen.
Auf Frage: Warum haben Sie Afghanistan verlassen?
In Afghanistan gibt es nur Gewalt.
Auf Frage: Sie waren ein Mitglied der Taliban?
Ja. Das ist richtig.
Auf Frage: Waren Sie an Gewalttaten beteiligt?
Ja. Das ist richtig.
Auf Frage: Was für Gewalttaten waren das?
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Auf Frage: Welche Asylgründe machen Sie geltend?
Wenn ich nach Afghanistan zurückkehre, werde ich getötet.
Auf Frage: Warum und von wem werden Sie getötet, wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren?
Ich werde von der Regierung getötet, weil ich bei den Taliban war, und ich werde von den Taliban getötet, weil ich nach Deutschland geflohen bin.
Auf Frage: Was erwarten Sie von Deutschland?
Sicherheit und ein gutes Leben.
Auf Frage: Nochmals ganz konkret: Was hätten Sie zu befürchten, wenn Sie nach Afghanistan abgeschoben würden?
Den Tod.
Die beiden Kommissare schauen sich an. »Den hat er hier auch bekommen«, sagt Leicht trocken. »Er hat zugegeben, dass er in Afghanistan ein Verbrecher war. Was heißt das? Was hat er getan, wann, wo? Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen.«
»Das BAMF ist keine Ermittlungsbehörde für Verbrechen in Afghanistan«, wendet Otto ein.
»Verdammt, ja. Aber wir schützen einen Mörder.«
»Nicht wirklich. Schau ihn dir an,« grinst Otto.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, flucht Leicht. »Haben wir nicht genug mit unseren eigenen Idioten zu tun? Wir müssen nochmals ins Asylantenheim. Mit Dolmetscher und Polizei. Ich organisiere das für morgen früh.« Otto schaltet den PC aus.
Leicht zieht es nicht zu seiner leeren Wohnung im Judenhof. Er überquert die Neue Straße, schaut sich am Weinhof um, bleibt vor dem Schiefen Haus kurz stehen, geht über die Brücke der Blau, schlendert über das Fischerplätzle und steht schließlich an der Donau. Ruhig fließt das Wasser, als würde es seit ewigen Zeiten alle Probleme mit sich nehmen. Auf den Liegewiesen zwischen Stadtmauer und Donau tummelt sich das Volk. Die einen haben Decken mitgebracht, auf denen sie sich in der Abendsonne ausstrecken; andere halten ein Picknick, und wieder andere spielen dazwischen Fußball. Vor dem Denkmal der Schiffsleute auf der Zille, das an die Auswanderung der Donauschwaben zu Maria Theresias Zeiten erinnert, sitzt eine alte, ganz in schwarz gekleidete Frau inmitten ihrer Familie zufrieden auf dem Boden. Sie haben ihr Mitgebrachtes vor sich ausgebreitet, formen es mit den Fingern, führen es zum Mund und kauen. Leicht beobachtet die archaisch feierliche Szene. Ihm fallen viele junge Leute auf, denen man ihren Migrationshintergrund ansieht. Der Kommissar kennt dieses Phänomen. Ein Jahr vor der Abiturprüfung brach er sich beim Skifahren bei einem unglücklichen Sturz das Schlüsselbein. Ein halbes Jahr lang traf er mehr Menschen mit Schlüsselbeinbrüchen als sein ganzes Leben davor und danach. Auch Männer, deren Frauen schwanger sind, erzählen, dass sie in dieser Zeit den Eindruck haben, die Stadt sei voll von Frauen, die ein Kind erwarten.
Er setzt sich an das Ende einer Bank, auf der ein Junge und ein Mädchen mit ihren Rücken aneinander gelehnt und mit ausgestreckten Beinen zwei Bücher lesen. Obwohl die Bank lang und ausreichend Platz ist, zieht das Mädchen ihre Knie an, um mehr Abstand zu ihm zu halten.
Das ist einer jener Momente, in denen er Judith vermisst. Gerne hätte er sie jetzt neben sich. Wenn er sicher wüsste, dass sie am Wochenende kommt, wäre alles in Ordnung für ihn. Die Woche ist angefüllt mit Arbeit, und er genießt es, was er tut oder lässt, niemandem erklären zu müssen. Dass Judith am Freitagabend ankommt und am Sonntagabend wieder abfährt, daran hat er sich gewöhnt, und so hat es sich eingespielt. Sie erzählen sich gegenseitig die erwähnenswerten Ereignisse der vergangenen Woche und haben zwei Nächte miteinander. Mit diesem Rhythmus können beide gut leben. Weil sie für das kommende Wochenende wegen ihrer Doktorarbeit vorerst abgesagt hat, sucht er nach Argumenten, die sie umstimmen könnten. Er will mit ihr sprechen, und da er ohnehin das Gefühl hat, die beiden auf der Bank zu stören, geht er zu einer der Steintreppen, die zur Donau hinunterführen, setzt sich auf eine Stufe und wählt Judith an. Als sie das Gespräch annimmt, atmet er erleichtert auf. »Ich sitze an der Donau und denke an dich«, beginnt er vorsichtig. »Ich hoffe, ich störe dich nicht bei der Arbeit. Es ist ein so schöner Abend.«
Judith ist solche Schalmeientöne von Leicht nicht gewöhnt und wartet ab. »Kannst du dir das mit dem Wochenende nicht nochmal anders überlegen? Ich würde dich wirklich gerne sehen«, drängt er.
Sie steckt bis über beide Ohren in ihrer Doktorarbeit, hat einen guten Lauf und möchte eigentlich dranbleiben.
Als sie immer noch schweigt, blufft er mit einem Ass im Ärmel. »Weißt du, ich muss diesen Samstag Gregor Starkbaum in seiner Hütte besuchen. Ich hätte dich gerne dabei.« Nach einer kleinen Pause kommt endlich die erhoffte Reaktion.
»Du triffst dich mit dem Doktor? Gehört er wieder zu deinen Verdächtigen?«, spielt sie scherzhaft auf seinen letzten Fall an.
»Nein«, versichert er. »Ich habe einen ziemlich bizarren Mordfall unter Afghanen und kann sein Wissen gut gebrauchen. Er war immerhin zehn Jahre dort und wird sich sicher nach dir und deiner Doktorarbeit erkundigen. Ich habe mir gedacht, dass du vielleicht mitkommen willst.«
»Klar komme ich mit«, antwortet sie spontan. »Mir fällt in meiner Bude ohnehin die Decke auf den Kopf. An der Hütte ist es bei diesem Wetter sicher wunderschön. Ich bin am Freitag bei dir.«
Am nächsten Morgen trifft Otto einen erstaunlich gutgelaunten Leicht. Selbst Plums Balkenüberschrift über vier Spalten Der Afghanistankrieg ist angekommen bringt ihn nicht aus der Ruhe.
Um neun Uhr sind sie mit Polizei, Dolmetscher und der städtischen Ausländerbeauftragten in der Asylantenunterkunft verabredet. Bevor sie losfahren, weist der Hauptkommissar seinen Azubi an, einen Bericht für die Oberstaatsanwältin fertigzustellen.
»Aber ich weiß doch nichts«, wehrt sich Bruno.
»Der auch nicht«, entgegnet Leicht und zeigt auf die aufgeschlagene Zeitung auf seinem Schreibtisch, »und trotzdem füllt er eine ganze Seite. Das können Sie auch.«
Als die zwei Kommissare am Ausländerheim ankommen, sehen sie drei parkende Einsatzfahrzeuge am Straßenrand. Den Polizeihauptmeister, der den Einsatz leitet, kennen sie. Mit seinen Leuten soll er erst dann in das Haus kommen, wenn es notwendig wird. Sie hofften, dass dieser Fall nicht eintritt und die bloße Anwesenheit der Polizeikräfte vor dem Haus genügt, die Leute von Übergriffen abzuhalten. Nach dieser Anweisung betreten sie das langgestreckte ehemalige Kasernengebäude, wo sie im Flur von drei Dolmetschern und einer Beamtin der städtischen Ausländerbehörde erwartet werden. In einem großen Raum im Erdgeschoß haben sich die Bewohner versammelt. Junge kräftige Männer und einige wenige Frauen und Kinder stehen dicht beieinander, als würden ihre Körper eine Wagenburg der Abwehr gegen äußere, unbekannte Gefahren bilden. Die Kommissare benötigen keine psychologische Ausbildung, um das Misstrauen und die Angst dieser Menschen zu spüren. Sie haben sich zu einer Herde zusammengeschlossen wie das Vieh auf der Weide, bevor ein Gewitter losbricht, und doch zeugen ihre Augenpaare von einem eigenen, individuellen großen Schicksal.
Die Mitarbeiterin der Stadt stellt sich als Frau Glaser vor und übernimmt die Rolle der Hausherrin. »Wir haben hier Flüchtlinge aus verschiedenen Herkunftsländern. Die meisten kommen aus Syrien und Afghanistan. Es sind aber auch welche aus dem Irak und Eritrea dabei. Mit einigen kann man sich auf Deutsch verständigen. Die Dolmetscher, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, sind hier.« Frau Glaser nennt drei Namen, die Leicht sofort wieder vergisst. »Wir decken damit die Sprachen Dari, Paschto, Farsi, Kurdisch und Tigrinya ab. Damit sollte ein Gespräch mit allen im Hause Anwesenden möglich sein. Wie wollen Sie vorgehen? Einzelbefragungen oder in der Gruppe?«
Er werde zunächst den Dolmetschern mitteilen, welche Informationen er brauche, meint Leicht und berichtet, dass man am Mittwoch einen Afghanen aus dieser Unterkunft mit durchtrenntem Hals am Pfuhler See gefunden habe. Der Fundort sei aber nicht der Tatort. Der Mann sei vermutlich am Sonntag getötet worden. »Wo, wissen wir nicht. Die Leiche muss aber irgendwie zum See transportiert worden sein.« Alles deute darauf hin, dass es mehrere Täter gewesen waren.
Leicht zeigt das Foto von Farid Diba aus der BAMF-Akte. »Sein Name ist Farid Diba. Er war achtunddreißig Jahre alt und als Mitglied der Taliban in Afghanistan im Zeitraum von ungefähr 2000 bis 2015 an Verbrechen beteiligt. Er wurde als Flüchtling anerkannt, weil ihm bei einer Abschiebung die Todesstrafe oder die Ermordung drohte. Die Details der Verletzungen machen es wahrscheinlich, dass er von seinen Landsleuten umgebracht worden ist. Mehr wissen wir nicht. Es ergeben sich also folgende Fragen: Ist es möglich, dass Farid Diba von einem Landsmann erkannt worden ist, der von seiner Vergangenheit wusste? Hat es Streitigkeiten innerhalb der Asylanten gegeben? Wo haben sich die einzelnen Bewohner dieser Unterkunft am Sonntag aufgehalten? Ist irgendeinem etwas aufgefallen, was für die Ermittlungen interessant sein könnte?«
Die Dolmetscher nicken und zeigen an, dass sie den Zweck der Befragung verstanden haben.
»Gibt es so etwas Ähnliches wie eine Hackordnung unter den Leuten hier?«, fragt Otto. »Einen, der für alle spricht. Einen, auf den die anderen hören?«
Die Beamtin zuckt mit den Achseln. »So eng ist mein Kontakt zu der Einrichtung nicht, dass ich das weiß.«
»Versuchen Sie, es herauszufinden«, weist Leicht die Dolmetscher an. Sie nicken beflissen.
Nach drei Stunden Befragungen unterbrechen die Kommissare das Procedere für eine Pause. »Keiner sieht was, keiner sagt was, keiner hört was, wie die drei Affen«, fasst Leicht das bisherige Ergebnis zusammen. »Wir kommen keinen Schritt vorwärts.«
Otto ist der gleichen Meinung. »Es ist verdammt schwierig, sich nur über Dolmetscher zu verständigen. Als wollte man mit einer gekochten Spaghetti zustoßen. Ich verstehe die Leute. Jedem ist sein Hemd näher als die Hose. Jeder hat Angst vor der nächsten Behördenentscheidung. Jeder hat nur sich selbst im Auge. Das ist keine Gemeinschaft, auch wenn es so aussieht.«
Er geht mit Leicht ein paar Schritte zur Seite. »Weißt du, an was mich das hier erinnert? Ich war voriges Jahr in Namibia in der Etosha-Pfanne. Da habe ich beobachtet, wie ein Löwe aus einer Herde von Gazellen ein Jungtier gerissen hat. Die anderen Tiere haben sich nicht darum gekümmert. Ich hatte den Eindruck, sie waren erleichtert, dass der Löwe endlich eines erwischt hat und sie davonkamen. So kommt mir das hier auch vor. Was machen wir?«
Leicht überlegt kurz und meint, es sei sinnlos, weiter im Nebel herumzustochern. »Wir schauen uns das Zimmer von dem Farid Diba an und lassen uns die Namen aller Bewohner geben. Dann fordern wir die passenden BAMF-Unterlagen an. Vielleicht ergeben sich daraus Anhaltspunkte.«
In dem Zimmer sind an der einen Wand zwei Stockbetten und an der anderen Kleiderschränke angeordnet. Durch das Fernster bohren die Sonnenstrahlen Lichtzylinder in den Raum, in denen Staubpartikel wirbeln und verraten, dass die letzte Reinigung schon längere Zeit zurückliegt. In der Mitte stehen zwei Stühle an einem Tisch, auf dem ein kleines, tragbares Fernsehgerät abgestellt ist. Das ist alles.
»Wer ist sein Zimmergenosse?«, erkundigt sich Leicht. Otto geht zu den Dolmetschern und gibt die Frage weiter. Kurze Zeit später bringt ein Übersetzer einen jungen Mann, der mit vor Angst flackernden Augen darauf wartet, was mit ihm geschieht. »Sein Name ist Milad. Er ist seit drei Monaten hier.«
»Fragen Sie ihn, wie lange er mit Farid Diba das Zimmer geteilt hat und was er über ihn weiß.« Ohne ein Wort zu verstehen, beobachten die beiden Ermittler das Gespräch der beiden. Heftig gestikulierend beantwortet Milad die kurzen Fragen des Dolmetschers. Als er endet, redet der Dolmetscher auf ihn ein. Er scheint ihm etwas zu erklären. Erneut antwortet der junge Mann mit einem längeren Wortschwall.
»Milad war von Anfang an mit Farid in diesem Zimmer zusammen. Als er gekommen ist, war Farid schon hier. Das war vor einem Vierteljahr. Von Farid weiß er nichts. Er sagt, dass Farid nichts von sich erzählt hat«, fasst der Dolmetscher das Gesprächsergebnis zusammen. Enttäuscht schauen sich Leicht und Otto an. Nach ihrer Beobachtung der Reaktion des Asylanten haben sie mehr erwartet. Sie wollen wissen, wo Farid seine persönlichen Unterlagen aufbewahrte. Noch bevor der Dolmetscher mit seiner Übersetzung beginnt, zeigt Milad auf eine Schranktür. Zwei Hosen, drei Hemden, ein Paar Schuhe, ein wenig Unterwäsche, mehr enthält der Schrank nicht. Kein Handy, keine Papiere, kein Geld, keine Fotos, nichts. Otto überprüft die Kleidungsstücke kurz und findet in einer der Hosentaschen lediglich ein zerknülltes Busticket. Routinemäßig steckt er es in ein Klarsichttütchen. Der Afghane sagt einige Worte, und der Dolmetscher teilt mit, dass Milad erklärte, Farid habe seine persönlichen Dinge immer bei sich getragen, weil die Türen zu den Zimmern nicht versperrt werden konnten. Brandschutz, sagen sie.
Die Kommissare schauen sich in den Gemeinschaftsräumen, der Küche und den Toiletten um. Schnell verabschieden sie sich danach und bitten, ihnen eine Namensliste aller Bewohner zukommen zu lassen. Zusammen mit den Einsatzfahrzeugen der Polizei fahren sie in die Stadt hinunter.
»Judith kommt morgen,« informiert Leicht seinen Kollegen, bevor Otto auf die Zustände in den Toilettenräumen zu sprechen kommt. Mit ihm arbeitet er inzwischen acht Jahre zusammen, seit er von Augsburg nach Ulm kam. Einen Grund für den Ortswechsel hat er nie genannt, und Leicht hat ihn auch nicht danach gefragt. Vor zwei Jahren überlebten sie nur knapp einen Anschlag. Professionelle Killer der bosnisch-albanischen Mafia hatten die Radaufhängung ihres Autos manipuliert. Sie überschlugen sich mehrmals. Danach hatte sich so etwas Ähnliches wie Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Otto respektiert nicht nur, dass Leicht der Chef der Mordkommission ist, sondern achtet darauf, dass für alle Beschäftigten unzweifelhaft bleibt, dass Leicht der Koch und er der Kellner ist. Ottos Lebensplanung, wenn er denn eine hat, sieht keine ehrgeizige Karriere vor. Über private Dinge sprechen sie eher selten. Leicht weiß, dass Otto in einem der Grabenhäuschen auf der Stadtmauer wohnt und zu den nachtschwärmenden Junggesellen der Stadt gehört. Er käme nicht auf die Idee, ihn dort zu besuchen oder sich eine Nacht mit ihm gemeinsam um die Ohren zu schlagen. Beide sind keine Kleber.
Otto kennt Leicht als Einzelgänger, der in seiner Arbeit aufgeht und außer zu Judith und seiner Mutter keine sozialen Kontakte pflegt. Zu Leichts Dachwohnung am Judenhof hat außer ihm selbst wohl nur ein streunender Kater Zutritt, der ab und zu durchs Küchenfenster springt, dem Leicht einige Happen aus seinem Kühlschrank auf den Unterteller legt und dem er den Namen Maus gegeben hat. Judith hat Otto schon einige Male gesehen. Es ist unvermeidbar, dass er mitbekommt, wie sie sich langsam und beharrlich an den Wochenenden bei ihm einnistet. Neidlos betrachtet er sie als Glücksfall für Leicht. Ab und zu, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, lässt er ihn seine Meinung wissen. Leicht wehrt dann regelmäßig mit der nicht beleidigend gemeinten Bemerkung ab, Otto solle sich um seine eigenen Weibergeschichten kümmern, dann habe er genug zu tun.
»Womit hast du sie rumgekriegt?«, fragt Otto, der weiß, dass Judith eigentlich an diesem Wochenende nicht kommen wollte.
»Mit einem Besuch beim Doktor in seiner Hütte am See. Sie ist doch ganz verschossen in den Typen. Von ihm hat sie das Thema ihrer Doktorarbeit.«
»Weiß er, dass ihr ihn besucht?«
Nein, er habe den Besuch spontan erfunden, gesteht Leicht.
»So risikofreudig kenne ich dich gar nicht. Was machst du, wenn der Doktor nicht da ist?«
»Er muss da sein«, sagt Leicht und Otto frotzelt, dass man mit einer solchen Einstellung im Spielkasino viel Geld verlieren könne. Sicherer sei, im Bundeswehrkrankenhaus anzurufen und mit dem Doktor einen Termin auszumachen.
»Mit welcher Begründung, Otto? Ich wollte es so aussehen lassen, dass wir mehr oder weniger zufällig verbeikommen.«
Otto kaut auf seiner Oberlippe herum. »Wenn du mich mitnimmst, habe ich einen Plan.«
Er störe ganz sicher nicht, versichert Leicht, und Judith würde sich bestimmt freuen, wenn er dabei wäre. Otto lässt sich mit dem BWK verbinden und fragt nach Dr. Gregor Starkbaum. Kurz darauf meldet sich der Oberfeldarzt. »Hier spricht Oberkommissar Müller. Wir hatten in der Sache Paul Schmidt miteinander zu tun.«
Er erinnere sich, sagt Dr. Starkbaum.
»Sie haben uns damals von Ihrer Zeit in Kundus erzählt. Jetzt haben wir einen ermordeten afghanischen Flüchtling, tappen völlig im Dunkeln und bräuchten Ihre Hilfe.«
Er habe den Artikel in der Zeitung gelesen, antwortet der Arzt. Das sei furchtbar, aber er wisse beim besten Willen nicht, wie er helfen könne. Er habe mit Ausnahme der im BWK beschäftigten afghanischen Hilfskräfte keine Kontakte zu anderen. Wenn dem Kommissar aber ein Gespräch sinnvoll erscheine, so wäre er gerne dazu bereit.
»Am Samstagnachmittag vielleicht?«, schlägt Otto vor.
Er habe eigentlich geplant, am Wochenende seine Mutter zu besuchen. Seit dem Tod des Vaters müsse er sich etwas um sie kümmern. Das könne er aber um eine Woche verschieben. »Ich erwarte Sie am Samstag. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich bin bei diesem Wetter in meiner Hütte im Ried.«
»Darf ich den Hauptkommissar Leicht und Judith mitbringen?«
Selbstverständlich dürfe er das. »Kommt sie mit ihrer Dissertation voran?«
Das werde sie ihm ganz sicher am liebsten selber erzählen, bedankt sich Otto für die Einladung und beendet das Telefonat.
»Puh«, stöhnt Leicht. »Das wäre fast in die Hosen gegangen. Du hast was gut bei mir.«
Im Kommissariat stochert Bruno an seinem Bericht für die Oberstaatsanwältin.
»Sie sollen die Frau Dr. Werr anrufen, hat sie gesagt. Sie habe etwas Neues entdeckt«, informiert er seine Kommissare.
»Wenn die Liste der Asylanten eintrifft, fordern Sie beim BAMF die dazugehörenden Akten an. Lesen Sie die Protokolle durch, und wenn Ihnen etwas auffällt, lassen Sie es uns wissen. Ich bin in der Anatomie,« teilt Leicht Bruno weitere Arbeit zu und schiebt Otto zur Tür. »Wir organisieren eine Flasche Grappa und besuchen die Frau Doktor.«
Im Reich von Ute Werr ist es wohltuend kühl. Wie beiläufig übergibt Leicht den versprochenen Treberschnaps, und die Gerichtsmedizinerin stellt ihn wortlos neben ihre Kladden in den Schrank.
»Mir ist etwas aufgefallen, das interessant sein könnte. An den Schnitträndern am Hals und im Genitalbereich befinden sich Spuren von Chlorophyll. Es sieht so aus, als wären mit dem Messer Pflanzen geschnitten worden. Fragen Sie mich nicht, was das bedeutet.«
»Vielleicht lag der Mann im Gras, als ihm die Verletzungen zugefügt wurden«, rätselt Otto.
»Unwahrscheinlich«, meint die Pathologin, »weder an Hemd und Hose, noch auf der Haut habe ich Grasspuren gefunden.«
»Tatzeit bleibt Sonntag?«, vergewissert sich Leicht.
»Definitiv, ja.«
Der Hauptkommissar hat von dieser Frau keine andere Antwort erwartet. »Wissen Sie eigentlich, wie froh wir sind, dass wir Sie haben?«
Ute Werr schaut skeptisch auf den Hauptkommissar. »Als Sie mir so etwas Ähnliches vor langer Zeit einmal gesagt haben, waren Sie ziemlich am Boden. Heute scheinen Sie eher aufgekratzt. Mann, dein Name ist Janus«, seufzt sie. »Dieses anstrengende Kapitel in meinem Leben habe ich Gott sei Dank hinter mir. Ich habe es mit Körpern zu tun, nicht mit Seelchen, schon gar nicht mit männlichen.«
»Belieben Sie uns heute Ihre stachlige Seite zu zeigen, Madame? Wir sind tief beeindruckt.« Die Kommissare verbeugen sich theatralisch.
»Was habt ihr denn heute geraucht? Legt euch zum Drogentest auf die Pritsche!«
»Ihm steht ein erotisches Wochenende bevor«, steigt Otto auf Ute Werrs Laune ein. »Adrenalin pur.«
»Na dann, raus mit euch. Hier wird gearbeitet!« Sie schickt den Kommissaren ein warmes Lächeln hinterher. Ute Werr hat sich nach zwanzigjähriger Ehe von ihrem Mann scheiden lassen, weil er jahrelang ein Verhältnis mit seiner Assistentin unterhielt, während er seiner vertrauensseligen Gattin den unermüdlich arbeitenden Oberarzt vorspielte.
Einige Minuten später meldet sich Plum auf Leichts Handy. Er erwartet eine Anerkennung für seinen Artikel und Informationen über den Verlauf der Ermittlungen. »Hast du Futter für mich?«, versucht er Leicht zu locken.
»Ja, aber nur wenn du morgen ein Foto von unserem Mordopfer in der Presse bringst. Dazu schreibst du einen Aufruf, dass sich jeder, der den Mann schon einmal gesehen hat, bei uns melden soll. Das Foto schicke ich dir auf deine WhatsApp. Es stammt aus der BAMF-Akte. Der Mann heißt Farid Diba, ist ein als Asylant anerkannter Afghane und achtunddreißig Jahre alt. Er ist allein ohne Familie vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen und war auf dem Eselsberg untergebracht. Ist das genug fürs Erste?«
»Heute früh standen drei Einsatzwagen vor dem Asylantenheim. Wart ihr das? Habt ihr was erfahren? Du weißt, eine Hand wäscht die andere.« Ohne Gegenleistung gibt es nichts von Plum. Das weiß der Hauptkommissar. Deshalb scheut er sich nicht, zuzugeben, dass sie keinen Schritt vorwärtsgekommen sind, lässt durchblicken, dass der Tote in Afghanistan kein unbeschriebenes Blatt war, und versteckt diese Informationen in einer Gegenfrage. »Würde ich dir das Bild schicken, wenn es nicht nötig wäre?«
Plum versteht und sagt die Veröffentlichung zu. »Und jetzt zieh deinen guten Anzug an und mach dich auf den Weg ins Rathaus. Wir sehen uns.«
Leicht weiß nichts von einem Rathaustermin. »Wieso Rathaus?«, fragt er erstaunt.
»Der OB hat die Presse eingeladen. Es geht sicher um den toten Asylanten. Ich dachte, du bist bei dieser Vorstellung auf der Bühne dabei.«
Es gibt nicht viele Tage, auf die der Hauptkommissar gerne verzichten möchte, aber dieser Freitagvormittag ist einer von ihnen. Nach dem Überfliegen der Tageszeitung spürt er ein ahnungsvolles Drücken in der Bauchgegend, wo sich sein siebter Sinn angesiedelt hat. OB verspricht schnelle Aufklärung und harte Bestrafung. Unter dieser Schlagzeile berichtet Plum von der Pressekonferenz im Rathaus. Darunter befindet sich das Passbild von Farid Diba und der Aufruf, jeder Bürger, der diesen Mann gesehen habe, solle sich bei der Polizei melden. Im Kontext entsteht der Eindruck, dass der OB die Initiative und Leitung der Ermittlungen übernommen hat. Kein Wort von Plum über die Staatsanwaltschaft, die Justiz und die ermittelnde Mordkommission. Was zu erwarten war, trifft ein. Frau Dr. Rossmann lädt zum Rapport. »Willst du mitkommen?«, fragt der Hauptkommissar, und Otto verweist darauf, dass er etwas guthat und verdrückt sich. Leicht legt gedanklich seine Rüstung an und macht sich auf den Weg.