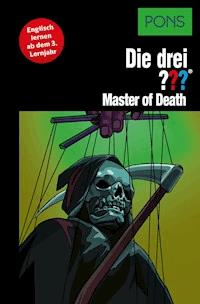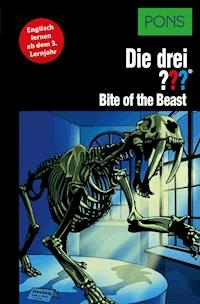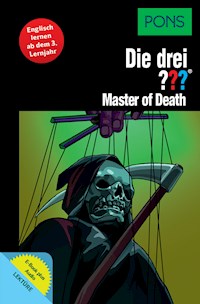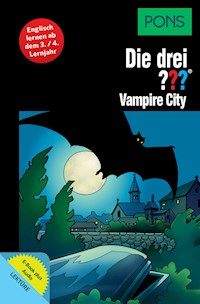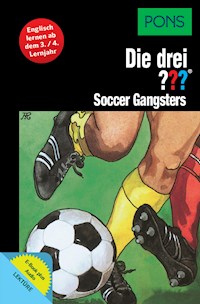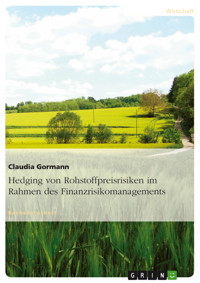
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,1, ( Europäische Fernhochschule Hamburg ), Sprache: Deutsch, Abstract: In den vergangenen Jahren war ein starker Anstieg der Rohstoffpreise zu beobachten. Auch wenn die Rohstoffhausse, die 2003 begann, durch die derzeitigen Finanzmarktturbulenzen und den dadurch verursachten weltweiten Konjunkturrückgang gedämpft wurde, gehören Rohstoffe dennoch zu den Unsicherheitsfaktoren eines fast jeden Industrie- und Handelsunternehmens. Nicht zuletzt da die Rohstoffe einen Großteil der Gesamtkosten ausmachen und aufgrund ihrer Entwicklung in den letzten fünf Jahren nach wie vor eine sehr hohe Volatilität aufweisen. Die Rohstoffressourcen werden immer knapper und es gibt weiterhin eine große Nachfrage nach Rohstoffen seitens der Schwellenländer wie China oder Indien. Hinzu kommt, dass mit einem Ansteigen des Preisniveaus nach Bewältigung der Finanzkrise gerechnet werden muss. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich mit dem Thema des Aufbaus eines effizienten Rohstoffpreisrisiko-Managements auseinandersetzen müssen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Hinzu kommt, dass Unternehmen die derzeitige Situation auf den Rohstoffmärkten als Chance nutzen könnten, um das niedrige Preisniveau für den zukünftigen Bedarf abzusichern. Wie Studien allerdings zeigen, legen Unternehmen zwar generell großen Wert auf Risikomanagement, das Rohstoffpreisrisiko-Management wird hingegen vernachlässigt. Unternehmen können mithilfe eines Rohstoffpreisrisiko-Managements Rohstoffpreisrisiken rechtzeitig identifizieren und bewerten und somit wirkungsvolle Gegensteuerungsmaßnahmen durch den Einsatz von Hedging-Instrumenten ergreifen. Die Identifikation, Bewertung und Steuerung - insbesondere das Hedging - der Rohstoffe - sind in dieser Arbeit ausführlich dargestellt. Ebenso werden die Voraussetzungen für die Implementierung eines Rohmaterialpreisrisiko-Managements sowie die Besonderheiten und die Vorgehensweise, die bei der Durchführung des Rohmaterialpreisrisiko-Managements beachtet werden müssen, vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Management Summary
Abbildungsverzeichnis
1.Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2.Das Finanzrisikomanagement (FiRM)
2.1 Definition der Finanzrisiken
2.1.1 Definition Marktpreisrisiken
2.1.2 Definition (Adress-)Ausfallrisiko
2.2 Der Finanzrisikomanagementprozess
2.2.1 Identifikationsinstrumente für Finanzrisiken
2.2.1.1 Die Analyse
2.2.1.2 Die Prognose
2.2.1.3 Die Früherkennung
2.2.2 Bewertungsmethoden für Finanzrisiken
2.2.2.1 Der Value-at-Risk
2.2.2.2 Der Cash flow-at-Risk
2.2.2.3 Der Earnings-at-Risk
2.2.2.4 Szenario- und Sensitivitätsanalyse
2.2.3 Steuerungsinstrumente für Finanzrisiken
2.2.3.1 Instrumente zur Steuerung von Marktpreisrisiken
2.2.3.2 Instrumente zur Steuerung von (Adress-)Ausfallrisiken
2.2.4 Controlling von Finanzrisiken
3.Das Rohstoffpreisrisiko-Management
3.1. Überblick über verschiedene Rohstoffe
3.1.1 Buntmetalle
3.1.1.1 Kupfer
3.1.1.2 Aluminium
3.1.2 Edelmetalle
3.2 Umsetzung des Rohstoffpreisrisiko-Managements
3.2.1 Identifikation von Rohstoffpreisrisiken
3.2.2 Bewertung von Rohstoffpreisrisiken
3.2.3 Steuerung von Rohstoffpreisrisiken
3.3 Hedging von Rohstoffpreisrisiken
3.3.1 Auswahlkriterien für Hedging-Instrumente (Derivate)
3.3.2 Definition Hedging
3.3.3 Short Hedge vs. Long Hedge
3.3.4 Hedging Strategien
3.3.5 Fair value hedge vs. Cash flow hedge
3.3.6 Hedge Ratio
3.3.7 Besonderheiten bei der Absicherung von Rohstoffpreisrisiken
3.3.8 Nutzung von Derivaten zur Rohstoffpreisrisikoabsicherung
3.3.8.1 Definition, Einteilung und Historie von Derivaten
3.3.8.2 Futures/Forwards
3.3.8.3 (Commodity-)Swaps
3.3.8.4 Optionen
3.3.8.5 Vergleich der Hedging-Instrumente
4.Schlussbemerkung
Anhang
5.Das Risikomanagement im Unternehmen
5.1 Der Begriff Risiko
5.2 Charakterisierung des unternehmerischen Risikos
5.2.1 Kategorisierung von Unternehmensrisiken
5.2.2 Ursachen-Wirkungs-Beziehung industrieller Risiken
5.2.2.1 Ursachenbezogene Risikodefinition
5.2.2.2 Wirkungsbezogene Risikodefinition
5.3 Ziele des Risikomanagements
5.4 Gesetzliche Grundlage für das Risikomanagement
5.5 Der Risikomanagementprozess
5.5.1 Risikoidentifikation
5.5.2 Risikoanalyse
5.5.3 Risikobewertung
5.5.4 Risikoaggregation
5.5.5 Risikosteuerung
5.5.6 Risikokontrolle
5.6 Effizienz des Risikomanagements
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Management Summary
There has been a strong increase of raw material prices in the last years. Now this raw material boom that began in 2003 has come to an abrupt ending by the current financial market crises and has led to a decrease of raw material prices. But even with the now declined prices, still the procurement of raw materials is counted as a high risk factor for almost every industrial and trading company. This is not only a consequence of the very high shares of the raw material in the overall costs but also due to the high volatility of raw material prices within the last five years. In addition to that, there is on the one hand the advancing scarcity of raw materials and on the other hand the increasing strong demand from the emerging markets like China and India. Furthermore, one can reckon that raw material prices will go up again after the recovery of the economic situation.
Taking all these facts into account, it is highly recommended for companies to implement an efficient raw material price risk management now in order to be pre- pared for the future. In addition to that, the companies could take advantage of the current low prices to secure for their resources for the upcoming years. But as sur- veys show, although companies are aware of the importance of a risk management, the raw material price risk management has been neglected so far. With the implementation of a raw material risk management companies could identify and evaluate raw material price risks in time and would be able to initiate appropriate counteracting measures by using hedging instruments.
The identification, evaluation as well as the controlling - in particular the hedging - of raw materials is explained in detail within this Thesis. Also the prerequisites for an implementation of a raw material price risk management as well as the speciali- ties and procedures that have to be considered for conducting the raw material price risk management are explained in detail.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Aufbau der Bachelor Thesis
Abbildung 2: Finanzrisiken
Abbildung 3: Finanzrisikomanagementprozess
Abbildung 4: Indikatoren-orientiertes Früherkennungssystem
Abbildung 5: Bewertungsmethoden
Abbildung 6: Historischer Verlauf Kupfer
Abbildung 7: Historischer Verlauf Aluminium
Abbildung 8: Historischer Verlauf Platin
Abbildung 9: Einteilung der Termingeschäfte
Abbildung 10: Gewinn-/Verlustprofil des Kaufs eines unbedingten Termingeschäfts
Abbildung 11: Gewinn-/Verlustprofil des Verkaufs eines unbedingten Termingeschäfts
Abbildung 12: Beispiel für Kupfer Commodity Swap
Abbildung 13: Gewinn- und Verlustprofil des Kaufs einer Kaufoption
Abbildung 14: Gewinn- und Verlustprofil des Kaufs einer Verkaufsoption
Abbildung 15: Gewinn- und Verlustprofil des Verkaufs einer Kaufoption
Abbildung 16: Gewinn- und Verlustprofil des Verkaufs einer Verkaufsoption
Abbildung 17: Gliederung der Optionen
Abbildung 18: Vor- und Nachteile der Hedging-Instrumente
Abbildung 19: Risikokategorien [Vgl. Romeike (2005), S. 21]
Abbildung 20: Dreidimensionale Risikokategorisierung
Abbildung 21: Risiken im Hinblick auf ihre Wirkung
Abbildung 22: Unternehmensziele und Ziele des Risikomanagements
Abbildung 23: Bestandteile Risikomanagement nach KonTraG
Abbildung 24: Kreislauf des Risikomanagementprozesses
Abbildung 25: Instrumente zur Risikoidentifikation
Abbildung 26: Instrumente zur Risikosteuerung [eigene Darstellung]
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
In den vergangenen Jahren war ein starker Anstieg der Rohstoffpreise zu beobachten. Auch wenn die Rohstoffhausse, die 2003 begann, durch die derzeitigen Finanzmarktturbulenzen und den dadurch verursachten weltweiten Konjunkturrückgang gedämpft wurde, gehören Rohstoffe dennoch zu den Unsicherheitsfaktoren fast jedens Industrie- und Handelsunternehmens. Nicht zuletzt da sie einen Großteil der Gesamtkosten (hier ist v. a. die Kostenwirkung auf die Materialkosten zu nennen) ausmachen und aufgrund ihrer Entwicklung in den letzten fünf Jahren nach wie vor eine sehr hohe Volatilität[1] aufweisen. Die starke Volatilität der Rohstoffe wird durch die weltweit immer knapper werdenden Rohstoffressourcen verschärft. Hinzu kommt, dass Schwelländer wie China, Indien, Indonesien und Vietnam sich in einem wirtschaftlichen Aufholprozess befinden und mit zunehmender Industrialisierung auch als immer stärker werdende Nachfrager für Rohstoffe auftreten. Diese Faktoren werden auch in Zukunft einen starken Einfluss auf die Rohstoffpreise ausüben. Vor diesem Hintergrund hat das Management von Rohstoffpreisrisiken für Unternehmen eine wichtige Bedeutung. Es gilt die Risiken, die sich aus den volatilen Rohstoffmärkten ergeben im unternehmensinternen Risikomanagementprozess zu identifizieren und zu bewerten, um somit durch entsprechende Gegenmaßnahmen die Rohstoffrisiken im Sinne des Unternehmens steuern zu können.
Eine Studie von KPMG, durchgeführt in der zweiten Jahreshälfte 2006 und damit in einer Zeit, in der die Rohstoffpreise bereits seit drei Jahren stark anstiegen, zeigt jedoch, dass dem Rohstoffpreismanagement nur eine geringe Bedeutung zukommt. Im Rahmen dieser Studie wurden über 500 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über ihren Umgang mit Energie- und Rohstoffpreisrisiken befragt.
Der Fokus der Studie lag u. a. auf dem Stellenwert des Risikomanagements im Unternehmen sowie auf dem Management der branchenübergreifend eingesetzten Energie- und Rohstoffrisiken im Rahmen des Risikomanagements. Die Studie ergab, dass 93% der befragten Unternehmen das Thema Risikomanagement für wichtig oder sehr wichtig erachten. Immerhin verfügen 76% der Unternehmen über eine schriftlich fixierte Risikomanagement-Strategie. Betrachtet man im Gegensatz dazu das Rohstoffpreisrisiko-Management, so ist festzustellen, dass dieses eine eher untergeordnete Rolle spielt, da hier beispielsweise nur bei 49% der Unternehmen schriftliche Strategien zur Absicherungen von Rohstoffpreisrisiken vorlie- gen.[2] Weitere Hinweise darauf, dass Unternehmen dem RohstoffpreisrisikoManagement nur eine geringe Bedeutung zukommen lassen, finden sich in den Studienergebnissen im Hinblick auf die Absicherung der Rohstoffpreisrisiken. Hierbei bedienen sich 66% der befragen Unternehmen der einfachsten Form der Absicherung, dem sogenannten Natural Hedge. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Rohstoffpreisrisiken auf Dritte (z. B. Kunden, Lieferanten) überwälzen. Doch eine solche Risikostrategie birgt durch die damit verbundenen Preiserhöhungen langfristig die Gefahr eines Wettbewerbsnachteils für die betroffenen Unternehmen. Weiterhin sichern Unternehmen ihre Rohstoffpreisrisiken durch den Cash Flow Hedge, bei dem Zahlungsströme aus dem Ein- und Verkauf von Rohstoffen abgesichert werden oder dem Fair Value Hedge, durch den bestehende Warenbestände abgesichert werden, ab. Allerdings hat die Studie gezeigt, dass vier von zehn Unternehmen ihre Rohstoffpreisrisiken weder durch den Cash Flow Hedge noch durch den Fair Value Hedge absichern und damit angesichts der starken Rohstoffpreisschwankungen auf dem Markt ein hohes Risiko eingehen.[3]
Somit wird in der vorliegenden Arbeit neben der generellen Betrachtung des Risikomanagements, insbesondere das Finanzrisikomanagement als wichtige Funktion für Unternehmen beleuchtet. Besonders das oftmals vernachlässigte Rohstoffpreisrisiko und dessen Management liegen im zentralen Fokus der Arbeit. Dabei werden die wesentlichen Methoden und auch die Besonderheiten des Rohstoffhedgings erläutert.
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema der Absicherung (Hedging) von Rohstoffpreisrisiken aufgegriffen. Da die Rohstoffpreisrisiken Marktpreisrisiken darstellen und letztere innerhalb des Finanzrisikomanagements behandelt werden, wird in dieser Arbeit das Hedging von Rohstoffpreisrisiken im Rahmen des Finanzrisikomanagements untersucht. Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst das Finanzrisikomanagement mit seinen wesentlichen Prozessen darzustellen und den Zusammenhang zwischen Finanzrisikomanagement und RohstoffpreisrisikoManagement aufzuzeigen, um im Anschluss daran Möglichkeiten aufzuzeigen, die Unternehmen wahrnehmen können, um Rohstoffpreiserhöhungen (-risiken) durch Hedging zu minimieren oder gar zu vermeiden und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind.
Die Bachelor Thesis ist nach dem einleitenden Kapitel 1 in drei weitere Kapitel gegliedert. Als Überleitung zum Kapitel 2 „Der Finanzrisikomanagementprozess“ dient das im Anhang dargestellte „Risikomanagement im Unternehmen“. Die Überleitung wurde aufgrund des vorgegebenen Umfangs der Arbeit in den Anhang gestellt. Der Aufbau der Arbeit ist nachstehend in Abbildung 1 dargestellt:
Abbildung 1: Aufbau der Bachelor Thesis
[Quelle: eigene Darstellung]