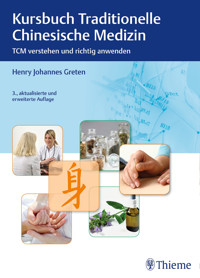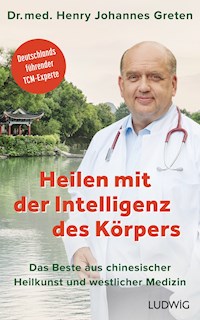
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Deutschlands führender Experte für Traditionelle Chinesische Medizin Prof. Dr. Henry Johannes Greten setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, die Schulmedizin mit der uralten, ganzheitlichen Heilkunst Chinas zu kombinieren. Erstmals erklärt er jetzt, welches enorme Potential in der Zwei-Welten-Medizin steckt. Während die westliche Medizin oftmals nur die Symptome behandelt, nimmt die Chinesische Medizin den ganzen Menschen in den Blick, betrachtet den Einfluss der Psyche auf unser Wohlbefinden und weckt unsere Selbstheilungskräfte. Wo die moderne naturwissenschaftliche Medizin an ihre Grenzen stößt, kann die Chinesische Medizin Beschwerden lindern, Erkrankungen vorbeugen und unsere Lebensqualität deutlich verbessern, dank natürlicher Heilmethoden wie Akupunktur oder Qigong. Greten zeigt anschaulich und verständlich, wie die Zwei-Welten-Medizin bei Problemen mit dem Bewegungsapparat, der Verdauung, den Atemwegen, bei Herz-Kreislauf- und Autoimmunerkrankungen hilft und auch chronische Leiden heilen kann.
»Dieses Buch ist tief berührend und ein wirkliches Erlebnis. Es hat mich sehend gemacht und ist ohne Zweifel das intelligenteste Medizinbuch seit Jahrzehnten.« – Dr. Andreas Spuller, Frauenarzt und Gründer des TCM-Zentrums Karlsruhe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Chinesische Heilkunst hat einen unschätzbaren Wert für die ganzheitliche Heilung. Mithilfe von uralten wissenschaftlichen Prinzipien, die den ganzen Menschen in den Blick nehmen, gelingt es ihr, die tiefere Ursache unserer Symptome erfahrbar zu machen und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Damit kann sie insbesondere dort helfen, wo die westliche Medizin an ihre Grenzen stößt. Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten setzt sich seit Jahrzehnten für eine Kombination aus westlicher Medizin und asiatischem Heilwissen ein. Anhand von vielen Beispielen aus seiner Praxis zeigt er auf, welches enorme Potenzial in dieser Medizin der zwei Welten steckt.
Über den Autor
Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten ist Deutschlands führender Experte für Traditionelle Chinesische Medizin. Er leitet das private Institut für Chinesische Medizin in Heidelberg, das internationalen Ruf genießt, und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Traditionelle Chinesische Medizin sowie der Deutsch-Chinesischen Forschungsgemeinschaft für TCM. Er lehrte die Chinesische Medizin als angewandte Neurophysiologie an der Universität Porto und unterrichtete Chinesische Medizin an verschiedenen Universitäten in China. Zudem beteiligt er sich als Hochschullehrer an der IBA University of Cooperative Education an der Entwicklung einer neuen Generation von Gesundheitsberufen. Zu seinen wissenschaftlichen Verdiensten gehören die Schaffung eines umfassenden medizinischen Erklärungsmodells für Chinesische Medizin, die Einführung der Doppelverblindung in die Akupunkturforschung, die Entdeckung neuer Akupunktursysteme und ein tieferes Verständnis für die Chinesische Diagnose.
Dr. med. Henry Johannes Greten
Heilen mit
der Intelligenz
des Körpers
Das Beste aus chinesischer
Heilkunstund westlicher Medizin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Sämtliche Inhalte dieses Buches wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig geprüft. Trotzdem stellt dieses Buch keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Verlag und Autor haften nicht für nachteilige Auswirkungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Originalausgabe 06/2022
Copyright © 2022 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Sophie Dahmen
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Motivs von
© Shutterstock/Efired und des Autorenfotos von
© Kay Blaschke/Penguin Random House Verlagsgruppe
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22380-9V001
www.Ludwig-Verlag.de
Inhalt
Das Beste aus zwei Welten
TEIL I Yin und Yang in der Theorie
Eine neue Medizin
Heilung als Weg zu sich selbst
Fahrplan von Europa nach China
Selbstbild: Wie ich zur Chinesischen Medizin gekommen bin
Das Weltbild der Chinesischen Medizin: Der Mensch als Teil der Natur
Das erste Zeichen: Kreise sind Sinuskurven, Sinuskurven sind Kreise
Das zweite Zeichen: Kochen und darüber nachdenken
Das dritte Zeichen: Entdeckung beim Italiener
Das Menschenbild der Chinesischen Medizin – wie die Gefühle im Körper entstehen
Der Mensch zwischen Himmel und Erde
Holz: Spannung und Kampfbereitschaft
Feuer: Bewegung und Freude
Metall: die Luft ist raus
Wasser: Ökonomie und Vernunft
Die Konstitutionstypen der Chinesischen Medizin
Die Symptome noch tiefer verstehen – wenn das Rad des Lebens nicht rund läuft
Das Gesetz der Balance – die Emotion im Schatten des Mondes
Die Urkonflikte und der Froschkönig-Effekt
Heilung als Weg – über das Symptom zur emotionalen Balance und zum Wiederfinden des Lebensweges
TEIL II Vom Befinden über den Befund zum Heilen in der Praxis
Krankheitsbilder: 10 Patientinnen und Patienten und ihre Geschichten
1. Die werdende Mutter
2. Die Frau mit dem entzündeten Darm
3. Musikerin mit System
4. Die Frau, die keine Luft kriegt
5. Der Mann, der aus dem Himmel fiel
6. Der Mann mit Bauchspeicheldrüsenkrebs
7. Die Frau mit dem faulen Zahn
8. Der Mann, der nicht mehr fühlt
9. Der Mann unter Druck
10. Die Frau mit der Fibrose
Schlusswort
Danksagung
ANHANG
Funktionskreise an den Symptomen erkennen
Leitbahn- und leibinselabhängige Symptome
Weiterführende Links
Bildnachweis
Anmerkungen
Das Beste aus zwei Welten
Was macht eigentlich einen guten Arzt aus? Diese Frage kann man unendlich lang, aber auch sehr kurz beantworten: Ein guter Arzt ist einer, der hilft. Es ist der Erfolg, der ihn ausmacht.
Er hilft bei dem Prozess, den wir allgemein als Heilung betrachten. Als Ärzte sollten wir uns aber hin und wieder eingestehen, dass wir bei diesem Vorgang tatsächlich nur die Rolle eines Helfers spielen. Im Grunde sagt es schon der Volksmund: Eine Grippe dauert ohne Arzt eine Woche und mit Arzt sieben Tage. Die meisten Krankheiten heilt die Natur also selbst am besten. Daher ist dieses Buch den beinahe grenzenlosen Möglichkeiten der Selbstheilungskräfte gewidmet. Diese ungeahnt großen Kräfte zu befreien, zu stärken und für den Vorgang der Heilung nutzbar zu machen – das ist das Ziel eines guten Arztes.
Das Bild des Arztes wird häufig durch unrealistische Erwartungen und sogar Träume der Patienten geprägt – und wer möchte ihn nicht haben, den Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, der jeden Tag kleine Wunder vollbringt, in jeder Situation unfehlbar richtig handelt und außer seiner Pflichttreue vor allem keine Eitelkeiten kennt, von jedem geachtet und respektiert wird und allen Dramen des Lebens gewachsen ist.
Von diesem Mythos des perfekten Arztes, der für alle Patienten gleich gut geeignet ist, sollten wir Abschied nehmen – aber dennoch die Eigenschaften benennen, die gerade in der heutigen Zeit einen guten Arzt ausmachen. Dabei geht es vor allem um die Bedürfnisse der Patienten. In einer Zeit, in der alles computerisiert, standardisiert und abrechenbar gemacht wird, sehnen sich die Menschen naturgemäß danach, wieder als Mensch wahrgenommen zu werden. Der gute Arzt behandelt also nach dem, was der individuelle Patient braucht, weil er sein Gegenüber erkennt und sich – so gut er kann und trotz aller Zwänge des Alltags – bemüht, das Individuum zu respektieren, die besonderen Stärken seines Gegenübers zu erkennen und es anzuregen, diese Stärken für den eigenen Heilungsprozess zu nutzen.
Doch der heute geforderte sparsame Umgang mit Zeit und Geld kommt einer individuellen Behandlung natürlich nicht entgegen. Gerade die »guten« Ärzte, die es verstehen, Symptome zu bessern, haben oft zu wenig Zeit für ihre Patienten, weil ihre Praxen überlaufen sind. Dabei würden viele Menschen sagen, dass genau der Arzt, der sich Zeit nimmt, gut ist. Man sieht schon an diesem Dilemma, dass es nicht leicht ist, einen guten Arzt zu finden.
Sehen wir uns noch einmal die Situation der Menschen an, die keine ganz einfache Erkrankung haben, deren Symptome nicht einfach so ausheilen. Dabei denke ich insbesondere an chronische Erkrankungen, also an Menschen, die immer wieder Rückenschmerzen, Allergien oder Verdauungsstörungen haben. Es ist offensichtlich, dass Krankheitsauslöser auf sie anders wirken als auf 90 Prozent der Menschen um sie herum, die den Krankheitsauslöser einfach abschütteln wie ein Hund das Regenwasser. Sie reagieren auf ihre eigene, leider problematische Weise auf die gesundheitlichen Herausforderungen des Lebens, und das ist der Grund, warum sie einen Prozess der Heilung anstreben. Und wir müssen uns dabei klar werden, was Heilung wirklich bedeutet: Heilung heißt neben der Gesundwerdung auch Ganzwerdung. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Patienten häufig das Gefühl oder den Gedanken entwickeln, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und der Zustand der Heilung im Sinne dieses Ganzwerdens noch nicht erreicht ist. Etwas fehlt also, und es kann ungeheuer schwer sein, herauszufinden, was es genau ist. Daher macht es keinen Sinn, nur die Krankheitsauslöser zu behandeln, sondern hier muss auch der Mensch behandelt werden, der auf diese Auslöser reagiert. Es muss eine Behandlung gefunden werden, die den einzelnen Patienten in seiner Konstitution, seinem Reaktions- und Bautyp erfasst und stärkt.
Es geht also um die Stärkung der körpereigenen Mechanismen, die Selbstheilungskräfte. Wenn diese Kräfte nicht funktionieren, nicht ausreichen oder falsch verteilt und »im Ungleichgewicht« sind, dann kommen die Symptome eben immer wieder oder werden »chronisch«.
Hier nun kommt die Chinesische Medizin ins Spiel. Sie beruht nämlich auf einer Beobachtung, die mit dem Begriff der Heilung unmittelbar zu tun hat. In der Erkrankung ist etwas nicht ganz, nicht ausgeglichen, es fehlt etwas, etwas ist im Vergleich zu den anderen Eigenschaften zu wenig ausgeprägt. Im chinesischen Denken ist die Persönlichkeit ein Leben lang in Bewegung. Denn das ganze Leben ist ein fortlaufender Prozess der Entwicklung und inneren Bewegung, der mit dem Zyklus der Wandlungsphasen zu tun hat – und Störungen in diesem Ablauf können in jedem Stadium des Lebens auftreten.
Im besten Falle behandelt man also nicht eine »Krankheit«, sondern eben den Menschen. Dies zu unterscheiden, ist eine Grundqualität des Arztes in der heutigen Gesellschaft, in der die Krankheitsauslöser eher zunehmen, in der Medikamente über längere Zeit gegeben werden als früher, in der Menschen älter und damit gebrechlicher werden und länger an den Krankheitsauslösern leiden und ihre persönliche Architektur, ihre Bauweise, also ihre Konstitution eine immer bedeutsamere Rolle spielt. Man muss die Symptome eben als Ausdruck des Ganzen sehen, als das Ergebnis des Wechselspiels zwischen dem Angreifer und dem Angegriffenen, dem Krankheitsauslöser und dem Individuum.
Aber es hängt nicht nur vom »Bautyp«, also von der Architektur des Menschen ab, wie, wann und in welcher Weise er erkrankt. Natürlich gibt es Menschen, die schwache Atemwege und Abwehrkräfte haben, oder Menschen, die schneller Gelenkschmerzen bekommen als andere. Aber übersehen wir dabei nicht etwas Wesentliches? Wo bleiben die Emotionen bei dieser Betrachtung? Erkranken wir auf verschiedene Weisen, weil wir als Teil einer menschlichen Gemeinschaft ganz unterschiedlich emotional reagieren?
Es geht also um die psychische Seite der Therapie – und eine Besonderheit der Chinesischen Medizin liegt ja darin, dass sie auch den Körper in die Psyche einschließt. Man kann erkennen, dass im Körpergefühl eine besondere innere Klugheit wirkt, die Intelligenz des Körpers. Weil alle Symptome des Menschen in der Chinesischen Medizin auch eine emotionale Bedeutung haben, deshalb sind die Symptome Botschafter aus dem Reich des Unterbewussten, die der Vernunftintelligenz, dem »Geist« eines Menschen, etwas über seinen Leib-Seele-Apparat mitteilen können. Dafür aber muss man einen Zugang zu ihnen bekommen, und es gibt eine Reihe hilfreicher Methoden, diese Grenzen des Unterbewussten aufzuheben. Dazu gehören natürlich die Methoden der westlichen Psychotherapie, beispielsweise die Psychoanalyse, die Verhaltenstherapie, die Familientherapie und die Körpertherapien – aber auch das zentrale und uralte Denken der klassischen Chinesischen Medizin, deren Methoden momentan von den modernen Neurowissenschaften und Verhaltenswissenschaften bestätigt werden.
Im Großen und Ganzen werden Menschen also nicht nur deshalb krank, weil sie ihren Körper nicht richtig behandeln oder Angriffen von Klima, Viren und Überarbeitung ausgesetzt sind, sondern auch, weil sie in Bindungsmustern und den dadurch ausgelösten Emotionen gefangen sind. Wie wir sehen werden, kommen diese aus der Tiefe des Unterbewusstseins, und deshalb kennen wir die Eigenschaften dieser Bindungsmuster und Emotionen häufig nicht näher und verstehen nicht immer, warum wir in einer bestimmten Weise emotional reagieren: Warum wird man krank, wenn man die Schwiegermutter sieht? Warum gibt es ganz bestimmte Kollegen, die man nicht riechen kann?
Das Verständnis des eigenen Körpers, der eigenen Person und der Lebensbeziehungen bezeichnen wir als das Selbstkonzept eines Menschen. Wir müssen es ein Leben lang erweitern. Denn wer mit seinem Körper richtig umgeht, seine Emotionen kennt und sie für einen lösungsorientierten Wandel einsetzt, wer seine Art, in Bindungen zu leben, immer weiterentwickelt, der bleibt auch lange gesund. Hat man aber ein falsches Selbstkonzept, so entwickelt man auch körperliche Symptome.
Auf den ersten Blick mag das vereinfachend wirken. Auf der anderen Seite aber gibt eine solche Grundannahme dem Arzt beim Heilungsprozess klare Anhaltspunkte dafür, ob er mit seiner Einschätzung des körperlichen und emotionalen Lebens des Patienten einigermaßen richtig liegt, ob seine Arbeitshypothesen richtig sind. Ist es die falsche Lebensweise für diesen Körper? Stecken alte Emotionen in blockierten (Un-)Gleichgewichten? Gibt es schädliche Automatismen in den Bindungsmustern, im menschlichen Miteinander? In letzterem Fall ist es wahrscheinlich, dass die Patienten eine bestimmte Konstellation der zwischenmenschlichen Verhältnisse immer wieder als schmerzhaft oder ärgerlich erleben. Daraus bilden sich bestimmte Glaubenssätze, wie etwa: »Nie bekomme ich, was ich brauche«, »Immer gerate ich an den falschen Mann« oder »im Grunde misstraue ich den Menschen«. Das wiederum könnte etwas mit ihrer Umgebung zu tun haben, aber auch mit dem jeweiligen Persönlichkeitstyp. Deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden, ob es an den anderen Menschen und ihren Verhaltensmustern liegt oder an unserem eigenen Persönlichkeitstyp, den wir besser kennen und annehmen müssen, damit er sich verändern kann.
Ob man seinen Zustand nun durch Nahrungsmittel, körperliche Übungen oder eine Selbstbehandlung mit den eigenen Händen oder Massagegeräten zu verbessern lernt – alle diese Therapien haben etwas gemein: Es geht darum, dass man selbst eine Wirkung erzeugt.
Ein guter Arzt, und das muss man hier besonders betonen, wird immer versuchen, die Eigenkompetenz des Patienten zu stärken. So lernt der Patient, sich selbst besser zu verstehen und zu behandeln, und diese Erkenntnis führt dazu, dass er eine neue Rolle erlernt. Das funktioniert vor allem dann, wenn die Patienten selber eine aktive Rolle einnehmen wollen. Die Mehrheit der Patienten wünscht sich schließlich, dass sie nicht nur be-handelt wird, sondern auch selbst handeln. Das ist nicht nur im Rahmen der Prävention möglich, etwa durch gesunde Ernährung, durch Bewegung oder durch eine gesunde Lebensführung überhaupt, sondern auch durch eine Stärkung der Eigenkompetenz der Patienten, indem man ihnen etwa Tools zum Selbstmanagement an die Hand gibt, mit denen sie kritische Situationen entschärfen können. Dazu können Gesundheitsübungen der Chinesischen Medizin ebenso gehören wie die Selbstbehandlung von Rückenschmerzen oder auch das Vermeiden bestimmter Konfliktmuster.
Am Ende eines solchen Prozesses geht der Patient kompetenter mit seinem Leben, seinem Körper und seinen Beziehungen um – und das ist etwas Großartiges!
Ganz besonders kommt es mir dabei darauf an, dass der handelnde Patient auch ein anderes Verhältnis zum Arzt entwickelt. Bisher haben wir nur davon gesprochen, was der Arzt machen und wie er sich verhalten muss. Wenn die Patienten selbst handeln können, bedeutet das aber auch, dass sie sich der Spritze, der Allmacht des Arztes, dem Apparat eines Krankenhauses oder der Chemotherapie gegenüber nicht mehr so ausgeliefert oder hilflos fühlen müssen. Und das hat letztlich mit ihrer Würde zu tun.
Damit ist zuerst einmal ein Zustand gemeint, in dem keine fundamentale Herabwürdigung des Menschen besteht. Für mich hört es an diesem Punkt aber nicht auf: Menschenwürde ist viel mehr als nur die Vermeidung von Herabwürdigung. Für mich hat Würde damit zu tun, dass jeder Mensch in sich eine Art Innenraum besitzt und empfindet, einen Bereich, in dem niemand die Wahrnehmung des Selbst stören darf, sozusagen einen inneren Schutzbereich.
Genau in diesem Sinne verändert sich in unserer Gesellschaft gerade die Rolle der Patienten. Dabei spielt auch das Internet eine Rolle. Es stellt dem Patienten alle erdenklichen Informationen über Erkrankungen, die er hat, zur Verfügung – aber leider auch über solche, die er nicht hat. Ich bin mir daher nicht sicher, ob Doktor Google wirklich so segensreich ist und ob dies alles immer der Selbstbestimmung dient. Denn ich sehe viele Patienten, die bereits mit einem durch das Internet geprägten Vorwissen über ihre Erkrankung kommen und danach geradezu unbelehrbar den einmal von Doktor Google übernommenen Glauben verteidigen. Dabei kommt es häufig zu schweren Fehleinschätzungen, denn kein Computer kann die kundige Diagnose und die Bewertung von Symptomen, der Konstitution und der gesamten Persönlichkeit des Patienten übernehmen. Dafür braucht es Menschen. Ich verstehe aber, dass dies alles geschieht, damit man sich dem Arzt nicht länger ausliefern muss, und im Bestreben, sich unabhängig zu machen und nicht entwerten zu lassen. Denn das müssen wir Ärzte im Grunde zugeben: Der Patient ist uns in gewisser Hinsicht ausgeliefert.
Umso wichtiger ist es, dass sich Arzt und Patient auf Augenhöhe, also in einer annähernden Gleichwertigkeit, begegnen und so die Würde beider gefestigt wird. Das geschieht, indem der Arzt die wesentlichen Entscheidungen verständlich begründet, zu denen der Patient dann freiwillig zustimmt. Und es gelingt auch dann, wenn der Arzt – vor allem bei ernsten Erkrankungen wie Krebs oder chronischen Leiden wie Rheuma – dem Patienten zugesteht, sich eine zweite oder sogar dritte Meinung einzuholen. Im Kontakt auf Augenhöhe liegt ein großer Segen, denn er ermöglicht eine echte, authentische Beziehung zu einem anderen Menschen, die an sich schon einen heilenden Wert hat.
Der amerikanische Psychologe Dr. Carl Rogers hat diese Erkenntnis in besonderer Weise gefördert und vertreten. In einer Untersuchung verglich er die Psychotherapie der damals vorherrschenden Psychoanalyse mit einfachen Gesprächen durch ehrlich bemühte Erstsemester der Medizin. Vielleicht können Sie sich denken, was dabei herauskam: Die Studenten waren häufig sogar die besseren Therapeuten! Er führte das darauf zurück, dass sie nicht »professionell« oder in der Fachsprache der Psychotherapeuten mit dem Patienten kommunizierten. Es waren die Ehrlichkeit ihrer Bemühung, die Hingabe, mit der sie sprachen, und vielleicht auch, dass sie hier und da mal ein kritisches Wort verwendeten, was ein »normaler« Psychotherapeut nie getan hätte, die den Unterschied machten. Sich auf Augenhöhe zu begegnen, also ehrlich und unverfälscht, ist ein wichtiger Faktor der Heilung, auf den ein guter Arzt und seine Patienten nicht verzichten können. Um die Freiwilligkeit aufseiten des Patienten und des Arztes zu gewährleisten, geben Anstand, Menschlichkeit und Ehrlichkeit klare Grenzen vor.
In der Psychotherapie der Chinesischen Medizin gehen die Prinzipien von Freiwilligkeit, Autonomie, Authentizität und Wahrhaftigkeit sogar noch weiter. Freiwilligkeit auf beiden Seiten ist wichtig, damit die drei anderen Prinzipien gelebt werden können. Nur wenn Patient und Arzt gleichermaßen freiwillig bleiben, lässt sich ein Maximum an Autonomie erreichen. Sie lesen richtig: Auch der Arzt muss die Therapie verlassen können, denn nur so kann er unter gewissen Umständen echt, also authentisch, und im Sinne von Rogers ein Gesprächspartner auf Augenhöhe sein. Auf diese Weise bilden Arzt und Patient ein wirkliches Team und schmieden ein Arbeitsbündnis, aus dem sich echte und nicht nur professionell bedingte Hinwendung entwickelt.
Denn auch der Arzt ist ja kein Roboter, sondern ein Mensch mit einer Persönlichkeit, hat eine Lebensgeschichte sowie einen subjektiven Hintergrund der ärztlichen Ausbildung und verfolgt eine gewisse Philosophie. In der Chinesischen Medizin ist man sich darüber im Klaren, dass all dies für die Therapie entscheidend ist. Und auch die Wahrheitspflicht ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn es gilt zwischen Arzt und Patient letztlich das, was nach dem ältesten Buch der Menschheit, dem I Ging, auch innerhalb von Familien gilt: Liebevolle Zuwendung und Strenge sind immer untrennbar, denn Liebe ohne Strenge funktioniert ebenso wenig wie Strenge ohne Liebe.
Diese Vertrauensbeziehung erleichtert auch die körperliche Interaktion zwischen Arzt und Patient, denn es ist wichtig, dass der Arzt den Patienten immer auch körperlich untersucht, ihn abtastet, anfasst. Das Abtasten des Patienten mit den Händen oder das Abhören mit dem Stethoskop sind fast immer sinnvoll: Eine tastende Hand kann die empfindliche Darmschlinge lokalisieren, die das Ultraschallbild noch als normal betrachtet. Und sie kann etwa im Muskelsystem mehr erkennen als das beste Kernspingerät, denn dieses kann nur die Form und Gestalt der Muskeln, aber nicht deren Spannung anzeigen. Eine manuelle Untersuchung gehört deshalb fast immer zur richtigen Deutung der Symptome und ist ein Zeichen eines guten Arztes.
All diesen Ansprüchen an einen guten Arzt versuchen wir in unserem Heidelberger Zentrum Genüge zu tun – und ich hoffe, dass uns das in den meisten Fällen auch gelingt. Mittlerweile haben bestimmt neunzigtausend Menschen Erfahrungen mit unserer Medizin, die das Beste aus zwei Welten vereint, gesammelt. Sie basiert auf vier praktischen Grundsätzen.
1) Die komplementären Verfahren kommen immer dann infrage, wenn die westliche Medizin das Problem nicht oder nur unzureichend löst oder wenn ihre Anwendung gefährlich oder mit Nebenwirkungen behaftet ist.
2) Die Chinesische Medizin und andere komplementäre Medizinmethoden richtig einzuschätzen, gelingt nur erfahrenen Ärzten dieses Faches und setzt eine intensive Diagnostik sowohl nach der westlichen wie nach der Chinesischen Medizin voraus. Nur ein Diagnoseverfahren ist nicht ausreichend, man braucht immer zwingend zwei Diagnosen, damit man einerseits die westlichen Heilungsaussichten einschätzen und zum Beispiel das richtige Medikament wählen kann und andererseits die Abwägung treffen kann, ob eine Chinesische oder andere komplementäre Behandlung hier sinnvoller wäre.
3) Während der Behandlung muss der Patient auch weiterhin von einem Arzt beurteilt werden, der über Kenntnisse in beiden Heilsystemen verfügt, da beide Medizinformen auch zu Nebenwirkungen führen können. Bei einer Auswahl der Therapiemöglichkeiten aus beiden Medizinformen sind erfahrungsgemäß aber weit weniger Nebenwirkungen und Komplikationen zu erwarten.
4) Beide Medizinformen haben Grenzen – aber in Kombination erreichen sie diese weit weniger schnell.
Als Faustregel gilt: Die westliche Medizin bringt die Sicherheit in die Therapie, die Chinesische Medizin birgt zusätzliche Chancen. Nur die Kombination beider Heilmethoden erfüllt die Erwartungen an Sicherheit und Wirksamkeit.
Und diese Medizin der zwei Welten bringt noch einen weiteren Vorteil. Im Heidelberger Institut haben wir festgestellt, dass etwa ein Drittel der Patienten, selbst wenn sie als von einer Universitätsklinik schulmedizinisch abgeklärt galten, noch »westlich-schulmedizinisch« behandlungsbedürftige medizinische Probleme hatten. Dabei haben wir den Eindruck gewonnen, dass die chinesische Diagnostik Funktionsstörungen bereits in einem Stadium anzeigt, in dem noch keine oder erst wenige Laborwerte verändert sind. In vielen Fällen konnten wir aufgrund dieser Diagnose ergänzende Befunde mit Methoden der westlichen Medizin erheben, die entsprechende Organfunktionen sichtbar machen konnten. Ohne die ergänzenden Hinweiszeichen aus der Chinesischen Medizin hätten wir diese Untersuchungen aber nicht angestellt. Wir können also durch das Heranziehen der chinesischen Diagnostik in vielen Fällen Erkrankungen finden, die wir dann auch mit den westlichen Methoden bestätigen können. Das bringt ein wunderbares Plus an Sicherheit und ermöglicht neue Behandlungsoptionen, auf die man natürlich auf keinen Fall verzichten möchte.
Und wir können sagen, wo die Zwei-Welten-Medizin am besten wirkt.1 Es sind:
• Gelenkschmerzen durch »Abnutzung«, etwa in Knie, Rücken, Schulter, Hüfte, Fußgelenken und Händen
• Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen
• Allergien
• Chronische Nasennebenhöhlenentzündungen
• Wiederkehrende Kopfschmerzen und Migräne
• Hauterkrankungen wie Akne, Psoriasis, also Schuppenflechte, und Neurodermitis
• Erkrankungen des Nervensystems wie Polyneuropathie, Demenz, Multiple Sklerose und Parkinson
• Beschwerden des Verdauungssystems wie Beschwerden im Oberbauch, Reizdarm, chronische Darmentzündungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
• seelische Ungleichgewichte wie Ängste und Depressionen
• Folgen unserer stresserzeugenden Lebensform wie Burn-out und Bluthochdruck
• Nebenwirkungen der Krebstherapie wie Übelkeit, Fatigue, Mangel an weißen Blutzellen und Polyneuropathie
• Post-Covid-Syndrom
• Gelenkrheumatismus
• Herzinsuffizienz und funktionelle Herzbeschwerden
TEIL I:
Yin und Yang in der Theorie
Eine neue Medizin
In unserer Praxis in Heidelberg, in einem schönen, großen Raum, den wir Turmzimmer nennen, steht eine alte französische Kommode. Es ist ein großes, schweres Ding, und ich habe es aus einer Gegend in der Hochprovence mitgebracht, in die es mich seit meiner Kindheit immer wieder zieht.
Gerade stehe ich mit einer Patientin im Turmzimmer, nein, sie liegt auf der Behandlungsliege, und ich sitze neben ihr, habe eine Nadel in eine Leitbahn, einen »Meridian« ihres Körpers gepikt, und wir unterhalten uns. Sie hat zum ersten Mal den Weg in unser Heidelberger Institut für Chinesische Medizin gefunden, weil eine Bekannte meinte, bei ihren wiederkehrenden Rückenschmerzen könnten wir ihr vielleicht helfen.
Meine neue Patientin und ich, wir haben uns ein halbes Stündchen unterhalten, woher sie kommt, wer sie ist, was sie zu mir führt. Ich habe ihre Art auf mich wirken lassen, ihrer Stimme gelauscht, ihrem Klang, habe mir ihre Augen angeschaut, sie ihre Zunge rausstrecken lassen, ihren Gang und ihre Haltung betrachtet, ihre Schultern, ihre Stirn, ihren Körper abgetastet. Und mir also ein Bild gemacht, wie es jeder Mensch bei der ersten Begegnung tut. Allerdings genauer, tiefergehender, professioneller, unter Hinzunahme der diagnostischen Beobachtungen, die die Chinesische Medizin mir zur Verfügung stellt. Und als die Dame sich erhebt, ein, zwei Schritte geht, ihre Brauen hebt und erstaunt ausruft: »Ist ja schon besser!« – da schmunzle ich, weil ich mich immer wieder über diese wunderbare Wirksamkeit freue, die wir in unserem Institut meist nach der ersten Behandlung schon erkennen können.
Und dann fragt sie: »Wie haben Sie das gemacht?«
Wenn Patientinnen oder Patienten mir diese Frage stellen, deute ich gerne auf die alte französische Kommode und sage: »Sehen Sie die schöne Kommode da? Sie klemmt.« So ähnlich, wie wir Menschen manchmal blockiert sind. Man kann nun die Kommode auf verschiedene Art untersuchen, z. B. könnte man sie röntgen, oder eine Kernspin-Aufnahme von ihr machen oder irgendein anderes bildgebendes Verfahren anwenden, das uns einen Blick ins Innere erlaubt.
Dabei käme man zu keinem nennenswerten Befund, denn die Kommode sähe von außen wie von innen in Ordnung aus. Keine Fraktur, kein Bruch der Schublade oder sonstige Schädigungen der Struktur der Kommode. Das Bild von der Kommode wäre »ohne Befund«. Ein Orthopäde könnte nach Betrachtung des MRT-Bildes, also des Ergebnisses der Magnetresonanztomografie, sagen: Da ist nichts zu sehen.
Oder sogar: Da kann nichts sein, weil ich es mit den modernsten bildgebenden Verfahren unserer westlichen Medizin nicht diagnostizieren kann.
Der Kommode, sage ich zu meiner Patientin, geht es gewissermaßen wie Ihnen. Auf dem Bild vom MRT, das Sie von Ihrem Orthopäden mitgebracht haben, ist auch nichts Kaputtes zu sehen. Und bestimmt haben Sie, wie manche Patienten, diese Diagnose mit einem unangenehmen Unterton gestellt bekommen, vielleicht sogar mit dem unausgesprochenen Vorwurf: Sie bilden sich das wohl ein!
Die Dame nickt, sie verdreht sogar leicht die Augen.
Und vielleicht haben Sie sich, fahre ich fort, beim Arzt dann unwohl gefühlt, womöglich sogar nicht ganz ernst genommen, waren vielleicht sogar wütend oder verzweifelt, und sind zu einem anderen Arzt gegangen, möglicherweise auch »heimlich«, und über die Jahre zu noch einem, zweien oder dreien, in der Hoffnung, der findet was. Nämlich: die Ursache für den Schmerz. Denn der ist ja nun mal da und nicht etwa eingebildet.
Der Arzt kann aber auch nichts dafür, dass er auf dem MRT-Bild nichts sieht. Denn man kann mit dieser Methode eben nicht feststellen, dass die Schubladen klemmen. Das könnte man nur bei einer Aufnahme, die die Bewegung sichtbar macht, etwa so wie in einem Film. Ja, man müsste sie in Bewegung versetzen: Schublade auf, Schublade zu, dran ruckeln und dran ziehen – und dann würde man vermutlich zu sehen und zu spüren bekommen, durch welches Ruckeln, also durch welche Bewegungsrichtung und -art das, was da klemmt, wieder in Gang gebracht wird.
Und auch beim Menschen können die Verbindungen der Knochen, die Gelenke, ähnlich wie eine Schublade ganz einfach klemmen. Dann reagiert der Körper mit einer Anspannung der Muskeln: Diese wollen die Gelenke bewegen, notfalls sogar mit Gewalt, aber die Gelenke klemmen eben. Und so spannen sich die Muskeln immer weiter an, was zu einem vermehrten Druck im Muskel führt. Er wird nicht mehr richtig vom Blutstrom durchflossen, schreit gewissermaßen nach dem lebenswichtigen Sauerstoff und schmerzt. Die Muskeln sind über die Sehnen mit den Knochen verbunden, und deshalb schmerzen auch die Ansätze der Sehnen und die Knochen selbst.
Mit dem MRT sehen Sie nun die Knochen, die Muskeln und die Sehnen und Nerven – also die Hardware, die Bauelemente des Körpers. Und die sind in ihrer Beschaffenheit, ihrer Struktur, im Prinzip in Ordnung. Aber die Spannung und den Druck in den Muskeln sieht man nicht, denn die entstehen dadurch, dass die Software, die für die Steuerung der Muskeln und Gelenke zuständig ist, nicht richtig arbeitet. Diese Software befindet sich in einem Teil des Gehirns, aber nicht in dem, der für das aktive Denken zuständig ist. Diese Steuerung funktioniert ganz automatisch, ohne den bewussten Willen des Menschen unterworfen zu sein. Lateinisch nennt man das »vegetativ«, und das heißt »aus sich selbst heraus funktionierend«. Der Fachausdruck für diesen Teil der Körpersteuerung heißt deshalb vegetatives Nervensystem. Und weil es sich um den Willen des Menschen nicht kümmert, nennt man es auch das »autonome« Nervensystem. Es macht, was es will – und im Falle der Patientin ärgert es sich offensichtlich, denn es will die blockierte Bewegung erzwingen.
Und deshalb steigt und steigt die Spannung in den Muskeln, bis die Schublade – Pardon, das Gelenk – gänzlich blockiert ist und man den Schmerz nicht mehr aushalten kann. Diese Ursache der Schmerzen lässt sich mit keinem bildgebenden Verfahren wirklich messen oder sehen. Und für solche Fälle gibt es die Chinesische Medizin: Sie sorgt sich um die Steuerung aller Lebensvorgänge, der Gewebe und Organe. Ihre große Wirksamkeit kommt also, mit einem einfachen Vergleich ausgedrückt, aus ihrer Eigenschaft als Software-Heilung, und die braucht man häufiger als gedacht.
Denn was machen Sie eigentlich, wenn Ihr Computer zu Hause einmal nicht mehr funktioniert? Wechseln Sie gleich die Festplatte, die Tastatur oder den Monitor aus? Meistens ist es doch ausreichend, die Software wieder richtig einzustellen oder ein Update aufzuspielen. Oft genügt hierzu ein einfaches Ausschalten und Wiedereinschalten, und überhaupt besteht die billigste Reparatur bekanntlich im Drücken der Reset-Taste. Und wenn die Software repariert ist, läuft der Rechner wieder.
Es scheint aber, als ob die westliche Medizin die Gesundheit oder Krankheit eines Menschen vorwiegend durch die Analyse der Hardwarekomponenten beurteilen wolle. Und natürlich bezweifelt niemand, dass es richtig ist, die Knochen zu röntgen oder die Niere zu untersuchen. Und es sind die erfolgreichen Behandlungen der großen Hardwareprobleme, die letztlich den weltweiten Sieg der westlichen Medizin bewirkt haben und immer noch bewirken. Denn hier – beim Herzinfarkt, bei Krebs oder bei der eitrigen Blinddarmentzündung – hat sie ihre Stärken.
Aber bei einer ganzen Reihe von Beschwerden, die eben durch die Software entstehen, funktioniert sie doch nicht so gut wie erhofft. Das reicht von bestimmten Schmerzen an der unteren Wirbelsäule und am Knie bis zu Regelschmerzen und Tennisarm, von der Maus-Hand bis zu Prüfungsangst und Burn-out. Und deshalb brauchen wir die Chinesische Medizin als Ergänzung unserer westlichen Hardware-Medizin – was immerhin so gut funktioniert, dass die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland einige dieser Behandlungen bezahlen und sie in der Schweiz noch viel unkomplizierter erstattet werden. Ein Allheilmittel ist die Chinesische Medizin natürlich trotzdem nicht.
Und deshalb möchte ich gerne von Anfang an betonen: Eine alleinige östliche Medizin, überhaupt eine Komplementärmedizin als Stand-alone-Behandlung, also ohne die konventionelle westliche Medizin, wäre nicht wünschenswert und eigentlich auch nicht denkbar. Denn: nur Hardware- oder nur Software-Reparatur, das ist beides nicht genug. Auf die Kombination kommt es an: sie müssen zusammenwirken.
Allerdings ist es entscheidend, beide Formen der Heilkunst systematisch miteinander zu verknüpfen: Die Vereinbarkeit von Hardware- und Software-Medizin muss bereits bei der Theorie und den Fachbegriffen gelingen. Sonst gibt es Chaos.
Aber wie funktioniert die Chinesische Medizin eigentlich? Sie liest an vielen kleinen Zeichen von außen ab, wie die Leibesregionen und Organe vom vegetativen Nervensystem aktiviert und deaktiviert werden. Sie verfügt über eine genaue Lehre dieser kleinen Zeichen, weiß sie zu erkennen, zu deuten und zur Diagnose unseres Softwarezustandes, des Zustandes unserer Körpersteuerung, zu nutzen. Sie kann dann die Funktionen quasi neu einstellen und neu programmieren, ein bisschen wie bei einem Update.
Das alleine ist bereits ein großer Segen. Aber wir wissen, dass bei jedem Softwareproblem auch der Anwender der Programme eine Rolle spielt. Und so kann man tatsächlich viele Erkrankungen vermeiden, wenn man weiß, wie sie entstehen.
Dabei geht es zunächst um pathogene Faktoren, also »äußere« Krankmacher wie Kälteeinwirkung, Zugluft oder Feuchtigkeit. Aber die menschlich viel interessanteren Faktoren kommen von innen. Beide Faktoren werden wir in den Fallbeispielen im dritten Teil dieses Buches besser kennenlernen. Diese inneren Krankmacher sind Emotionen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Sie entstehen durch Fragen, die die meisten Menschen tief bewegen, etwa: Welche Rolle spielen die Gefühle und woher kommen sie eigentlich? Warum habe ich so widersprüchliche Gefühle? Was will mir mein Körper sagen? Und was hat das mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun? Deshalb werden sie in unserer Darstellung der Medizin der zwei Welten deutlich im Vordergrund stehen.
Denn in der Tat hat die Chinesische Medizin für diese Menschheitsfragen ein paar Antworten anzubieten, die an vielen Stellen Licht ins Dunkel bringen und uns durch ihre Klarheit erstaunen. Sie kann auf eine besondere Art die Verbindung zwischen den Gefühlen des Patienten und seinen körperlichen Symptomen erkennen, und das Prinzip dahinter möchte ich hier genauer erklären.
Jeder kennt den Begriff der Körpersprache, der die körperlichen Ausdrucksformen der menschlichen Seele umfasst, die ebenso durch das vegetative oder autonome Nervensystem erzeugt werden. Aber in der Chinesischen Heilkunst geht das Lesen der Seele weit über die bei uns geläufigen Kenntnisse der Körpersprache hinaus. Die alten Ärzte konnten unmittelbar und tiefgehend den Zusammenhang zwischen den individuellen Symptomen und der emotionalen Balance in unserem Unterbewusstsein erkennen und somit helfen, unsere emotionalen Widersprüche, also das, was in uns die inneren Unstimmigkeiten erzeugt, im eigenen Leben zu erkennen und zu lösen.
So werden die inneren Bewegungen eines Menschen, die E-motionen, die Bewegungen aus dem gesunden Mittenzustand heraus, erkennbar. Denn es ist kein Zufall, dass sich das Wort Emotion aus zwei Bestandteilen zusammensetzt: E von »ex« (»heraus«) und motion vom lateinischen »motus« für »Bewegung«. Sie sind also Herausbewegtheiten des Gefühls aus einem Zustand, den man manchmal In-seiner-Mitte-sein nennt.
Die Reise in unseren Körper wird damit auch eine Reise in unser innerstes, häufig sogar vor uns selbst verborgenes Lebensgefühl, also unseren tiefen emotionalen Erfahrungsschatz. Und das ist nicht nur für unsere Lebensplanung, sondern gerade für das ganz Alltägliche ungeheuer wertvoll.
Noch etwas möchte ich vorwegnehmen: Gefühle sind bekanntlich nicht immer logisch erklärbar und werden gerne verdrängt, leider gerade auch dann, wenn sie für unsere Genesung so wichtig wären. Wir gestehen sie uns also manchmal nicht ein, aber sie sind bedeutsam. Wenn aber der Arzt oder wir selbst die Emotionen hinter den Symptomen einfühlsam, gründlich und zuverlässig ablesen und erkennen können, dann lassen sie sich auf einmal aussprechen und damit auf den Monitor unseres Bewusstseins holen.
Der Körper gibt uns also in Form eines Symptoms eine wichtige und hochintelligente Information über uns selbst und unsere innere Balance – und die alte Heilkunst Asiens sagt uns, wie wir damit unsere inneren Unstimmigkeiten entschlüsseln und unser Leben wieder neu ausrichten können. Das genau ist es, was ich unter der Intelligenz des Körpers verstehe, die beim Prozess der Heilung so hilfreich ist.
Das Symptom ist bei näherer Betrachtung also eine Art Sprache des Körpers, eine wichtige Mitteilung an unser Bewusstsein. Und in dieser Botschaft liegt fast immer auch schon ein Lösungsansatz, der rein aus uns selbst heraus entsteht und ein unaussprechliches inneres Drängen, das von unseren verborgenen und schwer in Worte zu fassenden inneren Unstimmigkeiten herrührt, behebt. Das Unaussprechliche zu erspüren und in Worte zu fassen, das ist so entscheidend für die Entwicklung und das innere Wachstum einer Person.
Und hier sehe ich eine große Gemeinsamkeit mit der alten Medizin des Westens und eine wichtige Verbindung zur Psychotherapie. Schon die alte griechische Philosophie wusste es: Ein Zustand, über den man sprechen kann, ist schon so gut wie überwunden. Sigmund Freud hat es anders ausgedrückt: Er vergleicht die Benennung einer wirklich bedeutsamen und relevanten emotionalen Lage mit einem Begriff aus der Naturwissenschaft, dem Katalysator, der eine ohnehin stattfindende chemische Reaktion beschleunigt. Dabei wird aus einem Stoff A ein Stoff B – und auch der Zustand des Menschen ändert sich von einem Zustand A zu einem Zustand B, wenn die Benennung als Katalysator beschleunigend wirkt. Wichtig dabei ist, dass im Idealfall nur das passiert, was ohnehin passieren soll, also der Zustand erreicht wird, der ganz natürlich erreicht werden soll – und nicht etwa eine vom Therapeuten in den Patienten hineingeredete Pseudolösung.
Dann entsteht das, was mir als das eigentlich Wunderbarste an diesem Prozess des Heilens erscheint, ein Vorgang, der das ganze Lebensgefühl der Menschen betrifft und der mich seit Jahrzehnten fasziniert: Die chinesische Medizin spricht davon, dass der innere Lebensweg, der blockiert erschien, wieder frei wird. Man kann sich diesen eigentlichen, im Inneren angelegten Weg wie ein eingeborenes »Skript« vorstellen, einen inneren Lebensplan, den man intuitiv fühlen kann. In der Chinesischen Medizin wird er das dao genannt, die eigene innere Bestimmung aller Dinge, die auch im Menschen wirkt. Aber diesen inneren Weg, das dao, kann der Mensch aus den Augen verlieren. Und das hat mit einer emotionalen Schieflage zu tun, die sich in körperlichen Symptomen bemerkbar macht. Die Therapie der Chinesischen Medizin bewirkt dann einen Wandel, der von Innen kommt, aus dem eigenen Wesen der Menschen. Auf einmal kommt man wieder zu sich selbst, ruht wieder in sich, wo man zuvor »außer sich« war, und das ist eine ganz großartige Erfahrung.
Die drei großen Stärken der Chinesischen Medizin sind also: Symptome heilen, Emotionen verstehen und lösen und den inneren Lebensweg wieder fühlbar machen. Diese drei Schritte werden uns in diesem Buch immer wieder begegnen, und ich scheue mich nicht, sie als die drei Dimensionen der Heilung zu bezeichnen.
Allerdings: So wie nicht in jedem Athener Taxifahrer gleich ein griechischer Philosoph steckt, so ist auch nicht jeder Vertreter der Chinesischen Medizin ein tiefer Kenner der alten und beinahe schon verloren geglaubten Heilkunst. Zwischen beiden liegen Jahrtausende der Geschichte, der Prägung, des richtigen Gebrauchs, aber auch des Missbrauchs. Deshalb müssen wir auf dem Weg zur Integration dieser wichtigen Heilkunst ihren erstaunlichen und wissenschaftlichen Ansatz erklären. Und wir müssen auch den wissenschaftlichen Nachweis ihrer Wirksamkeit erbringen und vor allem die Qualität ihrer Durchführung laufend überprüfen. Dazu müssen wir zuallererst noch besser verstehen, was beide Arten der Medizin leisten können, wie sie das tun, und an welchen Stellen sie sich ergänzen können.
Die westliche Medizin erhebt bei der Diagnosestellung Messwerte, die überwiegend die Struktur des Körpers, seine Hardware, im Blick haben: Die Größe der Organe im Ultraschall, die Stellung der Wirbel und Bandscheiben im Kernspin, die Höhe eines Enzymwertes, der die Leistungsfähigkeit der Leber misst. All diese Messwerte ermöglichen eine Momentaufnahme der körperlichen Struktur.
Die Chinesische Medizin zeichnet, wie wir gesehen haben, ein anderes Bild vom Menschen, das man ein sich bewegendes Abbild der sich ständig ändernden Funktionen nennen könnte. Die Steuerung des Körpers passt dessen Funktionen – die Muskeln, den Kreislauf, die Atmung und sogar die Erholung nach einer Anstrengung – normalerweise fortlaufend an die Erfordernisse der Lebenssituation an. Das geschieht im autonomen Nervensystem, das übrigens auch die grundlegenden Lebensempfindungen des Körpers und die Tiefenemotionen steuert.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der westlichen und der östlichen Medizin ist also der zwischen einer Momentaufnahme und einem Film. Und denken Sie noch einmal an unsere Kommode zurück: Ein Film wäre da besser gewesen als ein einfaches Bild, denn dann hätte man schon gesehen, in welche Richtung man ruckeln und schieben muss, um die klemmende Schublade zum Gleiten zu bringen! Die Wissenschaft nennt so etwas den Unterscheid zwischen einem »statischen« und einem »dynamischen« System.
Anhand der mit der Körpersteuerung verbundenen Körpergefühle, also der Eigenwahrnehmung der Patienten, kann die Chinesische Medizin die Störung erkennen. Diese Befindlichkeiten sind also für das Patientengespräch, die Anamnese in der Chinesischen Medizin ungeheuer wichtig. Sie entstehen auch bei Alltagsbeschwerden eben nicht zufällig und sind keinesfalls unbedeutend. Das sehr viel werte Befinden ist für den Arzt deshalb nicht etwa ein lästiges Beiwerk, ein überflüssiges Gerede, das von der »eigentlichen« Diagnose durch ein Röntgenbild oder Ähnliches ablenkt, sondern er versteht die Empfindungen der Menschen auf eine andere, tiefere und bedeutsame Weise. Das ist übrigens für beide Seiten, für Arzt und Patient, eine große Erleichterung und eine wohltuende Erfahrung.
In der Chinesischen Medizin wird also die Befindlichkeit des Patienten, die die westliche Medizin schwer oder gar nicht messen kann, zu einem regelrechten Befund. Und Befunde sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu jeder Therapie, da der Arzt aus ihnen eine Diagnose als Grundlage der Therapieentscheidung erstellt.
Mit dieser Therapie, etwa Akupunktur oder Therapie mit den Händen, Heilpflanzen oder therapeutische Gespräche, kann das Nervensystem umgestimmt werden, und die Symptome verschwinden. Und da jeder Mensch seine individuellen Leib- und Lebensempfindungen hat, hat auch jeder Patient in der Chinesischen Medizin eine individuelle Diagnose und jede Erkrankung eine klare, auf den Patienten abgestimmte Therapieanweisung. Das Prinzip der Individual-Diagnose steht in der Chinesischen Medizin ganz oben, und wir wissen; je besser die Diagnose, desto besser auch die Therapie.