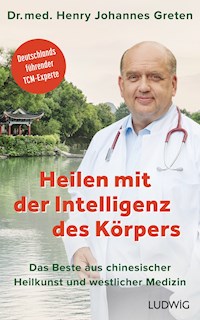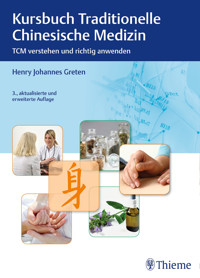
189,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kurskonzept mit klaren praktischen Rezepten
- Bildhafte Sprache und praxisbezogene Faktenpräsentation
- Arzneimittelrezepte, differenzierte Punktauswahl-, und Punktkombinationsstrategien
Verknüpfung von westlicher und chinesischer Medizin
- Brückenschlag zwischen chinesischen Erklärungsmodellen und der medizinischen Wissensbasis des Westens
Neu in der 3. Auflage:
- Neue Kapitel: TCM in der Neurologie; Janusakupunktur und Heidelberger Schädelakupunktur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1641
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kursbuch Traditionelle Chinesische Medizin
TCM verstehen und richtig anwenden
Henry Johannes Greten
3., aktualisierte und erweiterte Auflage
737 Abbildungen
Vorwort zur 3. Auflage
Warum Sie dieses Buch lesen müssen
Die Chinesische Medizin gewinnt in unserem Land immer mehr Anhänger. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die heterogene Qualität der Chinesischen Medizin verbessert werden kann.
Wir haben in den weltweit ersten doppelverblindeten klinischen Akupunkturstudien ▶ [1], ▶ [2] eindeutig und unwiderlegbar nachgewiesen, dass die Anwendung der diagnostischen Prinzipien der Chinesischen Medizin, wie sie in diesem Buch dargestellt werden, zu einer unmittelbaren, messbaren und spezifischen Wirkung führt.
Die eindrucksvolle Wirkung der TCM nach dem Heidelberger Modell geht weit über die teils zum Handwerklichen heruntergestuften Methoden der Akupunktur und Diagnostik hinaus. Die vollständige Wirkung der TCM beruht auf dem Verständnis der Chinesischen Medizin und ihrer Diagnostik als einem stringenten Modell der Systembiologie ▶ [3], ▶ [4].
Die Grundlage der Diagnose erschließt sich (nur) auf diese Weise schlüssig und logisch. Die Diagnose ist in der Medizin auch stets eine Handlungsanweisung, und so erklärt es sich, dass die verbesserte Diagnostik die Grundlage eindrucksvoller Erfolge in der Praxis ist, wenn man die in diesem Buch dargestellten Grundsätze technisch verstanden hat und umsetzt.
Ein wichtiger Vorteil einer stringenten und umfassenden Diagnose dabei ist, dass nicht nur Akupunkturpunkte den Beschwerdebildern besser zugeordnet werden können, sondern auch Heilkräuterrezepturen, Qigong-Übungen, diätetische Maßnahmen etc. einen synergistischen Platz im Konzert eines systematischen Behandlungskonzepts einnimmt.
Dieses Buch war nun für einige Jahre nicht mehr erhältlich und eine neue Auflage wurde sehnlichst erwartet. Es war uns deshalb ein Anliegen, diese grundlegende Quelle als Basis einer geordneten Tätigkeit der Chinesischen Medizin wieder auf den Markt zu bringen. Doch Vorsicht: Vor den Erfolg haben die Götter den Fleiß gesetzt und vor die Therapie die Diagnose.
Nutzen Sie deshalb auch das immer breiter werdende Angebot von Vorträgen zu diesem Thema auf YouTube (Kanal DGTCM) und www.dgtcm.de. Besuchen Sie die zahlreichen Lehrveranstaltungen, denn Medizin lernt sich nicht aus einem Buch allein. Besonders der praktische Unterricht liegt uns am Herzen, und wir sind stolz darauf, dass hocherfahrene Könner des Faches bei uns zusammenkommen, um den Kanon des theoretischen und praktischen Wissens weiter zu verbreiten.
Das Heidelberger Modell wurde in der Zwischenzeit von der State Administration of Chinese Medicine in Peking (Prof. Shen Yulong) positiv bewertet und stellt damit das erste Modell der Chinesischen Medizin dar, das als Theoriemodell überhaupt von einer chinesischen Regierungsstelle gewürdigt wurde.
Der erste Masterstudiengang Europas der Chinesischen Medizin für Healthcare Professionals wurde deshalb an der staatlichen Universität Porto auf der Grundlage dieses Modells eingeführt. Kurse und Unterrichtsveranstaltungen haben seitdem immer wieder auch in verschiedenen deutschen Universitäten stattgefunden.
Die Schlüsselfaktoren zu einer erfolgreichen Integration der Chinesischen Medizin in das westliche Gesundheitswesen sind Forschung und Qualitätskontrolle. Ich hoffe, dass die Offenlegung der oft vertraulich gehaltenen eigentlichen Prinzipien der Chinesischen Medizin auch zu einem besseren Dialog der vielen Menschen führt, die sich ernsthaft und beruflich mit Chinesischer Medizin, ihrer Erforschung und Ausübung befassen.
Eine sachliche Grundlage zu einer kritischen Diskussion unseres Faches wird mit diesem Buch wieder öffentlich gemacht. Mögen alle davon profitieren, die es benötigen.
Danksagung
Dieses Buch wurde von zahlreichen engagierten Menschen vom Beginn seiner Entstehungsgeschichte bis heute begleitet. Für die nun vorliegende 3. Auflage möchte ich mich besonders bei Frau Petra Fröschen für ihre Hilfe bedanken, die durch unermüdliche Korrektur- und Betreuungsarbeit und die enge Zusammenarbeit mit dem Verlag ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Neuauflage entstehen konnte. Frau Dr. Anne Frohn vom Thieme Verlag und dem Grafiker Herrn Roland Geyer danke ich herzlich für ihre stets hilfsbereite Unterstützung. Wir sind allen tiefen Dank schuldig.
Heidelberg/Porto
Johannes Greten
Literatur
[1] Hauer K, Wendt I, Schwenk M et al.Stimulation of Acupoint St 34 Acutely Improves Gait Performance in Geriatric Patients During Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(1): 7–14
[2] Karner M, Brazkiewicz F, Remppis A et al. Objectifying specific and non-specific effects of acupuncture: A double-blinded, randomised trial in osteoarthritis of the knee. Evid Based Complement Alternat Med 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/427265
[3] Greten HJ. Chinesische Medizin als vegetative Systembiologie. Teil I: Therapeutische Verfahren (Chinese Medicine as Vegetative System Biology I. Part I: Therapeutic Methods). HNO 2011; 59: 1160–1164; http://dx.doi.org/10.1007/s00106-011-2409-6
[4] Greten HJ. Chinesische Medizin als vegetative Systembiologie. Teil II: Die Struktur der TCM-Diagnose (Chinese Medicine as Vegetative System Biology. Part II: The structure of Chinese diagnosis). HNO 2011; 59: 1165–1175, http://dx.doi.org/ 10.1007/s00106-011-2413-x
Abkürzungsverzeichnis
ACTH
adrenokortikotropes Hormon
ADH
antidiuretisches Hormon
AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
ALS
amyotrophe Lateralsklerose
ALT
Algor-laedens-Theorie
ATP
Adenosintriphosphat
BWK
Brustwirbelkörper
BWS
Brustwirbelsäule
cAMP
zyklisches Adenosinmonophosphat
CMT
Chinesische Manuelle Therapie
COPD
chronisch obstruktive Lungenerkrankung (engl. Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
CPAP
Continuous Positive Airway Pressure
CRP
C-reaktives Protein
CT
Computertomografie
DD
Differenzialdiagnose
DGTCM
Deutsche Gesellschaft für Traditionelle Chinesische Medizin e.V.
FDA
Food and Drug Administration
FK
Funktionskreis
HSA
Heidelberger Schädelakupunktur
HWS
Halswirbelsäule
ICR
Intercostalraum
ISG
Iliosakralgelenk
KHK
koronare Herzkrankheit
KI
Kontraindikation
LB
Leitbahn
LK
Leitkriterium
LWS
Lendenwirbelsäule
MS
Multiple Sklerose
NMR
Kernspintomografie (Nuclear magnetic Resonance)
NNH
Nasennebenhöhlen
NSAR
nicht steroidales Antirheumatikum
PIP
Fingermittelgelenke
PMS
prämenstruelles Syndrom
PNP
Polyneuropathie
PT-Modell
Psychotherapiemodell
PTTCM
Psychotherapie nach der TCM
RAAS
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
RAC
auriculokardialer Reflex (reflexe auriculo cardiaque)
RR
Blutdruck nach Riva-Rocci
TCM
Traditionelle Chinesische Medizin
TEP
totale Endoprothese
TIA
transitorische ischämische Attacke
WHO
World Health Organization
WP
Wandlungsphase
YNSA
neue Schädelakupunktur nach Yamamoto (engl. Yamamoto New Scalp Acupuncture)
ZNS
zentrales Nervensystem
ZOP
zentraler Orientierungspunkt
Inhaltsverzeichnis
Teil I Standortbestimmung
1 TCM – die Rekonstruktion eines mythisierten Originals
2 Warum westliche Mediziner die TCM verstehen sollten: die Grenzen des Messbarkeitsdogmas
1 TCM – die Rekonstruktion eines mythisierten Originals
Die Bedeutung dieses Kapitels für das Verständnis der Chinesischen Medizin
Die Bedingungen, unter denen sich die Chinesische Medizin entwickelt hat, unterscheiden sich grundlegend vom Entwicklungshintergrund der europäischen Medizingeschichte.
Man muss sich die Größe Chinas, den Entwicklungszeitraum und die Leistungsfähigkeit der chinesischen Kultur verdeutlichen, um einen angemessenen Umgang mit der Chinesischen Medizin zu erlangen.
Dabei spielt eine Schlüsselrolle, ob man eine Rezept-Akupunkturversion, eine phänomenologische Form ohne angemessene Theoriebildung oder eine wissenschaftliche Form der Chinesischen Medizin anstrebt. Diese Versionen der Chinesischen Medizin entstanden nicht zufällig, sondern sind Folge einer wissenschaftlich-historischen Entwicklung.
1.1 Quantitative Dimension
Die ungeheure Zahl der Menschen und das in dieser Zahl enthaltene menschliche Talent, die frühzeitig genutzte Möglichkeit, Erkenntnisse systematisch aufzuzeichnen, und das Vorhandensein verhältnismäßig gut organisierter kaiserlicher Archive bilden ein Entwicklungs- und Erfahrungspotenzial, das historisch einmalig ist.
Zusatzinformation
Bereits vor 3000 Jahren hatten die Chinesen einen zentral regierten Staat, eine hochentwickelte Schrift, ein komplexes Steuer- und Einnahmenrecht und verhältnismäßig gut organisierte Verkehrs- und Handelswege.
1.2 Räumlich-klimatische Dimension
Die klimatischen Bedingungen, die im Entwicklungsraum dieses menschlichen Potenzials vorherrschen, reichen von der nördlichen Mandschurei und der historischen Mongolei mit teils beinahe sibirischem Klima über trockene Wüstengebiete und waldreiche Gebirgsketten bis an das südchinesische Meer, in dem ein subtropisches Klima vorherrscht. Würde man ähnliche Klimazonen in unseren Längengraden aufsuchen wollen, so würde man sich beinahe „vom Nordkap bis in den Kongo“ bewegen müssen.
Ein besonderes Charakteristikum der Chinesischen Medizin besteht darin, dass die Heilmittel, von denen viele pflanzlichen Ursprungs sind, aus allen diesen klimatischen Zonen entnommen, systematisch in ihren Wirkungen beschrieben, ihre Kombinationsmöglichkeiten gesammelt und die Indikationen präzisiert wurden.
1.3 Zeitlich-historische Dimension
Die zeitliche Dimension der Chinesischen Medizin ist am schwersten abzuschätzen. In Gräbern finden sich Hinweise darauf, dass möglicherweise bereits vor 8000 Jahren mit Steinsplitternadelnakupunktiert wurde. Da diese Technik eine hohe Kenntnis der Reflexologie, der Physiologie und der Anatomie des Körpers voraussetzt, können wir postulieren, dass bereits vor diesem Zeitpunkt eine entwickelte Medizin existiert haben muss.
In den meisten Sekundärquellen wird der Beginn der Chinesischen Medizin hingegen mit dem Huang Di Nei Jing, dem „Klassiker der Inneren Erkrankungen“ des gelben Kaisers in Verbindung gebracht (3. vorchristliches Jahrhundert, zur Zeit der Feldzüge Alexanders des Großen 336–323 v. Chr.).
Vom heutigen Standpunkt aus ist es nicht leicht zu ermitteln, aus welchen Gründen dieses zentrale und bis heute gültige Werk der Chinesischen Medizin vor 2300 Jahren erstellt wurde. Zwischen der Entstehungszeit des Huang Di Nei Jing und den oben postulierten frühen Akupunkturbehandlungen liegen mindestens doppelt so viele Jahre wie zwischen der Geburt Christi und der Gegenwart.
Um sich eine bessere Vorstellung der zeitlichen Entwicklung machen zu können, haben wir die Abbildung eines Zeitstrahls eingefügt, auf dem die historische Entwicklung der Chinesischen Medizin in Korrelation zu wichtigen Ereignissen der europäischen Geschichte dargestellt ist ( ▶ Abb. 1.1).
Zeitstrahl.
Abb. 1.1 Entwicklung der Chinesischen Medizin in Korrelation zu wichtigen Ereignissen der europäischen Geschichte. Wollte man auch den Zeitraum der ersten Akupunkturbehandlungen 6000–4000 v. Chr. eintragen, müsste der Zeitstrahl 2–3 Buchlängen über den Oberrand hinausragen.
1.4 Das „Original“ ist verloren
Dieser Zeitstrahl beginnt bei Konfuzius, der ebenso wie Lao Tse die Begriffe yin und yang verwendete. Die Werke von Konfuzius bleiben etwa ab Beginn unserer Zeitrechnung bindende chinesische Staatsphilosophie. Unser Zeitstrahl in ▶ Abb. 1.1 müsste nach oben um etwa 2–3 Buchlängen aus diesem Buch herausragen, um den Zeitraum zwischen den ersten Akupunkturbehandlungen und Konfuzius darzustellen. Einen derartigen Zeitraum in einem solchen geografischen Umfang historisch exakt zu beschreiben, dabei noch bei so dürftiger Quellenlage, erscheint kaum möglich. Was ist in dieser Zeit geschehen? Wo sind die Werke aus der Frühzeit der Chinesischen Medizin geblieben? Hierüber gibt es wenig Aufschluss.
Um 300 v. Chr. erscheint dann (eben nicht aus „heiterem Himmel“) das Huang Di Nei Jing. Man könnte 2 mögliche Schlussfolgerungen aus dem Erscheinen des Huang Di Nei Jing ziehen:
Offizielle Stellen hatten verfügt, eine solche Kompilation zusammenzustellen und damit das Wissen erneut zugänglich zu machen, um einer Verflachung der Medizin entgegenzuwirken.
Das medizinische Wissen der damaligen Zeit war möglicherweise im Niedergang, sodass eine Kompilation des noch vorhandenen Wissens dringend nötig war, um es zu bewahren.
Diese beiden möglichen Motive – das zentralstaatlicherseits begründete Interesse an einer medizinischen Qualitätssicherung einerseits und das Interesse des Erhalts des medizinischen Wissensstands vergangener Epochen, teils unter Miteinbeziehung neuer Erkenntnisse, Erfahrungen und Textfunde andererseits – bestimmen die Entwicklung des „Gebäudes Chinesische Medizin“ bis heute.
Insofern kann man die Chinesische Medizingeschichte als eine Abfolge von Kompilationsversuchen begreifen, unter Einbeziehung sowohl historischer als auch zeitgenössischer Erkenntnisse. Ein Charakteristikum dabei war, dass man sich zur Legitimation des eigenen Standpunkts auf ältere, teils mythisierte Quellen bezog. Schon beim Huang Di Nei Jing zeigte sich diese Tendenz, da das Werk einem längst verstorbenen Kaiser „untergeschoben“ wurde und durch dessen mystische Autorenschaft stärker legitimiert werden sollte. Noch heute findet man ein ähnliches Vorgehen, da manche Autoren immer noch verbreiten, die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) sei „unverändert seit 2300 Jahren“ und sie (alleine) würden die „echte“ Chinesische Medizin vertreten.
1.5 Technische Entwicklung
Interessanterweise taucht in den Werken von Konfuzius und Lao Tse der Begiff der Wandlungsphasen (wu xing) (WP) noch nicht auf, sondern erscheint erst im 3. Jahrhundert vor Christus, bei Zhou Han.
Parallel zur historischen Entwicklung im Zeitstrahl lässt sich in einer groben Vereinfachung folgende technische Entwicklung postulieren, die man erst nach vollständiger Lektüre dieses Buches ganz nachvollziehen kann ( ▶ Abb. 1.2):
Der „Klassiker der inneren Erkrankungen“ (Huang Di Nei Jing) sowie der „Angelpunkt der Struktivkraft“ (Lingshu) liegen uns in einer Fassung vor, die mindestens 1000 Jahre nach ihrer Entstehung rekonstruiert wurde. Dort sind bereits alle wesentlichen Postulate der Chinesischen Medizin enthalten. Hierzu gehören yin und yang, die Wandlungsphasen und die Funktionskreise (orbes) (FK), die wir als eine systematische Ordnung von Dysregulationszeichen begreifen können. Die Energieformen („Säftelehre“) und die Krankheitsauslöser (Agenzien) sind in diesen Schriften ebenfalls enthalten, werden aber erst später genauer präzisiert.
Entwicklung der Chinesischen Medizin.
Abb. 1.2 Hier unter dem technischen Aspekt in grober Vereinfachung.
1.6 Historische Entwicklung
Ein solches technisches Postulat kann in seiner Einfachheit die tatsächlichen historischen Verhältnisse in keiner Weise wiedergeben. Selbstverständlich sind die Energieformen, etwa qi und xue, schon in bedeutend älteren Schriften erwähnt, jedoch erscheinen sie in ihrem funktionellen Konzept noch undifferenziert und als Teil anderer Überbegrifflichkeiten. Um die historische Entwicklung wenigstens in ihrer Dimension zu begreifen, greifen wir im Folgenden einige Highlights heraus.
Zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments verfasste Zhang Zhongjing ein bedeutendes Werk, das man als ein neues und sensationelles „Klinisches Handbuch der Chinesischen Medizin“ bezeichnen kann. In diesem Buch über „Kälteinduzierte Erkrankungen“ (Shang Han Lun) beschrieb er detailliert die Rolle des xue (die Wirkungen des Blutes und der Mikrozirkulation) bei der Krankheitsentstehung. Aus diesem Buch ist die maßgebliche Theorie der Stadienbeschreibung zyklischer Infektionskrankheiten abzuleiten.
Der wesentliche neue Aspekt in der Betrachtung der Pathogenese ist hierbei das Eindringen von algor („Kälteschutzreflex“, lokale Minderdurchblutung), wodurch eine reaktive Mehrdurchblutung (calor, „Hitze“, gemeint ist Überfunktion des xue) entsteht, durch die ein Großteil der akuten Symptomatik bedingt ist. Nach dieser Theorie ergeben sich später auch wesentliche Erkenntnisse zur systematischen Abfolge des Leitbahnsystems.
Ein Zeitgenosse von Zhang Zhongjing war der legendäre Arzt Hua Tuo, der möglicherweise kein Chinese war, sondern aus Zentralasien stammte. 1700 Jahre vor Vincenz Prießnitz und Pfarrer Kneipp führte er systematische Güsse mit Wasser und andere Formen der Hydrotherapie sowie Gymnastik durch. Auf ihn soll das Qigong der 5 Tiere (Tiger, Hirsch, Bär, Affe, Vogel) zurückgehen.
Während Zhang Zhongjing sich im Wesentlichen mit der Arzneitherapie befasste, konnte Hua Tuo auch große Operationen mithilfe einer Anästhesie durch Absude von Hanf und anderen unbekannten Drogen durchführen. Er operierte bereits an Darm und Milz. Dabei waren den Quellen zufolge 5 Wochen post operationem die Patienten schmerzfrei geheilt. Leider vernichtete Hua Tuo vor seiner Hinrichtung (man hatte ihn aus Eifersucht denunziert) sein wichtiges medizinisches Werk.
Dennoch geben die große Vielfalt seiner Methodik und die von ihm berichteten großartigen Therapieerfolge einen wichtigen Einblick in den Stand der Chinesischen Medizin etwa um die Zeit der Erstellung des Neuen Testaments (ca. 150 n. Chr.) bzw. der Errichtung des Hadrianwalls (122–127 n. Chr.).
Im 3. Jahrhundert verfasste Huangfu Mi das Buch „Systematischer Klassiker der Aku-Moxi-Therapie“ (Zhenjin Jiayijing) wiederum auf der Grundlage eines „Nadelklassikers“, der bereits zum Zeitpunkt des Huang Di Nei Jing erschienen sein soll, jedoch als verschollen gilt. In diesem Buch nennt er bereits 354 Akupunkturpunkte (foramina). Zum Vergleich: Die regelrechten Akupunkturpunkte werden heute auf 372 (361) gezählt. Es waren also zu diesem Zeitpunkt bereits beinahe alle im Leitbahnsystem vorhandenen Akupunkturpunkte bekannt.
610 n. Chr. schrieb Chao Yuanfang eine Enzyklopädie „Über Ursprung und Verlauf aller Krankheiten“ (Zhubing Yuanhoulun), in der sich bereits die Differenzialdiagnose (DD) von 1720 Krankheitsbildern befindet. Er wurde bereits von einer staatlich beauftragten Ärztekommission unterstützt.
Am Ende des 6. Jahrhunderts (582–682) wurde Sun Simo geboren, der erst als Hundertjähriger verstarb. In dem Werk „Wichtige Rezepte, die tausend Goldstücke wert sind“ (Qianjin Yaofang) schreibt er ausführlich über Ethik und Grundlagen, Augen- und Ohren-, Frauen-, Mund- und Zahnheilkunde und erstellt eine Enzyklopädie.
Seit dem 7. Jahrhundert gab es in der chinesischen Hauptstadt ein sog. oberstes Medizinalbüro. 762 n. Chr. erweiterte Wang Bing das Huang Di Nei Jing Su Wen auf den doppelten Umfang und betonte dabei deutlich die sog. Phasenenergetik (Wandlungsphasen).
Im Jahre 1078 gab es schließlich eine eigenständige Behörde, das große Medizinamt, der eine Medizinschule mit 300 Studienplätzen und ein Verlag angeschlossen waren. Der sich entwickelnde Buchdruck ermöglichte eine Verbreitung des Huang Di Nei Jing, das einer gründlichen Textkritik unterzogen wurde. Zur gleichen Zeit beobachtete man auch eine Zunahme qualitativ schlechterer Kompilationen durch medizinisch meist ungebildete Beamte – ein Prozess, der in mancher Hinsicht mit den gegenwärtigen Verhältnissen in der Chinesischen Medizin zu vergleichen ist. Damals wie heute trug eine solche Entwicklung nicht zu einer verbesserten Qualität der Chinesischen Medizin bei. Allerdings konnte so die flächenhafte Verbreitung gefördert und die Versorgung der Bevölkerung am ehesten sichergestellt werden.
Im Jahre 1159 stellte der Arzt Tang Shibeni aus Sizhuan die systematische Pharmakopoe Zhenglei Bencao zusammen, die 1740 Pharmaka enthält.
Vom 12. Jahrhundert an jedoch verfällt die Chinesische Medizin. Der Grund hierfür mag u.a. darin liegen, dass im Medizinalamt 4 Unterschulen gegründet wurden, die sich auf je eine Methode spezialisierten und die anderen vernachlässigten. Die oben beschriebene Herstellung neuer, aber schlechterer Kompilationen durch medizinisch nicht ausgebildete Beamte und der Verfall der wissenschaftlichen Medizin zu reiner Büchergelehrsamkeit nach konfuzianistischem Muster taten ein Übriges.
Im 16. Jahrhundert erholt sich die Chinesische Medizin. Li Shizhen schreibt eine bedeutende Pharmakopoe, das Bencao Gangmu. In ihm sind 1892 Pharmaka und 10000 Rezepturen verzeichnet. Um 1800 gibt es einen Nachtrag, sodass dieses Werk insgesamt auf einen Umfang von 2608 Drogen kommt.
Im 19. Jahrhundert vollzieht sich erneut ein weitgehender Niedergang der Chinesischen Medizin. Seuchen breiten sich aus und die ärmlichen Lebensverhältnisse in dem von außen bedrohten China führen dazu, dass sich die Menschen eine medizinische Behandlung nicht mehr leisten können.
Zur gleichen Zeit tritt die westliche Medizin durch hygienische Seuchenbekämpfung, Desinfektion und Fortschritte in der Pathologie, Anästhesiologie etc. ihren Siegeszug an.
Die Chinesische Medizin verkommt zu einem Gebilde, in dem Reste alter Gelehrsamkeit neben dem vorherrschenden, marktschreierischen Drang zur Scharlatanerie ein so schlechtes Bild abgeben, dass 1914 die Gründung einer Ärztevereinigung für Chinesische Medizin vom Unterrichtsminister abgelehnt wird.
1929 beantragt der nationale Hygieneausschuss von Nanking sogar das vollständige Verbot der Chinesischen Medizin. Dies lässt sich jedoch nicht aufrechterhalten, da die medizinische Versorgung der Bevölkerung sonst vollends zum Erliegen gekommen wäre. Deshalb wird das Verbot nach zahlreichen Protesten wieder aufgehoben.
Auch Mao glaubt zunächst nicht an die Gleichberechtigung der Chinesischen Medizin. Er schreibt:
„Die Sterblichkeit unter der Bevölkerung ist sehr hoch ... wenn wir uns unter solchen Bedingungen einzig und allein auf moderne Ärzte stützen, werden wir nichts ausrichten können. Moderne Ärzte sind natürlich überlegener als die Ärzte alten Typus, aber wenn sich die modernen Ärzte nicht um die Leiden des Volkes kümmern, wenn sie das medizinische Personal nicht für das Volk ausbilden wollen, wenn sie sich nicht mit den im Grenzgebiet vorhandenen mehr als 1000 Ärzten alten Typus zusammenschließen, dann werden sie in Wirklichkeit den Medizinmännern helfen.“
So werden ab 1949 in allen größeren Städten Akademien der Chinesischen Medizin gegründet. 1950 schreibt Mao:
„Vereint alle medizinischen Arbeiter, junge und alte der chinesischen und westlichen Schule und organisiert eine starke Einheitsfront für die Entwicklung des Volksgesundheitsdienstes.“
Ab 1954 erscheinen schließlich neue Editionen der klassischen Medizinwerke der Chinesischen Medizin.
Die enormen Anstrengungen zur Rehabilitierung der Chinesischen Medizin in China in den 1950er- und 1960er-Jahren haben zunächst zu einer erneuten Blüte der Chinesischen Medizin geführt. Im Vergleich zu den Phasen des Niedergangs im 19. Jahrhundert ist dies als deutlicher Fortschritt zu bewerten.
Die World Health Organization (WHO) erkannte zu dieser Zeit, dass sie die Versorgung der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln und modernen Medikamenten auf absehbare Zeit nicht gewährleisten kann. Aus diesem Grund riet sie den Entwicklungsländern, die „autochthonen“ Behandlungsverfahren zu stützen und zu stärken. In diesem Zusammenhang entstand der Begriff der TCM, der Traditionellen Chinesischen Medizin. Dieser Begriff bezeichnet also die Neufassung der Chinesischen Medizin aus den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Unter den damaligen Umständen wurden, neben der Neuedition der Klassiker, einige grundlegende Bücher geschaffen. Diese sollten im Sinne einer Kompilation noch vorhandenen Wissens eine praxisbezogene Version zur schnellen Verbreitung gesundheitsdienstlicher Maßnahmen im Entwicklungsland China ermöglichen. Entsprechend dem Kenntnisstand der damaligen Zeit und den wenigen kooperationswilligen Ärzten der alten Schule entstand eine bis heute verbreitete Version der klassischen Chinesischen Medizin.
Beim Betrachten der Entwicklung der Chinesischen Medizin ergeben sich bestimmte historische und wissenschaftliche Glanzpunkte der Medizintheorie und Medizinliteratur. Es ist offensichtlich, dass in einem so großen Bevölkerungs- und vor allem Zeitraum neben grundlegend gültigen und bis heute bewährten Klassikern auch volkstümliche, regionale und sogar unfügliche Literatur zu finden sein wird.
Auch in der westlichen Medizinliteratur findet sich neben grundlegenden Schriften eine Fülle von Gelegenheitspublikationen, Irrtümern und durch subjektive Glaubenssätze geprägten Schriften. Im Vergleich dazu zeichnet sich das Schriftgut der Chinesischen Medizin, das beinahe kontinuierlich über mindestens 2300 Jahre gesammelt wurde, als geradezu vorbildlich aus. Verlautbarungen, dass der Kern der Chinesischen Medizin aus einer Art Ahnenkult und Hexerei ohne wissenschaftlichen Wert bestünde, beruhen gelegentlich auf dem Eindruck dieser klassischen Medizin zum Anfang des 20. Jahrhunderts oder resultieren aus der willkürlichen Auswahl missverständlicher und minderwertiger Texte. Wir verweisen an dieser Stelle solche Behauptungen in den Bereich der Fabel.
Zugegeben werden muss allerdings, dass das Bild der Chinesischen Medizin, das durch die gegenwärtige Qualität der „Exportversion TCM“ oder – schlimmer noch – durch die Akupunkturausbildung des Westens geprägt ist, den Ruf der Chinesischen Medizin nachhaltig zu schädigen in der Lage ist.
Die chinesische Kultur hat, weit früher als die europäische oder amerikanische, technologische, künstlerische und philosophische Höchstleistungen hervorgebracht. Beredte Beispiele hierzu liefern eine hochpotente Chemie, die Sprengstoff und Baumaterialien härter als Beton herstellen konnte, eine ausgeklügelte Architektur, die zur Errichtung weitgehend erdbebensicherer Bauten in der Lage war und mit der Chinesischen Mauer das bis heute größte Bauwerk der Welt hervorgebracht hat, sowie eine Mathematik und Astronomie, die zu genauesten Sternvorhersagen über Jahrhunderte in der Lage war.
Ist es überhaupt denkbar, dass ausgerechnet die Medizin – als die dem Menschen am nächsten stehende Wissenschaft – eine Art Schlusslicht der kulturellen und technischen Entwicklung darstellt?
Wäre diese Medizin wirklich so wirkungslos gewesen, wie manche Kritiker in teils unsachlicher Form beständig proklamieren, wie ließe sich dann die Tatsache erklären, dass über mindestens 100 Generationen (à etwa 25 Jahre) die Regeln dieser Medizin minutiös überliefert und unterrichtet wurden?
Insbesondere seit dem 19. Jahrhundert wurde diese Form der Überlieferung leider vernachlässigt. Zudem wurden viele Ärzte der Chinesischen Medizin wegen religiöser Überzeugungen oder aufgrund mangelnder Kooperationswilligkeit mit den Machthabern in Arbeitslager gesteckt, mundtot gemacht oder sie „verschwanden“ einfach.
Darüber hinaus existieren unterschiedliche Vorstellungen über Chinesische Medizin nebeneinander, die während verschiedener Epochen und Bedingungen entwickelt wurden. Aus diesem Grund kommt es zu einer scheinbaren Widersprüchlichkeit einzelner Begriffe, die sich jedoch durch Klärung des Kontexts und des technisch-praktischen Gebrauchs verhältnismäßig leicht aufklären lässt. Es ist sogar in hohem Maße erstaunlich, in welcher Präzision und Schlüssigkeit die diagnostischen und praktischen Begriffe ein in sich geschlossenes und zugleich sich dynamisch entwickelndes Ganzes bilden.
Definition
TCM – ein Kunstbegriff
Der Begriff der Traditionellen Chinesischen Medizin entstand in den 1960er-Jahren durch die WHO. Er bezeichnet eine zum damaligen Zeitpunkt pragmatisch ausgelegte Rekonstruktion der klassischen Chinesischen Medizin.
Aus praktischen Gründen verwenden wir hier den Begriff der TCM und der Chinesischen Medizin parallel, ohne damit die klassische wissenschaftliche Form der Chinesischen Medizin relativieren zu wollen.
1.7 Akupunktur im Westen: Kopie eines Notprogramms
Eine wesentliche Leistung der chinesischen Regierung der Nachkriegszeit bestand darin, die TCM in relativ kurzer Zeit für weite Teile der Bevölkerung verfügbar zu machen.
Hierzu gehörte auch das Senden von Arbeitern mit medizinischen Zusatzkenntnissen („Barfußärzte“) in die bedürftigen Gebiete. Deren Funktionen sind am ehesten mit den im Westen bekannten Gemeindeschwestern und -helfern vergleichbar. Unter den damaligen Bedingungen arbeiteten sie weitgehend selbstständig. Ihre Ausbildung erwarben sie zumeist in einem 100-Tage-Kurs, in dem die wichtigsten Akupunkturpunkte sowie eine einfache, weitgehend nach westlichen Diagnosen geordnete, symptomatische Akupunkturtherapie vermittelt wurden.
Als sich in den 1970er-Jahren China für den Westen vorsichtig zu öffnen begann, wurde durch Sensationsberichte in der Presse ein großes Interesse an Akupunktur im Westen geweckt. Man entdeckte dabei auch den wirtschaftlichen Wert des Exportartikels Akupunktur.
Die meisten der im Westen angebotenen Akupunkturausbildungsprogramme sind – in grosso modo – Kopien des Barfußdoktorprogramms, also Kopien eines Notprogramms für Gemeindehelfer der 1950er- und 1960er-Jahre im Entwicklungsland China.
So wie man sich in China von solchen Behandlungsmethoden wieder mehr und mehr distanziert und je nach Kenntnisstand eine Rückkehr zu den alten diagnostischen Grundsätzen anstrebt, so setzt sich im Westen nun auch die Erkenntnis durch, dass diese Form der Akupunktur verhältnismäßig oberflächlich und (wenn überhaupt) nur symptomatisch wirkt.
1.8 Rückkehr zur Überlieferung
Die bescheidene Wirkung der Rezept-Akupunktur veranlasste gerade in China viele Schulen, die Ausbildung wieder verstärkt nach den Regeln der TCM als nach westlichen Diagnosen auszurichten. Diese Regeln dienen dazu, etwa die Akupunkturtherapie dem funktionellen Status des Patienten anzupassen.
Akupunktur als Beispiel einer Therapiemethode der TCM ist eine Reflextherapie, die dann wirksam sein kann, wenn die reflektorische Ausgangslage (z.B. die laufende Nase bei Rhinitis) mit dem Wirkprofil eines Akupunkturpunkts übereinstimmt (z.B. Sekretion mindernd).
Die westliche Diagnose Rhinitis kann aber sowohl unter dem Bild einer laufenden Nase auftreten als auch unter dem Bild einer trockenen („Stockschnupfen“). Eine Akupunktur der trockenen Nase mit einem oben skizzierten Akupunkturpunkt muss deshalb klinisch scheitern.
Die Diagnose nach westlichen Gesichtspunkten alleine zu stellen würde bedeuten, diese reflektorische Ausgangslage und die präzise reflektorische Bedeutung des Akupunkturpunkts außer Acht zu lassen. Dies erklärt die häufige Beobachtung: „Mein Doktor hat mich von meinen Kopfschmerzen befreit, doch alle meine Freunde, die ich zu ihm geschickt habe, hatten nicht so viel Glück. War das jetzt ein Plazeboeffekt?“
In solchen Fällen wird von „Respondern“ und „Non-Respondern“ gesprochen. Zutreffender wäre es jedoch, von Patienten mit richtiger bzw. falscher Diagnose zu sprechen. Die Akupunktur wirkt nur dann (und dann in hohem Umfang), wenn das zugrunde liegende vegetative Steuerungsmuster zu der durchgeführten Behandlung passt.
1.9 Phänomenologischer Ansatz: Therapie nach „Mustern“
Nachdem die anfängliche Euphorie über die Akupunkturbehandlung einer gewissen Ernüchterung gewichen ist, wurde nach den Gründen für die häufigen „Therapieversager“ gefragt.
Dabei kam von chinesischer Seite der Einwand, dass die TCM „patterns“ (Muster) kenne, die seit Jahrhunderten beschrieben worden seien und nach denen die Therapie auszurichten sei. Diese Muster werden in einer phänomenologischen Weise präsentiert, also weitgehend ohne eine Physiologie (Nomologie), die diese Muster erklären könnte.
Aus diesem Grund betrachten viele Ärzte Chinesische Medizin als ein Art „Quacksalberei“. Angeblich ordne sie mit unlogischen und scheinbar unerklärlichen phänomenologischen Begriffen empirisch gewonnene Muster in Gruppen, die offensichtlich keiner dem westlichen Menschen zugänglichen inneren Logik folgen.
Die Begriffe yin, yang und Wandlungsphasen werden dabei fälschlicherweise als rein „philosophische“ Begriffe aufgefasst und ihre Bedeutung als Termini technici für die Beschreibung regulativer Abläufe vernachlässigt.
So kommt es bei der die Chinesische Medizin betrachtenden Ärzteschaft zu einer Spaltung der Wahrnehmung: Einerseits beobachtet man die teils spektakulären Heilerfolge der Chinesischen Medizin, andererseits fällt ihre anscheinend inkohärente Theoriebildung auf.
Das Problem zur Entschlüsselung dieser Theorie ist zunächst einmal ein sprachliches. Die Terminologie bestimmt, wie stets im Denken, dabei weitgehend das Verständnis und die innere Logik des Betrachters.
Daher ist es besonders notwendig, auf die tatsächlichen begrifflichen Bedeutungen und damit auf die Kohärenz des chinesischen Heilsystems zurückzukommen.
Merke
Der phänomenologische Ansatz, die Syndrome symptomatisch, aber ohne Physiologie zu ordnen, genügt keinem wissenschaftlichen Anspruch. Dennoch ist er dem rein symptomatischen Ansatz der Barfußdoktorakupunktur überlegen.
1.10 Wissenschaftlicher Ansatz: Therapie auf Grundlage der regulativen Physiologiemodelle der Chinesischen Medizin
Um sich der Chinesischen Medizin in angemessener Weise zu nähern, müssen zunächst die Grundbegriffe des Systems als Termini technici verstanden werden. Hierzu gehören zuallererst yin, yang und die Wandlungsphasen, sodann die daraus abzuleitenden Funktionskreise (FK, orbes) und die Leitkriterien.
Die in diesem Buch verwendeten deutschen und latinisierten Begriffe entsprechen im Wesentlichen der stringenten Übersetzung Porkerts ▶ [35]. Die starke wissenschaftliche Auslegung dieser Begrifflichkeiten gab hierzu den Ausschlag.
Es gibt Schulen für Chinesische Medizin, die ausschließlich chinesische Begriffe verwenden. Dabei bleibt der tatsächliche Sinngehalt dieser Begriffe jedoch meist im Verborgenen, da die chinesische Sprache, noch viel weitgehender als europäische Sprachen, assoziative Ketten im Bewusstsein des Begriffbenutzers voraussetzt, die in der einfachen – dazu meist noch falsch ausgesprochenen – Verwendung rein chinesischer Begriffe nicht zu erreichen sind.
Bei dem Begriff des wei qi etwa wird deutlich, dass eine einfache chinesische Diktion unverständlich bleibt. Wei qi bezeichnet einerseits das qi defensivum („Wehrenergie“, die vor Angriffen auf den Körper schützt), andererseits die Funktionskraft des Ausgleichens, die vom „Magen“-FK herrührt, also das qi stomachi („Magenfunktionskraft“). Dieses Wort unterscheidet sich in der chinesischen Originalsprache durch die melodische Aussprache nach den 4 Tönen und durch das verwendete Schriftzeichen.
Es ist also praktisch unmöglich, chinesische Begriffe zur Beschreibung der physiologischen Verhältnisse zu verwenden.
Zusatzinformation
Da die Terminologie ganz wesentlich das Verständnis der Sachverhalte bestimmt, bieten wir unter www.dgtcm.de ein Glossar, das in einfachen – nach Möglichkeit auswendig zu lernenden Definitionen – ermöglicht, das Sinngeflecht der chinesischen Termini weitgehend zu erfassen.
Anders als beim phänomenologischen Ansatz wird die Ansicht vertreten, dass die Chinesische Medizin eben keine Phänomenologie (keine Empirie) darstellt, sondern eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft unterscheidet sich von einer empirischen Anhäufung von Phänomenen durch eine einfache Eigenschaft:
Wissenschaft ist das systematische Neuerwerben von Erkenntnis.
Empirie hingegen ist das Sammeln von Erfahrung ohne gegebene innere Systematik.
Insofern vertreten wir die These, dass die Chinesische Medizin eine wissenschaftliche Physiologie besitzt. Auch wäre es unwahrscheinlich, spektakuläre Heilerfolge, wie sie die Chinesische Medizin vorweist, ohne wissenschaftliches Fundament zu erzielen.
Dabei spielt es eine besondere Rolle, dass die sog. 8 Leitkriterien der Chinesischen Medizin, die das zurzeit umfassendste Modell der funktionellen Gesamtaufnahme des Patienten bilden, auf 4 physiologischen Theorien beruhen. Diese werden quasi als 4 unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven miteinander verwoben. Diese 4 physiologischen Theorien werden wir im Einzelnen vorstellen und durch ihre Begrifflichkeiten voneinander absetzen. Danach versuchen wir, die Theorien als hierarchisch geordnete, wissenschaftliche Netzwerktheorie transparent zu machen.
Nur wer die „Muster“ auch begründen kann, wird sie erkennen und als Diagnose sinnvoll einsetzen. So wird schließlich auch die Hierarchisierung der Symptome im System der Chinesischen Medizin schlüssig und verständlich.
Merke
Der Prozess der Diagnosefindung ist das zentrale Problem der Chinesischen Medizin. Die funktionelle Diagnose, die die Chinesische Medizin erstellen kann, erfordert grundlegende und sichere Kenntnisse der Physiologie sowie der abzustufenden Begriffe und Phänomene.
Die „International Scientific Chinese Medicine Association“ hat daher ein Postgraduiertenprogramm von 5-jähriger Dauer für Chinesische Medizin eingeführt, das nach einem Credit-Point-System international austauschbar wird. An diesem internationalen Ausbildungssystem sind verschiedene Universitäten des In- und Auslands beteiligt. Adressen, bei denen Sie dazu nähere Informationen erhalten können, finden Sie im Anhang des Buches (s. Kap. ▶ 31). Das Credit-Point-System stützt sich inhaltlich ganz wesentlich auf das „Heidelberg Model of Chinese Medicine“, wie es auf dem 4. Weltakupunkturkongress im Jahre 2000 vorgestellt wurde.
1.11 Jede Diagnose ist eine Therapieanweisung
So wie in der westlichen Medizin etwa die Diagnose Herzinfarkt einen präzisen Ablauf von diagnostischen und therapeutischen Folgeschritten benötigt, beinhaltet auch eine chinesische Diagnose eine klare Therapieanweisung, die präzise auf die durch die Diagnose beschriebene Ausgangssituation zugeschnitten ist.
Die wissenschaftlich fundierte Chinesische Medizin setzt also die Physiologie der wesentlichen Äußerungsformen menschlicher Funktionen voraus sowie umfassende Kenntnisse der therapeutischen Möglichkeiten.
Merke
Im Rahmen eines Kursbuchs lassen sich nur die Grundlagen dieser Physiologie sowie die grundlegenden Therapieformen beispielhaft darstellen.
Mithilfe dieses Kursbuchs und des praktischen Unterrichts in der Diagnosestellung, der bei erfahrenen Kollegen in der Praxis erlebt werden muss, müsste es Ihnen als Leser allerdings möglich sein, die geeigneten Therapeutika in der Literatur zu finden, s. Kap. ▶ 30. Credo: keine Therapie ohne wissenschaftliche Diagnose (salopp formuliert: „Mit der Diagnose wissen Sie, wo Sie nachschlagen müssen“).
Merke
Fünf Thesen, die dieses Buch vertritt
Die TCM beruht auf einem präzisen und nachvollziehbaren System zur Beschreibung vegetativer Funktionen.
Jede Therapie durch Akupunktur, Phytotherapie, Tuina etc. benötigt eine korrekte Diagnose als Beschreibung der vegetativen Ausgangslage. Ohne eine solche Diagnose ist die Wirksamkeit der Therapie nicht vorhersagbar.
Die Therapie ausschließlich nach westlichen Krankheitsbildern zu ermitteln, kommt einer Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht gefährlich nahe.
Die kritiklose Übernahme von Akupunkturrezepten aus dem Barfußärzteprogramm Chinas entspricht nicht dem heutigen Kenntnisstand.
Die Chinesische Medizin ist wirksam, nebenwirkungsarm und in hervorragender Weise geeignet, die Mehrzahl der Beschwerden unserer Patienten zu lindern oder zu heilen.
2 Warum westliche Mediziner die TCM verstehen sollten: die Grenzen des Messbarkeitsdogmas
Die Bedeutung dieses Kapitels für das Verständnis der Chinesischen Medizin
In der Medizin bedeutet eine Messung die Quantifizierung eines biologischen Vorgangs in Form eines Punktes auf einer Vergleichsskala. Messungen sind in der westlichen naturwissenschaftlichen Medizin ein absolutes Muss.
Andererseits sind der Darstellung biologischer Vorgänge durch Messungen enge Grenzen gesetzt. Diese Grenzen liegen nicht nur in der technischen Durchführung begründet, sondern in der Natur einer Messung überhaupt.
Die Brisanz dieser These ergibt sich dadurch, dass nach einschlägigen westlichen Studien die Mehrheit der Patienten in der allgemeinmedizinischen Praxis kein messbares Korrelat ihrer Beschwerden zu haben scheint.
2.1 Naturwissenschaftliche Medizin: eine Erfolgsstory
Warum hat die Chinesische Medizin einen so großen Wert für den Westen? Um eine Antwort auf diese Frage zu geben, muss man sich den Wert der funktionellen chinesischen Diagnose vor Augen führen.
Die Chinesische Medizin kann Funktionen beschreiben, ohne dass durch Messungen im klassischen Sinne die funktionelle Ausgangslage des Körpers verändert wird. Dabei kann sie präzise Vorhersagen über den weiteren Krankheitsverlauf und das Befinden der Patienten treffen, die zu einer Heilung zahlreicher, als problematisch eingestufter Krankheitsbilder führen können.
Die besondere Verfahrensweise der Chinesischen Medizin unterscheidet sich dabei grundlegend von der westlichen Heilkunst, die als analytisch deduktiv beschrieben wird. Damit soll ausgedrückt werden, dass Auflösen in die Bestandteile (ana-lyse) und daraus resultierende Schlussfolgerungen deduktiv das medizinische Denken bestimmen. Im Gegensatz hierzu wird die Chinesische Medizinweise induktiv synthetisch genannt. Damit wird ausgedrückt, dass man zusammenfügend (syn-thetisch) alle sich gegenseitig induzierenden Wirkungen im Ganzen erfasst. Solche Balancemodelle bestimmter Teile des funktionellen Apparates finden sich nicht nur in der Chinesischen Medizin, sondern im Prinzip auch in der alten griechischen Medizin (s.a. „Deutsche Predigten zur Chinesischen Medizin“, Phainon ▶ [44]). Dabei werden die sich die gegenseitig induzierenden Wirkungen zu einem funktionellen Abbild der Person integriert, wobei wir die im Einzelnen hierzu verwendeten klinischen Zeichen in der westlichen Medizin gelegentlich für nicht maßgeblich erachten.
Es handelt sich hierbei um subjektive Befindlichkeiten und scheinbare Nebensächlichkeiten aus dem Bereich der vegetativen Funktionen. Bevor wir uns diesen Phänomenen aus chinesischer Sicht widmen, wollen wir uns damit befassen, wie die westliche Medizin diese Phänomene traditionell beurteilt:
Mit den Fortschritten der Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert veränderte sich die Qualität der Medizin in den westlichen Ländern grundlegend.
An die Stelle einer teils noch von griechischer „Elementenlehre“ geprägten Medizin – ergänzt durch teils beachtliche Kompilationen empirischer Pflanzenwirkungen – traten allmählich die auf breiter Basis verfügbar gewordenen anatomischen Darstellungen. Mit den Strömungen der Aufklärung und des Rationalismus gewann die Naturwissenschaft einen zusehends stärkeren Einfluss auf die Ausübung der Heilkunst.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich zunehmend das Paradigma der Organpathologie. Hierbei war die Messbarkeit vormals nicht zu beschreibender körperlicher Gegebenheiten, etwa des Blutfarbstoffs, der Organgrößen, der zellulären mikroskopischen Veränderungen, aber auch die im Zuge einer sich weiter entwickelnden Mikrobiologie feststellbaren Krankheitserreger von wachsender Bedeutung. Aus dem Erfolg der naturwissenschaftlichen Medizin entwickelte sich zunehmend das Paradigma der Messbarkeit als Grundlage einer rationalen Therapie.
Dennoch haben sich naturgemäß dort noch Reminiszenzen alter Medizintraditionen erhalten, wo Persönlichkeitstypen und ihre Handlungs- und Reaktionsmuster beurteilt werden müssen. Hier zeigt sich die Messung (Psychometrie) einzelner Eigenschaften (Items) aus Gründen der Komplexität des Gegenstands als ungenügend. Beispiele hierfür sind etwa:
Das Eysenck-Persönlichkeitsmodell, ein Rest der griechischen „Elementenlehre“, hat sich bspw. bis in unsere Zeit erhalten und stellt noch heute eines der bestvalidierten Persönlichkeitsmodelle dar ( ▶ Abb. 10.4).
In der anthroposophischen Medizin spielt die Temperamentenlehre Steiners, ein Derivat der griechischen „Elementenlehre“, eine nicht zu unterschätzende Rolle.
In beiden Fällen wird hier, auf einer langen Tradition aufbauend, versucht, „nicht messbare“, d.h. in einem naturwissenschaftlichen Sinne nicht darstellbare Größen zu beschreiben: nämlich die konstitutionsbedingte Veranlagung eines Individuums zu spezifischen Reaktionen. Dabei blieben, was das Eysenck-Modell anbelangt, körperbauliche Eigenheiten im Weiteren völlig unberührt. Die in der sokratischen Theorie miteinander verbundenen somatopsychischen Phänomene wurden mehr oder weniger abgetrennt, die psychischen weiterhin mit den traditionellen „Elementen“ beschrieben.
Diese Modelle weisen Überschneidungen mit klassischen chinesischen Vorstellungen auf.
2.2 Westlich-naturwissenschaftliche Medizin basiert auf Messbarkeit
Als Folge des Einzugs der Naturwissenschaften in die westliche Medizinlehre ergab sich zunehmend das Bedürfnis, krankhafte Zustände durch Messungen zu objektivieren. Als banale Tatsache kann man heute davon ausgehen, dass das cgs-System (cm, g, s) mit den daraus abgeleiteten Einheiten (cm3, g/cm3 etc.) sowohl bei der laborchemisch als auch morphologisch begründeten Diagnosestellung der westlichen Medizin eine besondere Rolle spielt.
Gerade auch Kostenträger im Gesundheitswesen verlangen vor Kostenübernahme einer Therapie zunehmend eine durch Messungen objektivierte Diagnosestellung. Dabei sind wir in Gefahr, uns durch die Bemühung um eine „evidence-based medicine“ an den subjektiven Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeizutherapieren.
Betrachtet man das Problem der Messbarkeit genauer, muss man sich zum einen der Komplexität des biologischen Netzwerks bewusster werden, welches der Mensch darstellt, und sich zum anderen genauer mit der „Natur einer Messung“ befassen.
Definition
Eine Messung ist definiert als das Bestimmen eines Punktes auf einer vorgegebenen Skala absoluter Werte.
Ein Beispiel hierfür ist die Definition des Meters oder des Kilogramms durch Definition eines Urmeters oder eines Urkilogramms, wie es bis zum heutigen Tag in Paris liegt. Auf Skalen kann man das Mehrfache dieser Urmessgröße auftragen und erhält auf diese Weise die Möglichkeit, einen Gegenstand als Punkt dieser Gerade zu beschrieben. So betrachtet, wäre 1,75 m etwa der 175. Punkt auf einem Zollstock mit Zentimetereinteilung.
Wir werden später genauer sehen, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen westlicher und „chinesischer“ Naturwissenschaft darin besteht, dass die Chinesische Medizin die „Verlaufsrichtung“ oder die Direktionalität eines Prozesses (also den „Vektor“ oder die Steigung in einem Punkt) bestimmt, während die westliche Medizin eher Punkte auf einer Vergleichsskala benennt.
2.3 Die nicht messbare Krankheitsursache: eine Realität
Die Bedeutung solcher Messungen im technisch-naturwissenschaftlichen Sinne ist unbestritten und selbstverständlich sind sie auch medizinisch bedeutsam. Es wäre daher wünschenswert, alle Diagnosen durch Messungen zu objektivieren. Nach einer Reihe verschiedener Statistiken und Studien gelingt dies jedoch in einer Allgemeinarztpraxis in einer Größenordnung von über 90% nicht. Mit anderen Worten: 90% der Patienten, die eine allgemeinärztliche Praxis aufsuchen, zeigen kein messbares Korrelat ihrer Beschwerden!
Man mag unterstellen, dass in einer Praxis nicht ständig alle diagnostischen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden. Möglicherweise würde der geringe Anteil an organisch messbaren Diagnosen also auf dem schwachen Standard der Diagnostik beruhen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Krankengut in den Praxen der Niedergelassenen und das Krankengut im Krankenhaus kaum vergleichbar sind. Im Krankenhaus kommt eine Präselektion zum Tragen, da nur diejenigen Erkrankten, deren Befunde eine Gefährdung des Patienten erwarten lassen, durch das Raster der Niedergelassenen an das Krankenhaus verwiesen werden.
Die in ▶ Abb. 2.1 dargestellte Studie ▶ [15] untersucht die häufigsten Symptome ambulanter Patienten über einen Zeitraum von 3 Jahren.
Anteil organischer Krankheitsursachen.
Abb. 2.1 Drei-Jahres-Prävalenz (in Prozent) 10 häufiger Symptome und Anteil wahrscheinlicher organischer Ursachen (grünes Raster) bei 1000 Patienten einer amerikanischen Klinik ( ▶ [15], ▶ [25]).
Dargestellt ist die Drei-Jahres-Prävalenz 10 häufiger Symptome sowie der Anteil der wahrscheinlichen organischen Ursachen bei 1000 Patienten. Diese Symptome sind: Thoraxschmerz, Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerz, Ödeme, Rückenschmerz, Dyspnö, Schlaflosigkeit, Bauchschmerz und Taubheitsgefühl.
Wie die Abbildung verdeutlicht, ist der Anteil wahrscheinlicher organischer Ursachen erschreckend niedrig. Man könnte aus diesen und vergleichbaren Daten folgern, dass unsere medizinische Wissenschaft und Versorgung dahingehend radikal zu ändern sei, mehr Aufwand für Erforschung und Therapie der nicht oder nicht ausschließlich organisch (messbar) verursachten Symptome zu betreiben.
In der Studie wurde, von der klinischen Symptomatik ausgehend, die organische Ursache untersucht. Zumindest theoretisch wäre folgende Annahme denkbar: Die Patienten des untersuchten Krankenguts erleben durch die bevorzugte Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale – einmal sensibilisert – ihre Symptomatik verstärkt, sodass die Studie mehr über das „pathologische Erleben“ der Patienten eine Aussage trifft als über die Objektivierbarkeit von Krankheitsursachen.
Aus diesem Grund kann man in der Herangehensweise auch umgekehrt verfahren und symptomlose Probanden untersuchen: In verschiedenen Studien ▶ [11], ▶ [48], ▶ [27] wurde der Rücken asymptomatischer Personen mit den besten zur Verfügung stehenden bildgebenden Verfahren (Computertomografie (CT), Kernspintomografie (NMR)) untersucht. Dabei haben ⅓ der jüngeren Probanden und über die Hälfte der Probanden über 60 Jahre eindeutig pathologische Befunde an der Wirbelsäule, meist im Sinne eines Bandscheibenvorfalls.
Diese Quote ist auch bei symptomatischen Patienten kaum höher.
Merke
Die Mehrheit der Patienten mit häufigen körperlichen Beschwerden hat keinen körperlich objektivierbaren (messbaren) Befund, der diese Beschwerden ausreichend erklären könnte.
Auch Patienten mit eindeutig pathologischem organischem Befund haben in bedeutendem Umfang hingegen keine klinische Symptomatik als Folge dieses Befunds.
Im Bereich der Lumbago (Kreuzschmerz) erklären die „organischen Befunde“ die Mehrheit der Fälle dieser Volkskrankheit nicht. Interessanterweise gibt es in diesem Bereich eine neue Diagnose, das „failed back surgery syndrome“, das die Folgen operativer Eingriffe bei dieser Erkrankung beschreibt.
Diese Zahlen zeigen, wie vergleichsweise hilflos die Medizin diesem Problem gegenübersteht:
„In vielen Fällen schadet die moderne Medizin dem Patienten, was nicht der Wahrheit widerspricht, dass sie ihm in vielen Fällen nützt.“ ▶ [25]
2.4 Wie soll der Arzt mit dieser Situation umgehen?
Es haben sich nun verschiedene Strategien etabliert, mit diesem Problem umzugehen.
2.4.1 „Alle zum Therapeuten“
Eine seit den 1970er-Jahren zunehmende Tendenz „die Seele zurück in die Medizin zu bringen“, führte unter aufgeklärten Ärzten zu einer Aufwertung psychotherapeutischer Maßnahmen und in der Folge auch zu einer Höherbewertung der psychosomatischen Grundversorgung in der hausärztlichen Praxis.
Ausgehend von den bereits zitierten durchaus realistischen Zahlen verbleiben 90% der allgemeinmedizinischen Patienten ohne eine gesicherte organische Diagnose. Demnach stellen 90% psychischer und psychosozialer Krankheitsbedingungen, die hieraus abgeleitet und gefolgert wurden, die „Restkategorie“ dar, was eine Herausforderung an das Selbstverständnis der Medizin bedeutet.
Viele Patienten empfinden es geradezu als Zumutung, wenn ihre Symptomatik vorwiegend unter psychopathologischen Gesichtspunkten erörtert wird. Abgesehen von den ungeheuren Kosten, die eine psychosomatische Grundversorgung in einem solchen Umfang verursachen würde, ließe sich bezweifeln, ob für eine solche Vorgehensweise bei den Patienten überhaupt eine Compliance erkennbar wäre.