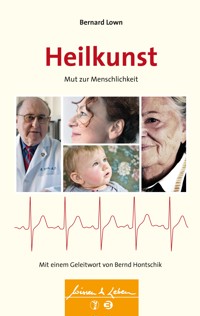
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wissen & Leben
- Sprache: Deutsch
Der Friedensnobelpreisträger Bernard Lown ist einer der bedeutendsten Ärzte unserer Zeit. Sein Bestseller "Die verlorene Kunst des Heilens – Anstiftung zum Umdenken" hat Ärzte weltweit zu mehr Menschlichkeit im Umgang mit ihren Patienten ermutigt. Nun geht seine Kampagne für eine Medizin mit menschlichem Gesicht weiter. Der "begnadete Erzähler" (FAZ) öffnet mit einer Fülle von Impressionen und Reflexionen aus seiner bewegten Laufbahn den Blick auf eine Heilkunst, die diesen Namen verdient und nicht zu einer technischen Reparaturwerkstatt verkommen soll: Er beleuchtet die unermessliche Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung – die "Droge Arzt" als bestes Heilmittel der Welt – und zeigt, wie man die Zeit mit dem Patienten nutzbringender verwendet, als gleich mit Apparate-Tests zu beginnen. Im Dialog mit seiner Enkelin Melanie stellt er sich auch den Fragen der jüngeren Patienten- und Ärztegeneration: - Ist es bei den heutigen technologischen Errungenschaften überhaupt noch nötig, einen Patienten in der Untersuchung zu berühren und ihn körperlich zu untersuchen? - Sind Hausbesuche überhaupt noch zeitgemäß? - Was unterscheidet den ärztlichen Alltag von einer Arztserie? - Kann jemand wie Lown tatsächlich die Krankheit eines Patienten erraten, indem er ihm die Hand schüttelt? Der Herzspezialist Lown als Erfinder des Defibrillators, der unendlich viele Menschenleben gerettet hat, ist nicht nur ein Meister der Heilkunst, sondern auch der Erzählkunst. Er lehrt, dass ein guter Arzt vor allem Mut braucht, um zu seinen Idealen zu stehen. Für menschliche Werte in der Medizin – um der schleichenden Erosion der Humanität entgegenzuwirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bernard Lown
Heilkunst
Mut zur Menschlichkeit
Deutsche Übersetzung von Helga Drews
Mit einem Geleitwort von Bernd Hontschik
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis:
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk mit allen seinen Teilen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert werden.
Autorisierte deutsche Ausgabe bestehend aus ausgewählten Teilen von Bernard Lowns Blogs http://bernardlown.wordpress.com/ und http://thelownconversation.com/
Authorized translation of the German language edition of selected parts of Bernard Lown’s blogs http://bernardlown.wordpress.com/ and http://thelownconversation.com/
Doctor both to patients and to the World; Medical technology – A deadly encounter; A Maverick’s Lonely Path in Cardiology; The Coronary Artery Entrapment; Thumpversion for the Tasered; Memories of Pain Beyond the Power of Healing; Black Blood Must Not Contaminate White Folks; Hard Wiring of Racism in the USA; A Chair to the Rescue; Salt: Culprit or the Stuff of Life?; Doctor as scientist, healer, magician, business entrepreneur, small shopkeeper, or assembly line worker – which is it?; The Doctor as a Placebo; “Widow-makers” and Other Unfortunate Things Doctors Say; When Words Can Be Lethal; The Roots of ‘Medical Bullying’; That ‘High’ Feeling Patients Get from Positive Doctors; Time Spent with Patients a Critical Factor in the National Health Crisis; A Patient’s Chief Complaint is Rarely the Problem; Why the House, M.D. Approach Only Works on TV; Our Tendency to ‘Medicine Shop’; Can a Handshake Reveal Health Problems?; “Oh doctor, one more thing ...”; Wives, Yes; Husbands, No; Power to the people: Patient in command; Doctors Don’t Listen; Reflections on a Half Century of Medical Practice: The art of listening to the elderly patient; Science, Technology and What Really Heals Patients; Medical Overtreatment is the Order of the Day; The Lost Touch; When a Touch is Worth a Thousand Tests; When the inventor is treated with his own invention; What Patients Really Want; Ivan Pavlov is alive and well, though forgotten; Sudden Cardiac Death: Resuscitation or Resurrection?; A Troubled Patient © 2014 by Bernard Lown
© 2015 by Schattauer GmbH, Hölderlinstraße 3, 70174 Stuttgart, Germany
E-Mail: [email protected]
Internet: www.schattauer.de
Übersetzung: Dr. Helga Drews
Projektleitung: Dr. Nadja Urbani
Umschlagabbildung: © Thomas K. – photocase.de; © a_sto – photocase.de; © van dalay – photocase.de; © Lown Institute
ISBN 978-3-7945-6947-2
Geleitwort
Bei manchen Namen habe ich mich schon gefragt, ob es einen Menschen dieses Namens wirklich gibt. Zu groß schienen mir das Werk und das Wirken für einen einzelnen Menschen. So ging es mir auch mit dem Namen Lown, bevor ich den wirklichen Menschen kennengelernt habe, der den Namen Bernard Lown trägt.
Wenn man in der Medizin tätig ist, muss man nicht unbedingt Kardiologe sein, um den Namen Lown schon einmal gehört zu haben. Die Einteilung der Herzrhythmusstörungen ,nach Lown‘ gehört zum Grundwissen, zu den sogenannten ,Basics‘ für jeden Medizinstudenten, für jeden Arzt. Als Student habe ich diese Einteilung zur Kenntnis genommen und mir bei dem Namen nichts weiter gedacht. Später habe ich überrascht festgestellt, dass es sich um denselben Bernard Lown handelt, der für bahnbrechende Erfindungen auf dem Gebiet der Kardioversion und der Defibrillation bekannt geworden ist, der sogar zu den Erfindern des Defibrillators gehört, wie er heute in jeder Bahnhofshalle, in jedem Notfallkoffer zu finden ist.
Wenn man dazu noch politisch interessiert ist, begegnet man dem Namen Lown schon wieder. Ist das wirklich derselbe Mann mit diesem Namen, der gemeinsam mit dem russischen Arzt Chasow 1985 den Friedensnobelpreis erhalten hat für den Kampf der von ihm mitgegründeten IPPNW gegen den Wahnsinn der weltweiten atomaren Aufrüstung? Ja, das ist derselbe Mann. Ist das derselbe, der mit Reagan, Gorbatschow und den Mächtigen dieser Welt gestritten hat, auf den sie sogar gehört haben bei den kleinen, mühsamen Schritten zu diesen und jenen Abrüstungsverträgen? Ja, das ist derselbe Mann.
Der inzwischen über neunzigjährige Bernard Lown hat schon einmal ein Buch mit einem denkwürdigen Titel geschrieben: „Die verlorene Kunst des Heilens“. Vielfach übersetzt und weltweit diskutiert hilft dieses Buch bis heute vielen Ärztinnen und Ärzten, nicht an den politischen und ökonomischen Zerstörungsattacken gegen die Humanmedizin zu verzweifeln, sondern für eine menschliche, nicht-industrialisierte Medizin zu kämpfen.
Mit dem lapidaren Titel „Heilkunst“ legt nun erneut der Schattauer Verlag den Folgeband zur „Verlorenen Kunst des Heilens“ vor. Es handelt sich um über fünf Jahre im Internet veröffentlichte Essays zu quasi allen wichtigen Fragen zwischen Gesundheit und Krankheit, und sozusagen als Sahnehäubchen um einen Online-Blog mit seiner Enkelin Melanie. Das sind nicht die üblichen Erinnerungen eines großen Arztes. Nein, das ist viel mehr. Mit dem Furor eines Mahners und Anwalts der Menschlichkeit geißelte er schon in der „Verlorenen Kunst des Heilens“ die Zerstörung der ärztlichen Tätigkeit durch die Industrialisierung des Gesundheitswesens: „Ein profitorientiertes Gesundheitswesen ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. In dem Augenblick, in dem Fürsorge dem Profit dient, hat sie die wahre Fürsorge verloren.“ Und so ist auch dieses Buch voller Verknüpfungen zwischen menschlichen Schicksalen und ärztlichem Tun, voller Verbindungen zwischen ärztlichem Denken und politischem Handeln, voller Weisheiten über das Schicksal von Menschen und über das Schicksal der Menschheit.
Lown ist ein berühmter Arzt. Lown ist ein begeisterter Wissenschaftler. Lown ist politisch, weil er von ganzem Herzen Arzt ist. Und: Lown ist ein begnadeter Erzähler. Diese Kombination ist etwas ganz besonders Wertvolles. Mögen Zitate aus diesem Buch in jedem Arztzimmer, in jedem Wartezimmer, auf jedem Krankenhausflur ausgehängt werden.
Frankfurt am Main, im Juli 2015Bernd Hontschik
Vorwort
Die Krise im Gesundheitswesen ist ein weltweites Problem, sie hat auch vor Deutschland nicht haltgemacht. Zwei unterschiedliche Kräfte halten die Medizin im Würgegriff: der Einfluss von Wissenschaft und Technologie und die Dominanz der Märkte. Erstgenannte Macht resultiert aus der allgemein verbreiteten Illusion, dass Ärzte in erster Linie Wissenschaftler seien mit einem naiven Glauben an die Magie der Technologie. Den zweiten Einfluss – und das ist weitaus gefährlicher – nehmen die Märkte. Sie agieren so, als wenn es sich bei der Medizin um ein Unternehmen handele.
Die Gesundheitsfürsorge ist zu einer riesigen Industrie geworden, ein auf die Kliniken zentriertes Krankheitssystem, das weitgehend von finanziellen Anreizen bestimmt wird. Wie bei jedem Unternehmen ist die Profitabilität ein wesentlicher Faktor. Medikamente werden angepriesen, komplexe Prozeduren gefördert und Patienten werden zu ärztlichen Eingriffen animiert.
Rund um die Uhr bombardieren Nachrichten eine leichtgläubige Öffentlichkeit mit Gesundheits„informationen“. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht bahnbrechende Erkenntnisse oder neu identifizierte Gefährdungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden triumphierend verkündet werden. Eine ganze Gesellschaft wird medikalisiert – Jung und Alt thematisieren wie in einer Dauerschleife ihre Leiden.
Hausärzte sind eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Spezialisten beherrschen auch den letzten Winkel des Gesundheitswesens. Diese Verlagerung betrifft Ansehen, Einkommen und Arbeitsbedingungen, der Hausarzt ist mittlerweile der Proletarier unter den im Gesundheitswesen Tätigen. Er muss viele Stunden arbeiten, erhält einen nur geringen Lohn, seine Zeit für die Patienten ist kurz bemessen und seine Eigenverantwortung bei Entscheidungen ist verlorengegangen.
In diesem technologischen Zeitalter stehen die Patienten nicht länger im Mittelpunkt. Ärzte sind zu Lieferanten für anonyme „Kunden“ geworden, ihr Einkommen wird von der Zahl der durchgeführten Tests und Prozeduren bestimmt. Das Resultat ist vorhersagbar: Tests nehmen um ein Vielfaches zu, Medikamente werden im Übermaß verschrieben und unnötige technologische Interventionen in großer Zahl durchgeführt. Überbehandlung ist die Regel, eine Falschbehandlung viel zu oft das Ergebnis. Die Unzufriedenheit der Patienten wächst. Gleichzeitig erhalten viel zu viele Amerikaner eine unzureichende oder überhaupt keine ärztliche Behandlung.
Ich möchte kein Unruhestifter sein und zur Zerstörung von Maschinen aufrufen. Für viele Patienten ist das System lebensrettend und macht sogar Wunder möglich. Ich bewundere nicht nur die bemerkenswerten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, sondern habe selbst auch einen Teil dazu beigetragen. Wer könnte etwas gegen Herztransplantate haben, gegen Robotergliedmaßen, Hörimplantate, das Ausmerzen der Pocken und die Heilung zuvor unheilbarer Krankheiten? Die Liste der Fortschritte ist lang und anerkennenswert. Die Wissenschaft ist das Wunder der Moderne, die Technologie ihr verlängerter Arm.
Beunruhigend ist jedoch der Faust’sche Pakt, der sich im Dickicht des Establishments des Gesundheitswesens verbirgt. Wenn die Märkte die Medizin beherrschen, ist der Patient lediglich ein Produkt. Jahrtausendalte und geheiligte hippokratische Traditionen werden damit aufgegeben. Die Sorge um das Wohl der Patienten ist nicht länger das Hauptanliegen eines Arztes. Die kurze Zeit, die den Visiten zugebilligt wird, beeinträchtigt das Zuhören und konzentriert sich auf die im Vordergrund stehende Klage – ohne Berücksichtigung der psychosozialen Stressbelastungen, die für den Großteil der Probleme verantwortlich sind, die den Patienten in erster Linie zum Arzt führen.
Ganz offensichtlich existiert hier ein Paradoxon. Trotz enormer medizinischer Erfolge ist das Ansehen der Medizin niemals zuvor in diesem Jahrhundert beschädigter und ihr Ratschlag fragwürdiger, ja suspekter gewesen. In einer Zeit, in der Ärzte Außerordentliches für das Heilen von Krankheiten und das Verlängern von Leben anzubieten haben, ist die Öffentlichkeit dem ärztlichen Berufsstand gegenüber argwöhnischer, misstrauischer und geradezu feindselig geworden.
Die folgenden Betrachtungen, manche im Dialog mit meiner Enkelin Melanie, sollen aufrütteln und Diskussionen provozieren, die zu Veränderungen in der Gesundheitsfürsorge führen. Unser Anliegen ist es, eine breite Öffentlichkeit sowie den ärztlichen Berufsstand daran zu erinnern, dass die Medizin eine Berufung, nicht aber eine Geschäftsangelegenheit ist. Es war Rudolf Virchow, der unter den Giganten der Gesundheitsfürsorge des 19. Jahrhunderts die Ansicht vertrat, dass Ärzte die natürlichen Anwälte sowohl der Kranken als auch der Armen und Gebrechlichen seien.
Wieder einmal danke ich Dr. Helga Drews für ihre Übersetzung unseres komplexen englischen Textes in flüssiges Deutsch und dem Schattauer Verlag für die Vermittlung unserer Ansichten einer breiten deutschen Öffentlichkeit.
Boston, im Mai 2015Bernard Lown
Inhalt
MutHinsehen, Begreifen, Verändern
1 Arztsein sowohl für die Patienten als auch für die Welt
2 Medizinische Technologie – eine tödliche Begegnung
3 Der einsame Weg eines Außenseiters durch die Kardiologie
4 Wie von den Koronararterien Besitz ergriffen wurde
5 Thumpversion oder die Umkehr von Herzrhythmusstörungen durch einen Faustschlag
6 Erinnerungen an Schmerzen verheilen nicht
7 Schwarzes Blut darf weiße Menschen nicht kontaminieren
8 Rassismus und kein Ende
9 Ein Stuhl als Rettung
10 Salz: Verderbnis oder Lebenselixier?
11 Der Arzt als Wissenschaftler, Heiler, Zauberer, Unternehmer, Einzelhändler oder Fließbandarbeiter – Was trifft zu?
MenschlichkeitZuhören, Berühren, Heilen
12 Der Arzt als Placebo
13 „Witwen-Macher“ und andere unglückselige Dinge, die Ärzte sagen
14 Wenn Worte töten können
15 Die Wurzeln der „ärztlichen Schikane“
16 Wie ich unter Verdacht geriet, meinen Patienten Marihuana zu verabreichen
17 Zeit für den Patienten als kritischer Faktor in der Krise des nationalen Gesundheitssystems
18 Die Hauptklage ist nur selten das Problem
19 Weshalb die Zuwendung des Dr. House nur auf dem Bildschirm wirkt
20 Unser Drang zum „Medizinladen“
21 Kann ein Händedruck gesundheitliche Probleme enthüllen?
22 „Oh, Herr Doktor, nur noch eine Sache …“
23 Ehefrauen ja, Ehemänner nein
24 Power to the people: Der Patient führt das Kommando!
25 Ärzte hören nicht zu
26 Die Kunst, alten Patienten zuzuhören
27 Wissenschaft, Technologie und was Patienten wirklich heilt
28 Medizinische Überbehandlung als Normalfall
29 Die verlorene Berührung
30 Wenn eine Berührung tausend Tests wert ist
31 Wenn der Erfinder mit seiner eigenen Erfindung behandelt wird
32 Was Patienten wirklich wünschen
33 Iwan Pawlow ist lebendig und munter – jedoch vergessen
34 Plötzlicher Herztod: Wiederbelebung oder Auferstehung?
35 Eine verstörte Patientin
Mut
Hinsehen, Begreifen, Verändern
1 Arztsein sowohl für die Patienten als auch für die Welt
Einführungsvortrag University of New England College Osteopathic Medicine
Portland, Maine
Meine heutige Aufgabe ist einfach: Ihnen zu gratulieren und einen oder auch zwei Gedanken mit Ihnen zu teilen, Sie herauszufordern und Sie hoffentlich nicht mit hochtrabender Rhetorik und müden Plattitüden zu belasten. Derartige Reden sollten kurz und erhebend sein – und sofort vergessen werden. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass eine Rede nicht unendlich lang sein muss, um unsterblich zu werden.
Obgleich ich Sie im Einzelnen nicht kenne, weiß ich Sie in Ihrer Gesamtheit zu würdigen für Ihre unglaubliche jugendliche Spannkraft, Ihren gesunden Menschenverstand und die fein geschärfte Intelligenz.
Sie sind eine gesegnete Gruppe. In Zeiten, in denen sich Studenten nach dem Examen unsicheren und tristen Zukunftsaussichten gegenübersehen, sind Sie gefragt, werden gebraucht, werden angeheuert und werden sofort eine dauerhafte und produktive Nische in der amerikanischen Gesellschaft finden.
Sie treten jetzt in einen Beruf ein, der in seiner Tradition nobel, jedoch zutiefst belastet ist mit Problemen, wie die Gesellschaft sie hat, aus der diese Tradition stammt. Dass wir ein funktionsgestörtes Gesundheitssystem haben, ist heute allgemein bekannt. Gesundheit in unserem Land stellt einen dreisten Widerspruch dar. Obwohl wir riesige Summen investieren, ist ein Drittel der Bevölkerung finanziell nur unzureichend gegen unvorhergesehene Krankheiten geschützt. Die Zahl der Nicht-Versicherten hat 47 Millionen erreicht, und zusätzliche vierzig Millionen haben keinen angemessenen Versicherungsschutz. Mit der gegenwärtigen Rezession und Depression steigen diese Zahlen noch weiter an. Das Problem ist nicht durch unzureichende Finanzierung bedingt. Die jährlichen Ausgaben in den USA liegen heute bei etwa 2,5 Billionen Dollar oder bei 16% unseres Brutto-Inlandprodukts. Wir geben fast das Doppelte an Gesundheitskosten aus im Vergleich zu den anderen neunundzwanzig industrialisierten Ländern (OECD).
Man sollte erwarten, dass mit solch riesigen Ausgaben der Gesundheitszustand unserer Bevölkerung als der beste in der Welt eingeordnet würde. Tatsache ist jedoch, dass die entsprechenden Zahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika denen in anderen industrialisierten Ländern hinterherhinken bei solch soliden Parametern wie Lebenserwartung bei Männern und Frauen und einer Reihe anderer harter Fakten. Zwischen 1991 und 2000 kostete die Unfähigkeit, eine medizinische Standardversorgung für Afroamerikaner zu liefern, 886.000 Menschenleben. Laut der Weltgesundheitsorganisation liegen die USA unter 191 Ländern an peinlicher 37. Stelle der Gesundheitsbelange. Wir leiden an einer fragmentierten, bürokratisierten Anzahl von „Heimarbeitsindustrien“, die fälschlicherweise als Gesundheitssystem bezeichnet werden.
Außerordentlich verstörend ist der Verlust einer moralischen Orientierung. Statt von den Bedürfnissen eines Patienten gelenkt zu werden, wird die Medizin zunehmend von ökonomischen Grundsätzen gesteuert. Wie Dr. Marcia Angell, frühere Herausgeberin des „New England Journal of Medicine“, einmal schrieb: „Der Grund, weshalb sich unser Gesundheitssystem in derartigen Schwierigkeiten befindet, besteht darin, dass es dazu dient, Profit, nicht aber Gesundheitsfürsorge zu liefern.“
Ich gebe zu, dass ich von einer noch tiefer gehenden pathologischen Erscheinung beunruhigt bin, nämlich der kränkelnden Arzt-Patient-Beziehung, der Distanzierung des Arztes vom Patienten. Der Akzent verlagert sich vom Eingehen auf den Patienten in Richtung Zurückhaltung. Statt den Menschen als Ganzes zu betrachten, konzentrieren wir uns auf unsere Spezialgebiete, auf das in seiner Funktion gestörte Organ statt auf das leidende menschliche Wesen. Die einmalige Individualität eines Patienten verschwindet. Sie wird einem Körperteil untergeordnet.
Zunehmend haben wir es mit chronischen Krankheiten zu tun sowie mit den vielen Beschwerden, die das Altern begleiten. Lassen Sie mich das Offenkundige wiederholen: Für den Tod und das Altern gibt es keine Gesundung. Patienten sehnen sich jedoch danach, geheilt zu werden. Der Heilprozess steht über dem Verordnen von geeigneten Medikamenten und Prozeduren. Er verlangt die Mobilisierung positiver Erwartungen und die Stärkung des Vertrauens in die Hilfeleistung des Arztes innerhalb einer emotional unterstützenden Beziehung. Zahlreiche Studien belegen, dass Zuwendung und Fürsorge dem Patienten mehr bedeuten als alle Anerkennungsurkunden und Diplome eines Arztes.
Es wird berichtet, dass ein Engel enttäuscht von den himmlischen Freuden war. Er stieg zur Erde herab und eröffnete eine Arztpraxis. Der erste Patient klagte über den Sehverlust in einem Auge und über Lähmung einer Gliedmaße. Der Engel berührt ihn und sogleich sieht und läuft der Patient – eine wundersame Heilung. Beim Hinausgehen hört er den Geheilten vor sich hin murmeln: „Ein typischer Arzt, er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, eine Anamnese zu erheben.“
Um heilen zu können, muss man vor allen Dingen lernen, zuzuhören. Zuwendung wird ausschließlich durch Worte vermittelt. Das Gespräch kann ein Therapeutikum sein. Es ist eines der unterschätzten Werkzeuge in der Ausrüstung des Arztes. Das therapeutische Gespräch ist eine große Kunst. Es verscheucht Unsicherheit, dämpft Angst, erweckt Vertrauen, verstärkt die Fähigkeit auszuharren und begünstigt dadurch die Genesung.
Intellektuelle Anregung erhält der Arzt weitgehend vom Umgang mit Menschen, nicht mit der Pathologie. Er ist der Betrachter eines Panoramas des menschlichen Charakters, seiner Motive und Handlungen; es ist ein Wandteppich, dessen Gewebe mehr Reichtümer enthält als die Dramen von Shakespeare oder die Romane von Tolstoi.
Das zweite Motiv in dieser kleinen Predigt bezieht sich auf die soziale Verantwortung oder Tätigkeit jenseits des Krankenbettes. Ich glaube zutiefst daran, dass Ärzte sich sozial engagieren sollen, um Erfüllung zu finden und ihrer ärztlichen Mission nachzukommen.
50 Jahre zuvor habe ich eine überzeugende Lektion gelernt. Zu jener Zeit ermutigte die US-Regierung die Menschen, unterirdische Bunker zum Schutz gegen einen atomaren Angriff zu errichten. Obgleich diese Idee in höchstem Maße verrückt war, überschwemmte sie das Land. Eine kleine Gruppe von Ärzten fand sich in Boston als „Ärzte für Soziale Verantwortung“ (PSR oder „Physicians for Social Responsibility“) zusammen. In unserer Eigenschaft als Akademiker untersuchten wir die Auswirkungen eines Multi-Mega-Tonnen nuklearen Angriffs auf Boston. Resultat unserer Studie waren fünf Artikel, die im „New England Journal of Medicine“ publiziert wurden. Die Wirkung war enorm und nachhaltig. Wir wiesen überzeugend nach, dass unterirdische Bunker wahrscheinlich der schlimmste Aufenthaltsort im Falle eines nuklearen Angriffs waren. Es gab überhaupt keinen Platz, um sich zu verstecken. Unsere Publikationen beendeten das Errichten unterirdischer Schutzräume als ungeeignete Verteidigungsmaßnahme gegen einen nuklearen Angriff. Sie trugen auch dazu bei, atomare Tests in der Atmosphäre zu stoppen.
Als der Kalte Krieg in den späten 1970er-Jahren an Intensität zunahm, wandten wir uns an sowjetische Ärzte für die Schaffung der Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs“ (IPPNW), eine spektakuläre Organisation, die half, Millionen von Menschen auf die nukleare Bedrohung aufmerksam zu machen. Es gelang uns, bis in die höchsten Ränge der politischen Macht vorzudringen. Dass die Welt nicht von unmittelbarer Auslöschung bedroht ist, geht zu einem nicht geringen Teil auf unsere Anstrengungen zurück. Auch wenn das Damokles-Schwert noch nicht in die Scheide gesteckt wurde, so sitzt es doch wenigstens nicht länger an der Kehle der Menschheit. Ärzte haben geholfen, dies zu erreichen.
Ich habe gelernt, dass das soziale Gewissen kein Luxus nur für die Wohlmeinenden, sondern eine Notwendigkeit für uns alle ist, um human zu bleiben.
Eine letzte Vignette: Als ich in Sachen IPPNW kreuz und quer durch die Welt reiste, erfuhr ich, dass man zwar überall in der Welt Coca Cola kaufen, jedoch kein einwandfreies Trinkwasser bekommen kann. Verunreinigtes Wasser ist aber zu 80% die Ursache aller Erkrankungen weltweit. Während fast eine Milliarde Menschen unterernährt sind und von einem Dollar am Tag leben, wird eine Kuh in Japan in der Höhe von 7,50 Dollar subventioniert. In Afrika sterben täglich 1.200 Kinder an Masern, deren Verhütung nur ein paar Cent pro gerettetes Leben kosten würde. Solche Statistiken sind Tatsachen, die einen zum Weinen bringen.
Darüber hinaus habe ich gelernt, dass Angehörige des Gesundheitswesens in Entwicklungsländern weniger Wert auf unsere Technologien als vielmehr auf Verbindungen untereinander sowie mit der Welt legen. Im Jahr 1987 rief ich eine Gruppe namens SatelLife ins Leben, und kurz darauf schickten wir niedrig fliegende Satelliten ins All. Da diese um die Pole kreisten, berührten sie vier Mal am Tag jeden Punkt der Erde (häufiger als wir Post in Boston empfangen).
Wir waren die Ersten, die E-Mail in Afrika etablierten. Zu isolierten medizinischen Mitarbeitern stellten wir Verbindung her, den Bibliothekaren, die nach Informationen hungerten, lieferten wir relevante Zusammenfassungen aus den besten medizinischen Zeitschriften. Wir verliehen den Menschen, die bisher in Stillschweigen gelebt hatten, eine Stimme.
Mein Anliegen ist, Ihnen aufzuzeigen, dass Sie, wenn Sie das Unsichtbare sehen, das Unmögliche vollbringen können. Ich richte diese Worte vor allem deshalb an Sie, weil es meine Überzeugung ist, dass Sie einen Unterschied machen können. Um dem Leben einen Sinn zu geben, müssen Sie sich die Worte des afroamerikanischen Dichters Langston Hughes zu Herzen nehmen:
Halte an Träumen fest,
denn wenn Träume sterben,
ist das Leben gleich einem Vogel,
dem die Schwingen gebrochen sind
und der nicht fliegen kann.
Der schönste Traum beinhaltet, dass menschliche Wesen eines Tages den Namen „human“ verdienen. Deshalb dränge ich Sie, mit dem Vorwärtsstreben nicht aufzuhören. Ein Patient mit Schmerzen sehnt sich nach Ihrer heilenden Berührung. Eine verstörte Welt wartet auf Ihre verständnisvolle Umarmung.
2 Medizinische Technologie – eine tödliche Begegnung
Ich begegnete Ed K. erst, nachdem er gestorben war – seines Ablebens war ich mir jedenfalls sicher. Damit begann eine Erfahrung, deren Ende ebenso bizarr war wie ihr Anfang.
Ein langweiliger Winternachmittag zog sich endlos hin. Ich wertete Elektrokardiogramme für das Peter Bent Brigham Hospital aus, an dem ich in den frühen 1950er-Jahren als „Postdoc“ bei dem berühmten Kardiologen Dr. S. A. Levine tätig war. Das dreimonatige Training war die reinste Langeweile. Plötzlich stürzte eine atemlose, höchst aufgeregte Krankenschwester von der allgemeinen Männerstation, die auf der anderen Seite des Korridors lag, herein. Sie verkündete, dass Herr K. seinen „endgültigen Herzstillstand“ erlitten habe.
„Kommen Sie schnell“, drängte sie mich, „ich konnte keinen Pflichtassistenten finden.“
„Was soll das denn alles, und wer ist Herr K.?“, fragte ich, als wir zurück zu ihrer Station rasten. Aber sie war mit dringlicheren Dingen vollauf beschäftigt und sah keine Notwendigkeit, meine Neugier zu befriedigen.
Am Krankenbett angelangt, sah ich mich einem alten Mann gegenüber, der eindeutig tot war. Er atmete nicht, die Haut war marmoriert mit einer bläulichen Verfärbung, die Gliedmaßen waren schlaff, die Pupillen erweitert, Schaum tröpfelte aus seinem offenen Mund. Das Elektrokardiogramm lief und druckte Bündel von nutzlosem Konfetti aus, auf dem nichts als die gerade Linie eines stillgestandenen Herzens geschrieben stand. Herr K. war jenseits allen Lebens.
Wenn das stillstehende Herz eine gerade Linie statt unregelmäßiger Zacken im EKG zeigt, hat alle kardiale Aktivität aufgehört. Selbst in der heutigen Zeit, in der modernere Methoden zur Verfügung stehen, sind Wiederbelebungsversuche nach wie vor oft vergeblich. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sich das Ereignis, von dem ich berichte, in einer Zeit zugetragen hat, in der Kouwenhoven und seine Gruppe an der Johns Hopkins Medical School die Wirkung der äußeren Brustkompression, die sogenannte Herzmassage, noch nicht demonstriert hatten. Darüber hinaus besaß das Peter Bent Brigham Hospital noch keinen äußerlich anwendbaren Wechselstrom-Defibrillator, der gerade in Mode kam. Die Patienten starben vorzeitig, oft unnötigerweise und ohne großes Aufheben.
„Wie lange dauert sein Herzstillstand schon an?“, fragte ich die Krankenschwester, um herauszufinden, ob überhaupt etwas getan werden solle. Sie öffnete das EKG-Gerät, schaute auf die verbliebene Rolle des EKG-Papiers und verkündete, dass die finale Episode vor etwa viereinhalb Minuten eingetreten sei. Sie erklärte, dass, als sie gerade eine neue Rolle EKG-Papier eingesetzt hatte, Herr K. seinen vierten Herzstillstand an diesem Tag erlitten habe. Jeder vorangegangene Herzanfall habe nach weniger als dreißig Sekunden spontan geendet. Als dieser letzte nicht aufhörte, ließ sie den EKG-Streifen laufen und raste auf der Suche nach Hilfe los. Sie wusste, dass eine EKG-Rolle fünf Minuten lang aufzeichnen konnte – und etwa 90% davon waren bereits aufgebraucht. Dies war eine lange Zeit ohne einen Herzschlag. Schon ein fünfminütiger Herzstillstand kann ein in seinen Funktionen schwer geschädigtes Gehirn zurücklassen.
Als ich das EKG sorgfältig examinierte, bemerkte ich überrascht winzige, kaum wahrnehmbare Wellen, die in einem regelmäßigen Rhythmus von etwa 280-mal pro Minute hochschossen. Diese gingen von den oberen Herzkammern, den Vorhöfen, aus. Ärzte nennen diese Art von kardialem Mechanismus Vorhofflimmern. Im Allgemeinen reagieren die Ventrikel auf die Hälfte der ankommenden flatterigen Wellen. Bei Herrn K. waren die raschen elektrischen Impulse jedoch auf dem Weg zu den Herzkammern vollkommen blockiert.
Da Herr K. trotz seines hoffnungslosen klinischen Erscheinungsbilds noch immer ein Fünkchen Leben zeigte, war ich tollkühn genug, einem damals gängigen Ritual zu folgen, und injizierte Adrenalin direkt in sein Herz. Kaum hatte ich die lange Nadel durch die Brustwand gestochen und das Herz punktiert, als sich eine spontane ventrikuläre Kontraktion einstellte, die von weiteren regellosen Herzschlägen gefolgt war. Nach der Adrenalin-Injektion beschleunigte sich die Pulsfrequenz auf dreißig Schläge pro Minute. Überraschenderweise war Herr K. mit diesem sehr langsamen Herzschlag imstande, einen regelrechten Blutdruck aufrechtzuerhalten.
Er war jetzt mein Schützling, und ich wich nicht mehr von seinem Krankenbett.
Ich erfuhr, dass Herr K. in den vergangenen Monaten an Ohnmachtsanfällen gelitten hatte, die durch einen kompletten Herzblock bedingt waren. Dies war damals – nicht selten bei alten Menschen – ein potenziell tödlich endender Zustand, der heutzutage ohne Weiteres durch Implantieren eines Herzschrittmachers behoben werden kann. Sein Zustand resultierte aus einer Unterbrechung der elektrischen Signale im Herzen. Der normale elektrische Impuls geht von einem biologischen Schrittmacher aus, einem Bündel von speziellen Nervenzellen, die im rechten Vorhof beheimatet sind. Dieses Bündel wird als Sinusknoten bezeichnet. Es besitzt die unheimliche Fähigkeit, sechzig bis achtzig oder mehr Herzschläge zu erzeugen und dies mit der Präzision eines Uhrwerks ein Leben lang. Ein Bündel an Nerven, die als elektrisches Kabel dienen, verbindet den Sinusknoten mit den Ventrikeln, den dynamisch pulsierenden Kammern des Herzens, die Blut durch den gesamten Körper befördern. Bei Herrn K. war dieses den Sinusknoten und die Ventrikel verbindende Bündel unterbrochen. Er hätte dringend einen Schrittmacher gebraucht – der aber war noch nicht erfunden. Selbst Dr. Paul Zolls externer Schrittmacher lag noch 50 Jahre in der Zukunft. Da bei Herrn K. ein kompletter Herzblock bestand, betrug seine Pulsfrequenz nur achtundzwanzig bis zweiunddreißig Schläge pro Minute und stieg auch bei Anstrengung und Aufregung nicht an.
Es war ein Wunder, dass Herr K. noch am Leben war. Weitere Wunder sollten folgen. Nach ungefähr achtundvierzig Stunden begann er, auf schmerzhafte Reize zu reagieren. Nach einer Woche war er recht munter, wenngleich noch benommen. Ich war erstaunt, dass er keinen irreversiblen Gehirnschaden davongetragen hatte, obwohl er etwa zehn Minuten lang ohne ausreichende Blutzirkulation geblieben war. Nach einer weiteren Woche war Herr K. wieder sein gutes altes Selbst. Seine Familie entdeckte keinerlei Störungen in seinem Gedächtnis, seinem Denken oder seiner Persönlichkeit.
Herr K., den ich später Ed nannte, war ein Mann in seinen späten Sechzigern, der keinen einzigen Tag in seinem Leben krank gewesen war. Er war ein fröhlicher älterer Herr, früher als Verkäufer von Kinderkleidung tätig, jetzt pensioniert. Ed strahlte eine unbefangene Gutmütigkeit aus, die von einem Leben herrührte, in dem er sich bei allen beliebt zu machen wusste, wobei er in jedem einen potenziellen Kunden sah. Er war anspruchslos, besaß einen gesunden Menschenverstand und die Fähigkeit, mit jeglicher Art von Menschen unkomplizierte Beziehungen herzustellen. Er stammte aus einer armen Familie und hatte nur die Volksschulbildung erfahren. Seine häufigen jüdischen Witze waren von scharfer spitzer Selbstkritik geprägt.
Ed war froh, am Leben zu sein. Abgesehen vom Unvermögen, einer Straßenbahn nachzurennen, ohne übermäßig außer Atem zu geraten, war er noch immer geplagt von einem Herzen, das nur zu halber Leistung fähig war. Ich erwartete die Wiederkehr von Ohnmachtsanfällen, aber nichts geschah. Nach ein paar Jahren hörte ich auf, mir Sorgen zu machen.
Ich versuchte, seine Pulsfrequenz mit Ephedrin, einem Adrenalin-ähnlichen Medikament, zu beschleunigen, brach die Therapie aber ab, da sie ihn nervös machte. Trotz meiner trüben Vorahnungen ging es ihm bemerkenswert gut. Er meldete sich als Ehrenamtlicher in meinem Krankenhaus und arbeitete für eine der Oberschwestern, die Ed als ein Gottesgeschenk ansah. Schon sehr früh am Morgen erschien er gut gelaunt, kein Job war ihm zu nieder, jeder stellte eine Herausforderung dar. Er sortierte die Vorräte im Arzneimittelschrank und räumte in den Wäschelagern auf. Wo immer er auch arbeitete: Er brachte eine schöne Ordnung und gute Laune mit. Dies hielt viele Jahre hindurch an.
Ed war durch seinen Herzblock jetzt nur noch psychisch beeinträchtigt. Dies drückte sich in einem ungewöhnlichen Fehlverhalten, in einer seltsamen Form von Schlaflosigkeit, aus. Der Schlaf kam in kleinen Portionen von einstündigen Intervallen. Ed stellte den Wecker auf eine Stunde. Wenn er geweckt wurde, stellte er die Uhr um eine weitere Stunde vor und schlief wieder ein. Dies wiederholte er die ganze Nacht hindurch. Wenn er den Wecker nicht auf diese Art und Weise stellte, konnte er nicht schlafen. Ed versuchte erst gar nicht, diese Absonderlichkeit zu rechtfertigen. Wenn man ihn danach fragte, entgegnete er, dass er sich die Nacht hindurch vergewissern wolle, dass er noch am Leben sei. Seine Frau war aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Seine Familie war so froh, ihn wieder in ihrer Mitte zu haben, dass sie diese besondere „Macke“ ignorierte. Ed gedieh; er hatte keine internistischen Beschwerden und nahm keine Medikamente.
Zwölf Jahre verstrichen ereignislos. Dann – als ich eines Tages mit einem führenden kardiologischen Chirurgen auf einem Krankenhauskorridor im Gespräch war – entdeckte ich Ed, der auf uns zukam. In wenigen Worten beschrieb ich seine bemerkenswerte Krankengeschichte. Als Ed bei uns angelangt war, stellte ich ihn dem Chirurgen vor, der sogleich nach seinem Puls griff. „Meine Güte, Sie haben aber einen langsamen Herzschlag! Ich kann das reparieren.“ Weiterhin wurde nichts gesagt, als jeder von uns seines Weges ging.
Einige Monate später wurde ich benachrichtigt, dass Ed nicht mehr am Leben sei. Als ich mich kundig machte, was geschehen war, erfuhr ich, dass er auf dem Operationstisch während einer Thorakotomie zwecks Einpflanzung eines Schrittmachers verstorben sei. Der Chirurg, der die Operation durchführte, war derjenige, dem ich Ed auf dem Krankenhauskorridor vorgestellt hatte. Diese zufällige kurze Begegnung hatte sein Schicksal besiegelt.
Bei der Erinnerung an diese letzte Szene überfällt mich ein quälendes Schuldgefühl. Es war, als sei ein leichtgläubiges Lamm einem verführerischen Löwen vorgeworfen worden. Wenn auch niemand ein solches Ende hätte erwarten können – hätte nicht wenigstens ich die möglichen Folgen ahnen müssen? Wo war meine kreative klinische Fantasie an jenem Tag? Sollte ich nicht vermutet haben, dass ein Patient mit einer chirurgisch offenbar korrigierbaren Veränderung – wird er erst einmal einem Chirurgen vorgestellt – zu einer Operation überredet werden würde?
Wie kann der Zustand eines weitgehend symptomfreien Patienten durch eine riskante Prozedur verbessert werden, die in ihrem Kielwasser mögliche ruinöse Komplikationen mit sich bringt? Dem Mann ging es gut; es bestand keine Veranlassung, etwas zu verbessern, das bereits in Ordnung war.
Selbst nach seinem Ableben fuhr Ed fort, meine Wachsamkeit als Arzt zu schärfen. Aufgrund jener Erfahrung ersparte ich zahllosen Patienten mit einem langsamen Herzschlag die Einpflanzung von Schrittmachern. Es widerstrebte mir, symptomfreie Patienten zu einer Operation zu schicken – es sei denn, es gab zwingende Beweise, dass ansonsten ihr Überleben auf dem Spiel stand. Wissenschaftliches Beweismaterial ist überaus wichtig, es sollte aber den gesunden Menschenverstand nicht übertrumpfen. Bei all meinen Begegnungen mit Patienten versuchte ich zu ergründen, was sie wirklich quälte. Nur so kann ein Arzt der alten Berufung als Heiler gerecht werden.
3 Der einsame Weg eines Außenseiters durch die Kardiologie
Soeben habe ich meinen neunzigsten Geburtstag hinter mich gebracht, da erinnere ich mich beim Schreiben an Machiavellis Ermahnung beim Empfangen der letzten Ölung auf seinem Sterbebett: „Schwören Sie dem Teufel ab und umarmen Sie den Herrn“, intonierte der Priester. Ein langes Schweigen. Dann flüsterte Machiavelli: „Es ist nicht die Zeit, neue Feinde zu machen.“
Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Ich habe während meiner Laufbahn gefährlich unorthodoxe Ansichten nicht nur gehegt, ich habe sie auch in die Tat umgesetzt. Die Tatsache, dass ich mich erst im Jahr 2007 aus eigenen Stücken aus der ärztlichen Praxis zurückziehen durfte und nicht schon Jahrzehnte zuvor meine ärztliche Lizenz abgeben musste, war entweder ein ungeheuerliches bürokratisches Versehen oder ein Akt göttlicher Fügung. Obwohl meine ärztliche Gesetzesverletzung niemals verdunkelt oder verborgen wurde, haben sie nur wenige wahrgenommen.
Mein abweichlerisches Verhalten bedeutete eine scharfe Abkehr von den gängigen Normen der ärztlichen Praxis. Ich schätzte ein solches Verhalten als einen Akt zivilen Ungehorsams ein, für den ich mich bereitwillig hätte bestrafen lassen. Aber traurigerweise hat niemand innerhalb oder außerhalb der Behörden etwas gemerkt.
Also: Was soll das alles? Auch wenn Sie nicht auf dem Gebiet des Gesundheitswesens tätig sind, so dränge ich Sie dennoch, durch das sumpfige Gelände des medizinischen Jargons zu waten. (Die Anmerkungen am Ende des Kapitels sollen einige Unverständlichkeiten dieses medizinischen Kauderwelsches klären helfen.) Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der rasch zunehmenden Industrialisierung des Gesundheitssystems, ein kritisches Thema für das weitreichende Wohl der Bevölkerung.
Vor gut 40 Jahren hörte ich auf, die meisten Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit (KHK) zur kardialen Angiografie zu überweisen. (1) Diese Prozedur erlaubt, das Ausmaß der Herzkranzgefäß-Verschlüsse sichtbar zu machen. Was bewog mich zu dieser Sinnesänderung? Das Problem war, dass fast alle, die sich einer Angiografie unterzogen, am Ende der Chirurgie zugeführt wurden, nämlich einer Herzkranzgefäß-Einpflanzung (= CABG für Coronary Artery Bypass Grafting, auch „Cabbage“ ausgesprochen).
Was könnte falsch sein an einer Verbesserung des Blutzuflusses zum Herzen durch die Aufhebung der Blockade in einer verschlossenen oder verengten Arterie? Eine derartig vernünftige Maßnahme fände die Zustimmung eines jeden Klempners, der sich einer blockierten Wasserleitung gegenübersieht.
Aber das Herz ist nun mal keine Wasserleitung. Wenn ein Herzkranzgefäß verengt oder blockiert ist, verfügt das Herz über einen eingebauten Verteidigungsmechanismus. Es entwickelt ein kollaterales Netzwerk von kleinen Gefäßen, um das verminderte Angebot an Nährstoffen und Sauerstoff zu kompensieren.
Die Beseitigung eines anatomischen Verschlusses durch chirurgische Herumbastelei – oder später mit Stent-Einpflanzungen – kann letztlich nicht die Lösung sein. Was immer die Überzeugungen der Kliniker sein mögen, jedes Verfahren muss durch Beweise legitimiert werden. Ohne Beweismaterial fehlt es dem ärztlichen Vorgehen an wissenschaftlicher Sanktionierung. Darauf beruht ein zweiter Einwand gegen den Ansturm auf die koronare Bypass-Chirurgie. Es gab keinen Beweis, dass diese sowohl das Überleben als auch die Lebensqualität günstiger beeinflusste als die optimale medikamentöse Behandlung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit. (2)
Ohne einen solchen Nachweis ruhte die weit verbreitete Anwendung der Herzkranzgefäß-Chirurgie eher auf einem dünnen Schilfrohr der Vermutung als auf einem soliden Fundament unanfechtbarer Daten. Da gab es kein sorgfältiges Abwägen. Die Folgen des Eingriffs waren ernüchternd. Die koronare Bypass-Operation war keine harmlose Prozedur. Sie brachte eine initiale Mortalität und auch eine bedeutende Rate an ernsten Komplikationen mit sich. Zudem vermehrte sie beträchtlich die Kosten für die Gesundheitsfürsorge. Einige Jahre später wurden die koronare Angioplastie und die Stent-Einpflanzung in Herzkranzarterien für die gleiche Indikation eingeführt – wiederum ohne beweiskräftige Daten.
Weshalb wurden dann diese Prozeduren so rasch populär? Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass für einige Patienten diese Interventionen auf wundersame Weise lebensrettend sind. Aber auch wenn sie bei einigen Patienten mit koronarer Herzkrankheit von außerordentlichem Nutzen sind, ist dann gleich die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass sie allen anderen Patienten ebenfalls nutzen?
Eingriffe an den Koronararterien
Chirurgische Eingriffe an den Koronararterien waren die ersten radikalen Maßnahmen zur Öffnung verschlossener Herzkranzgefäße – die Folge der Atherosklerose, der sogenannten Verhärtung der Arterien. Im Jahr 1967 benutzte der argentinische Chirurg Dr. René Favaloro, der an der Cleveland Clinic tätig war, erfolgreich ein Venentransplantat zur Umgehung eines verschlossenen koronaren Gefäßes. Wie Edmund Hillary und Tenzig Norgay, die ersten Bergsteiger, die den Gipfel des Mount Everest erreichten, oder Roger Bannister, der Erste, der gut eineinhalb Kilometer in vier Minuten lief, erschloss Favaloro ein Terrain, das als außerhalb menschlicher Reichweite gelegen galt. In der Herzkranzgefäß-Chirurgie hatte er die Barriere zum anscheinend Unmöglichen niedergerissen. Innerhalb von zehn Jahren wurden 100.000 Patienten in den USA einer koronaren Bypass-Operation unterzogen; in den 1990er-Jahren hatte sich die Zahl vervierfacht.
Der Ansturm auf die Eingriffe nahm mit der Einführung der weitaus weniger invasiven Koronararterien-Angioplastie weiterhin um ein Vielfaches zu. Hierbei wird ein dünner, mit einem Ballon an der Spitze versehener Katheter am Ort einer Gefäßverengung aufgeblasen. Diese perkutan durchführbare Maßnahme erforderte weder eine Narkose noch eine Eröffnung der Brusthöhle. Daraufhin kam als weitere Neuerung die Einpflanzung eines metallischen Stents hinzu – ein wahres Metallgerüst zur Dehnung und Offenhaltung eines verengten Gefäßsegments. Bald wurden in den USA jährlich mehr als eine Million Stents eingepflanzt. Eine Mehrheit der frisch gebackenen Kardiologen ist zu geschickten Interventionisten geworden. Sie verbringen ihre ganze Zeit im Katheter-Labor, einem Platz für Experimente mit neuen, herausfordernden Technologien – und eine wahre Goldgrube für die Klinik und die Ärzte.
Aber ich greife meiner Geschichte weit voraus. In den 1970er-Jahren war die koronare Bypass-Chirurgie die einzige verfügbare Maßnahme für die direkte Behandlung eines verschlossenen Gefäßes. Sie war – wie bereits erwähnt – keineswegs harmlos. Sie hatte eine Operationsmortalität von 2–5% zur Folge. Die Transplantate hatten die Tendenz, Gerinnsel zu bilden und sich zu verschließen. Zehn Jahre nach der Operation war die Mehrzahl der Gefäße wieder blockiert. Eine erneute Operation ging dann mit einer zweistelligen Mortalitätsrate einher. Etwa 10% der Patienten mit koronarer Bypass-Chirurgie erlitten irgendwelche Komplikationen. Blutgerinnsel, die sich während der Operation lösten, führten zu Schlaganfällen und Herzinfarkten. Viele Jahre hindurch blieb von den Kardiologen unerkannt, dass bei vielen Patienten die intellektuellen Funktionen beeinträchtigt wurden. Dies manifestierte sich in einem subtilen Gedächtnisverlust und einer leichten Depression. Ich wurde dieser Komplikationen ebenfalls nicht gewahr, bis ich von mehreren Ehepartnern der Patienten darauf aufmerksam gemacht wurde. (3) Wie eine Ehefrau präzise formulierte: „Mein Mann ist körperlich in Ordnung, aber er ist nicht mehr der Gefährte, den ich geheiratet habe.“ Überraschenderweise dauerte es ein Jahrzehnt oder länger, bis man diese Beeinträchtigungen erkannte. Eine publizierte Untersuchung über Magnet-Resonanz-Tomografie ergab, dass 51% der Bypass-Chirurgie-Patienten etliche Gehirnschädigungen aufwiesen. (4)
Angst begünstigt ärztliche Interventionen
Man könnte sich fragen, weshalb Patienten der Durchführung einer schmerzhaften und lebensbedrohlichen Prozedur zustimmten ohne die Sicherheit, damit ihre Lebenserwartung zu verbessern. Ich habe lange über eine solche Einwilligung gerätselt. Überraschenderweise stimmten die Patienten nicht nur dem empfohlenen Eingriff zu, sondern drängten im Allgemeinen sogar auf eine rasche Durchführung. Eine solche Haltung wird sowohl durch Unkenntnis als auch durch Angst erzwungen. Patienten werden leicht vom Kauderwelsch des ärztlichen Jargons ins Bockshorn gejagt. So etwas zu vernehmen wie „Ihre linke vordere absteigende Herzkranzarterie ist zu 75% blockiert, und das Auswurfvolumen beträgt 50%“ wirkt lähmend. (5) Für den einfachen Patienten drohen derartige Befunde einen Herzinfarkt an oder – schlimmer noch – sagen unheilvoll einen plötzlichen Herztod voraus.
Kardiologen und Herzchirurgen befleißigen sich häufig einer Angst einflößenden Wortwahl bei der Zusammenfassung angiografischer Befunde. Dies führt ohne Zweifel zur bedingungslosen Akzeptanz des empfohlenen Eingriffs. Über die Jahre habe ich einige hundert Formulierungen gehört wie: „Sie haben eine Zeitbombe in Ihrer Brust“ und deren Variante „Sie sind eine wandelnde Zeitbombe.“ Oder „Diese verengte Koronararterie ist ein Witwen-Macher.“ Und wenn Patienten gern einen Eingriff aufschieben möchten, beschleunigt eine Reihe furchterregender Formulierungen ihren Entschluss, doch bei der Stange zu bleiben. „Wir sollten keine Zeit verlieren, indem wir Hamlet spielen.“ Oder „Sie leben mit geborgter Zeit.“ Oder „Sie haben Glück – ein Platz auf dem Operationsplan ist gerade verfügbar.“ Schädigende Worte können Patienten zu unmündigen Kleinkindern machen, sodass sie die Ärzte als elterliche Autoritäten ansehen, die sie zu einem sicheren Hafen führen. (6)
Die Macht einer solchen Wortwahl erfuhr ich Anfang der 1970er-Jahre von einem Ehepaar aus Florida. Die Ehefrau, Marjorie, bestritt die ganze Unterhaltung. Es war ganz offensichtlich, dass ihr Ehemann, Bill, allzu beeinträchtigt war, um eine zusammenhängende Geschichte zu liefern. (7) Seine rechte Körperhälfte war kraftlos, sein Mund herabhängend und sabbernd, seine Sprache ein unverständliches Geplapper. Marjorie, eine jugendlich aussehende Frau in ihren Sechzigern, stolperte über ihre Worte in einem gehetzten, unruhigen Redefluss an abgehackten Sätzen. Sie war ungeduldig, mich rasch über alles zu informieren, so, als könnte ich ein wundersames Heilmittel für ihren behinderten Ehemann anbieten.
Bill war von lebenssprühender, guter Gesundheit gewesen. Zwei Jahre zuvor, als er 70 wurde, ging er in den Ruhestand und widmete seinen lange vernachlässigten Hobbys viel Zeit, vor allem dem Golfspiel (18 Löcher) zweimal pro Woche mit ehemaligen Geschäftsfreunden. An einem Freitagmorgen war Marjorie überrascht, als sie erfuhr, dass Bill auf dem Weg zu einer kardiovaskulären Durchuntersuchung in einem weltbekannten Medizinischen Zentrum war, das vor Kurzem eine Zweigstelle in Florida errichtet hatte. Bill verneinte jegliche Symptome. Die Gründe, die er für seine Terminabsprache nannte, waren die, dass er noch niemals eine Herzuntersuchung gehabt habe. Ihm sei durch die Werbeflut aus dem neuen Zentrum klar geworden, dass Vorbeugung bei Weitem besser sei als mit einem Herzinfarkt oder Schlimmerem fertigzuwerden. Er redete es Marjorie aus, „mitzulatschen“, voller Gewissheit, dass er zur Lunchzeit wieder zurück sein werde.
Als Bill gegen Mittag nicht erschien, wuchs bei Marjorie die Sorge. Sie rief das Medizinische Zentrum an, wurde jedoch zwischen automatischen Ansagen hin und her geschickt. Um zwei Uhr erhielt sie einen Telefonanruf, sie solle sofort in die Klinik kommen. Sie kam in der Kardiologen-Praxis mehr tot als lebendig an. Ihr Ehemann, normalerweise extrovertiert, war schweigsam und in Gedanken versunken und begrüßte sie mit einem gezwungenen Lächeln. Der Arzt erklärte, dass Bill „beim Belastungstest versagt“ habe und sich glücklich schätzen könne, dass es im Katheter-Labor gerade einen freien Platz gegeben habe, an dem er einem Notfall-Angiogramm unterzogen worden sei. Wie vom Arzt vermutet, habe er eine schwere koronare Herzkrankheit zahlreicher Gefäße.
Für Marjorie ist dieser Nachmittag in einen dichten Nebel gehüllt. Auf einem Lichtkasten demonstrierte der Kardiologe die Befunde. Diese sahen für Marjorie „wie weiße Bindfäden, die sich verknoten und das Herz ersticken“ aus. Sie erkundigte sich nach der Gefährlichkeit des Zustands. Der Kardiologe entgegnete, dass dieser anatomische Typ mit einem „drohenden Herzinfarkt oder Schlimmerem“ assoziiert sei und empfahl eine baldige koronare Bypass-Chirurgie. Marjorie bat den Arzt, die Operation so rasch wie möglich zu arrangieren.
Der Arzt setzte die Bypass-Chirurgie für den nächsten Morgen an. Abermals gratulierte er Bill zu seinem Glück, dass es gerade einen freien Platz auf dem vollen Operationsprogramm gebe. Alles verlief nach Plan – außer, dass Bill während der Operation einen massiven Schlaganfall erlitt.
Zutiefst von ihrer Erzählung berührt und mir vollauf bewusst, dass es kein Heilmittel gab, um den Hirnschaden rückgängig zu machen, stellte ich eine Frage, die sowohl taktlos als auch töricht war: „Warum haben Sie keine zweite Meinung eingeholt?“ Sie sprang von ihrem Stuhl auf und schrie: „Das ist eine blöde, blöde Frage, Doktor! Wenn Ihr Haus brennt, fragen Sie auch nicht nach einer zweiten Meinung! Sie rufen die Feuerwehr.“ Sie hatte in jeder Beziehung absolut Recht.
Krankenberichte von Bills Klinikbesuch in Florida zeigten, dass er sich zehn Minuten lang entsprechend einem Standard-Laufbandprotokoll körperlich hatte belasten können. Das Koronar-Angiogramm hatte lediglich eine mäßige Einengung zahlreicher Gefäße ergeben. Vor der Operation war er völlig symptomfrei und körperlich absolut fit gewesen. Diese Befunde wiesen darauf hin, dass Bill bei medikamentöser Betreuung wahrscheinlich eine nahezu normale Lebenserwartung gehabt hätte.
Weshalb Ängste schüren?
Warum schwelgen Kardiologen in Angstmacherei? Die Gründe sind vielfältiger Natur. Ein Faktor, so glaube ich, hat mit Kontrolle zu tun. Mit der Medikalisierung der Gesellschaft und der Überbehandlung, deren die Patienten zunehmend gewahr werden, gelten Ärzte nicht länger als unparteiische Berater, die volles Vertrauen verdienen. Zum Selbstschutz bedienen sich Patienten zahlreicher Manöver, um sich medizinisches Wissen anzueignen. Sie grasen auf den endlosen medizinischen Weiden des Internets, lesen ausführliche Gesundheitsinformationen durch, die aus einer Vielfalt von Quellen stammen, und kaufen zweite Meinungen ein.
Ein Arzt lernt bald, dass eine „realistische“ Formulierung Fragen abstellt und Zeit spart. Eine Bemerkung wie „Die Zyste im Computer-Tomogramm könnte karzinomatös sein“ oder „Eine der Hauptkoronararterien ist zu 50% verschlossen“ zerstreut Zweifel der Patienten an der Sachkenntnis eines Arztes. Den Kardiologen ist bewusst, dass die medizinische Technologie in einem Katheter-Labor Ehrfurcht einflößt. Das angefertigte Angiogramm gleicht der Mosaischen Heiligen Schrift, welche göttliche Autorität ausstrahlt. Der solchermaßen bewaffnete Arzt muss sich nicht länger Zweifel oder Widerspruch gefallen lassen. Selbst widerspenstige Patienten werden lammfromm.
Ein anderer Grund, weshalb Ärzte den Patienten zu Eingriffen raten, ist, dass sie stets ganz und gar an das glauben, was sie vermitteln. Oftmals jedoch denken sie eher wie Klempner denn als Wissenschaftler. Ein blockiertes Rohr muss durchgängig gemacht werden. Im Falle des Herzens: je früher, desto besser. Solche ärztlichen Ansichten, obgleich scheinbar von gesundem Menschenverstand geleitet, werden durch klinisches Beweismaterial nicht unterstützt.
Wird eine Koronararterie komplett verschlossen, so kommt es entweder zum Untergang lebenden Herzmuskelgewebes oder zum plötzlichen Tod. Die Annahme ist gerechtfertigt, dass eine zu 90% eingeengte Herzkranzarterie mit einem größeren Risiko des kompletten Verschlusses behaftet ist als eine Arterie mit einer weniger eingeengten Lichtung. Solch ein Blickwinkel überzeugt die Ärzte, Eingriffe zwecks Verbesserung des Blutflusses zu empfehlen. Und dennoch reflektiert menschliche Logik nicht akkurat die Kosmologie oder biologische Prozesse. Gewöhnlich stellt sich heraus, dass das Gefäß, welches für einen Herzinfarkt verantwortlich ist, nur mäßig, wenn überhaupt, eingeengt ist. Überraschenderweise muss ein zu 90% verengtes Gefäß, wenn es dann komplett verschlossen wird, weder zu weiterem Herzmuskelschaden führen noch Symptome provozieren.
Man hat in Erfahrung gebracht, dass die Ursache für ein akutes Koronarereignis in einer Entzündung und Ruptur der dünnen Abdeckung eines atherosklerotischen Plaques besteht. Wenn diese Abdeckung zerreißt, entleert sich der Plaque. Dies führt zu Blutgerinnseln und zum abrupten Verschluss eines bis dahin weitgehend durchgängigen Gefäßes. Das Herz ist auf solch ein plötzliches Ausbleiben an Nährstoffen und Sauerstoff völlig unvorbereitet. Im Gegensatz hierzu bewirkt eine allmähliche Blockierung des Gefäßes die Bildung eines Netzwerks von kleinen Kollateralgefäßen. Diese sorgen für alternative Wege des Blutstroms und bewahren dadurch die Lebensfähigkeit des Herzmuskels, wenn eine erkrankte Arterie sich am Ende ganz verschließt.
Das oben Erwähnte ist keine Theorie. Klinische angiografische Untersuchungen haben ergeben, dass Arterien mit nur minimalen krankhaften Veränderungen sich schließen und zu einem Herzinfarkt führen können. Als zwei Koronar-Angiogramme vor und nach einem Herzinfarkt angefertigt wurden, war das „schuldige“ Gefäß in der ersten Bilddarstellung nicht ernsthaft erkrankt. Dies ließ sich bei 85% der Herzinfarkt-Patienten beobachten! (8, 9) Man würde vermuten, dass die Gefäße, deren Lichtung erweitert oder mit einem Transplantat versehen worden sind, gar nicht diejenigen sind, die später Unheil verursachen. Es leuchtet deshalb ein, dass Eingriffe an den Koronararterien von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit nur eine Minorität entweder vor einem Herzinfarkt oder vor einem plötzlichen Herztod schützen werden.
Der Hauptfaktor, der klinisches Urteil zu Eingriffen verführt, ist – davon bin ich überzeugt – ökonomischer Natur. Die Einkünfte von Kardiologen sind seit der Einführung von interventionistischen koronaren Prozeduren in die Höhe geschnellt. Während der 1980er-Jahre wuchs das Einkommen eines Kardiologen um mehr als 50%, während das der Internisten stagnierte. Zwei führende interventionistische Kardiologen in New York City, die am Mount Sinai Hospital und am Presbyterian Hospital beschäftigt sind, verdienten 2012 etwa drei Millionen Dollar jährlich.
Zu derselben Zeit, in der invasive Prozeduren um sich griffen und an Zahl zunahmen, änderte sich die medikamentöse Behandlung von Grund auf. Zahlreiche Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit konnten nun durch Änderungen in der Lebensweise und durch neue Pharmazeutika behoben werden. (10)





























