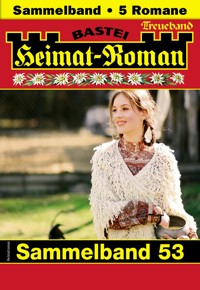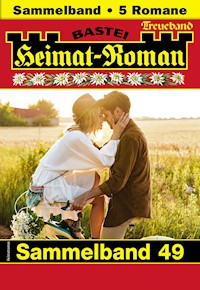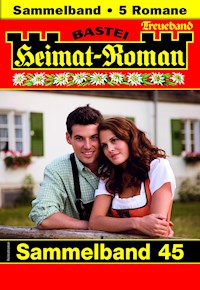5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimat-Roman Treueband
- Sprache: Deutsch
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 241 - Frühlingsfest auf Wildenhagen
Alpengold 242 - Glaub nicht seinen falschen Schwüren
Der Bergdoktor 1829 - Filli Burger im Glück
Der Bergdoktor 1830 - Der Patriarch vom Wendler-Hof
Das Berghotel 173 - Sein Liebesschwur beim Alpenglühen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2017/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Shutterstock AI
ISBN: 978-3-7517-8620-1
https://www.bastei.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Heimat-Roman Treueband 79
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Alpengold 243
Es fällt so schwer, dir zu verzeihen
Alpengold 244
Er kam, um Rache zu nehmen
Der Bergdoktor 1831
Bis zum Ende des Sommers …
Der Bergdoktor 1832
Der Dornenweg der schönen Magd
Das Berghotel 174
Die Wahrheit über Martha
Guide
Start Reading
Contents
Es fällt so schwer, dir zu verzeihen
Dramatischer Roman um eine schwere Schuld
Von Rosi Wallner
In dem Glauben, seine Eltern seien bei einem Zugunglück ums Leben gekommen, ist Stefan Lindacher bei Verwandten aufgewachsen. Doch dann bekommt er durch einen unglücklichen Zufall mit, wie sein Onkel ihn als Mörderbrut bezeichnet. Jetzt weiß Stefan: Sein Vater ist nicht tot, sondern er sitzt, zu lebenslanger Haft verurteilt, im Gefängnis, weil er seine Frau, die wunderschöne Rosa, getötet haben soll.
Stefan ist zutiefst erschüttert. Zum ersten Mal besucht er, inzwischen ein fescher junger Mann, seinen Vater im Gefängnis, und dieser beteuert seine Unschuld. Stefan glaubt ihm, und um seine Unschuld zu beweisen, kehrt er in seinen Geburtsort zurück und nimmt die Dörfler genau unter die Lupe. Wer von ihnen ist der Mörder seiner Mutter?
Stefan will nicht eher ruhen, bis er die Ehre seines Vaters wiederhergestellt hat! Doch es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn sein Vater ist todkrank …
Stefan Lindacher wandte sich kein einziges Mal mehr um, nachdem er den Leitnerhof verlassen hatte und den schmalen Pfad bergan stieg. Erst als das Anwesen nach einer Wegkrümmung außer Sichtweite war, blieb er stehen und schöpfte tief Atem.
Eigentlich hätte er jetzt niedergeschlagen und verzagt sein müssen, weil ihn der Leitnerbauer buchstäblich vom Hof gejagt hatte und er nun ohne Verdienst dastand, doch Stefan fühlte sich nur unendlich erleichtert.
Stefan, der nach dem frühen Tod seiner Eltern bei Verwandten aufgewachsen war, die ihn nur widerwillig aufgenommen hatten, war es auf dem Leitnerhof noch schlechter ergangen. Sein Onkel hatte ihn sofort nach Beendigung der Schulzeit bei dem Großbauern untergebracht, obwohl jeder im Dorf wusste, wie es auf dem Hof zuging.
Leitner war ein geiziger, bösartiger Mensch, der seine Leute ausnutzte und keine Widerworte duldete. Auf Stefan hatte er es von Anfang an abgesehen.
Fast vier Jahre hatte Stefan es ertragen, dass er schlecht behandelt wurde und für ein geringes Entgelt schwere Arbeit tun musste. Trotz seines Reichtums war bei dem Leitner Schmalhans Küchenmeister, und Stefan war mehr als einmal hungrig zu Bett gegangen. Es hielt sich sogar das Gerücht im Dorf, dass sich noch nicht einmal die Bäuerin satt essen konnte, denn Leitner hätte auch den Schlüssel zur Speisekammer in seinem Gewahrsam.
Vier Winter hatte Stefan allen Schikanen getrotzt und sich durch die harte Arbeit gemüht. Doch in dieser Zeit war er erwachsen geworden und wirkte weit über sein Alter hinaus gereift.
In seinem scharf geschnittenen Gesicht mit den ebenmäßigen Zügen fielen die dunklen Augen auf, deren nachdenklicher und zugleich ironischer Ausdruck andere leicht verunsicherte.
Ehe Stefan den Rucksack mit seinen wenigen Habseligkeiten aufhob, reckte und streckte er seine schlanke, hochgewachsene Gestalt und fuhr sich durch das dichte braun gelockte Haar. Er fühlte sich von neuer Kraft durchdrungen, als wäre er nach einer langen qualvollen Krankheit endlich genesen.
Der schöne Frühlingstag war ganz dazu angetan, dieses Gefühl der Befreiung in ihm zu verstärken. Tiefblau spannte sich der Himmel über das Tal, und die blütenbeladenen Bäume schienen sich unter ihrer Pracht zu beugen.
Obwohl Stefan dieses Bild begierig in sich aufnahm, hinderte es ihn nicht daran, gleichzeitig zu überlegen, wie seine Zukunft aussehen sollte.
Zunächst würde er bei seinen Verwandten leben, obwohl er wusste, dass er seinem Onkel nicht willkommen war.
Er war sich noch nicht sicher, was er nun anfangen sollte, wahrscheinlich würde er sich auf einem der Höfe im Nachbardorf umsehen. Andererseits drängte der Pfarrer seines Heimatortes ihn dazu, in die Stadt zu gehen, um dort die Abendschule zu besuchen. Doch Stefan konnte es sich nicht vorstellen, dort zu leben, denn er liebte seine Heimat und die bäuerliche Arbeit.
Wenn er einen eigenen Hof hätte …
»Kommst du schon wieder ins Träumen?«, schalt er sich laut. »Du wirst niemals einen Hof haben, denn du bist ein armer Schlucker, und dabei bleibt es halt. Aber wer weiß …«
Er musste unwillkürlich über sich selbst lachen. Übermütig drehte er sich mit seinem Rucksack im Kreis herum und stieß einen Jauchzer aus. Trotz aller Sorgen und Kümmernisse verlieh ihm seine Jugend die Gabe, sich seines Lebens zu freuen.
Dann jedoch beeilte er sich, seinen Weg fortzusetzen, und bald schon tauchte das Anwesen der Lindachers vor ihm auf.
Als er vor dem Haus anlangte, drangen durch die angelehnte Tür erregte Stimmen. Offensichtlich stritten Lindacher und seine Frau wieder einmal miteinander. Er blieb stehen, als er seinen Namen hörte, obwohl es nicht seine Art war, heimlich zu lauschen.
»So, das erfahr ich jetzt erst, dass dein sauberer Neffe davongejagt worden ist und sich wieder bei uns einnisten will«, schrie Alois Lindacher aufgebracht. »Als hätten wir ihn net die ganzen Jahre über durchgefüttert für nichts und wieder nichts, obwohl wir selbst net genug zum Beißen haben. Das hat man von seiner Gutmütigkeit! Und jetzt soll das wohl immer so weitergehen mit diesem Nichtsnutz, aber da hat er sich verrechnet!«
»Du und Gutmütigkeit, dass ich net lach!«, stieß Anna Lindacher erbittert hervor, und ihr Ton verriet, wie sehr sie ihren Mann verachtete. »Er wird net umsonst hier wohnen. Von seinem Ersparten gibt er uns ein Kostgeld, das wir gut gebrauchen können. Außerdem wird er dir auf dem Feld helfen, unsere Buben wollen halt lieber in der Stadt ihr Geld verdienen …«
»Ich schaff das schon allein, ich hab es ja immer allein schaffen müssen«, erwiderte er zornig.
»Was hast du eigentlich gegen den Stefan? Er hat dir doch fei nichts getan.«
Lindacher lachte böse auf. »Das fragst du noch? Ich will einfach net mit dem Sohn eines Zuchthäuslers unter einem Dach leben! Wie mir das zuwider war, diese Mörderbrut um mich zu haben! Sogar meinen ehrlichen Namen hat er bekommen, damit er net vorbelastet war …«
Er brach ab, als die Tür heftig aufgestoßen wurde und Stefan hereinstürzte. Das Gesicht des Jungen war totenblass und so verzerrt, dass seine Tante zurückzuckte.
»Was hast du da eben gesagt? Mein Vater war ein Zuchthäusler und Mörder? War es das, was ihr mir die ganzen Jahre über verschwiegen habt, war es das?«
Alois Lindacher war zurückgewichen. Der jähzornige, rücksichtslose Mann empfand plötzlich Angst vor Stefan.
»Sag mir die Wahrheit!«, herrschte Stefan ihn an, und seine Augen brannten vor Zorn.
»Scher dich zum Teufel! Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, verschwind!«
Lindacher versetzte seinem Neffen einen Stoß vor die Brust, und als Stefan zurücktaumelte, nutzte er die Gelegenheit, den Raum zu verlassen. Hart schlug die Tür hinter ihm zu.
Anna Lindacher hatte beide Hände auf den Tisch gestützt und stand da, als hätte sie einen schweren Schlag erhalten, der sie aller Kraft beraubt hatte.
Sie blickte Stefan nicht an.
»Sag mir die Wahrheit, Tante«, brachte Stefan keuchend hervor. »Habt ihr mir net die ganzen Jahre über erzählt, dass meine Eltern bei einem Eisenbahnunglück ums Leben gekommen wären? Belogen habt ihr mich, belogen! Aber ich hab gefühlt, dass es net gestimmt hat. Und jetzt bist du es mir schuldig, mir zu sagen, was wirklich mit meinen Eltern geschehen ist.«
»Ich hab deinem Vater damals geschworen, dir niemals die Wahrheit zu sagen«, sagte Anna nach einem langen Moment des Schweigens tonlos.
»Hat das jetzt noch einen Sinn? Jetzt weiß ich doch, dass er ein Mörder ist.«
Er hatte seine Tante unwillkürlich ergriffen, und sie sah gequält zu ihm auf.
»Du hättest nie davon erfahren dürfen, einen heiligen Eid hab ich darauf geschworen. Ich werde es dem Alois nie verzeihen, dass er net seinen Mund halten konnte. Stefan, du …«, sie stockte und suchte nach Worten.
»Was ist mit meinem Vater? Lebt er noch?«
»Ja, er lebt noch. Im Gefängnis, er hat lebenslänglich, krank ist er auch«, brachte sie stockend hervor.
»Ein Mörder ist er also, mein Vater. Wen hat er getötet?«, drang Stefan unnachgiebig in sie.
Anna senkte den Kopf und schwieg. Totenstill war es in dem Raum, als seien sie von der übrigen Welt abgeschnitten.
Hart und fordernd klang Stefans Stimme an ihr Ohr.
»Sag es mir!«
Sie setzte sich müde, als sei sie um Jahre gealtert, an den Tisch und stützte den Kopf in beide Hände.
»Wen hat mein Vater getötet?«, wiederholte er.
»Deine Mutter«, kam es wie ein Hauch von ihren Lippen.
»Nein, nein«, stöhnte der junge Mann auf und suchte taumelnd nach einem Halt.
»Du hättest es net wissen sollen, solang du noch so jung bist. Dein Vater hat gewollt, dass du unbeschwert aufwächst. Erst, wenn es an der Zeit wär …«
»Ich bin alt genug«, wurde sie von Stefan heftig unterbrochen. »Was ist damals geschehen? Wie konnt mein Vater nur so etwas tun?«
»Die Rosa, die meine Schwester war …«
Anna Lindacher bekreuzigte sich und seufzte schmerzerfüllt, ehe sie weitersprach.
»Die Rosa war ein bildschönes Madl. Du siehst ihr gleich, hast ihre dunklen Augen. Allen Burschen hat sie den Kopf verdreht, schon als sie noch blutjung war. Aber gern hat sie nur einen gehabt, deinen Vater. Das konnt ein jeder sehen, der Augen im Kopf hatte. Und dein Vater hat sie auch über alles geliebt, auch als sie schon länger verheiratet waren. Ich hab sie ja nur selten besucht, weil sie so weit weg wohnten, aber immer hab ich sie um ihr Glück beneidet. Doch dann ist das geschehen, was ich bis auf den heutigen Tag net begreifen kann.«
Anna hielt inne, als ob ihr das Sprechen Schwierigkeiten bereite.
»Die Rosa soll ein Gspusi mit einem Großbauern angefangen haben, der sich sogar wegen ihr scheiden hat lassen wollen. Der konnt ihr halt mehr bieten als dein Vater, der rechtschaffen, aber arm war. Aus Eifersucht hat sich dein Vater vergessen.«
Sie verstummte wieder kurz und fuhr sich mit der Hand abwesend über ihr Gesicht.
»Er wurde wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Noch net amal mildernde Umstände hat man ihm gewährt. Wahrscheinlich hat er alle gegen sich aufgebracht, weil er sich geweigert hat, ein Geständnis abzulegen. Ich war bei der Verhandlung dabei. Dein Vater hat ausgesehen wie einer, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Nur um dich hat er sich noch gesorgt, außer sich war er darüber, dass du in ein Waisenhaus kommen solltest. Wir haben dich dann aufgenommen, und du trägst auch unseren Namen, damit dich niemand mit deinem Vater in Zusammenhang bringt. Eigentlich heißt du Stefan Kastner.«
»Er hat also immer behauptet, unschuldig zu sein?«, fragte Stefan begierig.
»Ja, aber niemand hat ihm geglaubt«, erwiderte Anna. »Die Beweise waren erdrückend, und wer hätte denn sonst einen Grund gehabt, meiner Schwester etwas anzutun?«
»Wo ist mein Vater eingesperrt?«, fragte Stefan.
Seine Tante nannte zögernd die Stadt, in der Gregor Kastner inhaftiert war.
Stumm saßen sie dann beisammen. Stefan sah die weiße Strähne im Haar Anna Lindachers und ihren gekrümmten Nacken, und er dachte daran, was sie seinetwegen auszustehen gehabt hatte.
Mitleid überwältigte ihn, und er strich sanft über ihren Handrücken. Anna zog ihre Rechte so schnell zurück, als habe die Berührung ihr Schmerz zugefügt.
***
»Agnes!«
Das junge Mädchen, das wartend vor einem Marterl an der Wegkreuzung stand, fuhr erschrocken herum.
»Aber ich bin es doch, Madl, hast du mich net gehört?«
Stefan wollte sie in die Arme nehmen, wie er es immer tat, wenn er seine Tante besuchte, aber etwas hielt ihn davon ab. Sie kam ihm verändert vor, so als habe sie über Nacht alles Kindliche von sich abgestreift.
Agnes Thaler war der einzige Mensch, für den Stefan eine tiefe Zuneigung empfand, eine Zuneigung, die von dem Mädchen rückhaltlos erwidert wurde. Sie war schon als Kleinkind zu den Lindachers in Pflege gegeben worden. Ihre Mutter, für die die unehelich geborene Tochter nur ein Hindernis bedeutete, war nach München gegangen. Ihr schien es dort nicht gerade schlecht zu gehen, denn sie schickte regelmäßig einen ansehnlichen Geldbetrag, lehnte es aber ab, die Tochter zu besuchen.
Stefan und die etwas jüngere Agnes wuchsen wie Geschwister miteinander auf. Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft, denn nur so konnten sie sich gegen die Bösartigkeit der beiden Lindacher-Buben zur Wehr setzen, die ganz nach ihrem Vater geraten waren.
Stefan musterte sie forschend, und Agnes errötete tief unter seinem Blick.
Schön war sie geworden, die Agnes, mit ihrem zarten, regelmäßigen Gesicht und den dunkelblauen Augen. Das silberblonde Haar, das sich an den Schläfen lockte, hatte sie hochgesteckt, was ihren schön geschwungenen Hals zur Geltung brachte. Sie trug nur ein einfaches Dirndl mit einer selbst gestrickten Weste darüber, doch es unterstrich vorteilhaft ihre schlanke Gestalt.
»Wir wollten uns doch bei der Tante treffen«, sagte sie beunruhigt. Stefan schüttelte den Kopf.
»Hör mir jetzt gut zu, Agnes. Ich kann mich ja darauf verlassen, dass du kein Wort von dem, was du jetzt erfährst, weitersagst.«
Er fasste in knappen Sätzen zusammen, was ihm seine Tante eröffnet hatte.
»Du kannst jetzt sicher verstehen, dass ich net eher Ruh finde, bis ich mit meinem Vater gesprochen hab, das musst du einsehen«, fuhr er fort. »Hierher will ich auch nimmer zurückkehren. Aber auf dich hab ich gewartet, denn ich will net fort, ohne dir Lebwohl gesagt zu haben.«
»Du willst von hier weg, und ich werd dich nimmer wiedersehen?«, stammelte Agnes, und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Agnes, Herzerl! Ich schreib dir und der Tante, und wir können uns auch treffen, schließlich bin ich net aus der Welt«, versuchte er sie zu trösten.
Sein Blick fiel auf ihre roten, zerschundenen Hände, die sie vergebens vor ihm zu verbergen suchte. Eine zornige Falte kerbte sich auf seiner Stirn ein.
»Hat dich die Schneiderin net nur den Laden, sondern wieder amal das ganze Haus putzen lassen, anstatt dir das Nähen beizubringen, die Giftwurzen?«
Er hob ihre kleine Hand empor, doch das junge Mädchen entzog sie ihm hastig.
»Wenn ich Arbeit gefunden hab und vielleicht auch zu Geld gekommen bin, werd ich dich von hier wegholen. Du wirst eh nur ausgenutzt«, versprach er.
Agnes hatte im Dorf eine Schneiderlehre begonnen, denn sie war ungemein geschickt beim Nähen, doch die Schneiderin ließ sie hauptsächlich Hilfsarbeiten verrichten. Vermutlich befürchtete sie, sich in Agnes eine zukünftige Konkurrentin heranzuziehen.
Stefan umarmte das Mädchen und küsste es auf das schimmernde helle Haar.
»Ich hab dich immer lieb gehabt, Agnes. Ohne dich hätt ich es net ausgehalten bei meinen Verwandten. Ich werd mich immer um dich kümmern wie um eine Schwester.«
Das Mädchen riss sich los und rannte aufweinend davon.
***
»Kommen Sie bitte mit!«
Der Vollzugsbeamte wies Stefan zum Besuchsraum der Strafanstalt, in dem Gregor Kastner inhaftiert war. Es war ein kahler grün gestrichener Raum, in dem Stefan auf seinen Vater wartete.
Stefan fühlte sich hilflos und elend. Er hatte Angst vor diesem Treffen mit einem Vater, an den er sich nicht mehr erinnern konnte. Die Worte, die er sich zurechtgelegt hatte, schienen immer wieder seinem Gedächtnis zu entfliehen.
Er schrak zusammen, als sich die Tür öffnete und ein hochgewachsener Mann, dessen Schultern jedoch vorgebeugt waren, eintrat. Schweigend nahm er Platz, und Stefan empfand zu seiner Überraschung ein jähes Gefühl der Vertrautheit mit diesem Unbekannten.
Obwohl Gregor Kastner noch nicht einmal das fünfzigste Lebensjahr erreicht hatte, wirkte er schon wie ein alter Mann. Tiefe Furchen hatten sich in das müde Gesicht gegraben.
Seine sanften Augen richteten sich mit dem Ausdruck jäher Erkenntnis auf Stefan.
»Rosas Sohn …«, sagte er fast flüsternd in das Schweigen hinein.
Der schwache Abglanz eines Lächelns erschien auf seinem bleichen Gesicht.
»Ich bin auch dein Sohn«, sagte Stefan leise.
»Mein Sohn«, wiederholte Gregor Kastner, und er lauschte dem Klang der Worte nach. Dann aber lief ein schmerzliches Zucken über seine Züge.
»Ich hab nie gewollt, dass du mich hier siehst und dein junges Leben damit belastest. Tot und begraben wollt ich für dich sein, so wie es auch bald geschehen wird. An einer Begnadigung liegt mir nichts, denn ich finde mich nimmer zurecht. Ich finde mich schon lange nimmer zurecht, seit deine arme Mutter …«
»Was ist damals geschehen, Vater?«, fragte Stefan eindringlich und beugte sich vor.
»Ich schwör dir, mein Sohn, ich bin unschuldig am Tod deiner Mutter, die ich über alles geliebt hab, auch wenn alles gegen mich spricht, niemals hätt ich meinem Roserl etwas angetan! Wir waren so glücklich miteinander, doch dann hat uns das Schicksal für dieses Glück hart bestraft …«
Gregor musste sich erst fassen, ehe er weitersprechen konnte.
»Selbst vor einer Toten hatten sie keine Achtung, die Leut im Dorf. Sie haben sie als leichtfertige Person hingestellt. Sie war lebenslustig und hat gern gelacht, aber sie war net leichtfertig. Deine Mutter ist mir immer treu geblieben. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, hab ich sie gefunden, sie war schon tot, und ich kniete wie erstarrt neben ihr. So hat mich eine Nachbarin gefunden, und niemand zweifelte daran, dass ich sie ermordet hatte.«
Stefan Lindachers Hände öffneten und schlossen sich krampfhaft.
»Was hat man euch angetan, der Mutter und dir?«, stieß Stefan hervor.
Das Bild seines Vaters, dessen Leben durch ein gnadenloses Geschick heillos zerstört worden war, brannte sich unauslöschlich in seine Seele ein.
»Ich werd den Schuldigen finden, verlass dich drauf, Vater! Es muss doch eine Gerechtigkeit geben!« In Gregor Kastners matten Augen spiegelte sich plötzlich Erschrecken wider.
»Was hast du vor?«
»Ich werd in das Dorf gehen, wo sich alles abgespielt hat, und mich umschauen. Ich bin sicher, dass ich etwas herausfinden kann, was uns weiterhilft. Wer war eigentlich der Großbauer, von dem es heißt, dass er und die Mutter …«
»Hör auf, Stefan!«
Gregor Kastners Gesicht hatte einen gequälten Ausdruck angenommen.
»Lass die Vergangenheit ruhen, mein Sohn, ich will net, dass sie dir zur Last wird. Du kannst dadurch in große Gefahr kommen! Vielleicht ist der Mörder auch schon lange tot und hat für das Verbrechen gebüßt. Es ist ja so viel Zeit vergangen seitdem. Denk nur an dich, Stefan, und vergiss mich, damit nicht noch mehr Unglück geschieht.«
»Und du, Vater? Ich werd keine Ruh finden, bis das Unrecht, das man dir angetan hat, gesühnt ist.«
»Ich bin ein alter Mann, alt und abgelebt. Doch dich zu sehen, mein Sohn, war eine große Freude! Eine große Freude«, wiederholte Gregor Kastner und lächelte auf seine seltsame abwesende Art.
Stefans Herz krampfte sich zusammen.
»Bist du sehr krank, Vater?«, fragte er.
»Mach dir keine Sorgen um mich. Schau zu, dass du mit allem zurechtkommst, du hast noch dein ganzes Leben vor dir.«
Der Beamte, der taktvoll aus dem Fenster geblickt hatte, bedeutete den beiden, dass die Sprechzeit beendet sei.
»Versprich mir, dass du nichts Unbedachtes tust«, sagte Gregor, als er sich erhob, und in seiner Stimme lag ein Flehen, dem sich Stefan nicht entziehen konnte.
»Ich versprech’s dir, Vater«, versicherte er, »und ich werd dich bald wieder besuchen.«
Sein Vater lächelte, und Stefan wusste, dass die Erinnerung an dieses Lächeln ihn immer begleiten würde.
Er trat aus dem Gefängnistor und schlug fröstelnd den Kragen seines Jankers hoch. Ein dichter Nieselregen hatte eingesetzt und hüllte das triste Gebäude in graue Schleier.
Stefan wandte sich nicht mehr um, als er mit schnellen, harten Schritten die Straße überquerte.
***
»Möcht nur wissen, was das für einer ist«, sagte die Postwirtin abschätzig zu ihrem Mann. »Der kommt schon seit Tagen jeden Abend hierher, bestellt nur ein Bier und sitzt dann stundenlang davor. Nur ein Glück, dass wir net mehr solche Gäst haben.«
Der Wirt hielt ein Glas, das er gerade poliert hatte, gegen das Licht und warf einen Blick in die Richtung des jungen Mannes, der die Neugierde seiner Frau geweckt hatte.
Der Unbekannte drehte gedankenverloren das Bierglas in den kräftigen, verarbeiteten Händen. Seine Kleidung ließ vermuten, dass er ein Landarbeiter oder ein Holzfäller auf der Suche nach Arbeit war.
»Weißt du, beinah könnt man glauben, dass er die Leut beobachtet, auch wenn er es verbergen will. Sitzt da und lauert. Ich möchte mal wissen, auf was der aus ist. Aber solang er sich still verhält, kann es uns gleich sein. Er scheint ja ein ruhiger Gesell zu sein, wenn auch von der Sort, bei dem einem net wohl ist.«
»Ich hab auch die ganze Zeit über das Gefühl, dass er etwas im Schilde führt«, wiederholte seine Frau, ehe sie in der Küche verschwand.
Der Abend schritt voran, und die Gaststube füllte sich mit Dörflern. Am Stammtisch, wo die Honoratioren Tarock spielten, ging es bereits lebhaft zu. Man hatte reichlich Bier getrunken, die Stimmen wurden lauter und die Scherze, unterbrochen von heftigem Gelächter, immer deftiger.
Josef Aiblinger, der reichste Großbauer in der Umgebung, packte die aufkreischende Kellnerin derb um die Hüften, und er hätte sich wohl zu mehr hinreißen lassen, wenn ihn der Dorfpfarrer nicht so strafend angesehen hätte.
Mit gespielter Entrüstung ging Hanne, ein blühendes Mädchen Mitte zwanzig, zur Theke zurück und überlegte wieder einmal, wie sie den Aiblinger zu einem Eheversprechen verlocken könnte.
Nur der einsame Gast an seinem Eckplatz unter einem riesigen Hirschgeweih schien im Raum noch nüchtern zu sein. Seine kühlen Augen musterten forschend die Männer, die sich, unter ihresgleichen, völlig ungezwungen gaben.
Zu vorgerückter Stunde betrat ein Mann die Gaststube, dem die besondere Aufmerksamkeit des Fremden galt.
Franz Bieler durchquerte mit schlurfenden Schritten den Raum und blieb beim Honoratiorentisch stehen. Einst hatte auch er zu diesen Männern gehört, die ihn dann aus ihrer Mitte verbannt hatten.
Bieler hatte ein Sägewerk von seinem Vater geerbt und ein normales und zufriedenes Leben geführt, bis ihn ein Unfall aus der Bahn warf. Er war über dieses Unglück niemals hinweggekommen, litt ständig unter quälenden Schmerzen. Bald schon war er dem Alkohol verfallen, vertrank Haus und Hof.
Seine Frau sagte sich von ihm los, weil sie seinen Wutanfällen entkommen wollte, und das traf ihn am meisten. Die Dorfbewohner, die ihn anfangs bedauert hatten, brachten ihm danach nur noch Verachtung entgegen. Man machte ihm auf schonungslose Weise klar, dass er nirgends mehr erwünscht war und schon gar nicht am Tisch der Honoratioren.
Aber Franz Bieler rächte sich dafür: Fast jeden Abend schleppte er sich mühsam in die Gaststube, blieb am Honoratiorentisch stehen und goss in ätzenden Worten seinen Hohn über sie aus.
Trotz seiner fortschreitenden Trunksucht hatte er ein ausgezeichnetes Gedächtnis, und er verstand es, jede noch so kleine Verfehlung seiner früheren Freunde – und mochte sie auch Jahre zurückliegen – auf drastische Weise wieder in Erinnerung zu rufen.
Heute hatte er sich den Apotheker vorgenommen.
»Weißt du noch, wie du damals das Rezept für die Sonnleitnerin mit einem anderen verwechselt hast? Gerade noch davongekommen ist sie.«
Der Apotheker, in dessen Gesicht fleckige Röte gestiegen war, hieb mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Jetzt sei aber stad, Bieler! Müssen wir uns das eigentlich gefallen lassen, dass du uns in aller Öffentlichkeit verleumdest? Scher dich davon, oder der Postwirt wird dir zeigen, wo der Zimmermann das Loch gemacht hat!«
Franz Bieler kicherte böse und fuchtelte in der Luft herum.
»Kann mir schon denken, was in euren Köpfen vor sich geht! Wär euch am liebsten, ich würd auf dem Friedhof liegen, weil ich so viel von euch weiß.«
Sein Gesicht verzerrte sich zu einem höhnischen Lachen, und der Dorfpfarrer unternahm vergebliche Versuche, die wütenden Tischgenossen davon abzuhalten, Franz Bieler aus der Gaststube weisen zu lassen. Ehe es aber dazu kommen konnte, erklang plötzlich die Stimme des fremden jungen Mannes, dem niemand Beachtung geschenkt hatte.
»Setz dich halt hierher, da ist noch Platz für dich. Ein Weißes, Postwirt!«
Franz Bieler leistete dieser Aufforderung mit noch größerem Erstaunen Folge, als sie bei den anderen ausgelöst hatte.
»Du scheinst dich hier wirklich net auszukennen, obwohl ich dich schon vor ein paar Tagen hier sitzen gesehen hab«, meinte er mit unverhohlenem Spott, als er mühsam Platz genommen hatte.
Der junge Mann schwieg dazu und nahm einen maßvollen Zug aus seinem Bierglas.
Die Gasthausbesucher verloren nach einer gewissen Zeit das Interesse an dem seltsamen Paar, da die beiden ruhig beieinandersaßen und sich nur über oberflächliche Dinge zu unterhalten schienen. Der Unbekannte sorgte jedoch dafür, dass immer ein gefülltes Glas vor Bieler stand.
Wie alle Alkoholabhängigen nutzte dieser die Gelegenheit aus und ließ seinen Gönner häufig nachbestellen.
Ehe Franz jedoch völlig betrunken war, forderte ihn der junge Mann zum Aufbruch auf und verließ an seiner Seite die rauchgeschwängerte Gaststube.
»Da haben sich ja zwei seltsame Vögel zusammengetan«, meinte der Apotheker gehässig, als sich die Tür des Wirtshauses hinter ihnen geschlossen hatte.
Aiblinger warf unmutig seine Karten auf den Tisch, seine Brauen hatten sich düster zusammengezogen.
»Hab genug für heut, ist ja auch schon an der Zeit. Kann es net leiden, wenn ich beim Spielen abgelenkt werd, am wenigsten von dem Bieler. Ich wünscht wahrhaftig, man könnt seinem Treiben ein Ende machen. Hanne, zahlen!«
Die Kellnerin beeilte sich. Sie kannte besser als alle anderen Aiblingers Launen und wusste, dass in solchen Augenblicken nicht mit ihm zu spaßen war.
***
Franz Bieler, der schwer atmend stehen geblieben war, musterte – durch die kühle Nachtluft jäh ernüchtert – seinen Begleiter, dessen düsteres Gesicht ihm im schwachen Licht der Straßenlaterne geradezu bedrohlich erschien.
»Sag mal, wie heißt du denn eigentlich? Du bist net von hier, und doch erinnerst du mich an jemanden.«
»Stefan Lindacher ist mein Name, aber eigentlich heiß ich Kastner. Meine Eltern waren von hier. Erinnerst du dich jetzt?«
Franz Bieler fuhr so erschrocken zurück, dass er beinahe das Gleichgewicht verloren hätte und sich nach Halt suchend an den jungen Mann klammerte.
»Du bist der Sohn der Rosa – der schönen Rosa, wie wir sie hier immer genannt haben. Diese Ähnlichkeit! Nur hatte sie ganz helles blondes Haar …«
Er verstummte.
»Erzähl mir von meiner Mutter! Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Du hast sie also gekannt?«
Bieler nickte heftig.
»Es ist schon so lang her, und doch steht ihr Bild immer noch lebendig vor mir, als wären nur ein paar Tage vergangen. Ich werd sie nie vergessen, die Rosa.«
Stefans Gesicht zeigte kurz seine große Erschütterung, dann wurde es wieder hart und unnahbar.
»Sie hatte eine ganz besondere Art, mit anderen Menschen umzugehen. Sie war so heiter und voller Leben, aber auch wieder verständnisvoll, wenn ihr jemand von seinen Sorgen erzählte. Obwohl sie arm war, hat es ihr an Freundschaften net gemangelt. Sie war überall beliebt und gern gesehen. Natürlich hatte sie auch Neider, wie sich ja später auch gezeigt hat, als sie tot war.«
Bielers Stimme wurde brüchig, und er suchte mühsam nach den passenden Worten.
»Als sie tot war, wollt es niemand glauben, es war einfach unvorstellbar. Dann wandten sich alle gegen ihren Mann. Man war davon überzeugt, dass er sie aus Eifersucht umgebracht hatte. Da alles gegen ihn sprach, war man mit dem Urteil schnell bei der Hand.«
»Meine Mutter wurde als leichtfertig hingestellt, und mein Vater hatte keine Gelegenheit, sich gegen die Anschuldigungen zu wehren«, sagte Stefan bitter.
»Leider sah es bei der Verhandlung durch die Aussagen von ein paar neidischen Klatschweibern wirklich so aus, als hätte dein Vater allen Grund zur Eifersucht gehabt«, versuchte Franz Bieler zu erklären.
»Wer war eigentlich derjenige, mit dem meine Mutter angeblich ein Verhältnis gehabt haben soll?«, fragte Stefan unvermittelt und packte ihn mit einem schmerzhaften Griff am Oberarm.
»Unsinn, es gab keinen anderen Mann. Deine Mutter war eine anständige Frau. Das waren nur Hirngespinste, haltlose Gerüchte eben«, wich Bieler aus.
Er wollte sich aus Stefans erbarmungsloser Umklammerung befreien, doch der junge Mann gab nicht nach.
»Ich lass dich net aus, Bieler, und wenn wir die ganze Nacht hier verbringen müssen«, zischte er ihm ins Ohr.
»Du machst dich nur unglücklich! Lass das Vergangene doch endlich ruhen!«
Die armselige Gestalt Bielers zitterte und bebte, doch in Stefan war jegliches Mitgefühl erloschen.
»Und mein Vater? Hat jemand von euch schon amal an meinen Vater gedacht? Nur zu schnell habt ihr ihn verurteilt, nur weil er es war, den man neben seiner toten Frau gefunden hat. Er hat mir geschworen, dass er unschuldig ist, und ich glaube ihm. Wie kann ich das Vergangene ruhen lassen, wenn mein Vater elend und verlassen im Gefängnis sitzt? Er soll bald entlassen werden, doch wenn seine Ehre net wiederhergestellt ist, gilt ihm seine Freiheit nichts. Und ich möchte, dass das Schicksal ihn noch ein wenig für das Unrecht entschädigt, das ihm angetan worden ist.«
Franz Bieler hatte den Kopf gesenkt, und sein Körper schien noch mehr in sich zusammenzuschrumpfen.
»Ich kann mir net denken, dass er etwas damit zu tun hat, wahrhaftig net …«
»Sag schon«, forderte Stefan unnachgiebig.
Franz Bieler flüsterte ihm fast unhörbar den Namen zu und erschrak über die Veränderung, die in Stefans Gesicht vor sich ging.
»Jesses – komm net auf falsche Gedanken. Er ist ein Schürzenjäger, das stimmt, aber er hat noch keinem Madl was zuleid getan«, stammelte er.
»Ich bring dich nach Hause«, sagte Stefan, ohne auf Bielers Worte einzugehen, »und du hältst den Mund, hast du verstanden?«
Franz Bieler wohnte in einem Anbau eines alten Hauses am Dorfausgang.
»Und du, Lindacher, wo übernachtest du? Hast du dir irgendwo ein Zimmer gemietet?«, fragte er Stefan, als er zitternd den Schlüssel hervorsuchte.
Dieser zuckte gleichmütig mit den Schultern.
»Mach dir um mich amal keine Sorgen, Bieler, ich komm schon alleine klar.«
Er hatte, obwohl die Frühlingsnächte noch sehr kühl waren, in einer Scheune geschlafen. Gesund und abgehärtet, wie er war, hatte ihm das nicht geschadet. Bieler dachte sich seinen Teil und bot ihm an, die Nacht in seiner Wohnung zu verbringen.
»Ist halt sehr eng und grad net nobel, musst dich halt mit ein paar Decken begnügen.«
Stefan nahm widerstrebend an. Nachdem sie eingetreten waren, machte er sich ein Lager auf dem Fußboden zurecht. Beiläufig fragte er, wo seine Eltern gewohnt hätten und ob das Haus noch existierte.
»Ja, freilich existiert das Haus noch, obwohl es halb verfallen ist. Die Gemeinde hat vergeblich versucht, es wieder zu vermieten, doch niemand will dort einziehen. Das Mörderhaus wird es von den Dörflern genannt, abergläubisch, wie sie sind. Angeblich spukt es dort sogar. Net amal die Kinder trauen sich, dort zu spielen. Du hast doch net etwa vor, dort zu wohnen?«
»Ich hab dort meine ersten Lebensjahre verbracht. Ich möchte es mir gern ansehen.«
Franz Bieler murmelte etwas Unverständliches, das sehr besorgt klang, und zog dann die Decke bis zur Kinnspitze hoch. Bald verkündeten schnarchende Atemzüge, dass er eingeschlafen war.
Nur Stefan Lindacher lag noch lange wach und starrte mit weit geöffneten Augen in das Dunkel.
***
Es war leicht gewesen, in das Haus einzudringen. Die Scharniere waren verrostet, und die Fensterläden hingen lose in den Angeln.
Stefan öffnete an der Seite, die nicht einsehbar war, weit das Fenster, dass helles Morgenlicht hereinflutete. Staubteilchen tanzten in den Sonnenstrahlen, die Luft war aber immer noch dumpf und schwer.
Stefan blieb zögernd mitten im Raum stehen, der keinerlei vertraute Gefühle in ihm weckte. Die wenigen Gegenstände, die zurückgelassen worden waren, trugen eine dicke Staubschicht, und Spinnweben hingen von der Decke herab.
Trotz der heiteren Frühlingsstimmung und des hellen Vogelgezwitschers, das von draußen hereinklang, fror Stefan.
Er hatte Mühe, Angst und Beklommenheit abzuschütteln, dann aber begann er damit, das Haus gründlich zu untersuchen. Es sah aus, als sei es ausgeplündert worden, und Stefan dachte mit Erbitterung an seinen Onkel, der wohl alles mitgenommen oder verkauft hatte, was irgendetwas wert war.
Stefan öffnete die Schubladen einer wurmstichigen Kommode, rückte sie von der Wand ab und betastete die Rückseite. Dann stieg er in den Keller hinab, wo er außer einem Rattennest und ein paar zersplitterten Flaschen nichts fand.
Er war niedergeschlagen und erschüttert, war doch dieses Haus Sinnbild für das zerstörte Leben seiner Eltern, deren Ehe so glücklich begonnen hatte.
Als er sich auf einen Stuhl mit einer zerbrochenen Lehne setzen wollte, fiel ihm auf, dass dieser, im Gegensatz zu den anderen Möbelstücken, nur mit einer dünnen Staubschicht bedeckt war, und verwundert überprüfte er ihn. Auch auf dem Boden – der Stuhl stand in Türnähe – waren Spuren festzustellen, die darauf hindeuteten, dass jemand vor einiger Zeit das Haus betreten hatte. Sein Verdacht wurde dadurch noch verstärkt, als er am rostigen Schlüsselloch Ölspuren entdeckte.
Wer mochte einen Schlüssel zu dem Haus besitzen und sich manchmal darin aufhalten? Ein junges Paar vielleicht? Doch Stefan erschien diese Möglichkeit unglaubwürdig, denn dieser düstere Ort war für ein Liebesversteck wenig geeignet.
Unwillkürlich kam ihm die Behauptung der Dörfler in den Sinn, dass es in diesem Haus nicht geheuer sei. Doch konnte dieser Spuk nicht auch ganz natürliche Ursachen haben?
Stefan beeilte sich, alles, was seine Anwesenheit verraten könnte, so gut es ging, zu verwischen. Als er das Haus verließ, sah er sich sichernd um, doch niemand befand sich in der Nähe des kleinen Anwesens, und er war froh, dass niemand ihn beobachtet hatte.
Nachdenklich machte er sich auf den Rückweg zu Bieler, der ihm vorerst Unterkunft angeboten hatte. Franz hatte ihm nochmals versprechen müssen, dass er die Identität seines fremden Gastes nicht preisgab, und er wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte.
Er fand Bieler dabei vor, wie er an seinem halb verrosteten Herd eine Eierspeise anrührte. Jetzt, im hellen Tageslicht, wurde die Armseligkeit und Verwahrlosung des Raumes noch deutlicher. Unwillkürlich empfand Stefan heftiges Mitleid mit Franz Bieler, der so ins Elend herabgesunken war.
Stefan steuerte Brot und Schinken, beides hatte er unterwegs im Dorf gekauft, zu dem bescheidenen Mahl bei. Schweigend aßen sie. Mittags hackte er hinter der Hütte Holz und stapelte es säuberlich an der Hauswand auf. Als er fertig war, trat er zu Bieler, der auf der Bank neben der Eingangstür in der Frühlingssonne saß.
Sein Kopf war herabgesunken, offensichtlich hatte ihn die Müdigkeit überwältigt. Er fuhr erschrocken hoch, als Stefans Schatten auf ihn fiel.
»Ich wollt dich net erschrecken, Franz«, sagte Stefan beruhigend, »das Holz ist …«
Er verstummte und sah mit zusammengekniffenen Augen zur Dorfstraße hin, auf der ein schlankes, hochgewachsenes Mädchen mit einem Einkaufskorb entlangschritt. Es kam rasch näher, und der junge Mann starrte es wie gebannt an.
Das Mädchen hatte schöne ebenmäßige Gesichtszüge, die jedoch jede Weichheit vermissen ließen. Das volle schwarze Haar war in der Mitte gescheitelt und zu einem üppigen Nackenknoten zusammengefasst, am auffallendsten aber waren die großen graugrünen Augen.
Es trug ein dunkelgrünes Dirndl, dessen weiter Rock um seine Waden schwang.
Als das Mädchen auf gleicher Höhe mit Stefan angelangt war, trafen sich sekundenlang ihre Blicke. Der junge Mann spürte, wie eine heiße Lohe in ihm emporwallte.
»Grüß dich Gott«, sagte er schnell, doch das Mädchen erwiderte den freundlichen Gruß nicht. Es wandte noch nicht einmal den Kopf, sondern sah gleichsam durch ihn hindurch.
Stefan sah der schlanken Gestalt nach, bis sie hinter einer Wegbiegung verschwunden war.
»Wer ist denn dieses Mädchen?«, stieß er hervor, sein Herzschlag hatte sich beschleunigt.
Franz Bieler blinzelte in die Sonne.
»Das war die Aiblinger-Klara.«
»Doch net etwa die Tochter von dem Aiblinger …« Stefan war völlig aus der Fassung gebracht.
»Da staunst du, was? Doch – sie ist die Tochter von eben dem Aiblinger. Der Vater von dem Madl war schon nach kurzer Ehe Witwer, und es ist ihm gar net gut bekommen. Du hast ja gestern gesehen, wie er sich aufführt. Glaubt, weil er reich ist, kann er sich alles erlauben. Leider hat er seine Tochter auch so erzogen, sie ist net nur das schönste und reichste, sondern auch das hochmütigste Madl im ganzen Tal. Von unsereins will die nichts wissen.«
»Sicher hat sie es schwer mit ihrem Vater«, versuchte Stefan das Mädchen zu verteidigen.
Franz Bieler stieß ein kurzes, höhnisches Lachen aus.
»Von wegen! Er erfüllt ihr jeden Wunsch. Von Kind an hat er sie maßlos verwöhnt. Ein Wunder, dass sie es trotzdem gelernt hat, tüchtig mit anzupacken. Und sie wiederum vergöttert ihren Vater und ist blind gegen seine Fehler. Der Aiblinger hat sogar wegen dem Madl net wieder geheiratet, weil die Klara keine Stiefmutter haben soll.«
»Ich hab noch nie so ein schönes Madl wie die Klara Aiblinger gesehen«, sagte Stefan selbstvergessen.
Franz Bieler musterte ihn unter gerunzelten Brauen.
»Na, dich hat es wohl erwischt? Aber da hast du nichts zu melden, net nur, weil du ein armer Schlucker bist. Die Klara ist mit dem Kirchner-Hannes verlobt. Der soll später auch amal den Aiblingerhof übernehmen, denn der Alte würd die Klara net weggehen lassen. Da der Hannes mehr als genug mitbringt und auch noch eine größere Erbschaft von seiner Tante her erwartet, steht also alles zum Besten.«
»Aus der Heirat wird nichts werden«, unterbrach Stefan den Redestrom des alten Mannes. In seinem Gesicht stand ein so seltsamer Ausdruck, dass Franz Bieler für einen Augenblick betroffen schwieg.
»Setz dir nur nichts in den Kopf, das führt zu nichts Gutem, hast du gehört?«
Mühsam, mit einer Hand abgestützt, erhob er sich.
»Ich glaube, ich will doch noch einen Mittagsschlaf halten, auch wenn es schon ein bisserl zu spät dazu ist«, murmelte er vor sich hin und gähnte.
Um den Alten nicht zu stören und auch weil er jetzt allein sein wollte, ging Stefan quer über die Wiesen und Felder, bis er an den Waldrand gelangte. Dort setzte er sich auf einen gefällten Baumstamm.
Er war völlig aufgewühlt von der Begegnung mit dem jungen Mädchen, es war ihm, als sei ein Traumbild, das er schon lange in seinem Herzen getragen hatte, nun plötzlich Wirklichkeit geworden. Auch das Verhalten Klara Aiblingers konnte daran nichts ändern. Er wusste, dass der Augenblick, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, entscheidend für sein ganzes weiteres Leben war.
Und sie war die Tochter Josef Aiblingers. Trotz des Versprechens, das er seinem Vater gegeben hatte, hatte es Stefan hierhergezogen, wo sich die Tragödie seiner Eltern abgespielt hatte. Zunächst allerdings hatte er ihm gehorcht und in der Nähe der Kreisstadt auf einem Hof gearbeitet. Es war ihm nicht schlecht ergangen in dieser Zeit. Der Bauer hatte ihn anständig behandelt und war auch nicht knauserig gewesen. An seinen freien Tagen hatte Stefan seinen Vater besucht, der immer hinfälliger wurde. Allmählich hatte sich ein enges Verhältnis zwischen ihnen entwickelt.
Auch mit Agnes und seiner Tante hatte er sich einige Male getroffen. Das Zusammensein mit dem jungen Mädchen gehörte zu den unbeschwertesten Stunden, an die er sich in seinem Leben erinnern konnte.
Sein ganzes Mitgefühl galt seiner Tante, die immer bitterer wurde, weil sich die Söhne völlig vom Elternhaus gelöst hatten und ihr Mann lieber im Wirtshaus saß als zu Hause. Heimlich hatte er ihr etwas Geld zugesteckt, aber ihre Dankesbezeugungen waren ihm fast unerträglich gewesen.
Stefan hatte seinem Vater zwar anvertraut, dass er sich woanders Arbeit suchen würde, doch er hatte ihm verschwiegen, dass er die Absicht hatte, in seinen Geburtsort zurückzukehren.
Er handelte wie unter einem Zwang. Immer drängender wurde in ihm der Wunsch, seinen Vater von der Schuld an dem Verbrechen, das man ihm angelastet hatte, befreit zu wissen. Vielleicht auch, weil er instinktiv wusste, dass ihm das Schicksal dazu nur noch eine kurze Frist gönnen würde. Doch zunächst war er zum Abwarten verurteilt. Der Mantel des Vergessens hatte sich über das Geschehen gebreitet, und es würde schwer sein, die Wahrheit aufzudecken.
Er hoffte, wenigstens in Franz Bieler einen Verbündeten gefunden zu haben. Zwar wagte der Unglückliche es nicht, einen Verdacht zu äußern, doch er war so voller Hass auf die Dörfler, dass er ihn vielleicht bei seinem Vorhaben unterstützen würde.
***
»Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Vater plötzlich verstorben ist. Wir konnten Sie nicht verständigen, weil uns Ihre Anschrift nicht vorlag.«
Trotz seiner nüchternen Worte spiegelte sich Mitleid in den Augen des Vollzugsbeamten wider. Stefan taumelte zurück, alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
»Er … er ist tot?«, stammelte er.
Obwohl er vor Schmerz wie betäubt war, durchzuckte ihn der Gedanke, dass nun alles umsonst gewesen war. Mühsam fasste er sich wieder.
»Was war die Todesursache? Steht das schon fest?«, fragte er heiser.
»Herzversagen, das kam völlig unerwartet. Ihr Vater ist im Schlaf gestorben, er hat nicht gelitten.«
Der Beamte händigte Stefan die wenigen Habseligkeiten seines Vaters und dessen Papiere aus und teilte ihm außerdem mit, dass er noch Anspruch auf ein kleines Guthaben hätte.
Später irrte Stefan ziellos durch die Straßen der Stadt. Das Bündel mit den Sachen seines Vaters hielt er an sich gepresst.
Schließlich betrat er ein kleines Lokal und bestellte sich etwas zu essen, doch dann schob er den Teller bald von sich und versank in dumpfes Grübeln.
Der Schmerz über den Verlust erfüllte ihn, verstärkt durch die bittere Erkenntnis, dass es ihm nicht gelungen war, rechtzeitig die Unschuld zu beweisen.
Zu spät, zu spät! Diese Worte kreisten immer wieder hinter seiner Stirn, und tiefe Hoffnungslosigkeit bemächtigte sich seiner. Stefan fühlte sich verlassen und entwurzelt und jeglichen Lebensinhalts beraubt.
Den Rest des Tages streifte er ziellos durch die Straßen. Abends mietete er sich in einer billigen Pension ein und verbrachte dort eine schlaflose Nacht. Am nächsten Tag erledigte er noch einige Formalitäten, die mit dem Tod seines Vaters zusammenhingen, dann machte er sich auf den Weg zum Bahnhof.
Er war nicht imstande, das Grab seines Vaters zu besuchen, er wusste, dass das über seine Kräfte gegangen wäre. Ganz selbstverständlich und als habe er nie etwas anderes vorgehabt, löste er eine Fahrkarte zu seinem Geburtsort.
Etwas in ihm zog ihn mit magischer Kraft dorthin zurück. Erst wenn er sich Gewissheit verschafft hatte, konnte ein neuer Lebensabschnitt für ihn beginnen.
***
»Schau, da kommt er, der Spezi vom Bieler!«
Die Burschen stießen sich gegenseitig an, als Stefan den großen Saal des Wirtshauses Zur Post betrat, der anlässlich des Schützenfestes üppig geschmückt war.
»Ein Schandfleck für das ganze Dorf ist er, der Nichtsnutz. Genau wie der Bieler-Franz, der elende alte Säufer, bei dem er Unterschlupf gefunden hat«, hieß es.
»Lungert herum, der Faulenzer, und denkt gar net daran, sich sein Brot zu verdienen«, sagte Quirin Wiesner gehässig.
Doch auch Neid schwang in seiner Stimme mit, denn ihm war nicht entgangen, dass die Blicke der Mädchen dem hochgewachsenen jungen Mann folgten. Quirin dagegen wirkte selbst in seinem maßgeschneiderten Lodenanzug für einen Mann seines Alters viel zu schlaff und schwerfällig.
Stefan kümmerte sich nicht darum, was um ihn herum vor sich ging. Er setzte sich und trank ein Bier, wobei sein Blick hin und wieder den Honoratiorentisch streifte.
Gerade als die Musiker anfingen, ihre Instrumente zu stimmen, kündigte das Geraune und Gezischel, das plötzlich durch den Saal ging, den Eintritt von Festbesuchern an, denen die besondere Aufmerksamkeit der Dörfler galt. Unwillkürlich hob Stefan den Kopf, und sein Blick umfing Klara Aiblinger, die, begleitet von ihrem Vater und Hannes Kirchner, den Saal durchquerte.
Sie trug ein langes Festdirndl aus schwerer grüner Seide, kostbarer Goldschmuck schimmerte an ihrem Hals. Die kunstvoll zu einer Krone aufgesteckten Haare verstärkten noch das Würdevolle ihrer Erscheinung.
Stefan versank völlig in ihrem Anblick und verfolgte mit, wie sie mit der Andeutung eines Lächelns nach rechts und links grüßte. Hannes Kirchner rückte ihr fürsorglich den Stuhl zurecht, damit sie Platz nehmen konnte.
Unentwegt beobachtete Stefan Lindacher das junge Mädchen. Ihr Vater hatte sich schon bald zu seinen Stammtischbrüdern gesellt, wohl auch in der Absicht, das junge Paar sich selbst zu überlassen.
Hannes Kirchner schien heftig in seine zukünftige Frau verliebt zu sein. Man merkte ihm an, wie gerne er seiner Leidenschaft noch stärker Ausdruck verliehen hätte. Doch Klaras kühle Zurückhaltung, die Art, wie sie mit ihm tanzte, verbot jede Zärtlichkeit. Sie plauderte mit jener zuvorkommenden Freundlichkeit, die Vertrautheit und Nähe nur vortäuschte. Auffallend war, dass keiner der anderen Burschen es wagte, sie zum Tanz aufzufordern. Offensichtlich hielt Klara es für angemessen, sie seit ihrer Verlobung zurückzuweisen.
Ein ironisches Lächeln umspielte Stefans Mund. Klara Aiblinger gehörte zu den Menschen, die aus Hochmut einen vorbildlichen Lebenswandel führten und alles vermieden, was ihr Herz in Aufruhr bringen könnte, um sich desto leichter über andere zu erheben.
Unvermittelt stand Stefan auf und betrat die Tanzfläche, wo Klara gerade mit ihrem Verlobten so gemessen einen langsamen Walzer tanzte, als wären sie schon ein altes Ehepaar. Als Stefan Hannes am Arm berührte, hielt dieser überrascht inne und sah ihn mit einem offenen Lächeln an, in dem kein Argwohn war.
»Nimm mir’s net übel, Kirchner, aber lass mir dein Madl für einen Tanz!«
Hannes war viel zu klug, um deswegen einen Auftritt heraufzubeschwören.
»Wenn die Klara nichts dagegen hat. Sie musst du fragen, net mich.«
Die Augen des jungen Mädchens sprühten, doch ehe sie zu einer heftigen Entgegnung ansetzen konnte, hatte Stefan sie umfasst und wirbelte sie herum.
Aber er hatte sie offenbar unterschätzt, denn sie riss sich von ihm los.
»Komm mir net zu nah, du Bazi! Mit so einem wie dir hab ich nichts zu schaffen!«, rief sie erbost.
Ein paar Burschen, voran Quirin Wiesner, der endlich die Gelegenheit witterte, Stefan zu demütigen, umringten die beiden. Die Musik brach mit einem schrillen Misston ab.
»Ist er dir zu nah gekommen?«, fragte Quirin und schob sich, die Daumen angeberisch hinter den Hosenbund geklemmt, angriffslustig an Stefan heran.
»Darf man bei euch net amal mit einem sauberen Madl tanzen?«, kam Stefan Klaras Antwort zuvor.
»Einer wie du ganz bestimmt net«, erwiderte Quirin Wiesner und versetzte Stefan einen tückischen Stoß gegen das Brustbein, der manch anderen zu Fall gebracht hätte.
»Du schlaffer Mehlsack!«, rief Stefan aufgebracht und holte blitzschnell aus.
Mit einem dumpfen Geräusch schlug Quirin auf dem Boden auf, sein Gesichtsausdruck war, gelinde gesagt, dümmlich. Die anderen stürzten sich auf Stefan, und jemand versetzte ihm einen derart harten Schlag auf den Mund, dass Blut hervorquoll.
»Lass ihn aus! Ihr werdet euch doch net an einem Wehrlosen vergreifen wollen!«, rief Hannes Kirchner dazwischen, und da sein Wort etwas galt, ließen die Burschen schließlich murrend von ihrem Opfer ab.
Stefan richtete sich auf, mit der Hand tastete er nach seinem blutenden Mund. Unverwandt sah er Klara Aiblinger an.
»Du wirst eines Tages noch froh sein, wenn du mit einem wie mir tanzen darfst«, brachte er mühsam hervor, und es klang wie eine Drohung.
Alle Farbe war aus Klara Aiblingers Gesicht gewichen, und sie lachte böse auf.
»Scher dich weg! Ich lass mir net drohen! Etwas anderes bleibt dir ja net übrig als leeres Gerede, weil du ein Nichts bist. Hast du gehört – ein Nichts!«
Der Blick, mit dem Hannes Kirchner ihre hassverzerrten Züge musterte, hätte sie nachdenklich stimmen müssen, doch weder sie noch Stefan schienen die Umstehenden wahrzunehmen.
»Komm, ich bring dich weg von hier.«
Zur Überraschung aller ergriff Hannes Kirchner Stefan sacht, aber unnachgiebig am Arm und führte ihn hinaus. Jetzt erst spürte Stefan die Schmerzen.
»Soll ich dich zum Arzt bringen? Deine Oberlippe schaut gar net gut aus und muss vielleicht genäht werden.«
Stefan erkannte echte Besorgnis in Kirchners Augen.
»Du bist sehr freundlich und viel zu gut für …« Stefan verschluckte den Rest des Satzes. »Ich komm schon allein zurecht. Aber trotzdem vielen Dank, Kirchner.«
***
Hannes kehrte danach in den Saal zurück, wo die Musik wieder spielte und sich die Paare im Tanz drehten, als sei nichts geschehen. Quirin Wiesner ließ sich, wehleidig auf einem Stuhl zurückgelehnt, von seinen Spezis trösten. Obwohl sein feistes Kinn nur eine leichte Schwellung aufwies.
»Wenn ich den erwisch, den Halunken«, grummelte er immer wieder, während er sich langsam betrank.
Seine Spezis nickten zustimmend und bestellten auf seine Rechnung eine Maß nach der anderen.
Klara blickte ihren Verlobten, der inzwischen zu ihr zurückgekehrt war, aus schmalen Augen an. Ihr schönes Gesicht war immer noch sehr blass.
»Warum hast du ihn net noch nach Hause gebracht und ihm ein Schlaflied gesungen! Was macht es denn schon aus, dass er mich beleidigt hat! Du bist schlimmer als ein ganzer Verein wohltätiger alter Jungfern«, fuhr sie ihn bösartig an.
Sie hatte noch nie in diesem Ton mit ihm gesprochen, obwohl er schon mehrmals Zeuge ihrer Heftigkeit gewesen war. Wieder trat jener nachdenklich-prüfende Ausdruck in seine Augen, als er Klara schweigend ansah.
»Es hat dir wohl die Sprache verschlagen, oder meinst du, es gibt nichts mehr zu sagen zu der ganzen Sach«, stieß sie hervor.
»Doch, Klara, dazu gibt es noch allerhand zu sagen. Vor allem, dass du dich unklug verhalten hast. Warum hast du eigentlich so ein Geschrei angestimmt, nur weil ein Bursche mit dir tanzen wollt? Dafür gab’s doch überhaupt keinen Grund. Ich hab euch beobachtet, und du kannst net behaupten, dass er sich etwas herausgenommen hätt. Anstatt dich ein bisserl zusammenzunehmen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, hast du dich aufgeführt wie eine Giftnocken.«
Sie sah ihren Verlobten fassungslos an, dann erhob sie sich.
»Ich will nach Hause! Das Fest ist mir gründlich verdorben«, herrschte sie ihn an.
»Sei doch net kindisch! Komm, trink ein Glaserl Wein und beruhige dich wieder.«
Ihr Vater, der sich bisher wohlweislich aus der Auseinandersetzung herausgehalten hatte, versuchte seine aufgebrachte Tochter zu beschwichtigen, doch vergebens.
»Ich bin net kindisch! Von meinem zukünftigen Mann kann ich schließlich erwarten, dass er auf meiner Seite steht und mich vor Belästigungen schützt. Bring mich sofort nach Hause, Vater, sonst geh ich fei allein.«
Auch Hannes war bleich geworden.
»Und von meiner zukünftigen Frau kann ich erwarten, dass sie net aus einer Laune heraus eine Wirtshausrauferei anzettelt, sondern sich benimmt wie ein erwachsener Mensch!«
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging auf den Tisch zu, an dem seine Eltern und Geschwister saßen.
Aiblinger war das Blut in die Stirn gestiegen, ihm kam dieser Zwischenfall äußerst ungelegen. Gerade war er dabei gewesen, mit dem alten Kirchner einen günstigen Handel abzuschließen.
Noch mehr beunruhigte ihn auf der Heimfahrt allerdings Klaras eisiges Schweigen.
Aiblinger lag sehr daran, dass die Heirat zwischen Hannes und Klara zustande kam.
»Warst du net ein bisserl zu unwirsch zu dem Hannes, Klärchen? Ich find, so unrecht hat er net gehabt«, begann er vorsichtig.
Klara stieß einen verächtlichen Laut aus.
»Wenn er ein rechtes Mannsbild wär, hätt er fei net zugelassen, dass dieser … dieser Hergelaufene mit mir tanzt. A Feigling ist er, der Hannes!«
»Jetzt sei aber stad, Klärchen. Der Hannes ist vernünftiger als jeder andere Bursch im Dorf. Ein Feigling wär er, wenn er zu allem Ja und Amen sagen tät. Und heut hast du ja gesehen, dass sogar du net so mit ihm umspringen kannst, wie du es gerne hättest. Ich kann deinen Zorn auf diesen Hergelaufenen verstehen, aber der ist es doch sicher net wert, dass du dich deshalb mit dem Hannes überwirfst. Was glaubst du, wie der sich ins Fäustchen lachen tät, dann hätt er es ja geschafft, Unfrieden zu stiften!«
»Dieser Nichtsnutz«, sagte sie leise und kaum verständlich, und es schwang ein solcher Hass in ihrer Stimme mit, dass ihr Vater zusammenzuckte.
Sie schwieg den Rest des Weges. Als sie in die Stube trat, goss sich das Mädchen gegen seine sonstige Gewohnheit einen Klaren ein und trank ihn mit einem Zug.
»Du hast recht, Vaterl«, sagte Klara dann beherrscht. »Es wär wahrhaftig dumm, mich mit dem Hannes so kurz vor der Hochzeit zu streiten, noch dazu wegen einer solchen Sache!«
Ihre Worte klangen beiläufig, ihr Gesicht war starr und kalt. Aiblinger war erleichtert, Klaras kühl berechnender Verstand hatte wieder die Oberhand gewonnen.
»Das ist gut so, Klärchen, ich weiß doch, dass du mein kluges Madl bist.«
Er sprach mit ihr so sanft wie in ihren Kindheitstagen, was noch nie seine Wirkung auf sie verfehlt hatte.
»Am Sonntag laden wir die Kirchners ein, das ist eh längst überfällig. Dann kannst du dich mit dem Hannes aussprechen, ich bin davon überzeugt, dass er dir auf halbem Weg entgegenkommen wird. Du brauchst dir also nichts zu vergeben. Wenn man jung und heftig ist, gerät man sich leicht in die Haare, aber umso schöner ist die Versöhnung. Daher sollst du net so halsstarrig sein, Madl. Merk dir das für die Ehe, sonst ist das Glück zum Fenster hinaus.«
Aiblinger, der sich um seine eigene Ehe keine Gedanken gemacht und seine Frau bei jeder sich bietenden Gelegenheit bedenkenlos betrogen hatte, gefiel sich in der Rolle des weisen Ratgebers. Er goss seiner Tochter noch einen Enzian ein.
Klaras Züge verloren den starren Ausdruck, und sie umhalste den Vater, ihre Wange an seine schmiegend. Zärtlich streichelte er den Rücken des Mädchens.
»Und weißt du, mit diesem Reingeschmeckten, der so viel Unruhe stiftet, werd ich kurzen Prozess machen. Der kommt dir bald nimmer unter die Augen. Ich lass net zu, dass einer meinem Madl wehtut«, murmelte er verschwörerisch an ihrem Ohr. »Und jetzt denkst du nimmer dran! Denk lieber an deine Hochzeit, das soll ein Fest werden, wie man’s hier noch nie erlebt hat. Der Hannes hat dich außerdem wirklich lieb, er wird dir ein guter Ehemann werden.«
Ein Laut wie ein Schluchzen brach aus ihrem Mund.
»Aber dich hab ich am allerliebsten, Vaterl.«
»Aber Klärchen, du bist halt noch ein rechtes Kind.«
Er wiegte sie in seinen Armen, seinen Triumph verbergend.
***
Hannes Kirchner kam Klara nicht auf halbem Wege entgegen, wie es ihr Vater prophezeit hatte. Er verbrachte die Abende nicht mehr auf dem Aiblingerhof, sondern machte sich zu Hause nützlich. Da seine Familie Zeuge der Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Verlobten gewesen war, stellte man ihm keine neugierigen Fragen.
Hannes war wortkarg geworden und grübelte vor sich hin. Sein klarer Verstand sagte ihm, dass Klara Eigenschaften besaß, die kaum dazu geeignet waren, eine Ehe mit ihr glücklich werden zu lassen. Hellsichtig hatte er außerdem erkannt, dass sie ihren Vater auf eine Art und Weise liebte, die keine gute Voraussetzung für eine Beziehung bot. Klara hatte sich nicht von ihm gelöst, und er bezweifelte, ob sie je willens dazu sein würde.
Trotz dieser Überlegungen verbot er sich, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Er sah sie vor sich, schön und blühend, und Leidenschaft wallte in ihm empor und löschte alle Bedenken aus. Er liebte Klara und verzehrte sich nach ihr, und dieses Gefühl war stärker als alle Vernunft.
Sie wird sich ändern, wenn wir erst einmal verheiratet sind , dachte er, die Mutterschaft wird sie bestimmt reifer und auch gütiger machen .
Als sie am nächsten Sonntag vor ihm stand, lächelnd und heiter, schwanden seine ganzen Bedenken dahin, und er dachte nur noch, dass er sie und keine andere zur Frau haben wollte.
Ehe sie etwas sagen konnte, nahm er sie zärtlich in die Arme und bat sie um Vergebung, weil er sie nicht schon früher besucht und sich mit ihr ausgesöhnt hatte.
Weder Aiblinger noch die Kirchners gaben sich Mühe, ihre Erleichterung zu verbergen, als sich das junge Paar in bestem Einvernehmen zeigte. Man erhob das Glas auf ihr Wohl und ging dazu über, Einzelheiten der Hochzeitsvorbereitungen zu besprechen.
***
»Weißt du es schon, Stefan, weißt du, was …«
Franz Bieler stand stammelnd und zitternd vor dem Haus, als Stefan spät von der Arbeit – er half einem Bauern bei Waldarbeiten – heimkehrte.
»Was hat’s denn gegeben?«
Stefan klopfte dem Alten auf die Schulter und versuchte ihn zu beruhigen.
»Die Unterkunft haben’s uns aufgekündigt, ab sofort! Wo sollen wir denn jetzt hin? Ich kann keine höhere Miete bezahlen«, brachte Bieler verzweifelt hervor.
Sein Atem roch nach Alkohol, und seine Augen waren rot umrändert. Offensichtlich hatte er seinen Kummer zunächst einmal mit billigem Fusel betäuben wollen.
»Was wurde denn als Grund für die Kündigung angegeben? Du wohnst doch jetzt schon seit Ewigkeiten hier, ohne dass man dir Schwierigkeiten gemacht hat.«
Sie waren in das Hausinnere gegangen. Stefan ließ sich auf den wackligen Küchenstuhl sinken, die Blasen in seinen Handinnenflächen brannten.
»Was für ein furchtbarer Tag heute! Beinahe hätt mich ein Baumstamm erschlagen«, sagte er zutiefst erschöpft, um dann unvermittelt zu fragen: »Wer ist denn bei der Gemeinde zuständig für diesen schäbigen Verschlag?«
»Der Riedinger-Alois. Das ist ein Spezi vom Aiblinger, sie haben immer was miteinand zu mauscheln.«
Franz Bieler verstummte und vermied es, Stefan anzublicken.
»Hat er dir net gesagt, so ganz im Vertrauen, du könntest bleiben, wenn du mich vor die Tür setzen tätst? Es ist dir ja klar, dass der Aiblinger hinter der ganzen Sach steckt, weil ich seiner hochwohlgeborenen Tochter zu nah getreten bin. Er will mich aus dem Dorf herausekeln.«
Franz wollte zuerst alles ableugnen, dann gab er jedoch zu, dass Stefans Vermutung zutraf.
»Aber ich bleib auch net, wenn’s dich raushaben wollen«, erklärte er mehrmals eigensinnig.
»Sei stad! Ich will net, dass du durch mich Ärger bekommst. Du gehst zum Riedinger und sagst, dass du mich rausgeworfen hättest, weil ich unverschämt geworden wär. Das wird ihm gefallen und dem Aiblinger noch mehr.«
»Das werd ich net tun, das kannst du net von mir verlangen«, protestierte Franz Bieler aufgebracht.
»Doch, denn es passt mir ganz gut. Ich werd nämlich von hier verschwinden. Oder besser gesagt, es wird so aussehen, als hätt ich mich vom Aiblinger einschüchtern lassen und wär auf und davon. In Wirklichkeit aber bleib ich in der Näh, und du wirst schon noch von mir hören.«
Franz Bieler sah ihn beunruhigt an.
»Was hast du vor, Stefan? Tu nichts, was du später amal zu bereuen hast.«
»Keine Angst! Du wirst schon noch früh genug erfahren, was ich vorhab.« Ein lautloses Lachen kam von Stefans Lippen, das Bieler mit Furcht erfüllte. »Ich werd es dir aber net vergessen, dass du zu mir gehalten hast. Und eines Tages, hoff ich, werd ich es dir auch vergelten können. Dann wirst du es besser haben, das versprech ich dir, Franz!«
Im Morgengrauen schlich Stefan leise aus der Hütte, um den Alten nicht zu wecken. Er hatte ihm etwas Geld auf den Küchentisch gelegt, was ihm über die nächste Zeit hinweghelfen sollte.
Als er die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte, wandte er sich noch einmal um. Während er mit zusammengekniffenen Augen die im Morgennebel zerfließenden Umrisse des Dorfes betrachtete, nahm der Plan, mit dem er sich schon lange trug, langsam Gestalt an.
***
Aiblinger durchquerte gerade eine kleine Waldung, die den Weg zu seinem Hof abkürzte, als er ein leises Geräusch hinter sich wahrnahm. Er blieb stehen und wandte sich halb um.
»Ist da jemand?«
Seine Augen, die noch nichts von ihrer Schärfe eingebüßt hatten, erforschten jede Einzelheit seiner Umgebung. Er verharrte noch einige Zeit mit angespannten Sinnen an der gleichen Stelle. Sein Herz hämmerte, und eine jähe Atemnot befiel ihn.
Warum kann ich net damit aufhören, warum muss ich immer wieder dorthin gehen, obwohl es mich zugrund richtet? Die Vergangenheit ist tot, tot und begraben! Was nur treibt mich also dazu, alles aufs Spiel zu setzen?
Wie schon unzählige Male zuvor ging ihm das durch den Sinn. Seine Rechte umkrampfte den Schlüssel in seiner Jackentasche, und das kalte Metall schien ihm die Handfläche glühend zu versengen.
Mit gesenktem Kopf schritt Aiblinger endlich weiter. Hin und wieder hielt er misstrauisch inne, als lausche er auf Schritte, die ihm folgten.
Seit Wochen quälte ihn die Vorstellung, belauert und beobachtet zu werden. Sobald er allein unterwegs war, glaubte er, schleichende Fußtritte hinter sich zu vernehmen. Sein Verdacht bestätigte sich, als er eine schattenhafte Gestalt wegtauchen sah, als er sich einmal überraschend umdrehte. Jetzt hörte er nur noch ab und zu diese leisen Schritte, die ihn immer mehr in Angst versetzten.
Oder war es nur Einbildung, nahm die Erinnerung an seine Schuld, seine übergroße Schuld, Gestalt an? War er im Begriff, den Verstand zu verlieren?
Wie von Furien gejagt, hastete er weiter, bis die Umrisse des Aiblingerhofes vor ihm auftauchten. Er ließ das tröstliche Lichtviereck der Stube nicht aus den Augen, und sein Herzschlag begann sich zu beruhigen.
Klara saß über einem Stück Leinenzeug aus ihrer Aussteuer, als er die Stube betrat. Das Licht der Lampe warf einen warmen Schein auf sie, und sie wirkte rührend schutzbedürftig, wie sie so ganz in ihre Arbeit vertieft war.
Ich werd es aushalten, ich muss es einfach aushalten bis zu meinem Tod. Wenn ich schwach werd, dann zerstör ich ihr Leben. Und sie hat doch noch alles vor sich, sie ist ja fast noch ein Kind , dachte er verzweifelt.
Klara erschrak, als sie aufblickte und die fahle Blässe auf dem Gesicht ihres Vaters wahrnahm.
»Jesses, Vater! Bist du krank? Du schaust ja ganz bleich und elend aus!«
Die vertraute Umgebung und Klaras Fürsorge gaben ihm wieder etwas von seiner üblichen Selbstsicherheit zurück.
»Es ist heut ein wenig später als sonst geworden, das vertrag ich wohl nimmer so gut. Aber du sollst auch net so lang aufbleiben und auf mich warten«, fügte er mit liebevollem Vorwurf hinzu.