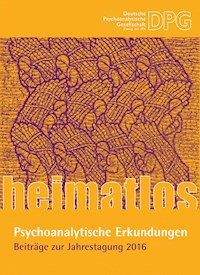
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Un-heimlich bestürzt und fassungslos-verstört in Anbetracht der näher rückenden Kriege und des Terrors suchten die Teilnehmer der Jahrestagung 2016 der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft in Stuttgart in Vorträgen, Seminaren und Arbeitsgruppen nach einem Zugang, um sich mit den Ursachen und Folgen von Vertreibung, Entwurzelung, Verlust von Vertrauen und von Geborgenheit auseinander zu setzen und fragten sich mit Jean Améry: "Wieviel Heimat braucht der Mensch?" Viele Millionen Menschen sind heimatlos und auf der Flucht. In unserem Land werden wir an Zerstörungen, Leid und Vertreibungen erinnert, die von Deutschland ausgingen, und wir denken an den Zusammenbruch 1945, in dessen Gefolge Millionen Vertriebene eine neue Heimat suchten. Diese historischen Erfahrungen sind in vielen Familien als psychisches Erbe eingeschrieben, werden wieder lebendig und äußern sich nicht selten in entstellter Form. Inzwischen haben Flüchtlingsbewegungen auch Mitteleuropa erreicht und schaffen in Deutschland eine ganz neue Situation. Der Empfang ist sehr unterschiedlich. Mitgefühl und eine große, 2015 sogar überschwängliche Hilfsbereitschaft zeigen Sicherheit und Einfühlungsvermögen der hier Ansässigen, aber den Flüchtlingen schlagen auch Ablehnung und Feindseligkeit entgegen. Auf eine allen innewohnende Repräsentanz des Fremden werden einerseits Wünsche und Hoffnungen projiziert, ebenso aber auch alles, was im eigenen Inneren unakzeptabel ist und Angst macht. Flüchtlinge bringen ihre Gewalt- und Todeserfahrungen mit, werden als "Boten des Unglücks" (B. Brecht) bekämpft, aber auch als Mutige beneidet. Dabei sind Vertreibung, Flucht, Exil und Auswanderung Teil der Geschichte der Menschheit, und "heimatlos" zu sein ist eine anthropologische Grundkonstante. "Heimatlos" muss nicht nur mit Verlust, Trauer, Schmerz, Trennung, Traumatisierung und Verunsicherung verknüpft sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses E-Book wurde auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Bildern kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
DPG Tagungsband 2016
Herausgeber: Ingo Focke, Gerhard Salzmann
unter Mitarbeit von: Annegret Dieterle, Inge Gmelin und Thomas Wesle
Inhalt
1. Editorial – Ingo Focke
2. Prolog – Annegret Dieterle, Friedemann Schmoll, Jürgen Keim
a. Zuhause, Heimatlosigkeit und Nirgends-Sein in der frühen Kindheit – Joshua Durban
b. „Man hat das Gefängnis … immer noch sehr geliebt“ – Christoph Frühwein
c. Die Urheimat vor der Geburt als Tiefendimension von Heimat – Ludwig Janus
d. Liebe ist Heimweh – Peter Messe
a. Von der Unvermeidlichkeit des Heimatverlustes und der Fähigkeit, neue Heimaten zu schaffen – Mario Erdheim
b. „Beheimatungsversuche“ im Ghetto Theresienstadt (1942-1944) Die Tagebücher von Egon Redlich – Eva Gaal (†) und Sigmund Mang
c. Freud und das Vaterland im Ersten Weltkrieg – Frank Dirkopf
d. Heimat? – Los! – Karla Hoven-Buchholz
e. Die Heimat(losigkeit in) der Psychoanalyse – Michael Pavlović
a. Exil und Heimatlosigkeit im Schatten extremer Traumatisierung – Sverre Varvin
b. Risse in Beziehungen – Psychoanalytische Psychotherapie mit Migranten der zweiten Generation – Alexander Frohn
c. Heimatverlust und seine psychosozialen Spätfolgen bei Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten am Beispiel der schlesischen Spätaussiedler – Norbert Mierswa
a. Heimat ist kein Ort – Anna Leszczynska-Koenen
b. Wieviel Fremdheit braucht eine Psychoanalyse? Psychoanalytisches Verstehen zwischen kultureller Nähe und Distanz – Paola Francesca Acquarone
c. Die Heimatlosigkeit des Psychoanalytikers in der Begegnung mit dem Fremden – Astrid Kloth, Annette Wieder
d. Braucht Heimat einen Ort? Menschen auf der Suche nach Heimat in der Fremde – Hermann Hilpert
e. „Seelische Wahrheit als Heimat“ – Die Verschränkung von äußeren und inneren Räumen in Louise Bourgeois’ Werk – Bettina Hahm
Editorial
Un-heimlich bestürzt und fassungslos-verstört in Anbetracht der näher rückenden Kriege und des Terrors suchten die Teilnehmer der Jahrestagung 2016 der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft in Stuttgart in Vorträgen, Seminaren und Arbeitsgruppen nach einem Zugang, um sich mit den Ursachen und Folgen von Vertreibung, Entwurzelung, Verlust von Vertrauen und von Geborgenheit auseinander zu setzen und fragten sich mit Jean Améry: „Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ Viele Millionen Menschen sind heimatlos und auf der Flucht. In unserem Land werden wir an Zerstörungen, Leid und Vertreibungen erinnert, die von Deutschland ausgingen, und wir denken an den Zusammenbruch 1945, in dessen Gefolge Millionen Vertriebene eine neue Heimat suchten. Diese historischen Erfahrungen sind in vielen Familien als psychisches Erbe eingeschrieben, werden wieder lebendig und äußern sich nicht selten in entstellter Form. Inzwischen haben Flüchtlingsbewegungen auch Mitteleuropa erreicht und schaffen in Deutschland eine ganz neue Situation. Der Empfang ist sehr unterschiedlich. Mitgefühl und eine große, 2015 sogar überschwängliche Hilfsbereitschaft zeigen Sicherheit und Einfühlungsvermögen der hier Ansässigen, aber den Flüchtlingen schlagen auch Ablehnung und Feindseligkeit entgegen. Auf eine allen innewohnende Repräsentanz des Fremden werden einerseits Wünsche und Hoffnungen projiziert, ebenso aber auch alles, was im eigenen Inneren unakzeptabel ist und Angst macht. Flüchtlinge bringen ihre Gewalt- und Todeserfahrungen mit, werden als „Boten des Unglücks“ (B. Brecht) bekämpft, aber auch als Mutige beneidet. Dabei sind Vertreibung, Flucht, Exil und Auswanderung Teil der Geschichte der Menschheit, und „heimatlos“ zu sein ist eine anthropologische Grundkonstante. „Heimatlos“ muss nicht nur mit Verlust, Trauer, Schmerz, Trennung, Traumatisierung und Verunsicherung verknüpft sein. (Die) Heimat-los zu sein, wird mit Hoffnungen auf einen Neuanfang, auf Entwicklung und auf die Verwirklichung der eigenen Träume verbunden.
Für die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft – wieder beheimatet in der IPV – ist die Beschäftigung mit Heimatlosigkeit in besonderem Maße belastet und die Begrifflichkeit selbst umstritten. Viele Psychoanalytiker mussten vor der Verfolgung durch die Nazis ins Exil fliehen. Die Psychoanalyse wurde aus Deutschland verbannt, kam selbst ins Exil und fand in anderen Sprachen eine neue Heimat.
„Heimat“ hat einen spezifisch deutschen Assoziations-Kontext, der durch eine romantische Verklärung im 19. Jahrhundert, den Missbrauch in Nazideutschland und die Heimatvertriebenenverbände genährt wurde. Wir stoßen einerseits auf ein sentimentales Bild von Herkunft, welches deutliche Zeichen einer nachträglichen Zuschreibung trägt und in sich rückwärtsgewandt ist, wie in der Vorstellung von einer „guten Zeit“, die es nie gegeben hat. Andererseits finden wir eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Vertrautheit und Sicherheit, die auch in die Zukunft gerichtet wird. Vertrauen in sich selbst und das Leben muss sich bei jedem einzelnen Menschen erst entwickeln, in enger Verbundenheit und in völliger Abhängigkeit von einem Anderen. Diese Entwicklung ist störanfällig. Viele Menschen begegnen in sich selbst einem Gefühl von Fremdheit, Verlorenheit und Angst, bleiben zeitlebens auf der Suche nach Sicherheit und Geborgenheit, geben sich auf oder ziehen sich zurück, z. B. in eine Sucht, oder sie verlieren ganz den Bezug zu ihrer Welt, wie in einer Psychose, in autistischen Zuständen oder einer schweren Depression. In der Zusammenstellung der folgenden Arbeiten geht es also nicht nur um den Verlust einer „äußeren Heimat“, sondern auch um die Entwicklung des Sicherheitsgefühls, die Regulierung des seelischen Gleichgewichts, die Folgen schwerer Traumatisierungen und Defizite und um ihren Niederschlag in den menschlichen Beziehungen. So spannte sich der thematische Bogen dieser Zusammenstellung psychoanalytischer Arbeiten weit und berührt empirische Kulturwissenschaft, Begriffsgeschichte, Entwicklungspsychologie, Identitätsfragen, Geschlechtszugehörigkeit, transgenerationelle Weitergaben, interkulturelle Verständigungen, das Schicksal von Flucht, Vertreibung, Exil und Migration über Generationen hinweg und die Suche nach Heimat in der Fremde.
Die Teilnehmer der Tagung, die von Donnerstagabend bis Sonntagmittag währte, besannen sich immer wieder und fragten sich, wo sind wir gerade, aus welcher Perspektive schauen wir auf dieses Thema, auf dieses Gefühl, auf diese Geschichte. Sie fragten sich, bewegen wir uns in Bildern und Kategorien einer inneren Welt, in sozialen, kulturellen oder politischen Vorstellungen oder im familiären Kontext und in der Entwicklungspsychologie jedes einzelnen Kindes. Und immer konnten sie feststellen, wie die Prinzipien der Nachträglichkeit und der Rationalisierung am Werke sind und wie die eigene Geschichte in der Gegenwart nachwirkt. Auf diese Weise erlebten die Teilnehmer der Tagung selbst in einem eigenen Prozess der Selbsterfahrung, wie aus Fremdheit und Verlorenheit etwas Gemeinsames und Verbindenden entstehen kann.
Im Begriff Heimat verdichten sich intensive ambivalente Empfindungen. Sie verweisen auf ein grundlegendes menschliches Problem, sich aufgehoben, geborgen und zugehörig fühlen zu können, und sich doch losreißen zu wollen, um sich dann auf die Suche nach dem Verlorenen zu begeben. Bei einer Sehnsucht nach einem vergangenen Gefühl wissen wir nicht, ob wir es je erlebt haben. Entwicklung und innere Arbeit verlaufen entlang beider Zeitachsen, wie es einmal war und wie es gewesen sein könnte. Nachträglich und rückwärtsgewandt entsteht dann eine „Heimat“ mit intensiv besetzten Bildern, Gerüchen, Szenen und Gefühlen aus der Kindheit als Verdichtung von Verlust und Sehnsucht.
Alle aus der älteren Generation werden sich erinnern, wie sie nach dem 2. Weltkrieg in einem zerstörten Land aufwuchsen, selbst Flüchtlinge waren oder sie als neue Nachbarn bekamen, die oft nur verschämt über die verlorene Heimat sprachen und sie am Leben zu halten suchten. Dann entstanden verklärende Bilder, der Schmerz über das Verlorene war nicht ohne Selbstmitleid. Ein Mitfühlen und die Übernahme von Verantwortung für das Entsetzen, welches von Deutschland aus in die Welt gebracht worden ist, sollten sich erst viel später entwickeln.
Wenn Psychoanalytiker wie alle anderen überwältigt sind von den rasanten Veränderungen, müssen auch sie sich erst einmal orientieren. Wie entwickelt sich eigentlich ein Gefühl des Beheimatetseins, was heißt es, sich zu Hause zu fühlen? Wie kommt es zur Ausbildung eines fundamentalen Sicherheitsgefühls, zur Entwicklung einer Beziehung zu einem guten inneren Objekt? Wie ist es überhaupt möglich, dass wir uns auf dieser Welt heimisch fühlen können – angesichts der entsetzlichen traumatischen Erfahrungen, die eine Beheimatung in der Welt und im eigenen Körper zerstören können? Wie gestaltet sich die Entwicklung, von Kindern, die wenig Hilfe bekommen, um sich ausreichend sicher zu fühlen, oder die mehr Hilfe benötigen als andere? Wir haben es dann mit besonders schwierigen Behandlungen zu tun, die einen Analytiker mit unerträglichen Affekten in Berührung bringen.
Wir freuen uns, dem Leser eine Auswahl der Vorträge zu diesen Themen präsentieren zu können. Die Herausgeber haben sie vier Themen zugeordnet.
Diesen voran stellen wir einen überarbeiteten Prolog, mit dem die Tagung in Stuttgart eröffnet wurde. In einer gemeinsamen Reflektion des empirischen Kulturwissenschaftlers Friedemann Schmoll mit den Psychoanalytikern Annegret Dieterle und Jürgen Keim soll versucht werden, sich dem Thema „heimatlos“ zu nähern. In einem ersten Schritt werden aus nicht-psychoanalytischer Sicht Fragen an den Begriff „Heimat“, seine Geschichte und seinen Bedeutungswandel gestellt. Es gilt den Blick zu weiten über den Assoziationshof hinaus, der „Heimat“ seit seiner Verwendung im nationalsozialistischen Deutschland bis heute begleitet. In seiner langen Geschichte changierte seine Bedeutung zwischen Humanisierungsversprechen und Ausgrenzungspraktiken. Heimat lässt sich in Bezug auf Raum, Zeit, Entwicklung, Ursprung und sozialer Zugehörigkeit verorten, bewahrt aber doch seine Vielschichtigkeit und bleibt in sich widersprüchlich. In einer ersten assoziativen Annäherung werden grundlegende psychoanalytische Begriffe ausgeführt und Schwierigkeiten benannt, nicht nur von Heimatlosigkeit, sondern über „heimatlos“ zu sprechen. Daraus resultieren Fragen nach dem Heimweh und was dieses in unfreiwilliger Fremde anrichten kann. Ihnen wird erneut aus historischer Perspektive nachgegangen. Schließlich erfahren die Überlegungen eine Bündelung und erste systematische Erörterung, um zu der Einsicht zu gelangen: Die Ankunft in einem neuen, fremden Land bedürfen zur Herstellung biographischer Kontinuität des resonanten Anderen, der Empathie und Anerkennung.
In „Frühe Entwicklungen“ findet der Leser Arbeiten zum Sicherheitsgefühl, seiner Entstehung und seinen fundamentalen Störungen. Zum Teil ausdrücklich, zum Teil indirekt beziehen sich die Autoren auf ein Zitat von Freud, der in Das Unheimliche meinte, dass es ein Heimweh gebe nach der „alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat“ (Freud 1919, S. 259). Es geht um frühe Zustände und Phantasien: vorgeburtlich, geburtlich und um die ersten Monate des Menschenkindes. Die Autoren legen ihr Augenmerk auf die Frage, ob man den Heimatbegriff mit frühen Erfahrungen in Verbindung bringen und für psychoanalytisches Verständnis fruchtbar machen kann. Die Existenz im Mutterleib wird oft idealisierend und verklärend als ein verlorenes Paradies symbolisiert, in den nachfolgenden Arbeiten hingegen werden Spuren der Erfahrungen von Anfang an in einen spannungserfüllten Kontext gebracht. Joshua Durban bringt den Leser in Zuhause, Heimatlosigkeit und Nirgends-Sein in der frühen Kindheit mit psychischen Zuständen in Kontakt, die noch jenseits einer Heimaterfahrung und ihres Verlustes liegen. Das Leiden an einem Zustand der völligen Ortlosigkeit zeigt er in der gleichzeitigen Behandlung von einem Vater und seinem autistischen Sohn auf. Die Psychoanalyse und der Psychoanalytiker bekommen im Grenzbereich fundamentaler Ängste, Verwirrung und namenlosen Schreckens die Aufgabe, selbst erst einmal dabei helfen zu müssen, einen Raum zu schaffen, in dem sich Sicherheit, Aufgehoben-Sein und Vertrauen entwickeln können. Dieser therapeutische Weg führt den Behandler in unerträgliche innere Zustände und kann Modifikationen der Behandlungstechnik nötig machen. Durban führt aus, wie sich ein Gefühl, in der Welt beheimatet zu sein, erst allmählich entwickelt. Es ist eingebettet in eine psychisch-körperliche Gesamterfahrung, die die Mutter einschließt, in die Internalisierung einer Erfahrung von sich selbst im Innenraum der Mutter und in die Erfahrungen der ödipalen Situation, die mit Verlust, Trauer und Sehnsucht einhergehen. Wie in dieser verstörenden kasuistischen Schilderung nacherlebbar, können wir es in einer Behandlung mit inneren Zuständen zu tun bekommen, die als inneres Niemandsland (Nowhereness) bezeichnet werden. Christoph Frühwein untersucht in „Man hat das Gefängnis … immer noch sehr geliebt“ – Innere Heimat: Zusammenfall des ‚potenziellen Raums‘ und Rückzug ins ‚Klaustrum‘ anhand einer ausführlichen Vignette den inneren Zustand eines Analysepatienten und beschreibt dessen einerseits schreckliche, andererseits Schutz bietende „innere Heimat“. Dabei nutzt er die Konzepte eines Übergangsraums wie bei D. Winnicott und T. Ogden und des Klaustrums nach D. Meltzer und ermöglicht es so, die Zusammenhänge zwischen äußerer Beheimatung und dem Erleben von Beheimatet-Sein besser zu verstehen. Ludwig Janus möchte die Leser in Die Urheimat vor der Geburt als Tiefendimension von Heimat darauf aufmerksam machen, dass seit der Auseinandersetzung von Rank und Freud über die Bedeutung der realen Geburt für die weitere psychische Entwicklung eine nicht verarbeitete Spaltung die psychoanalytische Theoriebildung durchziehe. Er geht davon aus, dass sich hinter unbewussten Fantasien reale vorgeburtliche und geburtliche Erfahrungen verbergen können, die es gilt aufzuspüren und ernst zu nehmen. Dieser Blickwinkel eröffne praktische Hilfestellungen in den Berufsfeldern, die sich mit dem Anfang des Lebens befassen, wie die Geburtshilfe, die Geburtsvorbereitung und die Schreiambulanzen. Darüber hinaus zeigt Janus die Relevanz der Pränatalen Psychologe für alle Psychotherapien auf. Peter Messer entwickelt in Liebe ist Heimweh anhand von neun Thesen, dass der regressive Kontakt zu unserer Urheimat wie auch der Verlust derselben in einer Pendelbewegung notwendig für psychische Entwicklung sind. Als Prototyp für diese Entwicklung wählt er die „Liebe als sehnsuchtsvolle Suche nach tiefer Verbindung und Vereinigung“. Dabei spannt er seine Untersuchung weit – von Sloterdijk über Platon zu den Befunden der Pränatalen Psychologie, den Ultraschalluntersuchungen von A. Piontelli bis hin zu Chasseguet-Smirgels Beschäftigung mit Sexualität.
Unter der Überschrift „Ersatzheimaten“ findet der Leser Arbeiten von Autoren, die sich damit befassen, wie neue Heimaten die vertrauten ersetzen und dem Versuch dienen, neue Lösungen für den elementaren Wechsel zwischen Geborgenheit und ihrem Verlust zu erkunden. Mario Erdheim beschreibt in Die Unvermeidlichkeit der Heimatlosigkeit und die Fähigkeit, neue Heimaten zu schaffen die Dichotomie, wie Heimat und wie auch Familie einem fremd werden müssen, um sich Neuem öffnen zu können. In der psychosexuellen Entwicklung spielt ihre Zweizeitigkeit eine zentrale Rolle. In der Adoleszenz als zweite Chance werden die frühen Erfahrungen aufgemischt und fügen sich neu zusammen. Erdheim plädiert für Verständnis und Anerkennung der vielfältigen Jugendkulturen als einem Experimentierfeld, in dem neue Ideen und Verhaltensweisen ausprobiert werden und nach „neuen Heimaten“ gesucht werden kann. Sigmund Mang und Eva Gaal† widmen sich in „Beheimatungsversuche“ im Ghetto Theresienstadt (1942-1944). Die Tagebücher von Egon Redlich dem Thema, wie Anerkennung und Abwehr der Realität in der Schwebe gehalten werden, um unter den Bedingungen des Verlustes von Menschlichkeit überhaupt einen kohärenten inneren Raum aufrechtzuerhalten oder zu schaffen. Die Autoren sind bemüht, wie Bergen et al., den Verfolgten und den Opfern zuzuhören und damit ihre Bewältigung angesichts eigener Ohnmacht zu Wort kommen zu lassen. Frank Dirkopf führt den Leser in Freud und das Vaterland im Ersten Weltkrieg in die Zeitspanne in S. Freuds Leben, als der erste Weltkrieg ausbrach. Er untersucht, im Rückgriff auf seine Promotionsarbeit, die Entwicklungsschritte Freuds von einer anfänglichen, nur wenige Tage währenden patriotischen Begeisterung zur Auseinandersetzung mit Enttäuschung, Verlust und Rückzug, in dem die jüdische Loge B’nai B’rith eine wichtige haltgebende Rolle spielte. Bekanntlich erschien schon ein Jahr später Zeitgemäßes über Krieg und Tod (Freud, 1915). Karla Hoven-Buchholz untersucht die Entwicklung des Heimatbegriffs und seinen Missbrauchs in Heimat? -Los! im geschichtlichen Kontext, in seiner Verwurzelung in der Romantik und in seinen politischen Verwendungen. Sie beschreibt seine rückwärtsgewandte Dimension, woraus folgen kann, wie wichtig es für die Entwicklung sein kann, sich von der „Heimat“ los machen zu können. Michael Pavlović wendet sich in Die Heimat(losigkeit in) der Psychoanalyse der Geschichte der psychoanalytischen Institutionen zu. Er konstatiert den Verlust der Psychoanalyse durch Emigration, Vertreibung und Verbot nach 1933. Wie wurde die 1945 wiedergegründete DPG mit den Verlusten fertig, in welchen Schritten gestaltete sich das Bemühen der deutschen Psychoanalytiker, der Psychoanalyse wieder einen Platz in diesem Land zu schaffen? Er beschreibt die Beheimatungsversuche der deutschen Psychoanalytiker selbst in ihren eigenen Institutionen, ihre Ängste, Bewältigungsschritte und ihr Scheitern.
Die folgenden drei Arbeiten beschäftigen sich mit den heutigen Flüchtlingsschicksalen. Sverre Varvin berichtet in Exil und Heimatlosigkeit im Schatten extremer Traumatisierung von seinen jahrzehntelangen Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten in Norwegen. Ein inneres Heimatgefühl repräsentiert eine komplexe Struktur aus Objektbeziehungserfahrungen im individuellen, familiären und soziokulturellen Kontext. Eine erzwungene Migration oder Flucht ist mit einem Verlust verbunden, ebenso bedeutsam ist jedoch das Schicksal, wie in der neuen Umgebung eine „Heimat“ aufgebaut werden kann. Welche Faktoren begünstigen, welche stören diese Entwicklung oder verhindern sie gar? Alexander Frohn untersucht in Risse in Beziehungen – Psychoanalytische Psychotherapie mit Migranten der zweiten Generation, wie sich in der psychoanalytischen Behandlung einer jungen Türkin das Migrationsschicksal der Eltern in der nächsten Generation abbildet und wie es bewältigt wird. Eine wichtige Rolle spielen bei den „Kofferkindern“ nicht nur Konflikte, die sich aus der Identitätssuche ergeben, sondern auch die vielen Trennungserfahrungen, die mit dem häufigen unfreiwilligen Wechsel der Bezugspersonen einhergehen. Norbert Mierswa schreibt über Heimatverlust und seine psychosozialen Spätfolgen bei Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten am Beispiel der schlesischen Spätaussiedler. Unter dem Eindruck eigener Erfahrungen erläutert er, wie Gefühle von Inferiorität, Randständigkeit, Identitätsunsicherheiten und Scham hinter einer äußeren Fassade mit einer großen Leistungsfähigkeit im Beruf verborgen bleiben können. In einer inneren Abkapselung finden Loyalitätskonflikte, traumatische Erfahrungen und Bilder aus der Vergangenheit erst in Krisen und in psychosomatischen Symptomen einen Ausdruck, der sie potentiell der erneuten Bearbeitung zugänglich machen kann.
Im abschließenden Abschnitt findet der Leser Arbeiten, die die Herausgeber unter Psychoanalyse und Fremdheit zusammengefasst haben. Sie beschäftigen sich mit Auseinandersetzung und Bearbeitung eines in den Mittelpunkt der psychischen Welt gehörenden Konzepts, der Fremdheit im Unterschied zum Eigenen, eine Unterscheidung, die oft nur scheinbar gelingt. Anna Leszczynska-Koenen beschreibt in Heimat ist kein Ort in einem ersten Teil die Entwicklung des Antisemitismus im Österreich der dreißiger Jahre und die Entwicklung einer Volksgemeinschaft als einen Prozess der Homogenisierung, der zu einer kulturellen Verarmung führte und die drohende Ausschließung des fremd werdenden Eigenen schon früh ankündigte. Die heutige Migration kann zu einer defensiven Erstarrung sich abschottender Gemeinschaften führen, die es unmöglich macht, sich mit den Herausforderungen und Spannungen eines beschleunigten Wandels und einer schnell fortschreitenden Globalisierung auseinanderzusetzen, die die Voraussetzungen für die heutigen Migrationsbewegungen geschaffen haben. D. Winnicotts Konzept eines Übergangsraums ist hilfreich, um einen Bereich erfassen zu können, der mit der Trennung von Selbst und Objekt seinen Anfang nimmt und Abgrenzungen und Öffnungen verstehen hilft. Paola Francesca Acquarone fragt in Wieviel Fremdheit braucht eine Psychoanalyse? Psychoanalytisches Verstehen zwischen kultureller Nähe und Distanz was passiert, wenn sich das analytische Paar- in Abgrenzung zur normalen landestypischen Situation - durch eine besondere, phantasierte oder reale kulturelle und biographische Nähe auszeichnet. Anhand von zwei Kasuistiken und weiteren Erfahrungen kommt sie zum Schluss, dass für den Umgang mit einer solchen ausschließenden Nähe die eigene selbstanalytische Fähigkeit vor einer besonderen Herausforderung steht. Astrid Kloth und Annette Wieder gehen in ihrer Arbeit Die Heimatlosigkeit des Psychoanalytikers in der Begegnung mit dem Fremden der Frage nach, wie in der westlichen kulturellen Tradition verankerte Psychoanalytikerinnen mit kulturell Fremden arbeiten. Sie setzen sich dabei mit zwei Fragen auseinander: Inwieweit sind auch unsere psychoanalytischen Konzepte selbst kulturbedingt, und gestalten sich die psychoanalytischen Beziehungen zwischen „Fremden“ anders? Diese Fragen diskutieren sie an Hand zweier Behandlungserfahrungen. Hermann Hilpert schreibt unter dem Titel Braucht Heimat einen Ort? Menschen auf der Suche nach Heimat in der Fremde über seine Erfahrungen mit sogenannten „freiwilligen Migranten“, wenn für diese die Migration den Versuch beinhaltet, innere Konflikte lösen zu wollen, indem sie aus innerer Heimatlosigkeit eine ‚Adoptivheimat’ suchen. Die schwierigen psychischen Probleme, die sich daraus ergeben können, werden ebenso diskutiert, wie die kreative, emanzipatorische Bedeutung der Migration. Bettina Hahm untersucht anhand lebenslanger Aufzeichnungen und anhand der künstlerischen Arbeit von Louise Bourgeois Stationen der Suche nach äußerer und innerer Beheimatung. Diese lebenslange Suche geht zurück auf ihre Stellung in der Ursprungsfamilie, auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter in der New Yorker Fremde und behandelt den Verlust ihrer Heimat Paris, die sie zunächst froh war, verlassen zu können. In ihrer existentiellen Suche fand die Künstlerin Unterstützung und Halt in einer jahrzehntelangen Psychoanalyse. Die Arbeit hat den Titel „Seelische Wahrheit als Heimat“ – Die Verschränkung von äußeren und inneren Räumen im Werk von Louise Bourgeois.
Annegret Dieterle
Ingo Focke
Inge Gmelin
Gerhard Salzmann
Thomas Wesle
2. heimatlos, ein Thema für eine psychoanalytische Tagung? – Problematisierungsversuche
Annegret Dieterle, Friedemann Schmoll, Jürgen Keim
Kann „heimatlos“ ein Thema für eine psychoanalytische Tagung sein? Diese Frage war im Vorfeld der Tagung nicht unumstritten. Die Diskussionen liefern deshalb den Ausgangspunkt des folgenden Beitrags. In einem ersten Schritt werden aus nicht-psychoanalytischer Sicht Fragen an den historischen Ballast des Heimatbegriffs gestellt, der in seiner langen Geschichte zwischen Humanisierungsversprechen und Ausgrenzungspraktiken changierte. In einer ersten assoziativen Annäherung werden grundlegende psychoanalytische Begriffe ausgeführt und Schwierigkeiten benannt, nicht nur von Heimatlosigkeit, sondern über „heimatlos“ zu sprechen. Daraus resultieren Fragen – nach dem Heimweh und was dieses in unfreiwilliger Fremde anrichten kann. Ihnen wird erneut aus historischer Perspektive nachgegangen. Schließlich erfahren die Überlegungen eine Bündelung und systematische Erörterung, um zu der Einsicht zu gelangen: Die Ankunft in einem neuen, fremden Land bedürfen zur Herstellung biographischer Kontinuität des resonanten Anderen, der Empathie und Anerkennung.
Die (unheimliche) Geschichte des Tagungsthemas und der Einwände dagegen (J. Keim)
Als es im Herbst 2014 an die verbindliche Präzisierung möglicher Tagungsthemen ging, drängten sich zunächst Phänomene der Destruktivität in der Welt geradezu mit Gewalt auf. Zu diesem Zeitpunkt warfen vor allem die Grausamkeiten in der Ost-Ukraine sowie der IS-Terror in Syrien und im Irak erneut grundlegende Fragen auf. Es war noch die Zeit vor dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ sowie den späteren Selbstmordattentaten in Paris, Istanbul, alsbald Brüssel, Israel und schließlich auch in Deutschland. Schon damals war absehbar: Gewalt schien sich auszubreiten und in ihrem Gefolge die als „Ströme“ portraitierten Flüchtlinge; Millionen von Menschen verloren und verlieren ihre Heimat, sind auf der Flucht, heimatlos.
Der Gang der Dinge zwang so zur Wiederaufnahme und zeitgemäßen Auseinandersetzung mit der u. a. von Jean Améry aufgeworfenen Frage: Wieviel Heimat braucht der Mensch? Dies reiht sich durchaus auch ein in eine Kontinuität psychoanalytischer Auseinandersetzungen. Erinnert sei nur an die kontroversen Positionierungen der 1990er-Jahre: Heimat als „seelische Plombe“ für Paul Parin, allenfalls Ersatz für die Leerstellen eines brüchigen Selbst (Parin 1996). Einerseits: Heimat als Stabilisierungsfaktor in einer für das Individuum durch den Schwund von Vertrautheit, Sicherheit und Verständnis geprägten Welt (Schmidbauer 1996)andererseits. In jedem Fall: In diesen Zeiten global wachsender Konflikte mit ihren humanen Katastrophen erschien uns die Frage nach den Folgen unfreiwilliger Heimatlosigkeit als ein im wahrsten Sinne des Wortes brennendes Zeitproblem, umso beängstigender, weil „brennend“ aus dem metaphorischen Gebrauch in die Realität hereinbricht.
Freuds Studie über „Das Unheimliche“ (Freud 1919) war ein erster und zentraler Ansatzpunkt. Die im historischen Kontext von Nationalsozialismus, Antisemitismus und Judenverfolgung noch vorrangig im individuell-psychologischen Kontext der Verdrängung diskutierte Konstellation ‚heimatlich/unheimlich‘ hat in der aktuellen Konstellation von Migration, Flucht und Verfolgung (erneut) eine bedeutsame soziale und politische Dimension (vgl. Eigler, F. 2012). Das Unheimliche heute hat bei der Globalisierung der Überwachung auch die Doppelbedeutung des Nicht-mehr-Heimlich-sein-Könnens. Heute würde man nicht nur das schon symbolisierte Verdrängte, sondern auch das noch nicht Symbolisierte, Namenlose mit hinzunehmen. Es sind dies Dimensionen, die auch Franz Wellendorf in seiner Arbeit 2007 über„die unheimliche Wirklichkeit der Übertragung“ für das Tagungsthema sehr produktiv erschloss (s.u.).
In jedem Fall: Die Beschäftigung mit „Heimatlosigkeit“, die immer auch Fragen nach Beheimatung aufwirft, ist nach wie vor vermint, mindestens problematisch nach den Aufladungen und Essentialisierungen des Heimatbegriffs im Nationalsozialismus, der dazu beigetragen hat, dass, so Mahrokh Charlier, der „Schatten der großen Exilgeschichte des 20. Jahrhundert“ (…) auf ihm liegt“ (zit. n. Leszczynska-Koenen, 2009, S. 1133)) und ebenfalls viele Psychoanalytiker ein Exilschicksal erleiden mußten. Die Beheimatung bzw. Migration ist demnach auch ein existentielles Thema der Geschichte der Psychoanalyse.
Ende 2014 waren Teile der Vorbereitungsgruppe – wie übrigens auch Autoren der Wochenzeitung „Die Zeit“ – der Meinung, dass die größere Gefahr nicht von der wiederbeginnenden Migration, sondern von der Ebola-Epidemie ausgeht – diese gilt laut Zeitungshinweis (Südwestpresse) seit dem 14. Januar 2016 als beendet. Die Migration dagegen besteht weiter. Ist sie die unendliche Geschichte eines exilistischen Grundmotives (Leszczynska-Koenen, 2009)? Verdichtet im Fort-Da (Freud, Jenseits des Lustprinzips 1920) des Heim-Weg (Karen Joisten, 2007). Dem wird gleich im nächsten Teil nachgegangen werden. Es stellte sich dabei auch die Frage, ob das Thema damit eine eine Psychoanalytische Tagung überfordernde Dimension bekommt?
Ist Migration als eine unendliche Geschichte der Menschheit eine anthropologische Grundkonstante? Wäre eine Psychoanalytische Tagung damit überfordert? Psychoanalyse ist seit ihren Anfängen nicht nur eine klinische Theorie, sondern immer auch kritische Kulturtheorie, beides dialektisch miteinander verschränkt. Freud schuf – so Micha Brumlik – „nicht mehr und nicht weniger als eine neue Anthropologie, (…) die – wie alle anderen (…) – universale und überzeitliche Gültigkeit beanspruchen muß“. (Brumlik, 2006, S. 9.)
Es gibt nicht nur in Deutschland und nicht erst heute, sondern es gab immer wieder schon Migrations-Bewegungen; heute spricht man von Migrationswellen. Dabei klingt eine ein zu schwaches Ich überschwemmende Bedrohung an. Die Beschäftigung mit diesem Themenfeld war mit viel Unsicherheit verbunden, auch mit viel Ungewissheit, was da noch kommen möge. Wir wurden ständig eingeholt und überholt von neuen Entwicklungen.
Migration bedeutet Wanderung im Raum; Heimat war lange weniger emotional aufgeladen, sondern bezeichnete eine Verortung. Wir Psychoanalytiker sind mehr in inneren Räumen der Patienten, in Gefühlszuständen zuhause und interessieren uns für die Bedeutung, die einer Sache, einem Ort, einem Objekt gegeben wird, das dann auch zu einem inneren Objekt werden kann, auch davon wird noch zu sprechen sein. Wir sind demgegenüber nicht wirklich beheimatet in kulturwissenschaftlichen und philosophischen Diskursen über Heimat und Heimatlosigkeit. Deshalb soll im Folgenden der Themen- und Problembereich im Dialog und in Perspektivwechseln zwischen Psychoanalyse und Kulturwissenschaften erschlossen werden. Wer meint was, wenn Heimat gesagt wird? In jedem Fall geht es um einen Begriff mit vielerlei möglichen Bedeutungen – Schutzraum, Kompensation und Ersatz, xenophobe Kampfparole, Rückzugsort, Kitsch-Idylle, Ware, Gefühl … Er stellt mit Bion einen Container für eine Vielzahl wichtiger Gefühle dar und kann auch als Suchbewegung verstanden werden, als ein exilistisches Narrativ (Leszczynska-Koenen 2013, S. 30), das in einer globalisierten Welt existentieller werden könnte. Konzentrierten sich Psychoanalytiker eher auf das „innere Objekt“ Heimat, so beschäftigen sich die Kulturwissenschaftler schwerpunktmäßig mit dem Entstehen polarisierter Positionen eines „Selbst ohne Ort“ bzw. eines „Ortes ohne Selbst“ (Sloterdijk, 1999) Wäre zu fragen: In welchen Beziehungen stehen Fragen der äußeren und inneren Beheimatung, inneren und äußeren Räumen? In einem ersten Schritt wird es um die Fragen gehen, wann Heimat immer wieder besonders vehement thematisiert wird, diese „Konjunktur“ hat? Und welche Elemente und Themen Heimat beheimatet.
Heimat, eine Gebrauchsgeschichte zwischen Fürsorge und Verbrechen (F. Schmoll)
Heimat ist ein vermintes Gelände, ein kontaminiertes Feld für eine volkskundliche Kulturwissenschaft. Es ist die vage Unschärfe, die das schlichte Wortgeschöpf verfügbar macht für jedwelche Absichten und fast immer auch ihr Gegenteil – Integration und Exklusion, Fürsorge und Abweisung, Humanisierung und Vernichtung. Die gespaltene Beziehung, welche dieses Fach – ehedem „Volkskunde“, heute auch Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft, mitunter auch Kulturanthropologie geheißen – zur Heimat unterhält, liegt nicht nur an dieser Disziplin, sondern in der Sache selbst. In ihrem Namen wurden und werden ganz unterschiedliche, auch widersprüchliche Erfahrungen Intentionen reklamiert.
So gilt für diese Disziplin, was Margarete Hannsmann einmal trefflich in ihrem persönlichen Bekenntnis „Heimatweh“ vortrug: Es gebe kaum ein Wort, so Hannsmann, „das mich zerreißt wie dieses“ – unfassbar unbestimmt im Niemandsland zwischen „schierer Angst“ und „reinstem Glückszustand“. „Schiere Angst“ befiel sie vor bornierter Enge, vor kleinkarierter Gartenzwergkultur und provinzieller Selbstgenügsamkeit. Heimat also zuvorderst als Zwang, Zurückgebliebenheit, als muffige Enge. Einerseits, andererseits aber eben auch: „reinster Glückszustand“, weil kein anderes Wort ihre Gefühle von Geborgenheit, von Aufgehobensein – die Erfahrung einer Übereinstimmung von Innen und Außen, von Vertrautheit mit der Welt besser benennen könne als eben diese scheinbar schlichte Vokabel Heimat (Hannsmann 1986, S. 36).
Für eine volkskundliche Kulturwissenschaft ist nicht nur ein individuelles, sondern ein kollektives Unbehagen mit einer immer unentschiedenen Heimat zu diagnostizieren. Es war in jedem Fall stets eine innige Liaison, aber eben mitunter auch eine verquere, die da unterhalten wurde. Warum, das ist im Grunde genommen simpel; das lag und liegt an einer weithin ungeklärten Doppelrolle gegenüber einem Gegenstand, den man einerseits unentwegt selbst mitproduzierte und gleichzeitig auch aus gebotener Distanz analysierte. In der Rolle des Doppelagenten sozusagen, teilnehmend und beobachtend zugleich, laborierte diese Disziplin unentwegt mit an der „Identitätsfabrik“ Heimat (Köstlin, 1991). Sie modellierte und zementierte Vorstellungen von der schicksalhaften Prägekraft von Heimat-Räumen und Herkunftsgemeinschaften. Ein nicht ungewichtiger Ahnherr des Faches, John Meier, verstand dieses nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs denn auch unumwunden als „geistiger Heimatschutz“ (Meier Vorwort, S. 13), als Sinnstifterin, die in einer zerrissenen, krisengeschüttelten Gesellschaft platt gesagt Geborgenheit und Harmonie produzieren sollte. Jedenfalls: In der Gebrauchsgeschichte des Begriffes kippte das Versprechen, das Eigene und Vertraute bewahren zu wollen, regelmäßig in militant-xenophobe Wendungen gegen Fremdes und Offenes. Heimat fungierte alsbald als ideologisch aufgeladene Abwehr- und Abschottungsformel, sodass sich durch und durch Widersprüchliches – Regression und Utopie, Glück und Verbrechen, Humanisierung und Barbarei – an dieses eigentümlich schillernde Wort lagert. Immerzu mobilisierten Imaginationen des Heimatlichen als Kehr- und Nachtseite auch die Bereitschaft zu rücksichtlosem Exzess – das Unheimliche als verdrängter Anteil des Heimisch-Vertrauten (Freud 1919). Nur vordergründig Nicht-Zusammengehörendes kennzeichnet die beiden Seiten einer deutschen Heimat-Geschichte.
Diese Zwiespältigkeit ist geblieben – auch und gerade in unserer Gegenwart, in der wieder viel von Heimat die Rede ist. Globalisierung, beschleunigter Wandel, Migration – eine Welt in Bewegung, Auflösung und Neuordnung: Das sind unruhige Zeiten, in denen „Heimat“ offenkundig besondere Plausibilität entfaltet, in vielerlei Hinsicht Sinn zu stiften scheint (Costadura und Ries 2016). An dieser Stelle könnte gefragt werden: Ist der Begriff vonnöten oder verzichtbar? Vielleicht ist dies schon eine falsche Frage: Wenn dieser Begriff immer wieder mit unterschiedlicher Intonation und Akzentuierung aufgerufen wird, dann sind ihm offenkundig bestimmte Erfahrungen und Bedürfnisse eingeschrieben, die nicht einfach sprach- und gesinnungspolizeilich abgesprochen werden können. Die Berufung auf Heimat kann nicht einfach abgesprochen werden, genauso wenig wie jemand Liebe abgesprochen werden kann, auch wenn sie noch so auf Selbsttäuschung basieren mag. Aber zu fragen wäre in jedem Fall nach den Wirkungen des Wortes: Verschleiert es mehr als es zu klären imstande ist? Der Anspruch auf Heimat – ein legitimes Recht oder ein hoffnungsloses Vereinfachungsversprechen?
Das wäre ja vielleicht schon eine erste wichtige Beobachtung: Das Reden über Heimat hört nicht auf, sondern erfährt im Rhythmus bestimmter Krisen immer wieder Konjunktur. Dieses zweisilbige Wörtchen hat etwas von einem hartnäckigen Wiedergänger, der sich zumindest nicht ordentlich begraben lässt, sondern in regelmäßigen Zyklen immer wieder Krisensymptomatik und Klärungsbedarf signalisiert. Dann wäre zu klären: Liegt das nun daran, dass das „Chamäleon Heimat“ (Bausinger 2009) etwas benennt, das ohne dieses Wort nicht sagbar wäre? Transportiert der Begriff Sehnsüchte, die ohne ihn nicht auskommen? Oder ist es gerade umgekehrt: Besitzt er gerade deshalb seine Anziehungs- und Verführungskraft, weil er so schön verwässert und Nebel wallen lässt – weil er so geschmeidig und kaugummiartig als Platzhalter oder „Plombe“ (Parin 1996) in jede Lücke passt? Was meinen eigentlich diejenigen, die Heimat sagen? Zumindest mag auf den ersten Blick irritieren, in welch unterschiedlichen Zusammenhängen auf sie zurückgegriffen wird und welche Fülle an Erscheinungsformen zu beobachten ist, wenn man sich an eine kleine Inventur von Heimat-Sprechweisen macht.
Unisono bei Lidl oder Edeka bewerben Slogans wie „Heimat ist Ursprung“ oder „Unsere Heimat“ zusammen mit Hübsch-Bildern aus idyllischen Landlust-Welten fragwürdig billige Lebensmittel, die eben garantiert nicht aus sozial und ökologisch intakten Umwelten, sondern aus denaturierten Agrarfabriken stammen. Offenbar benötigt es solch mentaler Geschmacksverstärker wie „Heimat“, dass solche Produkte als einverleibbare Nahrung überhaupt identifiziert werden können – Heimat als mentaler Ersatz, als Selbsttäuschung und Kompensation.
„Unsere Heimat bleibt deutsch“ – heißt es entschieden auf den Transparenten von AfD oder Pegida. Gemeint sind die Kampfparolen weniger als ein selbstgewisses Bekenntnis zum Eigenen, sondern vor allem als Abwehr und Abwertung der Anderen. Hier wird im Namen der Heimat militante Ausgrenzung vollzogen.
Heimat präsentiert sich in Erscheinungsformen des Kitsches und Kommerzes seit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts in allerlei ästhetisierten Varianten: Heimatroman, Heimatfilm, Schlager, Verdirndelung, folkloristische Kulissenheimaten und künstliche Idyllen des Tourismus (Egger 2014).
Heimatgeschichte oder eine „Heimatkunde des Nationalsozialismus“ betrieb der Kulturwissenschaftler Utz Jeggle (Projektgruppe Heimatkundes des Nationalsozialismus 1989) und reklamierte bewusst diesen Begriff, um ihn nicht den Heile-Welt-Aquarellisten zu überlassen. Er hätte bei Versuchen, den Nationalsozialismus in der Welt des Alltäglichen verstehen zu wollen, ja auch ganz nüchtern „Lokalgeschichte“ sagen können oder „Lebenswelten im Nationalsozialismus“. Aber es ging ihm dezidiert um Heimat einerseits als Ort des Zutrauens und der Geborgenheit und andererseits um dessen Nachtseiten, die unheimlichen Abgründe des Heimelig-Vertrauten.
„Heimat ist da, wo ich keine Scheiße an der Backe habe“, meinte einmal überaus entschieden eine Studentin in der ersten Sitzung eines Heimat-Seminars. Nach höflichem Insistieren auf weniger Anschaulichkeit und mehr Konkretion, sprach sie von ihrer Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht alles kompliziert und undurchschaubar scheint, und von einem sozialen Raum, in dem sie sich nicht verstellen und verbiegen müsse, sondern „einfach so“ angenommen werde.
„Making Heimat – Germany, Arrival Country“. So lautete 2016 der deutsche Beitrag zur internationalen Architekturausstellung in Venedig. Dabei geht es um die brisante Frage, wie den Heimatlosen unserer Zeit, den Hunderttausenden von Flüchtlingen, nicht nur ein funktionelles Dach über dem Kopf, sondern auch Räume gegeben werden können, die in der Unwirtlichkeit unfreiwilliger Fremde tatsächlich ein Zuhause sein könnten. Auch wenn an Heimat gelagertes Denken und Fühlen immer von Erfahrungen des Verlustes stimuliert werden und mit Intentionen der Kontingenzbewältigung einhergehen: Im Kontext von Flucht, Vertreibung und Migration drängt ihre Abwesenheit am intensivsten zur Vergegenwärtigung von Heimat.
„Heimatschutz“ war um 1900 eine bildungsbürgerliche Bewegung, die die Kehrseite des Fortschritts, die Destruktionsmöglichkeiten moderner Industriezivilisationen und damit auch die Frage nach der Natur, aber auch nach Tradition stellte. Da war zunächst einmal also ein Gestus der Fürsorge, eine bewahrende Zuwendung … Alsbald kippte das in einen Kult des Eigenen und die Eigenart, die zunächst geschützt werden sollte mutierte zum Arteigenen …
„Heimatschutz“ – in der Variante des „Thüringer Heimatschutzes“, aus dem sich der Nationalsozialistische Untergrund schälte, war dies die Legitimation für eine Mord- und Terrorserie gegen alles Nicht-Deutsche.
Das scheint bemerkenswert – dieses reibungslose Hinübergleiten, das Kippen von Fürsorge ins Gegenteil, von Grün nach Braun, dieses chamäleonartige Changieren von Heimat-Kündern zwischen Humanisierungsversprechen und entfesselter Brutalität. Die Erfahrung von Entfremdung mutiert unversehens in die Diagnose von Überfremdung. So erscheint Heimat also im Irgendwo zwischen folkloristischer Gemütlichkeit und Barbarei, zwischen Humanisierung und Vernichtungsobsessionen. Wir haben es mit einem offenkundig schillernden, fast nuttigen Begriff zu tun, der sich an Vielerlei binden lässt: die ewige, die himmlische Heimat als Vertröstung auf das Jenseits, die Zutrauen schenkende Geburts- und Kindheitsheimat, Heimat als Gartenzwerg-Gemütlichkeit unter „Senilitätsverdacht“ (Bausinger 1991, S. 122) Spießeridylle, Kampfvokabel – Heimat also jedenfalls sehr unbestimmt zwischen Glück und Verbrechen, Regression und Utopie.
Das gehört offenkundig zum Wesen dieses Wortgeschöpfs; es entfaltet Bedeutung auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber ganz so wahllos und willkürlich sind diese dann ja vielleicht nun auch wieder nicht, zielen sie doch allesamt in irgendeiner Form auf Bindungen. Wäre also nach Bedeutungsebenen zu fragen: Was meinen wir eigentlich, wenn wir Heimat sagen? Ganz so zufällig und austauschbar scheint das Reden über Heimat auf der anderen Seite dann doch wieder nicht zu sein. Gibt es da bei aller Unschärfe und Unbestimmtheit nicht doch etwas Bestimmtes, das immer bei dieser Suchbewegung Heimat mitschwingt?
Da wäre bei der Suche nach Bedeutungsebenen zunächst eine zeitlose und überkulturelle Ebene des allgemein Menschlichen: Der Mensch ist von Natur aus „heimatlos“, zugleich nirgendwo und doch (fast) überall zuhause. Wir sind alle Migranten, verwaiste und bedürftige Fremdlinge auf Erden. Die Welt ist offen, aber abweisend. Der Mensch, von Natur aus in zwiespältiger, disharmonischer Beziehung zur Welt, benötigt eine Eigenwelt, in die er gehört, die ihm vertraut ist, sicher, verlässlich und stabil, mit der er sich anfreunden lässt. Da wäre also eine anthropologische Dimension von Heimat – der Zwang für das Gattungswesen Mensch, sich beheimaten zu müssen. Beheimatung als eine Aufgabe tätiger Weltaneignung, durch die der Mensch – immer und überall – eine für ihn unwirtliche Welt erst in ein Zuhause verwandelt.
Aber muss das gleich Heimat heißen? Oder reicht nicht eben dieses Zuhause – ein Obdach, das einerseits mehr ist als eine Bleibe, aber eben doch nicht so viel unkalkulierbarer Sprengstoff? Darauf, dass das Konzept Heimat seine geistige Heimat in Weltbildern der agrarischen Sesshaftigkeit besitzt, insistierte Peter Sloterdijk. Erst hier sei die Bindung des Selbst an Ort und Raum geknüpft worden als Vorstellung befreundeter Räume. Hat dies damit im globalen Zeitalter beschleunigter Mobilität und Flexibilität mit dem Verschwinden des Raumes, der Entstehung der „Nicht-Orte“ (Marc Augé) und neuen nomadischen Lebensformen an Sinnstiftungspotenzial verloren? Für Sloterdijk schon: „Darum gehört auch das deutsche Wort ‚Heimat’ zu einem Zeichen-Reservoir, dessen Hauptgeltungszeit offenkundig vorüber ist: zum Leitvokabular des agrarischen Weltalters, mitsamt seiner Politik und Metaphysik.“ (Sloterdijk 1999, S. 24)
Wie auch immer, Heimat bedeutet Eingrenzung. Da werden Grenzen gezogen – Zäune, Mauern, Barrieren. Wer Heimat sagt, zieht immer Grenzen zwischen der vertrauten, der überschaubaren und verstandenen Welt des Eigenen (die Welt, in der ich mich auskenne), und der Fremde als unvertraute, unverstandene Welt der Anderen. Hier folgen die Grenzen des Heimatlichen weitgehend der Unterscheidung Edmund Husserls in Fremd- und Heimwelt, wobei Letztere eben die „Welt der All-Zugänglichkeit (…), weitreichende Grundschicht des Normalen, des Allverständlichen in Verharren und Wandel (alltäglich normale Umwelt, alltägliches Menschentum, ‚Durschnittsmenschlichkeit’)“ meint (Husserl 1973, S. 629).
Das sind nicht nur räumliche, sondern immer auch soziale und kulturelle Ein- und Ausgrenzungen. Womit sich die Frage stellt, an was sich Heimat lagert und bindet – an Menschen, ihre Sprache, an Räume, an Landschaften? Heimatgefühle sind oft verknüpft mit primären, mit sinnlichen Erfahrungen – Heimat ist hier eine warme und weiche Welt: der Geschmack von Kindheitsspeisen, Atmosphären, Gerüche, Lichtspiele einer Landschaft, der Zungenschlag und die Färbungen einer unverwechselbaren Mundart. Wie das Schwäbische – dafür mag man sich mitunter schämen, wenn etwa relative Weltläufigkeit durch eine korrekte Aussprache des Hochdeutschen gefragt wäre, der Dialekt einen jedoch gefangen hält und untrüglich identifizierbar macht. Diese Haftung begrenzt und hält gefangen, lässt sich nicht verbergen, wird zum Zwang und Anlass der Scham – tönt aber unendlich vertraut und innig. So verweist auch Wilhelm von Humboldt auf die Macht des Ohres, wenn es um die Erzeugung von Vertrautheit und Bindung geht: „Die wahre Heimath ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die Entfremdung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten und leichtesten, wenn auch am leisesten vor sich.“ (Humboldt 1847, S. 315)
Orte, Worte, Menschen – Heimat meint immer Bindung. Und es geht dabei immer um Zugehörigkeit und Verstandenwerden. Was wären also trigonometrischen Punkte möglicher Bindungen und Beheimatungen?
Erstens: Heimat als
Bindung an Orte und Räume
– ob Haus, Dorf, Flur, Stadtteil, Region oder Landschaft. Das Reden über Heimat zeichnet sich aus durch räumliche Konkretheit, durch Ortsbestimmtheit und die Unverwechselbarkeit von Nah-Räumen (Greverus 1972). Ist Heimat dann das, was Tieren ihr Lebensraum wäre? Das wäre eine fatale Analogie. Tiere sind gefesselt an ihre Lebensräume, in die sie an- und eingepasst sind. Der Mensch ist kein Anpasser. Die Räume, die Menschen bewohnen, sind in relativer Freiheit des Handelns entstanden – in der Freiheit, sie zu gestalten und zu bearbeiten. Und sie können verlassen werden. Womit natürlich auch nicht in Abrede gestellt werden soll, dass die Bindung nicht unversehens zur Fessel werden könnte. Aber, hierin liegt auch eine umweltethische Dimension: Aus einer räumlich gedachten Heimat resultiert die Frage, wie denn die von Menschen geschaffenen und bewohnten Räume beschaffen sein sollten, um in ihnen zu leben, zu arbeiten, zu lieben und zu sterben?
Ein Zweites: Die Rede von Heimat bindet sich an den Umgang mit Menschen – gerade im Exil. Das Reden über Heimat ermöglicht die Thematisierung eines
sozialen Miteinander-Seins
und zielt dabei primär auf zweckfreie, von Nähe und Verlässlichkeit geprägte soziale Beziehungen. Familie, Gemeinschaft, Nachbarn: Das wäre also eine Welt, in der ich mich nicht verstellen und verbiegen muss – in der ich Anerkennung erfahre und sein kann, wie ich sein möchte. Das ist diejenige Heimat, um eine Wendung aufzunehmen, die Johann Gottfried Herder zugeschrieben wird als die Welt, „in der ich mich nicht erklären muss.“ Heimat erscheint hier als Versprechen einer Gewissheit und Selbstverständlichkeit verlässlicher Bindungen, die nicht hinterfragt oder legitimiert werden müssen, weil sie im Rahmen primärer Sozialisationsprozesse entstanden sind und damit gesetzt scheinen. Heimat bedarf keiner Erklärungen, Begründungen und Legitimationen. Nach einer langen Geschichte nationalistischer und völkischer Ideologisierungen häufen sich Vorschläge, die Essentialisierung und Statik herkömmlicher Heimatbegriffe zu meiden und stattdessen von „Beheimatung“ im Sinne einer Erzeugung sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung zu sprechen (z.B. Binder 2008).
Drittens – das zeitliche Bindemittel:
Heimat verknüpft Fragen der Herkunft (Ursprung, Abstammung, Tradition …) mit solchen der Zukunft (Heimat als Utopie eines unentfremdeten Daseins). Herkunftsgewissheit und Zukunftsvertrauen – diese Bezüge besitzen gleichermaßen regressive wie progressive Potenziale. Heimat als eine gesellschaftliche Utopie humanisierter Welt, das ist das, was Ernst Bloch im fulminanten Schlussakkord seines „Prinzip Hoffnung“ anklingen ließ:
„Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende,
und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (Bloch 1973, S. 1628)
Kulturelle Aspekte – Identitäten:
Heimat bezieht sich auch auf ein geistiges Zuhause – gerade und erst recht im Zustand der Heimatlosigkeit: in einer als vertraut erfahrenen Sprache und des Denkens, durch die ich verstehe und verstanden werde. Oder der Glaube als verbindende Heimat.
Schließlich, nicht zuletzt – Heimat und Natur:
Heimat eröffnet wie kaum ein anderer Begriff eine Klammer, welche Wirklichkeit nicht auseinander dividiert in Menschengemachtes und außermenschliche Wirklichkeit, die auch ohne den Menschen existiert. Damit ermöglicht die Rede von Heimat die Thematisierung von Fragen nach den Beziehungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Natur, nach der Organisation des Stoffwechsels zwischen Natur und Gesellschaft, der Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Heimat zählt zu den wenigen Begriffen, die sich der Dichotomie von Natur und Geist, Natur und Gesellschaft verweigern, sondern diese auch in anderen Beziehungsmöglichkeiten zu denken vermag (Piechocki/Wiersbinski 2007).
Zusammengefasst also: Ob Orte oder Menschen, Herkunft oder Sprache – wenn von Heimat die Rede ist, geht es immer um Bindungen, nicht irgendwelche, sondern um solche mit spezifischen, identitätsverbürgenden Qualitäten: Nähe, Unmittelbarkeit, Vertrautheit, Zutrauen, Verlässlichkeit, Identifikation. Es geht um ein Bindemittel, das auf die Vermittlung zwischen inneren und äußeren Wirklichkeiten zielt. Und dies ermöglicht, so das Heimat-Versprechen: Geborgenheit und Zugehörigkeit.
Festzuhalten wäre also: Ganz so wahllos, ganz so zufällig erfolgt das Reden über Heimat sicher nicht, wie dies das anfängliche Nebeneinander von Lidl-Werbung und dem Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds vielleicht suggerieren mochte. Und noch ein weiteres wäre wichtig – außer der Frage, was denn gemeint ist, wenn Heimat gesagt wird. Nämlich die Frage, wann Heimat besonders häufig aufgerufen und intensiv beschworen wird – das Phänomen der Konjunkturen, Reprisen und Verdichtungen von Heimat-Thematisierungen. Heimat ist nicht statisch, sondern präsentiert sich als historisch wandelbar. Wann gibt es Konjunkturen für diesen Begriff und für das, was er transportiert? In welchem Verhältnis stehen Kontinuitäten und Wandel in den begrifflichen Gebrauchsweisen – was bleibt gleich und was ändert sich im Reden über Heimat?
Das Wort fällt nicht vom Himmel. Das Wort ist seit dem 15. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich. Vorläuferformen wie das mittelhochdeutsche „heimõt“ benannten zunächst zuvorderst sachlich das Heim, das Anwesen, den Hof – also den materiellen (Grund-)Besitz (Bastian 1995, S. 20-23). „Der Älteste bekommt die Heimat“, hieß es beim Erben. Heimat meinte also primär den Geburts- oder Wohnort, woraus sich dann das traditionelle „Heimatrecht“ ableitete und damit Rechte des Aufenthalts, der sozialen Fürsorge oder des Besitzerwerbs.
Einen neuen Zungenschlag, einen emotionalen und romantischen Klang bekam das Wörtchen Heimat Ende des 18. und im 19. Jahrhundert. Agrarische Gesellschaften bauen auf sesshafte Menschen. Die Industriemoderne benötigt bewegliche, innerlich und äußerlich mobile, flexible Menschen. Je vehementer, rasanter und unüberschaubarer sich der Umbau der alten europäischen Welt in moderne Industriegesellschaften sich vollzog, desto dringlicher wurde als konservative Antwort auf Erfahrungen der Entfremdung und des Zerfalls traditioneller Lebensformen und Bindungen die Anrufung geschlossener, still gestellter Heimaten vorgetragen. Heimat erscheint hier, so Hermann Bausinger, als Gegen- und Ersatzwelt, als „Kompensationsraum, in dem die Versagungen und Unsicherheiten des eigenen Lebens ausgeglichen werden, in dem aber auch die Annehmlichkeiten des eigenen Lebens überhöht erscheinen: Heimat als ausgeglichene, schöne Spazierwelt (…), als Besänftigungslandschaft, in der scheinbar die Spannungen der Wirklichkeit ausgeglichen sind.“ (Bausinger 1986, S. 96)
Das Europa des 19. Jahrhunderts ist kein Einwanderungskontinent, sondern, im Gegenteil, ein Kontinent der Auswanderung und unfreiwilliger Heimatlosigkeit: 50 Millionen Menschen verlassen Europa und suchen eine neue Heimat in Übersee. Es ist eine Epoche der Suchbewegungen und Entwurzelungen – des Vertrautheitsschwunds und des Verlusts von Zugehörigkeits-Gewissheit. Umso mehr ist nun die Rede vom Heimweh, von Ursprüngen, von ländlichen Idyllen und intakten Welten. Diese gefühligen Heimat-Versprechen stehen also krass in Kontrast zur sozialen Realität; vielleicht liegt ja gerade hier die Anziehungskraft eines romantisierten und emotional aufgeladenen Heimatbegriffs (Seifert 2010).
„Jeder Mensch sollte lernen sich irgendwo zu Hause zu fühlen.” (Rudorff 1880, S. 272) Mit dieser 1880 scheinbar schlicht vorgetragenen Forderung nach Beheimatung artikulierte Heimatschutz-Nestor Ernst Rudorff Bedürfnisse, über die sich die Moderne rücksichtslos hinwegzusetzen schien: Geborgenheit, Zugehörigkeit, Harmonie, Sicherheit und Stabilität. In diesem Sinne gewann die Rede von Heimat nicht als präziser Begriff Bedeutung, sondern als vages Gegenkonzept, das die Zumutungen, Destruktionspotenziale und unverarbeiteten Begleiterscheinungen der Moderne thematisierte: Entfremdungserfahrungen, Anonymität, die Funktionalität sozialer Beziehungen, den Zerfall traditionaler Sozialstrukturen sowie die mit Hilfe von Wissenschaft und Technik möglich gewordene Unterwerfung der Natur.
Heimat als emotionale Bindung erschien verfügbar für kleine und große Einheiten wie Dorf, Landschaft, Region, Volk, Staat, Nation etc. Obgleich die deutschen Heimatbewegungen zunächst als regionale Reflexe auf die Zentralisierungstendenzen im Zuge der Nationalstaatsgründung von 1871 reagierten, sollte sich die Bezugnahme auf Heimat besonders nach dem Ersten Weltkrieg als mühelos transformierbar erweisen für ethnopolitische Projekte unter dem Programm der deutschen „Volksgemeinschaft“ (Oberkrome 2004). Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Bewegung des Heimatschutzes durchaus drängende Fragen der Zeit aufgegriffen und auch die Frage nach der Natur als eine Schlüsselfrage moderner Gesellschaften thematisiert. Sie hatte den Fortschrittsoptimismus konterkariert mit den Destruktionspotenzialen moderner Industriezivilisation, auf die Folgen einer Ökonomisierung und Rationalisierung der Natur verwiesen, die im Zeitalter von Wissenschaft, Technik und Industrie historisch ungeahnte Dimensionen erreichten, und sich – so der Tenor der zeitdiagnostischen Beschreibungen – offenbar rücksichtslos über alles Vorgefundene in Natur und Kultur hinwegzusetzen schienen. Diese historisch neuen Erfahrungen ließen sich auch mit der Frage nach „Heimat“ zunächst legitim und rational thematisieren: Wie sollte die Welt beschaffen sein? Wäre ein Primat der Natur nicht höher zu bemessen als jener der Ökonomie? Gab es Grenzen in der menschlichen Naturbeherrschung und Naturausbeutung, die dank moderner Technik und Wissenschaften ins Grenzenlose gesteigert werden konnten?
Spätestens nach den Nationalisierungsschüben der traumatisch erfahrenen Weltkriegsniederlage von 1918 war die Mutation einer Bewegung, die sich dem Anliegen des Bewahrens und Schutz des Lebendigen verschrieben hatte, zur Erfüllungsgehilfin einer Vernichtungsideologie unübersehbar; in der Zwischenkriegszeit vollzog sich im Reden und Denken über Heimat ein allmähliches Hinübergleiten von Grün nach Braun (Bausinger 1982). Der Schutz von Heimat komplettierte alsbald allerbestens den Schollenkult, die Heimattümelei und den Bauernkult der NS-Ideologie. Nicht erst im Nationalsozialismus, aber nun radikal, erfuhr Heimat eine obsessive Aufladung als eine biologistisch begründete Abwehr-, Reinheits- und Gleichartigkeitsideologie. Über die Kategorie der „Eigenart“ oder des „Heimischen“ konnte Heimatliches gegen eine feindliche und bedrohliche Welt der Nivellierung und Standardisierung in Stellung gebracht werden. Das Anliegen des Bewahrens des Eigenen mutierte jetzt zur Ideologie und Praxis der Vernichtung der Anderen. Die über „Blut und Boden“– Zugehörigkeiten ausgeschlossenen Fremden, das waren diejenigen, die nicht „eingewurzelt“ schienen, vor allem die „heimatlosen“ Juden, denen Bindungs- und Verantwortungsfähigkeit für den Boden abgesprochen wurde (Schmoll 2003). Eine anfängliche Integrationsidee mutierte damit zur Ausgrenzungs- und Vernichtungsideologie.
Gemütlichkeit und Brutalität – zwei Seiten einer deutschen Heimat-Medaille. Nach dem Nationalsozialismus, nach der Erfahrung von Flucht und Vertreibung in den inneren und äußeren Trümmerzuständen der Nachkriegszeit und den Erfahrungen von über zwölf Millionen deutscher Heimatvertriebener versprach Heimat erneut Aufgehobensein und Geborgenheit in einer undurchschaubaren Welt. Und natürlich: Heimat erschien als die verlorene Heimat in der Geschichte der Heimatvertriebenen, in der die Konsequenzen von Nationalsozialismus und Weltkrieg unfreiwillige Fortsetzung fanden, unkomfortabel für die Nachfolgegesellschaften, weil ihr Schicksal beidseits des Eisernen Vorhangs nicht so geschmeidig in dominante Geschichtsbilder zu integrieren war und die politische Rhetorik ihrer professionellen Verbände so ungebrochen zu tönen schien. Heimat ist hier die Erinnerung an einen verlorenen Ort der Geburt und Herkunft, der zwangsweise und unrechtmäßig verlassen werden musste (Fendl 2002; Beer 2010).
Heimat blieb indes in der BRD kein Monopol des politischen Konservativismus, sondern fand sich nach dem Fortschritts-, Planungs- und Machbarkeitsoptimismus der Wirtschaftswunderjahre seit den 1970er-Jahren als Sinnstiftungsvokabel neuer sozialer Bewegungen wieder. Hier mobilisierte der Anspruch auf politische Selbstbestimmung Protestbewegungen gegen politische Zentralisierung, Bürokratisierung, Umweltzerstörung und technologische Großprojekte (Bredow/Foltin 1981). Gegen eine so erfahrene Enteignung der Lebenswelten und des Nahraums wurde Heimat hier thematisiert als Ort aktiver Weltaneignung und menschlich gestalteter Umwelt, die Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstbestimmung ermöglichen sollte.
Zur Funktionsgeschichte moderner Heimat-Thematisierungen zählt indes genauso die von der Kulturindustrie produzierte und gelieferte Kulissen-Heimat – als Kitschroman, Schlager oder Heimatfilm. Auch hier fungieren Heimat-Botschaften als Sedativum und lösen Widersprüche in konsumierbaren Bildern heiler Welt und Kitschidyllen auf. Die Anziehungskraft der Heimatfilme der 1950er-Jahre wäre ohne vorangegangene NS-Diktatur und Traumatisierungserfahrungen nicht plausibel.
In jedem Fall: Heimat erschien immer als eine mögliche Antwort auf Krise, ein Krisensymptom. Und dies setzt sich fort mit der Entfaltung moderner Industriezivilisationen bis hin zu unserer gegenwärtigen Epoche der Globalisierung, in der nun wieder so viel von Heimat die Rede ist. Und wieder sind es ähnliche Erfahrungen, ähnliche Zumutungen – Erfahrungen des Verlusts, des beschleunigten Wandels, fragwürdiger Zugehörigkeiten, Auseinandersetzungen mit Fremdem, eben Nicht-Vertrautem. Vielleicht lässt sich ja diese Rechnung aufmachen: Je komplexer die Wirklichkeit, je undurchschaubarer, desto drängender und lauter umgekehrt die Heimat-Reden. In jedem Fall: Dem Reden über Heimat geht immer erst ein Verlust voraus – eine Vertreibung aus irgendeiner Form von Paradies, auch wenn dieses nie ein Paradies gewesen sein mag.
Heimatlos – eine psychoanalytische Annäherung (A. Dieterle)
Ich möchte die Unbestimmtheit des Begriffs Heimat zum Ausgangspunkt meiner assoziativen Überlegungen machen. Ich rede aus der Perspektive einer sesshaften Kultur. (Bazzi, 2013)
Zunächst Bemerkungen zu meiner Gegenübertragung
Bei der Vorbereitung fiel es mir immer wieder schwer, mich auf „heimatlos“ zu focusieren, – hielt ich etwas nicht aus? Einsamkeit, Erinnerung an Heimweh, Verzweiflung, sozialer Tod, zu Ikonen gewordene Fotos von Flüchtlingen an Nicht-Orten im Sinne von „Orten der Ortlosen“ (Auge, 2014) eine Passage aus dem Gedicht ‚Heimatlos’ von Max Herrmann Neisse (1889-1941):
„Wir ohne Heimat irren so verloren und sinnlos in der Fremde Labyrinth“
Musik hören um ‚heimatlos’ annähernd emotional erfassen zu können, – für mich die Winterreise von Schubert, andere haben andere Präferenzen – Musik als präsentative Symbolisierung von Emotionen (Langer, zit. nach Rolf, 2006, S. 126). Ich war auch etwas beschämt, wenn ich bei mir Heimatgefühle feststellte, mich an Heimweh erinnerte, Abhängigkeitsscham? Aber abhängig sein ist ein fact of life.
Immer mal wieder habe ich genug von Heimat und dem Los der Heimatlosigkeit. Ich halte mir lieber vor Augen: Neugier, der Wisstrieb, stehen am Anfang der alttestamentarischen Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies. Migration im Außen und Innen kann Leiden schaffen und sie ist ein kreativer Akt.
Wie im Vorangehenden Teil ausgeführt wurde, ist Heimat ein widersprüchlicher, starke Affekte auslösender Begriff, eine Melange die in Menschen die Gewissheit von guten Erfahrungen ansprechen kann, im Namen derer aber auch Aggression bis zu Vernichtung anderer legitimiert erscheint. Er hat in Krisenzeiten Konjunktur. Das weckt das psychoanalytische Interesse: heftiges konflikthaftes Erleben, Gefahr des Ausagierens, Mehrdeutigkeit. Da geht es um Unbewusstes, Verdrängtes, Unintegriertes, etwas schwer Darstellbares.
Der Medientheoretiker Vilem Flusser (1992) spricht von „geheimen Codes der Heimaten, die größtenteils aus unbewussten Gewohnheiten gesponnen“ sind (S. 12). Heimat habe etwas Heiliges, Mystifiziertes, eine Sakralisierung des Banalen.
In der Romantik kam die Rede von der Heimat auf und die Erkenntnis von Carl Gustav Carus: „Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens liegt in der Region des Unbewussten …“ (nach Krämer, 2012, S. 22), eine Wurzel der Psychoanalyse als unserer geistigen Heimat liegt auch in der Romantik, spezifischer: der schwarzen Romantik.
Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Anerkennung – das ist unser Terrain, da kennen wir uns aus - wirklich? Auf unser Wissen komme ich zurück, vorab jedoch zum Fragezeichen – „Schlag nach bei Freud“. Ausgerechnet in seiner Arbeit „Das Unheimliche“ (1919) schreibt Freud über Heimat, der Mutterleib als „die alte Heimat des Menschenkindes, die Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat.“ Zuerst kommt er nach gründlicher „semantischer Subversion“ (Krämer, 2012, S. 22 ) zu dem Schluß: unheimlich ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, vertraut, aber es ist mehr: heimlich heißt auch versteckt, verborgen, unbehaglich, Grauen erweckend. …“ Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendeine Art von heimlich…“ (S. 250) Nichts ist sicher. Und Heimat verweist implizit auf Fremdes, schließt aus, macht etwas zum Abseitigen.
S. Freud: „Das Unheimliche des Erlebens kommt zustande, wenn verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden oder wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt erscheinen“ (S. 271). An verdrängten infantilen Komplexen nennt Freud den Kastrationskomplex und die Mutterleibsphantasien – eine Phantasie vom Leben im Mutterleib „von gewisser Lüsternheit getragen“ (S. 266). Implizit darin enthalten ist der tief erschütternde Anlaß für den Kastrationskomplex: die Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes – dann ist der Mutterleib kein gemütlicher Ort mehr – die alte Heimat wird, auch aus anderen Gründen, hochambivalent. Illusion von Heimat als Zustand der Ungetrennheit, in dem alle Unterschiede aufgeboben sind?
Kurzer Exkurs: Freuds Arbeit „Das Unheimliche“ entstand im Zusammenhang mit der Theoriewende Freuds der zwanziger Jahre. A. Green: „Zur damaligen Zeit deuten etliche Zeichen darauf hin, dass etwas in Bewegung gekommen ist, ohne dass man allerdings hätte vorhersagen können, in welche Richtung dies gehen würde: in dem Text Das Unheimliche beispielsweise, dessen Titel allein schon Programm ist.“ (2000, S.18/19) - ein Beitrag zur aktuellen Zeitdiagnose?
Heute haben wir differenziertere Kenntnisse über die frühe kindliche Entwicklung und den damit verbundenen Ängsten, die „archaischen Seelenqualen“, wie Winnicott (1974, 1991) sie in seiner Arbeit „Die Angst vor dem Zusammenbruch“ nennt, das Wort Ängste ist ihm nicht stark genug. Er nennt u.a. Angst vor Desintegration, Angst vor Verlust der psychosomatischen Verschmelzung als des in sich Wohnens (indwelling). Vielleicht hat Freud das mit Grauen gemeint, was wir heute namenlose Angst nennen, Angst vor der katastrophischen Veränderung. Grauen als Erleben der nicht darstellbaren Abwesenheit des Notabwendenden Objekts. Grinberg und Grinberg (1984, 2019) beschreiben Migration als einen möglicherweise „katastrophenhaften Wandel.“ (S. 91)
Um diese in jeder psychischen Entwicklung vorkommenden Ängste, Konflikte bewältigen zu können, bedarf es bestimmter Bedingungen von außen. Dazu Parin (1996), in seiner in verärgertem Ton verfassten Rede „Heimat, eine Plombe“: „gewiß sind Kinder auf eine Heimat, eine Sicherheit und Geborgenheit angewiesen, auf ein Minimum, einen Stall von Bethlehem oder auch nur das Tragtuch einer liebenden Nomadenmutter“, (S. 17), ein berührendes Bild für holding und containing. Es bedarf zu Beginn des Lebens des Zusammentreffens der Fähigkeit des Kindes zur Projektion und einer die Affekte aufnehmenden, verarbeitenden und sie zurückgebenden Person – nach Bion Paarung einer Präkonzeption mit einer Realisierung, die Angriffe übersteht (Nissen, 2009). Kann dies als Keim der Erfahrung von Heimat verstanden werden, als psychische „Wurzelbildung“? Die erste Heimat im Austausch mit einer Person, in der das Kind psychisch repräsentiert ist, ergänzend zum Mutterleib als erste Heimat der psychische Raum der Mutter, vielleicht sogar die Phantasie des zeugenden Elternpaares. Daraus kann sich die Heimat entwickeln, von der Parin sagt: Eine Heimat, „die man hat (als Erwachsener), die man braucht, die man in sich hat“ (S. 14).
Missglückt dies, ist das der Kern einer unerträglichen fundamentalen Heimatlosigkeit? Eine äußere Heimat, die an einen konkreten Ort gebunden ist, kann, so Parin: „eine seelische Plombe sein, die Lücken füllt, seelische Brüche überbrückt, je brüchiger das Selbstwertgefühl, desto nötiger die Heimatgefühle.“ (S. 18). Die Bildung von Abwehrorganisationen, Rückzugsorten, romantischer Perversion, Utopien, Dystopien, usw. können als Versuche einer Beheimatung verstanden werden, allerdings auf Kosten der Entwicklung. Das Bedürfnis, sich einzurichten ist sehr groß.
Zu Parin und seiner als provokant erlebten Rede: Heimat, eine Plombe: Er hielt diese Rede 1994 anlässlich eines Symposiums: „Wie viel Heimat braucht der Mensch und wie viel Fremde verträgt er.“ (auf dem Hintergrund der Arbeit von Jean Améry). Er war über das Thema „konsterniert“. „Nicht wegen Heimat. … Was mich betroffen gemacht und beinahe verärgert hat, war das Allgemeine an der Frage … Sobald „Mensch“ befragt wird, ob er Heimat braucht, rücken wir ihn in die bedenkliche Nähe zu den postmodernen Suchern, Vermittlern und Kämpfern um Identität, mit der heute jede nationale, völkische oder sonst wie kollektive Abgrenzung oder Ausgrenzung legitimiert, jeder beliebige Herrschafts- und Machtanspruch begründet, schließlich jede menschliche Solidarität in Frage gestellt wird“ (S. 17).
Heimat hat in Krisenzeiten Konjunktur. Wir können das als Regression verstehen. Ich möchte eine Vignette vorstellen, in der dies im Kontext der „psychischen Entwicklung als migratorische Erfahrung“ wie es Grinberg und Grinberg (1984, 2010) nannten, illustriert wird.
Es handelt sich um einen jungen Soldaten, Don Jose, aus der Oper Carmen von G. Bizet.
1. Akt: Carmen sang die Habanera, das Lied von der Freiheit der Liebe, im Weggehen warf sie Don Jose auffordernd eine Blume zu, die dieser an sich drückt. In diesem Augenblick höchster Verwirrung: „Dieser Duft so berauschend, und die Blume, wie schön! – Und das Mädchen – sollt wirklich Hexen es geben, ist sie eine, ganz gewiss.“ ruft Micael „Jose.“ … Micaela das Bauernmädchen, die Botin der Mutter mit dem Auftrag, ihn nach hause zu holen. Don Jose singt „Parle-moi de ma mère“
„Ich seh die Mutter dort, sie ruft zurück mir im Bilde
Das stille Tal und das Haus, wo meine Wiege einst stand.
Ach gern denk deiner ich, mein teures Heimatland.
… wer weiß, welcher Dämon sich gegen mich wendet?
Selbst in der Ferne schützt mich der Mutter Wort
Und dieser Kuß, den sie gesendet,
entreißt mich der Gefahr, er sei mein Schirm und Hort.
… fürchte nichts oh Mutter, Dein Sohn wird Deine Wünsche mit Freuden
stets erfüllen. Lieb ich doch Micaela, sie soll mein Weibchen sein,
trotz Deiner Blumen, Du braune Hexe.“
Es geht furchtbar aus.
Zur Musik dieser Szene schreiben Abbate und Parker (2012): „Stücke, wie das Duett Micaelas mit Jose „muten im Vergleich zur Bühnenmusik abgehoben an: schön zwar, aber distanziert, auf eine Vergangenheit verweisend (oder aus ihr kommend), die sich nicht mehr zurückholen lässt: die Musik scheint einer idealisierten Welt anzugehören, die wahrscheinlich nie existiert hat und mit Sicherheit 1875 nicht existierte.“( S. 423).
Leidet Don Jose unter anderem an Heimweh?
1936 (!) schrieb der Psychoanalytiker Wilhelm Nicolini in einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift Imago (bevor diese 1937 „ins Exil“ ging) „Über den Zusammenhang von Heimweh und Kriminalität“:
„… ein „Heim“weh im Sinne einer Sehnsucht nach einer bekannten Umgebung existiert nicht. Der mit „Heim“weh bezeichnete Gefühlskomplex ist nur ein Ausdrucksmittel einer inzestuös fixierten Libido – ein „Heim“weh im Sinne einer Sehnsucht nach einer bekannten Umgebung existiert nicht.“ (S. 115)
Nach Hause – Skizzen zur Geschichte der Heimweh-Krankheit (F. Schmoll)
Über Heimat können eigentlich nur die Heimatlosen reden. Sie artikulieren den Anspruch auf Beheimatung ohne jede Fragwürdigkeit. Heimweh ist nun ganz sicher etwas, von dem wir ausgehen müssen, dass es jeden Heimatlosen, jeden Heimatvertriebenen, jeden Flüchtling und Migranten plagt, dass er es mit sich schleppt – gleichwie er damit zurande kommt, ob als existenzielle Infragestellung, als harmloses Sentiment oder vielleicht auch als schöpferische Möglichkeit (Flusser 1992). Natürlich sind bei der Symptomatik „Heimweh“ die Ursachen genauso von Interesse wie die psychischen Energien. Im Fall der Krankheits-Geschichte Heimweh fasziniert freilich auch die Frage, wie dieses Symptom in der Geschichte des europäischen Wissens diagnostiziert und gedeutet wurde. Welchen Reim machten sich eigentlich welche Wissenschaften zu welchen Zeiten auf diese Sehnsucht der Heimatlosen, nach Hause kehren zu dürfen? So besehen ist die Geschichte des Heimwehs, seit es zunächst als „Schweizer Krankheit“ in der europäischen Geschichte dokumentiert ist, bis hin zu E.T., der sein Heimweh mit seinen Telefonaten zum drei Millionen Lichtjahre entfernten Heimat-Planeten lindern möchte, auch eine Geschichte von Deutungsversuchen, von Versuchen, Beziehungen zwischen Heimat und Fremde auszubalancieren.
Eine der frühen Quellen zur Geschichte des Heimwehs stammt aus dem „liber familiarum“ des Krummenauer Pfarrers Alexander Bösch, der 1683 niederschrieb: „Glych im Anfang, als ich gen Zürich kamm, veillycht wegen Heimwehes und weil ich der Spyss nicht gewohnet hatte, ohne Milch sein müesst, bin ich in schwere Krankheit gefallen.“ (zit. nach Baumann 2013, S. 102) Da mag man hellhörig werden, dass da einer in schwere Krankheit fällt, weil er seine vertrauten Speisen entbehren muss, vor allem Milch. Noch anderes ist bemerkenswert: Alexander Bösch stammte aus dem Toggenburg – zwischen seiner heimisch-vertrauten Welt, aus der er aufgebrochen war und dieser unwägbaren-abweisenden Fremde in Zürich lagen gerade mal rund 80 Kilometer! Heute ein Katzensprung, damals eine unendlich ferne Fremde.





























