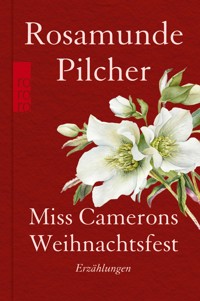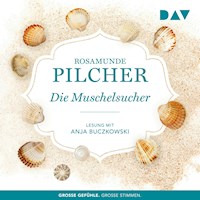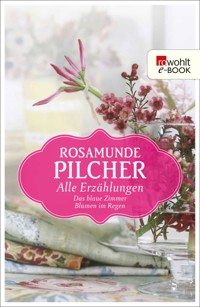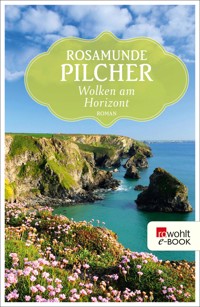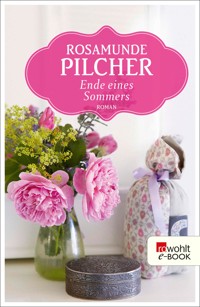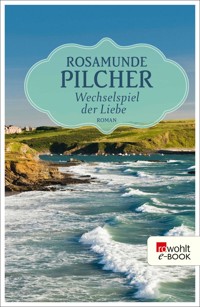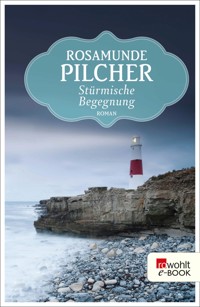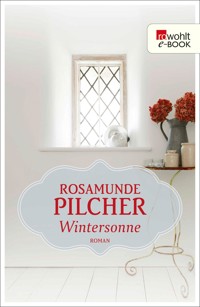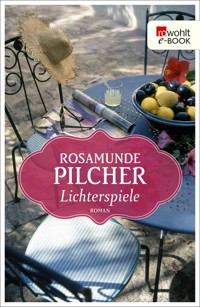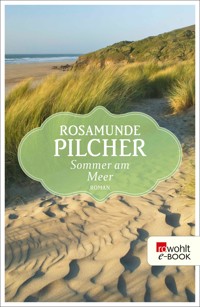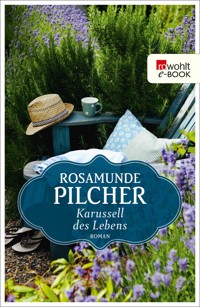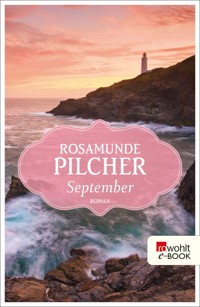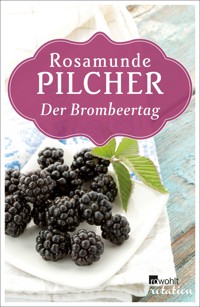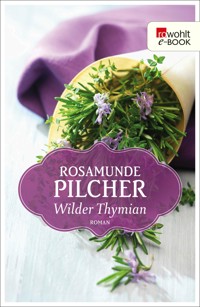9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ein Stoff, aus dem die Träume sind.» (Marie Claire) Cornwall 1935. Während ihre Familie zum Vater ins ferne Ceylon zieht, bleibt die vierzehnjährige Judith Dunbar allein in England zurück. Auf einem Internat soll sie ihre Schulausbildung beenden. Judith ist alles andere als glücklich darüber. St. Ursula ist eine altmodische Mädchenschule, die Trennung von ihrer Familie fällt ihr schwer. Zum Glück freundet sie sich bald mit der unkonventionellen und wohlhabenden Loveday Carey-Lewis an. In den folgenden Jahren verbringt Judith viel Zeit auf dem Anwesen von Lovedays warmherziger Familie. Hier erlebt sie nicht nur eine völlig neue, aufregende Welt, sondern auch die erste Liebe. Doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und verändert das Leben der jungen Frauen für immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1774
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Heimkehr
Roman
Aus dem Englischen von Ingrid Altrichter, Helmut Mennicken und Maria Mill
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für meinen Mann Graham, der in der Highland Division gedient hat.
Und für Gordon und Judith und für alle von uns, die in jener Zeit gemeinsam jung waren.
Erster Teil
1935
Die Städtische Schule von Porthkerris stand auf halber Höhe eines steilen Hangs, der vom Herzen der Stadt ins offene Heideland hinaufführte. Es war ein wuchtiger viktorianischer Granitbau mit drei verschiedenen Eingängen für Knaben, Mädchen und Kleinkinder, ein Vermächtnis aus den Tagen, in denen die Geschlechtertrennung vorgeschrieben war. Mit dem geteerten Schulhof und dem hohen schmiedeeisernen Zaun wirkte sie meistens ziemlich abweisend. An diesem Spätnachmittag im Dezember war sie jedoch hell beleuchtet, und aus den offenen Türen strömten Scharen aufgeregter Kinder mit Turnbeuteln, Bücherranzen, Luftballons und kleinen Papiertüten voller Süßigkeiten. Drängelnd und kichernd kamen sie in Grüppchen heraus und hänselten einander noch vergnügt, bevor sie sich schließlich trennten und nach Hause gingen.
Für ihren Überschwang gab es zwei Gründe: das Ende des Wintertrimesters und die Weihnachtsfeier in der Schule. Sie hatten gespielt und gesungen und sich bei Staffelläufen in der Aula kleine, mit Bohnen gefüllte Säckchen aus den Händen gerissen und an den Nächsten in der Mannschaft weitergegeben. Zu den dumpfen Klängen des verstimmten alten Klaviers hatten die Kinder den Volkstanz Sir Roger de Coverley aufgeführt, danach Marmeladenkuchen und Safranbrötchen gegessen und Brauselimonade dazu getrunken. Am Ende hatten sie sich in einer langen Reihe aufgestellt und nacheinander Mr. Thomas, dem Direktor der Schule, die Hand geschüttelt, ihm frohe Weihnachten gewünscht und eine Tüte mit Süßigkeiten in Empfang genommen.
Es war Jahr für Jahr die gleiche Prozedur, die aber immer mit Freuden erwartet wurde und großen Anklang fand.
Allmählich verebbte der geräuschvolle Strom der Kinder, bis nur noch die Nachzügler herauströpfelten, die sich bei der Suche nach verlorengegangenen Fäustlingen oder einem abhandengekommenen Schuh verspätet hatten. Ganz zuletzt, als die Schuluhr bereits ein Viertel vor fünf schlug, traten zwei Mädchen durch die offene Tür: Judith Dunbar und Heather Warren, beide vierzehn Jahre alt, beide in marineblauen Mänteln und Gummistiefeln und mit Wollmützen, die sie sich über die Ohren gezogen hatten. Doch weiter reichte ihre Ähnlichkeit nicht, denn Judith war blond und hellhäutig, hatte kurze, dicke Zöpfe, Sommersprossen und blassblaue Augen, während Heather, die das Aussehen ihres Vaters geerbt hatte, über Generationen von Vorfahren hinweg einem spanischen Seefahrer nachschlug, der nach der Vernichtung der Armada an die Küste Cornwalls gespült worden war. Deshalb hatte sie einen olivfarbenen Teint, rabenschwarzes Haar und dunkle, strahlende Augen.
Die zwei Mädchen brachen nach der Feier als Letzte auf, weil Judith die Schule von Porthkerris für immer verließ und sich nicht nur von Mr. Thomas verabschieden musste, sondern auch von allen anderen Lehrern sowie von Mrs. Trewartha, der Köchin, und vom alten Jimmy Richards, zu dessen bescheidenen Aufgaben es gehörte, den Heizkessel in Gang zu halten und die außerhalb des Gebäudes gelegenen Toiletten zu reinigen.
Aber schließlich hatte Judith allen Lebewohl gesagt, und sie gingen über den Schulhof und durch das Tor. An diesem wolkenverhangenen Tag war die Dämmerung früh hereingebrochen. Schwarz und nass wand sich die Straße den Hügel hinab, und ein feiner Nieselregen schimmerte in den Lichtkegeln der Laternen, die sich in den Pfützen spiegelten. Die Mädchen machten sich auf den Weg in die Stadt. Eine Weile schwiegen beide. Dann seufzte Judith.
«So», sagte sie entschieden, «das war’s dann.»
«Muss ein komisches Gefühl sein, wenn man weiß, dass man nicht mehr zurückkommt.»
«Ja, das stimmt. Doch am meisten wundert mich, dass ich ein bisschen traurig bin. Ich hätte nämlich nie gedacht, dass ich jemals traurig würde, wenn ich irgendeine Schule verlasse, aber jetzt bin ich’s trotzdem.»
«Ohne dich wird es nie mehr so, wie es war.»
«Ohne dich auch nicht. Nur, du hast es gut, dir bleiben immerhin noch Elaine und Christine als Freundinnen. Ich muss ganz von vorn anfangen und versuchen, in St. Ursula eine zu finden, die ich mag. Außerdem muss ich dort diese Schuluniform tragen.»
Heather schwieg mitfühlend. Die Uniform war fast das Schlimmste von allem. In Porthkerris konnten sie anziehen, was sie wollten; mit ihren Pullovern in verschiedenen Farben sahen sie fröhlich aus, und die Mädchen banden sich bunte Schleifen ins Haar. Aber St. Ursula war eine Privatschule und vorsintflutlich altmodisch. Dort mussten alle dunkelgrüne Tweedjacken und dicke braune Strümpfe tragen, dazu dunkelgrüne Hüte, die sie so entstellten, dass selbst die Hübschesten damit richtig hässlich aussahen. In St. Ursula wurden sowohl Mädchen aufgenommen, die nur tagsüber kamen, als auch solche, die dort im Internat wohnten. Für diese bedauernswerten Geschöpfe empfanden Judith, Heather und ihre Mitschülerinnen in Porthkerris nichts als Verachtung, und sie verspotteten sie gnadenlos, falls sie das Pech hatten, mit ihnen im selben Bus zu fahren. Wie deprimierend, sich auszumalen, dass Judith es mit diesen bescheuerten Musterschülerinnen aufnehmen musste, die sich selbst für so großartig hielten.
Am schrecklichsten war allerdings die Aussicht auf das Internat. Die Warrens hielten zusammen wie Pech und Schwefel, und Heather konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als von ihren Eltern und ihren zwei Brüdern getrennt zu werden. Die beiden waren älter als sie, sahen gut aus und hatten ebenso rabenschwarzes Haar wie ihr Vater. In der Schule von Porthkerris waren sie für ihren Unfug und ihre üblen Streiche berüchtigt gewesen, doch seit sie eine höhere Schule in Penzance besuchten, dort von einem furchterregenden Direktor einigermaßen gezähmt wurden und sich hinter ihre Bücher klemmen mussten, hatten sie sich etwas gebessert. Trotzdem machte mit ihnen alles immer noch den größten Spaß, sie hatten Heather Schwimmen und Radfahren beigebracht und ihr gezeigt, wie man von ihrem plumpen Holzkahn aus mit dem Schleppnetz Makrelen fischte. Wie konnte man sich allein mit Mädchen überhaupt amüsieren? Es spielte keine Rolle, dass St. Ursula in Penzance und damit nur zehn Meilen entfernt war. Zehn Meilen wären für Heather ewig weit, wenn sie von Mum und Dad und Paddy und Joe fort müsste.
Der armen Judith blieb anscheinend keine andere Wahl. Ihr Vater arbeitete in Colombo auf Ceylon, und Judith hatte mit ihrer Mutter und der kleinen Schwester vier Jahre lang getrennt von ihm gelebt. Jetzt kehrte Mrs. Dunbar mit Jess nach Ceylon zurück, und Judith musste hierbleiben, ohne die leiseste Ahnung, wann sie ihre Mutter wiedersehen würde.
Aber es war, wie Mrs. Warren zu sagen pflegte, zwecklos, über vergossene Milch zu weinen. Heather suchte nach etwas, womit sie Judith aufheitern könnte.
«Es gibt ja noch Ferien.»
«Bei Tante Louise.»
«Ach komm, lass den Kopf nicht so hängen! Du bleibst wenigstens hier in der Gegend. In Penmarron. Stell dir vor, deine Tante würde in einem schrecklichen Ort wohnen, irgendwo landeinwärts, oder in einer Stadt, in der du keinen kennst. So können wir uns immerhin noch treffen. Du kannst zu mir kommen, und wir gehen an den Strand runter. Oder ins Kino.»
«Bist du dir da so sicher?»
Heather war verdutzt. «Was soll das heißen?»
«Na ja, bist du dir sicher, dass du mich dann immer noch sehen und meine Freundin sein willst? Wenn ich in St. Ursula bin und so. Meinst du dann nicht, ich sei auch eingebildet und grässlich?»
«Ach du!» Heather gab ihr mit dem Turnbeutel einen freundschaftlichen Klaps auf den Po. «Wofür hältst du mich denn?»
«Für mich wäre es ein Stückchen Freiheit.»
«Das hört sich ja an, als müsstest du in ein Gefängnis.»
«Du weißt schon, was ich meine.»
«Wie sieht eigentlich das Haus deiner Tante aus?»
«Es ist ziemlich groß und steht direkt oberhalb des Golfplatzes. Außerdem ist es vollgestopft mit Messingtabletts, Tigerfellen und Elefantenfüßen.»
«Elefantenfüße? Du meine Güte, was macht sie denn damit?»
«Einen benutzt sie als Schirmständer.»
«Das würde mir nicht gefallen. Aber du musst ihn sicher nicht dauernd anschauen. Hast du dort ein Zimmer für dich?»
«Ja. Ich krieg ihr bestes Gästezimmer. Es hat ein eigenes Waschbecken und genug Platz für meinen Schreibtisch.»
«Klingt gut. Ich weiß gar nicht, warum du so ein Theater machst.»
«Ich mache kein Theater. Es ist eben nicht mein Zuhause. Und da oben ist es so kalt, rau und windig. Das Haus heißt Windyridge, was mich überhaupt nicht wundert. Selbst wenn sich sonst nirgendwo ein Lüftchen regt, scheint an Tante Louises Fenstern immer ein Sturm zu rütteln.»
«Hört sich irgendwie gespenstisch an.»
«Außerdem ist es so abgelegen. Dort kann ich nicht mehr einfach in einen Zug einsteigen, und die nächste Bushaltestelle ist auch zwei Meilen entfernt. Und Tante Louise wird keine Zeit haben, mich durch die Gegend zu kutschieren, weil sie ständig Golf spielt.»
«Vielleicht bringt sie es dir bei.»
«Ha, ha, ha.»
«Mir scheint, du brauchst unbedingt ein Fahrrad. Dann kannst du jederzeit hinfahren, wohin du willst. Über die Höhenstraße sind es nur drei Meilen bis Porthkerris.»
«Du hast wirklich gute Einfälle. Auf ein Fahrrad bin ich noch gar nicht gekommen.»
«Ich weiß sowieso nicht, warum du noch keins hast. Mein Dad hat mir meins geschenkt, als ich zehn war. Es taugt zwar nicht viel hier in diesem elenden Kaff mit den ganzen Hügeln, aber da draußen bei dir wäre es genau das Richtige.»
«Sind die sehr teuer?»
«Ein neues kostet ungefähr fünf Pfund. Aber vielleicht kannst du ein gebrauchtes ergattern.»
«Meine Mutter kennt sich in solchen Sachen nicht besonders gut aus.»
«Ich glaub, das tut keine Mutter, ehrlich. Aber es ist nicht sehr schwierig, in einen Fahrradladen zu gehen. Lass dir eins zu Weihnachten schenken.»
«Ich hab mir für Weihnachten schon einen Pulli gewünscht. Einen mit Polokragen.»
«Na, dann wünsch dir noch ein Fahrrad dazu.»
«Das kann ich nicht.»
«Natürlich kannst du. Sie kann ja schlecht Nein sagen. Wenn sie weggeht und nicht weiß, wann sie dich wiedersieht, schenkt sie dir alles, was du willst. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist», was ein weiterer Lieblingsspruch von Mrs. Warren war.
Doch Judith antwortete nur: «Mal sehen.»
Eine Weile gingen sie schweigend weiter, nur ihre Schritte hallten über das nasse Pflaster. Sie kamen an einer Fisch-und-Frittenbude vorbei, die hell erleuchtet war, und der Geruch nach heißem Fett und Essig, der aus der Tür drang, machte ihnen den Mund wässrig.
«Diese Tante Louise, ist das die Schwester deiner Mutter?»
«Nein, die Schwester meines Vaters. Sie ist aber viel älter. Um die fünfzig. Sie hat lange in Indien gelebt. Von dort hat sie auch die Elefantenfüße.»
«Und dein Onkel?»
«Der ist tot. Sie ist Witwe.»
«Hat sie Kinder?»
«Nein. Ich glaub, sie haben nie welche gehabt.»
«Komisch, nicht? Meinst du, weil sie keine gewollt haben oder weil da … irgendwas … nicht passiert ist? Meine Tante May hat auch keine Kinder, und ich hab gehört, wie Dad gesagt hat, sie hat keine, weil Onkel Fred ihn nicht hochkriegt. Was glaubst du denn, was er damit gemeint hat?»
«Keine Ahnung.»
«Denkst du, es hat etwas mit dem zu tun, was uns Norah Elliot erzählt hat? Du weißt schon, neulich hinter dem Fahrradschuppen.»
«Das hat sie doch bloß erfunden.»
«Woher willst du das denn wissen?»
«Weil es zu widerlich ist, um wahr zu sein. Etwas so Widerliches kann sich nur Norah Elliot ausdenken.»
«Wahrscheinlich …»
Es war ein spannendes Thema, um das die beiden Mädchen von Zeit zu Zeit herumgeredet hatten, ohne dass sie dabei jemals zu einem brauchbaren Ergebnis gelangt wären, es sei denn zu der Erkenntnis, dass Norah Elliot unangenehm roch und ihre Blusen immer schmutzig waren. Jedenfalls war jetzt nicht die Zeit dazu, das Rätsel zu lösen, denn über ihrem Gespräch waren sie unten im Stadtzentrum angekommen, bei der öffentlichen Bibliothek, dort, wo sich ihre Wege trennten. Heather musste weiter in Richtung Hafen, durch schmale Straßen und verwinkelte, mit Kopfsteinen gepflasterte Gassen, bis zu dem schlichten Haus aus Granitsteinen, in dem die Warrens über Mr. Warrens Lebensmittelgeschäft wohnten, während Judith noch einen weiteren Hügel hinauf zum Bahnhof musste.
Klitschnass standen sie unter einer Straßenlampe im Nieselregen und sahen einander an.
«Jetzt müssen wir wohl Abschied nehmen», sagte Heather.
«Ja, ich glaub schon.»
«Du kannst mir schreiben. Meine Adresse hast du ja. Und ruf im Laden an, wenn du mir eine Nachricht hinterlassen willst. Ich meine … sag Bescheid, wann du in den Ferien herkommst.»
«Ja, das mach ich.»
«Die Schule wird schon nicht so schlimm werden.»
«Nein, sicher nicht.»
«Also dann, bis bald.»
«Bis bald.»
Doch keine rührte sich von der Stelle. Sie waren vier Jahre lang Freundinnen gewesen. Es war ein schmerzlicher Augenblick.
Schließlich sagte Heather: «Schöne Weihnachten.»
Pause. Plötzlich beugte sie sich vor und drückte Judith einen Kuss auf die regennasse Wange. Danach wandte sie sich ohne ein weiteres Wort um und rannte weg. Ihre Schritte wurden leiser und leiser, bis sie gar nicht mehr zu hören waren. Erst dann setzte Judith ihren Weg fort. Sie kam sich ein wenig verwaist vor, als sie die schmale Gasse zwischen kleinen, hellerleuchteten Geschäften hinaufstieg, in deren weihnachtlich geschmückten Schaufenstern sich Rauschgoldgirlanden um Mandarinenkisten und dunkelrote Schleifen um Gläser mit Badesalz schlangen. Sogar der Eisenwarenhändler hatte das Seine getan. EIN NÜTZLICHES UND PASSENDES GESCHENK, stand auf einer handgeschriebenen Karte, die an einem gewaltigen, mit einem künstlichen Stechpalmenzweig verzierten Tischlerhammer lehnte. Oben angelangt, ging Judith an dem letzten Geschäft vorüber, der hiesigen Filiale von W.H. Smith, in der ihre Mutter samstags ihre Leihbücher umtauschte und einmal im Monat die Vogue kaufte. Von da an wurde die Straße eben, die Häuser hörten allmählich auf, und ohne ihren Schutz war Judith nun voll dem Wind ausgesetzt. Er kam stoßweise und wehte ihr seine feuchten Schwaden ins Gesicht. In der Dunkelheit fühlte sich dieser Wind eigentümlich an, und er brachte das Geräusch der Brecher mit, die weit unten an den Strand donnerten.
Nach ein paar Schritten blieb Judith stehen und stützte die Ellbogen auf eine niedrige Steinmauer, um nach dem steilen Anstieg ein wenig zu verschnaufen. Verschwommen sah sie das Gewirr der Häuser, die sich bis zum dunklen Hafenbecken hinunterzogen, das die Laternen der Hafenstraße wie eine gewundene Halskette umschlossen. Die roten und grünen Ankerlichter der Fischerboote dümpelten in der Dünung und spiegelten sich im tintenschwarzen Wasser. Der Horizont verlor sich in der Dunkelheit, doch der Ozean wogte rastlos weiter. Weit draußen sandte der Leuchtturm seine Warnfeuer aus. Einen kurzen Strahl, dann zwei lange Strahlen. Judith stellte sich die Wellen vor, die unentwegt die gefährlichen Klippen überspülten, zwischen denen er aufragte.
Sie fröstelte. Es war zu kalt, um in dem nassen Wind herumzustehen. In fünf Minuten würde der Zug abfahren. Sie begann zu laufen, wobei ihr der Turnbeutel gegen die Beine schlug, erreichte endlich die lange Treppe aus Granitstufen, die zum Bahnhof hinabführte, und flitzte so unbekümmert hinunter, wie das nur jemand tun konnte, der sie seit Jahren gut kannte.
Die kleine Küstenbahn stand bereits da. Eine Lokomotive, zwei Waggons der dritten und einer der ersten Klasse und der Dienstwagen. Sie brauchte keinen Fahrschein zu kaufen, da sie eine Schülerkarte besaß, und Mr. William, der Schaffner, kannte sie ohnehin so gut wie seine eigene Tochter. Charlie, der Lokführer, kannte sie auch, und wenn sie sich einmal verspätet hatte, brachte er es fertig, mit seinem Zug an der Haltestelle von Penmarron zu warten und die Pfeife zu ziehen, während Judith durch den Garten von Riverview House hetzte.
Die tägliche Bahnfahrt zur Schule und wieder zurück war etwas, was sie wirklich vermissen würde, denn die Strecke schlängelte sich drei Meilen an einem atemberaubenden Küstenstrich entlang, der dem Auge bot, was man sich nur wünschen konnte. Weil es dunkel war, konnte Judith nun, während der Zug dahinratterte, zwar nichts sehen, wusste aber, dass dennoch alles vorhanden war: Felsen und steile Abhänge, Buchten und Strände, bezaubernde kleine Cottages und schmale Wege zwischen winzigen Wiesen, auf denen im Frühling gelbe Narzissen blühten. Dann kamen die Sanddünen und der riesige, menschenleere Strand, den sie inzwischen als ihren eigenen betrachtete.
Manchmal, wenn Leute erfuhren, dass Judith ohne Vater aufwuchs, weil er am anderen Ende der Welt für die angesehene Reederei Wilson-McKinnon arbeitete, tat sie ihnen leid. Wie schrecklich, ohne Vater zu leben! Vermisste sie ihn denn nicht? Was war das für ein Gefühl, keinen Mann im Haus zu haben, nicht einmal am Wochenende? Wann würde sie ihn wiedersehen? Wann würde er heimkommen?
Auf solche Fragen antwortete sie stets ausweichend, teils weil sie darüber nicht sprechen wollte, teils weil sie nicht genau wusste, wie sie es wirklich empfand. Sie wusste nur seit eh und je, dass ihr Leben so verlaufen würde, weil alle Familien in Britisch-Indien so lebten, und die Kinder schluckten es und fanden sich damit ab, dass sie schon in zartem Alter Abschied nehmen mussten und lange Trennungszeiten letzten Endes unvermeidlich waren.
Judith war in Colombo geboren und hatte dort gelebt, bis sie zehn wurde, zwei Jahre länger, als die meisten britischen Kinder in den Tropen bleiben durften. In dieser Zeit waren die Dunbars nur einmal für einen langen Urlaub in die Heimat gereist, aber Judith war damals erst vier gewesen, und die Erinnerung an diesen Aufenthalt in England war mit den Jahren verblasst. Sie hatte England nie als Zuhause empfunden. Ihr Zuhause war Colombo, der geräumige Bungalow an der Galle Road mit seinem üppigen Garten, den nur die eingleisige Bahnlinie, die Richtung Süden nach Galle führte, vom Indischen Ozean trennte. Da das Meer so nahe war, spielte es offenbar keine Rolle, wie heiß es wurde, denn die heranrollenden Wellen brachten immer eine frische Brise mit, und im Haus hielten hölzerne Deckenventilatoren die Luft in Bewegung.
Doch unausweichlich war der Tag näher gerückt, an dem sie all das zurücklassen und nicht nur Haus und Garten Lebewohl sagen mussten, sondern auch Amah, der Kinderfrau, sowie Joseph, dem Butler, und dem alten Tamilen, der den Garten pflegte. Und auch Dad. Warum müssen wir fort?, hatte Judith noch gefragt, als er sie schon zum Hafen fuhr, wo das P & O-Schiff, das bereits die Dampfkessel aufheizte, vor Anker lag. Weil die Zeit dafür gekommen ist, hatte er geantwortet. Alles hat seine Zeit. Ihre Eltern hatten ihr nicht erzählt, dass ihre Mutter schwanger war, und Judith wurde erst nach der dreiwöchigen Reise, als sie bereits in dem grauen, verregneten, kalten England waren, in das Geheimnis eingeweiht, dass ein neues Baby unterwegs war.
Da sie kein eigenes Haus besaßen, in das sie zurückkehren konnten, hatte Tante Louise, von ihrem Bruder Bruce darum gebeten, sich der Sache angenommen, Riverview House gefunden und möbliert gemietet. Kurz nachdem sie eingezogen waren, kam Jess im Porthkerris Cottage Hospital zur Welt. Und jetzt war es an der Zeit, dass Molly nach Colombo zurückreiste. Jess fuhr mit ihr, und Judith musste hierbleiben. Sie beneidete die beiden entsetzlich.
Seit vier Jahren wohnte sie nun schon in Cornwall. Nahezu ein Drittel ihres Lebens. Im Großen und Ganzen waren es gute Jahre gewesen. Das Haus war komfortabel, bot genügend Platz für sie alle, und es hatte einen großen, weitläufigen Garten, der sich in mehreren Terrassen, Rasenflächen, Steinstufen und einer Wiese mit Apfelbäumen einen ganzen Hang hinunterzog.
Das Beste von allem war jedoch die Freiheit, die Judith genoss. Dafür gab es zwei Gründe. Das Baby, um das Molly sich kümmern musste, ließ ihr nur wenig Zeit, die größere Tochter ständig im Auge zu behalten, weshalb sie froh war, dass Judith sich mit sich selbst zu beschäftigen wusste. Und obwohl sie von Natur aus überängstlich und eine sehr fürsorgliche Mutter war, hatte sie schnell festgestellt, dass in dem verschlafenen kleinen Dorf und seiner friedlichen Umgebung einem Kind keine Gefahr drohte.
Vorsichtig hatte sich Judith über die Grenzen des Gartens hinausgewagt und die Gegend erkundet, sodass der Bahndamm, die angrenzenden Veilchenfelder und das Ufer der Flussmündung ihr Spielplatz wurden. Mutiger geworden, entdeckte sie den Weg zu der aus dem elften Jahrhundert stammenden Kirche mit dem rechteckigen normannischen Turm und dem windgepeitschten Friedhof voll alter, flechtenbewachsener Grabsteine. Eines Tages, als sie am Boden kauerte und versuchte, die in einen der Steine gemeißelte Inschrift zu entziffern, überraschte der Vikar sie dabei und führte sie, von ihrem Interesse entzückt, in die Kirche, erzählte ihr etwas über deren Geschichte, wies sie auf die architektonischen Eigenheiten hin und zeigte ihr die bescheidenen Schätze. Dann waren sie in den Turm hinaufgestiegen, ließen sich oben vom Wind durchschütteln, und er machte sie auf besonders sehenswerte Dinge aufmerksam. Judith kam es so vor, als täte sich die ganze Welt vor ihr auf, eine riesige Landkarte in herrlichen Farben: Wiesen und Felder wie eine Flickendecke aus grünem Samt für die Weideflächen und braunem Kord für die Äcker; in der Ferne einige Hügel, von Steinmalen gekrönt, die aus einer unvorstellbar weit zurückliegenden Zeit stammten; die breite Mündung des Flusses, die sich kurz vor dem Meer noch einmal zu einem schmalen, «Kanal» genannten Schlauch verengte, glich einem großen Binnensee, in dem sich das Blau des Himmels spiegelte. Dennoch war dies kein See, da die Wasser im Wechsel der Gezeiten stiegen und sanken; sie strömten mit der Flut herein und flössen bei Ebbe wieder hinaus. An jenem Tag war der Gezeitenstrom in diesem Kanal indigoblau, während vom Atlantik her türkisfarbene Wellen auf dem menschenleeren Strand ausrollten. Judiths Blick folgte der Küste, die sich in einer langen Dünenkette nach Norden wand, bis zu dem Felsen, auf dem der Leuchtturm stand. Weit draußen sah sie Fischerboote, und die Luft war erfüllt vom Kreischen der Möwen.
Der Vikar erklärte ihr, dass man die Kirche auf dieser Anhöhe oberhalb des Strandes erbaut hatte, damit ihr Turm weithin sichtbar war und den Schiffern bei ihrer Suche nach sicherem Fahrwasser den Weg weisen konnte. Judith fiel es nicht schwer, sich die Galeonen aus längst vergangenen Tagen vorzustellen, wie sie mit geblähten Segeln vom offenen Meer hereinkamen und bei Flut die Flussmündung hinauffuhren.
Doch sie entdeckte nicht nur die Gegend, sondern lernte auch die einheimische Bevölkerung kennen. Die Menschen in Cornwall lieben Kinder, und wo Judith auftauchte, wurde sie mit solcher Freude willkommen geheißen, dass ihre angeborene Schüchternheit schnell verflog. Im Dorf wimmelte es nur so von originellen Charakteren: Mrs. Berry, die den Gemischtwarenladen betrieb und aus Puddingpulver selbst Eiscreme herstellte; der alte Herbie, der den zweirädrigen Kohlenkarren fuhr, und Mrs. Southey vom Postamt, die ein Kamingitter vor ihren Schalter stellte, um Banditen abzuwehren, und einem kaum eine Briefmarke verkaufen konnte, ohne sich beim Wechselgeld zu irren.
Und es gab deren mehr, sogar noch faszinierendere Leute, die etwas weiter draußen wohnten. Mr. Willis war einer von ihnen. Er hatte lange Zeit in einem Zinnbergwerk in Chile gearbeitet, war aber schließlich nach einem Leben voller Abenteuer in sein heimatliches Cornwall zurückgekehrt und hatte sich in einem Blockhaus in den Sanddünen am Ufer des Kanals häuslich eingerichtet. Der schmale Strand vor seiner Hütte war mit allerlei interessantem Treibgut übersät, mit Seilresten, kaputten Fischkisten, Flaschen und aufgequollenen Gummistiefeln. Eines Tages, als sie Muscheln suchte, war ihr Mr. Willis zufällig über den Weg gelaufen, mit ihr ins Gespräch gekommen und hatte sie auf eine Tasse Tee in seine Hütte eingeladen. Von da an hielt Judith immer nach ihm Ausschau, um mit ihm zu plaudern.
Doch Mr. Willis trieb sich keineswegs müßig am Strand herum, denn er übte zwei verschiedene Tätigkeiten aus. Er beobachtete die Gezeiten und hisste eine Signalflagge, sobald das Wasser so hoch gestiegen war, dass die Kohlenschiffe über die Sandbank segeln konnten, und er war Fährmann. An der Außenwand seines Hauses hatte er eine alte Schiffsglocke aufgehängt, und wenn jemand über den Kanal wollte, läutete er sie, worauf Mr. Willis aus seiner Hütte herauskam, sein störrisches Ruderboot vom Ufer zog und ihn über das Wasser ruderte. Für diesen beschwerlichen und bei Ebbe sogar gefahrvollen Dienst verlangte er zwei Pence.
Mr. Willis lebte mit Mrs. Willis zusammen. Sie molk bei dem Bauern des Dorfes die Kühe, deshalb war sie oft nicht da. Es ging das Gerücht um, sie sei gar nicht Mrs. Willis, sondern Miss Soundso, und keiner redete viel mit ihr. Das Geheimnis um Mrs. Willis musste etwas mit dem Geheimnis um Heathers Onkel Fred zu tun haben, der irgendwas nicht hochkriegte, aber wann immer Judith die Sache zur Sprache brachte, verzog ihre Mutter nur den Mund und wechselte das Thema.
Judith erzählte ihr nie von ihrer Freundschaft mit Mr. Willis. Instinktiv ahnte sie, dass ihre Mutter ihr den weiteren Umgang mit ihm ausreden könnte und ihr sicher verbieten würde, seine Hütte zu betreten und mit ihm Tee zu trinken. Das war lächerlich. Was konnte Mr. Willis ihr schon Böses antun? Mami war manchmal schrecklich dumm.
Aber schließlich konnte sie in vielen Dingen schrecklich dumm sein; so behandelte sie Judith zum Beispiel genau so, wie sie Jess behandelte, und Jess war erst vier. Mit vierzehn hielt Judith sich für reif genug, dass man wirklich wichtige Entscheidungen, die sie selbst betrafen, auch mit ihr besprechen konnte.
Aber nein. Mami besprach nie etwas mit ihr. Sie erklärte einfach:
«Ich habe einen Brief von deinem Vater erhalten, und Jess und ich müssen demnächst nach Colombo zurück.»
Das hatte eingeschlagen wie eine Bombe, um es gelinde auszudrücken.
Aber es kam noch schlimmer: «Wir haben beschlossen, dass du ins Internat St. Ursula gehst. Ich war schon bei Miss Catto, der Schulleiterin, und es ist alles geregelt. Das Frühjahrstrimester fängt am fünfzehnten Januar an.»
Als ob Judith ein Paket wäre oder ein Hund, den man in den Zwinger sperrte.
«Und was mache ich in den Ferien?»
«Die verbringst du bei Tante Louise. Sie hat freundlicherweise zugesagt, sich um dich zu kümmern und deine Vormundschaft zu übernehmen, solange wir im Ausland sind. Sie gibt dir ihr bestes Gästezimmer, und du kannst deine eigenen Sachen mitbringen und sie dort lassen.»
Das schreckte sie vielleicht am meisten. Nicht dass sie Tante Louise nicht mochte. Seit sie in Penmarron wohnten, hatten sie sie oft zu Gesicht bekommen, und sie war stets freundlich gewesen. Nur, sie war einfach die ganz und gar falsche Person. Sie war alt – mindestens fünfzig –, und sie schüchterte Judith ein bisschen ein, denn sie strahlte keinerlei Wärme aus. Und Windyridge war das Haus einer alten Frau, ordentlich und ruhig, und die zwei Schwestern Edna und Hilda, die als Köchin und Hausmädchen bei ihr arbeiteten, waren auch schon ältlich und nicht sehr gesprächig. Kein Vergleich mit der lieben Phyllis, die in Riverview House die gesamte Hausarbeit allein bewältigte, aber dennoch Zeit fand, am Küchentisch Schwarzer Peter zu spielen, und aus Teeblättern die Zukunft las.
Wahrscheinlich verbrachten sie Weihnachten bei Tante Louise. Zuerst würden sie in die Kirche gehen, mittags gab es dann sicher Gänsebraten im Club, und danach würden sie, bevor es zu dämmern begann, in flottem Tempo über den Golfplatz zurückwandern, bis zu dem weißen Tor, das hoch oben über dem Meer stand.
Keine sehr aufregende Aussicht, aber mit vierzehn hatte Judith ohnehin einen Teil ihrer Illusionen über Weihnachten verloren. Eigentlich sollte es so sein wie in Büchern oder auf Weihnachtskarten, doch es war nie so, weil Mami nicht viel Talent besaß, Weihnachten zu feiern, und traurigerweise eine unüberwindliche Abneigung dagegen hegte, das Haus mit Stechpalme zu schmücken oder gar einen Christbaum aufzustellen, und schon vor zwei Jahren hatte sie Judith erklärt, sie sei nun wirklich zu alt, als dass man ihr zu Weihnachten noch einen Strumpf fülle.
Wenn sie es recht bedachte, war Mami in nichts dergleichen besonders gut. Picknicks am Strand mochte sie nicht, und sie würde eher alles tun, bevor sie eine Geburtstagsparty schmiss. Sie scheute sich sogar davor, Auto zu fahren. Natürlich hatten sie ein Auto, einen kleinen, klapprigen Austin, aber Mami ließ sich alle möglichen Ausreden einfallen, um ihn bloß nicht aus der Garage zu holen, denn sie befürchtete, sie könnte ein anderes Fahrzeug rammen, von der Bremse abrutschen oder beim Kuppeln vor einer Steigung mit dem Zwischengas nicht zurechtkommen.
Zurück zu Weihnachten! Wie auch immer sie das Fest verbringen würden, Judith wusste, dass nichts schlimmer sein konnte als jenes Weihnachten vor zwei Jahren, bei dem Mami darauf bestanden hatte, für ein paar Tage zu ihren Eltern zu fahren, zu Pfarrer Evans und seiner Frau.
Der Großvater stand einer winzigen Pfarrgemeinde in Devon vor, und die Großmutter war eine verbitterte alte Frau, die sich ihr Leben lang mit hehrer Armut und mit Pfarrhäusern für viktorianische Großfamilien herumgeschlagen hatte. Sie waren damals übertrieben oft zur Kirche gegangen, und die Großmutter hatte Judith ein Gebetbuch zu Weihnachten geschenkt. «Oh, danke, Großmutter, ich habe mir schon immer ein Gebetbuch gewünscht», hatte Judith höflich gesagt und den Zusatz «aber nicht so dringend» für sich behalten. Und Jess, die stets alles verdarb, hatte sich eine Kehlkopfdiphtherie eingefangen und Mutters ganze Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Außerdem hatte es jeden zweiten Tag gedünstete Feigen mit Mandelsülze zum Nachtisch gegeben.
Nein, nichts konnte schlimmer sein!
Trotzdem wurmte sie die Sache mit St. Ursula immer noch, denn wie ein Hund, der ständig am selben Knochen herumnagt, kehrten Judiths Gedanken immer wieder zu ihrem eigentlichen Groll zurück. Bisher hatte sie weder die Schule besichtigen können noch die bestimmt entsetzliche Miss Catto kennengelernt. Möglicherweise hatte ihre Mutter befürchtet, sie würde sich zur Wehr setzen, und war den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Doch selbst das war unbegreiflich, denn Judith hatte noch nie in ihrem Leben gegen irgendetwas aufbegehrt. Ihr kam in den Sinn, dass sie es jetzt, mit vierzehn, vielleicht einmal versuchen sollte. Heather Warren verstand es seit Jahren, ihren eigenen Willen durchzusetzen, und wickelte ihren völlig in sie vernarrten Vater um den kleinen Finger. Aber bei Vätern war das etwas anderes. Nur, Judiths Vater war weit weg.
Der Zug wurde langsamer. Er fuhr unter der Brücke durch, was man immer am veränderten Geräusch der Räder hören konnte, und kam quietschend zum Stehen. Sie sammelte ihre Taschen ein und sprang auf den Perron. Das winzige, mit vielen Schnörkeln verzierte Bahnhofsgebäude sah aus wie die hölzernen Umkleidekabinen auf einem Cricketplatz. Im Licht, das durch die offene Tür drang, war Mr. Jackson, der Stationsvorsteher, nur als Silhouette zu erkennen.
«Tag, Judith. Du kommst heute spät.»
«Wir hatten unsere Weihnachtsfeier in der Schule.»
«Schön.»
Das letzte Stück ihres Heimwegs war das denkbar kürzeste, denn der Bahnhof lag dem unteren Eingang in den Garten von Riverview House genau gegenüber. Sie schritt durch den Wartesaal, in dem es immer erschreckend nach Toiletten roch, und trat auf die schmale, unbeleuchtete Straße hinaus. Während sie einen Moment stehen blieb, um ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, merkte sie, dass es nicht mehr regnete, und hörte den Wind in den obersten Zweigen der Kiefern raunen, die dem Bahnhof etwas Schutz vor dem schlimmsten Wetter boten. Es war ein gespenstisches Geräusch, aber kein beängstigendes. Judith lief über die Straße, tastete nach dem Riegel an der Gartentür, schob ihn zurück, ging hinein und erklomm den steilen Weg, der über Stufen und Terrassen hinaufführte. Ganz oben ragte das Haus dunkel vor ihr auf, doch in seinen Fenstern leuchtete hinter den Gardinen freundliches Licht. Die schmiedeeiserne Lampe über dem Eingang war eingeschaltet, und in ihrem Schein sah Judith ein auf dem Kies geparktes fremdes Auto. Sicher war Tante Louise zum Tee gekommen.
Ein großer, schwarzer Rover. Wie er da stand, sah er recht unschuldig aus, harmlos, solide und verlässlich. Aber jeder, der auf den schmalen Straßen und Feldwegen von West Penwith unterwegs war, tat gut daran, sich vor ihm in Acht zu nehmen, wenn er seiner nur ansichtig wurde, denn er hatte einen starken Motor, und Tante Louise, die brave Staatsbürgerin, regelmäßige Kirchgängerin und Stütze ihres Golfclubs, unterlag einer Art Persönlichkeitswandel, sobald sie sich ans Steuer setzte, und brauste mit siebzig Sachen um unübersichtliche Kurven, in der sicheren Gewissheit, dass die Buchstaben des Gesetzes auf ihrer Seite seien, solange sie nur anhaltend auf die Hupe drückte. Deshalb zog sie, wenn sie mit ihrer Stoßstange den Kotflügel eines anderen Autos gerammt oder ein Huhn überfahren hatte, auch keinen Augenblick lang in Betracht, dass das ihre Schuld sein könnte, und ihre Vorwürfe und Ermahnungen fielen so energisch aus, dass die Geschädigten für gewöhnlich nicht den Mut aufbrachten, es mit ihr aufzunehmen, und von dannen schlichen, ohne es auch nur zu wagen, Schadenersatz zu fordern.
Judith wollte sich nicht sofort Tante Louise aussetzen. Also ging sie nicht durch den Vordereingang, sondern außen herum über den Hof und durch die Hintertür in die Spülkammer und von da aus in die Küche. Dort saß Jess mit ihren Buntstiften und einem Malbuch an dem blankgescheuerten Tisch, während Phyllis, in ihrem grünen Nachmittagskleid mit Musselinschürze, einen Stapel Wäsche bügelte.
Nach der Kälte und Feuchtigkeit draußen war die Küche erfreulich warm. Sie war ohnehin der wärmste Raum im ganzen Haus, denn in dem für Cornwall typischen schwarzen Herd mit den Messinggriffen ging das Feuer nie aus. Jetzt bullerte es leise vor sich hin, dass das Wasser im Teekessel sang. Dem Herd gegenüber befand sich eine Anrichte mit einer ganzen Sammlung von Fleischplatten, Gemüseschüsseln und einer Suppenterrine, und daneben stand Phyllis’ Korbsessel, in den sie sich plumpsen ließ, wann immer sie einen Moment Zeit fand, um ihre Beine auszuruhen, was nicht oft geschah. Der Raum roch angenehm nach frischgebügelter Wäsche, und unter der Decke hingen an einem über Rollen hochgezogenen Gestell noch einige Kleidungsstücke zum Auslüften.
Phyllis hob den Kopf. «Nanu, was machst du denn, schleichst du dich hinten rein?»
Wenn sie lächelte, kamen ihre nicht sehr guten Zähne zum Vorschein. Sie war ein flachbrüstiges und knochiges Mädchen mit blassem Teint und glattem, mittelblondem Haar, jedoch mit dem sanftesten Gemüt, das Judith jemals an jemandem erlebt hatte.
«Ich habe Tante Louises Auto gesehen.»
«Das ist doch kein Grund. Habt ihr eine schöne Feier gehabt?»
«Ja.» Judith kramte in ihrer Manteltasche. «Da, Jess», sagte sie und gab der Kleinen ihre Tüte mit Süßigkeiten.
Jess sah sie an. «Was ist das?»
Sie war ein hübsches Kind, pummelig und silberblond, aber noch ein furchtbares Baby, und Judith ärgerte sich unablässig über sie.
«Was Süßes natürlich, du Dummerchen.»
«Ich mag Fruchtgummi.»
«Na, dann schau nach, ob du einen findest.»
Judith zog den Mantel aus, nahm die Wollmütze ab und warf beides auf einen Stuhl. Phyllis sagte nicht: «Häng die Sachen auf!» Irgendwann hängte sie sie vermutlich selbst auf.
«Ich hab gar nicht gewusst, dass Tante Louise zum Tee kommt.»
«Sie hat angerufen, so gegen zwei.»
«Worüber reden sie?»
«Du neugieriger Pinsel.»
«Wahrscheinlich über mich.»
«Über dich und diese Schule, über Anwälte und Gebühren und über Trimesterferien und Telefongespräche. Apropos Telefongespräche, deine Tante Biddy hat heute Morgen angerufen. Hat zehn Minuten oder noch länger mit deiner Mutter geredet.»
Judith horchte auf. «Tante Biddy?» Sie war Mamis Schwester und Judiths Lieblingstante. «Was wollte sie denn?»
«Ich hab doch nicht gelauscht. Da musst du schon deine Mama fragen.» Sie stellte das Bügeleisen ab und knöpfte Mamis beste Bluse zu. «Du gehst jetzt besser rüber. Ich habe dir eine Tasse hingestellt, und es gibt Scones und Zitronenkuchen, falls du Hunger hast.»
«Mir knurrt der Magen.»
«Wie üblich. Haben die euch bei eurer Weihnachtsfeier nichts zu essen gegeben?»
«Doch, Safranbrötchen. Aber ich bin immer noch hungrig.»
«Jetzt geh schon, sonst wundert sich deine Mutter noch.»
«Worüber?»
Aber Phyllis sagte nur: «Los, zieh dir andere Schuhe an und wasch dir noch die Hände!»
Judith tat es, wusch sich die Hände in der Spülkammer und benutzte dabei Phyllis’ billige Seife. Dann verließ sie widerstrebend die behagliche Küche und ging durch die Diele. Aus dem Wohnzimmer drang gedämpftes Gemurmel weiblicher Stimmen. Sie öffnete die Tür, aber so leise, dass die zwei Frauen einen Moment lang ihre Anwesenheit nicht bemerkten.
Molly Dunbar und ihre Schwägerin, Louise Forrester, saßen vor dem Kamin. Auf dem ausklappbaren, mit besticktem Leinen und dem besten Porzellan gedeckten Teetisch zwischen ihnen standen Platten mit Sandwiches, ein glasierter Zitronenkuchen, heiße Scones mit Sahne und Erdbeermarmelade sowie zwei Sorten Teegebäck: Butterkekse und Schokoladenplätzchen.
Sie hatten es sich sehr gemütlich gemacht; die Samtvorhänge waren zugezogen, und im Kamin flackerte ein Kohlenfeuer. Das Wohnzimmer war weder groß noch sonst wie beeindruckend, und da sie Riverview House möbliert gemietet hatten, war es auch nicht besonders geschmackvoll eingerichtet. Sessel mit verblichenem Chintz, ein Webteppich in orientalischem Muster und die Beistelltische und Bücherregale waren eher zweckdienlich als dekorativ. Im sanften Lampenlicht sah es trotzdem recht hübsch aus, denn Molly hatte von Ceylon ihre Lieblingssachen mitgebracht, und im Raum verteilt, milderten sie seine unpersönliche Atmosphäre. Ziergegenstände aus Jade und Elfenbein, ein rot lackiertes Zigarettenkistchen, eine blau-weiße, mit Hyazinthen bepflanzte Schale und Familienfotos in Silberrahmen.
«… du wirst viel zu tun haben», sagte Tante Louise gerade. «Wenn ich dir helfen kann …» Sie beugte sich vor, um ihre Tasse auf dem Tisch abzustellen. Als sie den Blick hob, sah sie Judith in der offenen Tür. «Schau mal, wer da kommt …»
Molly wandte sich um. «Judith! Ich dachte schon, du hättest den Zug verpasst.»
«Nein. Ich habe mich noch mit Phyllis unterhalten.» Sie schloss die Tür und ging durchs Wohnzimmer. «Guten Tag, Tante Louise.» Sie bückte sich und küsste sie auf die Wange. Tante Louise ließ sie gewähren, machte aber keinerlei Anstalten, den Kuss zu erwidern.
Sie zeigte nicht gern Gefühle. So blieb sie unbewegt sitzen, eine stämmige Frau Anfang fünfzig mit überraschend schlanken und eleganten Beinen und langen, schmalen Füßen in festen Lederschuhen, die so auf Hochglanz poliert waren, dass sie wie Kastanien schimmerten. Sie trug eine Jacke und einen Rock aus Tweed, und ein kaum sichtbares Haarnetz hielt die ondulierten Wellen ihres kurzen grauen Haars in Form. Ihre Stimme klang tief und rauchig, und selbst wenn sie sich abends weiblicher anzog, Samtgewänder und bestickte Westen trug, so haftete ihr doch etwas verwirrend Maskulines an, wie einem Mann, der aus Jux oder für ein Kostümfest in den Kleidern seiner Frau auftritt, dass die Leute vor Vergnügen kreischen.
Eine stattliche Erscheinung. Aber nicht schön. Und wenn man den alten, vergilbten Fotos Glauben schenken durfte, war sie selbst in ihrer Jugend nicht hübsch gewesen. Als sie mit dreiundzwanzig noch nicht verlobt war und kein Mann um sie anhalten wollte, hatten ihre Eltern keinen anderen Ausweg gesehen, als sie kurzerhand nach Indien zu schicken, zu Verwandten, die mit einem Armeekorps in Delhi stationiert waren. Sobald die sommerliche Hitze einsetzte, wurde der gesamte Haushalt nach Norden verlegt, in die kühlen Hügel, und dort lernte Louise Jack Forrester kennen. Jack war Major im Bengalischen Schützenregiment und hatte gerade zwölf Monate in einem entlegenen Fort in den Bergen hinter sich, wo es von Zeit zu Zeit zu Scharmützeln mit kriegerischen Afghanen gekommen war. Nach Monaten der Enthaltsamkeit lechzte er während seines Urlaubs nach weiblicher Gesellschaft, und die junge, rotwangige Louise, ungebunden und sportlich, die er auf einem Tennisplatz herumhüpfen sah, war in seinen hungrigen, geblendeten Augen das begehrenswerteste Geschöpf. Mit ungeheurer Entschlossenheit, aber wenig Finesse – dafür reichte die Zeit nicht – stellte er ihr nach, und noch ehe er recht wusste, wie ihm geschah, war er mit ihr verlobt.
Merkwürdigerweise wurde es eine gute Ehe, obwohl – oder vielleicht gerade weil – ihnen Kindersegen versagt geblieben war. Stattdessen teilten sie ihre Vorliebe für das Leben im Freien und für all die ruhmreichen Gelegenheiten zu Sport und Spiel, die Indien ihnen bot. Es gab Jagdgesellschaften und Ausflüge in die Berge, Pferde zum Reiten und zum Polospiel und jede Menge Tennis und Golf, worin Louise sich auszeichnete. Als Jack schließlich seinen Abschied von der Armee nahm und sie nach England zurückkehrten, ließen sie sich allein wegen der Nähe des Golfplatzes in Penmarron nieder, und der Club wurde ihr zweites Zuhause. Bei rauem Wetter spielten sie Bridge, doch nahezu jeder schöne Tag sah sie draußen auf den Fairways. Einige Zeit brachten sie auch an der Theke zu, wo Jack sich den zweifelhaften Ruf erwarb, jeden Mann unter den Tisch trinken zu können. Er prahlte damit, einen Magen zu haben, der alles vertrug, und seine Freunde stimmten ihm zu, bis er an einem strahlenden Samstagmorgen auf dem vierzehnten Green tot umfiel. Danach waren sie sich nicht mehr so sicher.
Molly befand sich, als dieses traurige Ereignis eintrat, auf Ceylon und schrieb einen Brief tiefster Anteilnahme, zumal sie sich nicht vorstellen konnte, wie Louise ohne Jack zurechtkommen würde. Sie waren doch so gute Freunde gewesen, so unzertrennlich. Aber als sich die beiden Frauen schließlich wieder trafen, konnte Molly an Louise keinerlei Veränderung feststellen. Sie sah noch genauso aus, wohnte noch im selben Haus und genoss ihr Leben nach derselben Fasson. Jeden Tag war sie auf dem Golfplatz, und da sie ein ausgezeichnetes Handicap hatte und den Ball ebenso kräftig wie ein Mann schlagen konnte, mangelte es ihr nie an männlichen Spielpartnern.
Nun griff sie gerade nach ihrem Zigarettenetui, klappte es auf und steckte eine türkische Zigarette in eine lange Spitze aus Elfenbein. Sie zündete sie mit einem goldenen Feuerzeug an, das einst ihrem verstorbenen Mann gehört hatte.
Durch eine Rauchwolke fragte sie Judith: «Wie lief denn eure Weihnachtsfeier?»
«War ganz gut. Wir haben Sir Roger de Coverley getanzt. Und es hat Safranbrötchen gegeben.» Dabei schielte Judith nach dem Teetisch. «Aber ich bin noch immer hungrig.»
«Wir haben dir genug übrig gelassen», sagte Molly. Also zog Judith einen niedrigen Hocker heran und setzte sich zwischen die beiden Frauen, sodass ihre Nase auf einer Höhe mit Phyllis’ Leckereien war. «Möchtest du Milch oder Tee?»
«Ich nehme Milch, danke.» Sie angelte sich ein Scone und begann zu essen, vorsichtig, denn es war sehr üppig gefüllt, und Sahne und Erdbeermarmelade drohten herauszuquellen und alles zu bekleckern.
«Hast du dich von deinen Freundinnen verabschiedet?»
«Ja. Auch von Mr. Thomas und den anderen. Wir haben alle eine Tüte mit Süßigkeiten gekriegt, aber ich habe meine Jess gegeben. Nach der Feier bin ich mit Heather in die Stadt hinunter.»
«Wer ist Heather?», fragte Tante Louise.
«Heather Warren, meine beste Freundin.»
«Du kennst doch Mr. Warren», sagte Molly, «den Lebensmittelhändler am Market Place.»
«Oh!» Tante Louise hob die Brauen und lächelte spitzbübisch. «Der flotte Spanier. Ist das ein gutaussehender Mann! Ich glaube, bei dem würde ich sogar einkaufen, wenn er nicht meine Lieblingsmarmelade hätte.»
Offenbar war sie glänzend gelaunt. Judith fand, das sei der richtige Augenblick, das Thema Fahrrad anzuschneiden. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist, wie Mrs. Warren zu sagen pflegte. Den Stier bei den Hörnern packen.
«Heather ist übrigens auf die glänzende Idee gekommen, dass ich ein Fahrrad haben müsste.»
«Ein Fahrrad?»
«Mami, du hörst dich an, als hätte ich um einen Rennwagen oder um ein Pony gebeten. Ich halte es wirklich für eine gute Idee. Windyridge steht nicht gleich neben dem Bahnhof wie dieses Haus, und die Bushaltestelle ist Meilen entfernt. Wenn ich ein Fahrrad habe, bin ich beweglicher, und Tante Louise braucht mich nicht in ihrem Auto herumzukutschieren. Und dann», so fügte sie listig hinzu, «kann sie weiter Golf spielen.»
Tante Louise prustete vor Lachen. «Du hast aber auch an alles gedacht.»
«Du hättest doch nichts dagegen, Tante Louise, nicht wahr?»
«Warum sollte ich? Ich bin froh, wenn ich dich los bin», was ihre Art war, witzig zu sein.
Molly fand ihre Sprache wieder. «Aber Judith, ist ein Fahrrad nicht schrecklich teuer?»
«Heather sagt, ungefähr fünf Pfund.»
«Das dachte ich mir. Schrecklich teuer. Und wir müssen noch so viele andere Dinge kaufen. Wir haben noch nicht einmal deine Schuluniform, und die Kleiderliste von St. Ursula ist ellenlang.»
«Du könntest es mir ja zu Weihnachten schenken.»
«Aber ich habe dein Weihnachtsgeschenk schon besorgt. Das, was du dir gewünscht hast …»
«Wir können das Fahrrad zum Geburtstagsgeschenk erklären. Du bist an meinem Geburtstag sowieso nicht hier, sondern in Colombo, und dann brauchst du mir kein Päckchen zu schicken.»
«Aber du müsstest damit auch auf Hauptstraßen fahren. Du könntest einen Unfall haben …»
Hier griff Tante Louise ein. «Kannst du Rad fahren?»
«Ja, natürlich. Aber ich habe nie um ein Fahrrad gebeten, weil ich es nicht wirklich gebraucht habe. Doch du musst zugeben, Tante Louise, dass es furchtbar praktisch wäre.»
«Aber Judith …»
«Ach, Molly, stell dich doch nicht so an! Was soll denn dem Kind schon passieren? Und wenn sie unter einen Bus radelt, dann ist sie selbst schuld. Ich spendiere dir ein Fahrrad, Judith, aber weil es so teuer ist, muss es auch für deinen Geburtstag herhalten. Das erspart mir, dir ein Päckchen zu schicken.»
«Wirklich?» Judith konnte es kaum fassen, dass ihre Argumente gezogen hatten, dass sie so beharrlich geblieben war und tatsächlich ihren Willen durchgesetzt hatte. «Tante Louise, du bist ’ne Wucht.»
«Ich tu ja alles, damit du mir nicht vor den Füßen rumläufst.»
«Wann können wir es kaufen?»
«Wie wär’s mit Heiligabend?»
Molly stöhnte leise. «O nein!» Sie klang entnervt, und Louise zog die Stirn kraus. «Was ist denn jetzt wieder?», fragte sie. Judith sah keinen Grund für diesen barschen Ton, aber Tante Louise verlor ja mit Molly oft die Geduld und behandelte sie eher wie ein dummes kleines Mädchen als wie eine Schwägerin. «Ist dir noch etwas eingefallen, wogegen du etwas haben könntest?»
«Nein, das nicht …» Eine leichte Röte stieg Molly in die Wangen. «Nur, wir werden nicht hier sein. Ich habe es dir noch nicht erzählt, weil ich es zuerst Judith sagen wollte.» Sie wandte sich Judith zu. «Tante Biddy hat angerufen.»
«Ich weiß. Das hat mir Phyllis schon gesagt.»
«Sie hat uns eingeladen, Weihnachten und Neujahr bei ihnen in Plymouth zu verbringen. Du und ich und Jess.»
Judith hatte den Mund voller Scone. Einen Moment lang befürchtete sie, sich zu verschlucken, dann bekam sie den Bissen aber doch hinunter, bevor etwas so Grässliches passierte.
Weihnachten bei Tante Biddy!
«Und was hast du gesagt?»
«Dass wir kommen.»
Das war so unglaublich aufregend, dass Judith alles andere vergaß, sogar das neue Fahrrad.
«Wann?»
«Ich dachte am Tag vor Heiligabend. Da sind die Züge noch nicht so voll. Biddy holt uns vom Bahnhof ab. Sie sagte, es täte ihr leid, dass sie so spät damit herausrückte, ich meine mit der Einladung, aber es sei ein spontaner Einfall gewesen. Und weil es doch für eine Weile meine letzten Weihnachten in England sind, hielt sie es für eine gute Idee, die Feiertage gemeinsam zu verbringen.»
Wäre Tante Louise nicht hier gewesen, hätte Judith die Arme hochgerissen und wäre auf und ab gehüpft und im Zimmer herumgetanzt. Doch es kam ihr ein bisschen rüde vor, sich so sichtbar zu freuen, wenn Tante Louise nicht mit eingeladen war. Deshalb zügelte sie ihre Begeisterung, als sie sich ihrer Tante zuwandte.
«Tante Louise, könnten wir unter diesen Umständen das Fahrrad vielleicht nach Weihnachten kaufen?»
«Sieht so aus, als müssten wir das wohl, nicht wahr? Eigentlich wollte ich euch einladen, Weihnachten bei mir zu verbringen, aber jetzt hat mir Biddy anscheinend die Last abgenommen.»
«Oh, Louise, entschuldige bitte! Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich dich im Stich lasse.»
«Quatsch! Ein bisschen Abwechslung tut uns allen gut. Ist Biddys Sohn auch da?»
«Ned? Leider nicht. Er fährt nach Zermatt zum Skilaufen, mit ein paar Schulfreunden aus Dartmouth.»
Tante Louise hob die Augenbrauen, denn teure und extravagante Lustbarkeiten fanden nicht gerade ihren Beifall. Aber schließlich hatte Biddy ihr einziges Kind schon immer entsetzlich verwöhnt und konnte ihm kein Vergnügen abschlagen.
Doch «Schade!» war alles, was sie dazu sagte. «Dann hätte Judith Gesellschaft gehabt.»
«Tante Louise, Ned ist sechzehn! Der hätte keinerlei Notiz von mir genommen. Sicher unterhalte ich mich viel besser, wenn er nicht da ist …»
«Wahrscheinlich hast du recht. Und wie ich Biddy kenne, werdet ihr euch prächtig amüsieren. Hab sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wann war sie zum letzten Mal hier bei dir, Molly?»
«Anfang Sommer. Das weißt du doch noch. Wir hatten diese herrliche Hitzewelle …»
«War das damals, als sie in diesem unbeschreiblichen Strandpyjama zu mir zum Dinner kam?»
«Ja, stimmt.»
«Und als ich sie in deinem Garten antraf, wie sie in einem zweiteiligen Badeanzug in der Sonne lag. Hautfarben. Sie hätte genauso gut nackt sein können.»
«Sie richtet sich immer sehr nach der Mode.» Molly fühlte sich veranlasst, ihre flatterhafte Schwester in Schutz zu nehmen, auch wenn das noch so nutzlos war. «Über kurz oder lang werden wir wohl alle Strandpyjamas tragen.»
«Gott behüte!»
«Was machst du zu Weihnachten, Louise? Hoffentlich fühlst du dich nicht einsam.»
«Um Himmels willen, nein! Ich werde es eher genießen, allein zu sein. Vielleicht lade ich Billy Fawcett zu einem Drink ein, und dann gehen wir zum Mittagessen in den Club. Die ziehen für gewöhnlich eine große Sache auf.» Judith malte sich in Gedanken all die Golfer in Knickerbockern und derben Schuhen mit Knallbonbons und Papierhüten aus. «Kann sein, dass wir danach noch eine Runde Bridge spielen.»
Molly runzelte die Stirn. «Billy Fawcett? Ich glaube nicht, dass ich den kenne.»
«Nein. Bestimmt nicht. Ein alter Freund aus den Tagen in Quetta. Hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt und wollte es mit Cornwall versuchen. Deshalb hat er einen der neuen Bungalows gemietet, die sie in meiner Straße gebaut haben, und ich stelle ihn reihum den Leuten vor. Du musst ihn noch kennenlernen, bevor du abreist. Ist auch ein begeisterter Golfer, deshalb habe ich ihn dem Club als Mitglied vorgeschlagen.»
«Das ist schön für dich, Louise.»
«Was?»
«Na ja … dass du einen alten Bekannten in deiner Nachbarschaft hast. Noch dazu einen Golfspieler. Nicht dass es dir jemals an Spielpartnern gemangelt hätte.»
Doch Louise wollte sich nicht festlegen. Sie spielte nur mit den Besten. «Kommt darauf an, was für ein Handicap er hat», erklärte sie, während sie energisch ihre Zigarette ausdrückte. Dann sah sie auf die Uhr. «Himmel, ist es schon so spät? Ich muss los.» Sie griff nach ihrer Handtasche und stemmte sich aus dem Sessel hoch. Auch Molly und Judith erhoben sich. «Sag Phyllis, der Tee war köstlich. Dieses Mädchen wird dir fehlen. Hat sie schon eine neue Stelle?»
«Ich glaube, sie hat sich noch keine große Mühe gegeben, eine zu finden.»
«Ein Glück für den, der dieses Goldstück kriegt. Nein, klingle nicht nach ihr! Judith kann mich rausbringen. Und falls ich dich vor Weihnachten nicht mehr sehe, Molly, wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Ruf mich an, wenn du wieder da bist. Sag mir Bescheid, wann du Judiths Sachen nach Windyridge bringen möchtest. Judith, wir kaufen das Fahrrad Anfang der Osterferien. Vorher brauchst du es ja ohnehin nicht …»
1936
Es war noch dunkel und so kalt, dass Judith beim Aufwachen das Gefühl hatte, ihre Nase sei ein auf ihrem Gesicht festgefrorener Fremdkörper. Als sie am Abend zu Bett gegangen war, hatte sie nicht einmal gewagt, das Fenster zu öffnen, sondern nur die Vorhänge ein wenig zurückgezogen, und nun schimmerte durch die Eisblumen an der Scheibe das gelbe Licht einer Straßenlaterne herein. Tiefe Stille. Vielleicht war es ja noch mitten in der Nacht. Doch nach einer Weile hörte sie den Hufschlag der Pferde des Milchwagens und wusste, dass es nicht mehr mitten in der Nacht, sondern bereits Morgen war.
Nur Mut, auch wenn es große Überwindung kostete! Eins, zwei, drei! Sie zog eine Hand unter der warmen Bettdecke hervor und knipste die Nachttischlampe an. Auf ihrer neuen Uhr – von Onkel Bob und eines der schönsten Geschenke – sah sie, dass es Viertel vor acht war.
Schnell steckte sie die Hand wieder unter die Decke und wärmte sie zwischen den Knien. Ein neuer Tag. Der letzte Tag. Sie war ein wenig traurig. Die Weihnachtsferien waren vorüber, es ging wieder nach Hause.
Der Raum, in dem sie lag, befand sich im Dachgeschoss von Tante Biddys Haus und war ihr zweitbestes Gästezimmer. Das beste, im ersten Stock, hatten Mutter und Jess bekommen, aber Judith mochte dieses Zimmer mit seinen schrägen Wänden, dem Mansardenfenster und den geblümten Vorhängen ohnehin lieber. Nur die Kälte war unangenehm, weil die Heizung in den Räumen darunter zu schwach war, um auch das oberste Stockwerk zu versorgen. Doch Tante Biddy hatte ihr einen kleinen Elektroofen gegeben, und mit dessen Hilfe und mit ein paar Wärmflaschen war es ihr gelungen, nicht zu sehr zu frieren.
Denn kurz vor Weihnachten waren die Temperaturen beängstigend gesunken. Der Wetterbericht im Rundfunk hatte zwar vor einem Kälteeinbruch gewarnt, doch niemand war auf die arktische Witterung vorbereitet gewesen, die seither herrschte. Als die Dunbars von der Kornischen Riviera landeinwärts gereist waren, lag das Bodmin-Moor unter einer Schneedecke, und als sie in Plymouth aus dem Zug stiegen, war ihnen, als kämen sie in Sibirien an, so rau war der Wind, der Graupelschauer über den Bahnsteig peitschte.
Das war Pech, denn Tante Biddy und Onkel Bob wohnten in dem wohl kältesten Haus auf Gottes Erdboden. Dafür konnten sie allerdings nichts, denn es handelte sich um eine Dienstwohnung, die Onkel Bob als Kommandant der Königlichen Marineakademie in Keyham bezogen hatte. Ein Reihenhaus mit Blick nach Norden, hoch und schmal, und der Wind pfiff durch alle Ritzen. Der wärmste Ort war die Küche im Erdgeschoss, doch die war das Reich von Mrs. Cleese, der Köchin, und Hobbs, einem ehemaligen Mitglied des Musikkorps der Königlichen Marine, der inzwischen im Ruhestand lebte und jeden Tag kam, um Stiefel zu wichsen und Kohlen zu schleppen. Hobbs war ein richtiges Original, mit weißem Haar, das er über seine Glatze kämmte, und mit so funkelnden, schlauen Augen wie eine Amsel. Er hatte Nikotinflecken an den Fingern, und sein Gesicht war so runzlig und zerfurcht wie ein alter Koffer, doch wenn abends eine Party stattfand, warf er sich in Schale, zog weiße Handschuhe an und schenkte die Getränke ein.
Dabei hatte es eine Menge Partys gegeben, und trotz der Eiseskälte waren es wunderbare Weihnachten gewesen, genau, wie Judith sich immer vorgestellt hatte, dass Weihnachten sein müsste, obwohl sie schon geglaubt hatte, dass sie es so nie erleben würde. Biddy, die keine halben Sachen machte, hatte das ganze Haus dekoriert – über die Toppen beflaggt wie ein Schlachtschiff, hatte Onkel Bob es genannt –, und ihr Christbaum, der in der Diele stand und das ganze Treppenhaus mit Lichtern, Glitzerschmuck, Lametta und Tannenduft erfüllte, war der prächtigste Baum, den Judith je gesehen hatte. Die übrigen Räume waren ebenso festlich geschmückt. Hunderte von Weihnachtskarten hingen an knallroten Bändern, und Girlanden aus Stechpalmenzweigen und Efeu rahmten die Kamine ein. Im Esszimmer und im Salon brannten pausenlos große Kohlenfeuer, die Hobbs schürte und jeden Abend mit Grus abdeckte, damit sie über Nacht nicht ausgingen.
Und sie hatten so viel unternommen, ständig war etwas los gewesen. Gäste kamen zum Lunch oder zu Dinnerpartys, bei denen sie nach dem Essen zu den Klängen des Grammophons tanzten. Unablässig kreuzten Freunde auf, zum Tee oder nur auf einen Drink, und falls einmal eine Flaute eintrat oder ein ereignisloser Nachmittag drohte, zog sich Tante Biddy nie in einen stillen Winkel zurück, sondern schlug sofort einen Kinobesuch oder einen Ausflug in die Eislaufhalle vor.
Ihre Mutter, das wusste Judith, fühlte sich allmählich erschöpft, und von Zeit zu Zeit vertraute sie Jess der Obhut Hobbs’ an und stahl sich nach oben, um sich auf ihrem Bett auszuruhen. Judith mochte Hobbs und Mrs. Cleese ausgesprochen gern, deshalb verbrachte sie viel Zeit in der Küche, wo sie sich wider alle Vernunft mit köstlichen Leckereien vollstopfen ließ. Für sie war das eine schöne Abwechslung, denn sie amüsierte sich viel besser, wenn ihre kleine Schwester nicht hinter ihr herzockelte. Ab und zu war Jess natürlich dabei.
Onkel Bob hatte Karten für die Weihnachtspantomime besorgt, und sie waren, zusammen mit einer anderen Familie, alle gemeinsam hingegangen und hatten eine ganze Sitzreihe belegt. Außerdem hatte Onkel Bob einen großen Kasten Konfekt und für jeden ein Programm gekauft. Doch als die komische Alte mit ihrer purpurfarbenen Perücke, in einem engen Mieder und in weiten, scharlachroten Pluderhosen auftrat, hatte sich Jess furchtbar angestellt und vor Angst laut aufgeheult. Deshalb musste Mami sie eilends hinausbringen und kam mit ihr nicht mehr zurück. Zum Glück war das gleich am Anfang passiert, sodass alle anderen sitzen bleiben und die Aufführung genießen konnten.
Onkel Bob war der Beste. Bei ihm zu sein, ihn richtig kennenzulernen war für Judith unbestritten die Hauptattraktion dieser Feiertage. Sie hatte nie gewusst, dass Väter so hinreißend sein konnten, so geduldig, so interessant, so lustig. Da Ferien waren, brauchte er nicht jeden Tag in seine Akademie zu gehen, sondern hatte auch frei, und sie hielten sich oft in seinem Allerheiligsten auf, in seinem Arbeitszimmer, wo er ihr seine Fotoalben zeigte, sie auf dem aufziehbaren Grammophon Schallplatten abspielen ließ und ihr den Umgang mit seiner ramponierten Reiseschreibmaschine beibrachte. Beim Eislaufen hatte er sie gestützt und über die Eisbahn gezogen, bis sie «seetüchtig» war, wie er es ausdrückte, und bei Partys hatte er immer darauf geachtet, dass sie nicht ausgeschlossen wurde, und sie wie eine Erwachsene den Gästen vorgestellt.
Obgleich sie Dad liebte und ihn wohl auch vermisste, hatte sie mit ihm nie so viel Spaß gehabt. Während sie sich dies eingestand, regte sich ihr schlechtes Gewissen, weil sie in den letzten zwei Wochen so vergnügt gewesen war, dass sie kaum an ihn gedacht hatte. Zum Ausgleich dafür dachte sie jetzt an ihn, ganz fest, aber zuvor musste sie an Colombo denken, weil er sich dort aufhielt und das der einzige Ort war, an dem sein Bild für sie lebendig wurde. Es war schwierig. Colombo lag weit zurück. Sie meinte, sich noch aller Einzelheiten zu entsinnen, die Zeit hatte jedoch die Erinnerungen verwischt, wie das Licht alte Fotos verblassen lässt. Sie überlegte, ob ihr irgendein Ereignis einfiel, mit dem sie ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen konnte.
Weihnachten. Das war naheliegend. Weihnachten in Colombo war unvergesslich, und sei es nur deshalb, weil es ganz anders verlief als hier, unter einem strahlenden Tropenhimmel, bei sengender Hitze, mit der Brandung des Indischen Ozeans im Ohr und einer leichten Brise, die durch die Palmen strich. Im Haus an der Galle Road hatte Judith ihre Weihnachtsgeschenke auf der luftigen Veranda ausgepackt, und zum Dinner hatte es keinen gebratenen Truthahn, sondern ein traditionelles Currygericht im Hotel Galle Face gegeben. Auch viele andere Leute feierten Weihnachten auf diese Weise, sodass es fast wie ein riesiges Kinderfest war, auf dem alle Papphüte trugen und in Papiertrompeten pusteten. Sie dachte an den Speisesaal, in dem ganze Familien saßen und alle viel zu viel aßen und tranken, während ein leichter Wind vom Meer hereinwehte und die Deckenventilatoren langsam kreisten.
Es klappte. Jetzt hatte sie ein klares Bild von Dad vor Augen. Er saß am Kopf des Tisches und hatte eine blaue, mit Goldsternchen verzierte Papierkrone auf. Sie fragte sich, wie er wohl dieses einsame Weihnachten verbracht haben mochte. Als sie ihn vor vier Jahren verlassen hatten, war ein Junggeselle, mit dem er befreundet war, bei ihm eingezogen, um ihm Gesellschaft zu leisten. Doch es wollte ihr einfach nicht gelingen, sich die beiden Männer in weihnachtlichem Frohsinn vorzustellen. Wahrscheinlich waren sie in ihrem Club gelandet, mit all den anderen Junggesellen und Strohwitwern. Sie seufzte. Vermutlich vermisste sie ihn schon, aber es war nicht einfach, jemanden immer noch zu vermissen, wenn man so lange ohne ihn gelebt hatte und der einzige Kontakt in den monatlichen Briefen bestand, die bei ihrer Ankunft bereits drei Wochen alt und nie besonders spannend waren.
Auf der neuen Uhr war es inzwischen acht. Zeit zum Aufstehen. Jetzt! Eins, zwei, drei! Judith schlug die Decke zurück, sprang aus dem Bett, rannte zum Elektroofen und schaltete ihn ein. Dann schlüpfte sie sehr schnell in ihren Morgenmantel und schob die nackten Füße in die Hausschuhe aus Schaffell.
Ihre Weihnachtsgeschenke lagen aufgereiht auf dem Fußboden. Sie holte ihren kleinen Koffer hervor – ein chinesischer aus Korbgeflecht mit einem Tragegriff und mit winzigen Knebeln als Verschluss – und klappte ihn auf, um ihre Schätze einzupacken. Zuerst legte sie die Uhr hinein und die zwei Bücher, die Tante Biddy ihr geschenkt hatte, das neueste von Arthur Ransome, das Winter Holiday hieß, und ein schönes, dickes, ledergebundenes: Jane Eyre