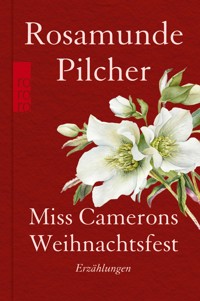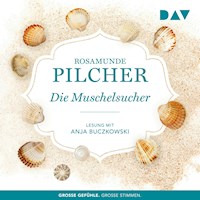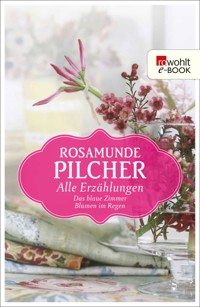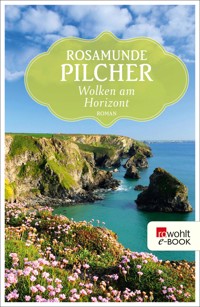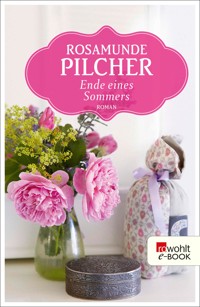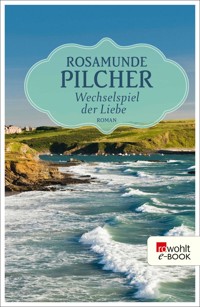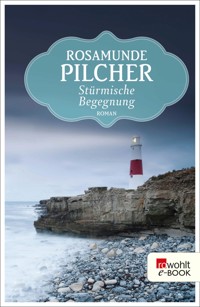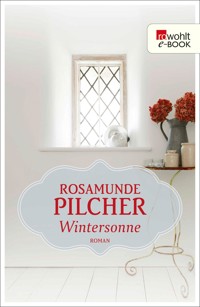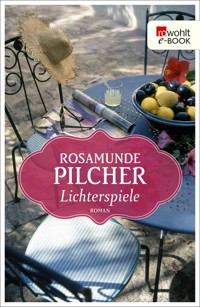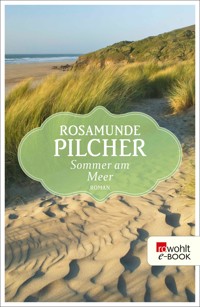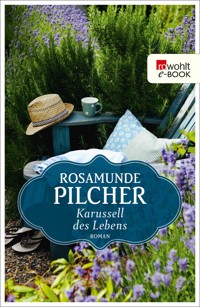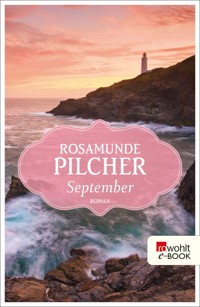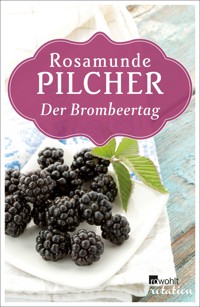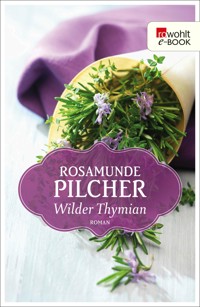
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann aus ihrer Vergangenheit - eine Liebe für die Zukunft? Vor Jahren hat Oliver seine Geliebte Victoria wegen einer anderen verlassen. Plötzlich steht er unvermutet wieder vor ihrer Tür, im Arm seinen zweijährigen Sohn. Trotz großer Zweifel lässt Victoria sich erneut auf Oliver ein. Doch ihr erster gemeinsamer Urlaub in einem schottischen Schloss verwandelt sich unversehens in eine dramatische Odyssee der Gefühle und Leidenschaften. Victoria steht vor der Frage, ob eine alte Liebe sich so einfach neu entfachen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Wilder Thymian
Roman
Über dieses Buch
Ein Mann aus ihrer Vergangenheit – eine Liebe für die Zukunft?
Vor Jahren hat Oliver seine Geliebte Victoria wegen einer anderen verlassen. Plötzlich steht er unvermutet wieder vor ihrer Tür, im Arm seinen zweijährigen Sohn. Trotz großer Zweifel lässt Victoria sich erneut auf Oliver ein. Doch ihr erster gemeinsamer Urlaub in einem schottischen Schloss verwandelt sich unversehens in eine dramatische Odyssee der Gefühle und Leidenschaften. Victoria steht vor der Frage, ob eine alte Liebe sich so einfach neu entfachen lässt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1978 unter dem Titel «Wild Mountain Thyme» im Verlag St. Martin’s Press, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2014
Copyright © 1993 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Wild Mountain Thyme» Copyright © 1978 by Rosamunde Pilcher
Umschlaggestaltung AMMA Kommunikationsdesign, Stuttgart
(Umschlagabbildung: Photocuisine/Masterfile)
ISBN 978-3-644-21541-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
1 Freitag
2 Freitag
3 Freitag
4 Freitag
5 Sonntag
6 Montag
7 Dienstag
8 Donnerstag
9 Donnerstag
10 Freitag
11 Samstag
12 Sonntag
13 Montag
14 Dienstag
15 Mittwoch
16 Donnerstag
Für Robin
und Kirsty
und Oliver
1 Freitag
Früher, als die Umgehungsstraße noch nicht gebaut war, rollte der gesamte Verkehr mitten durch das Dorf; ein endloser Strom von Fahrzeugen, die den anmutigen Queen-Anne-Häusern und den kleinen Läden mit den überquellenden Schaufenstern das Innerste herauszurütteln drohten. Woodbridge war vor noch nicht so langer Zeit ein Ort gewesen, durch den man auf dem Weg in einen anderen Ort einfach durchfuhr.
Aber seit es die Umgehungsstraße gab, hatte sich das geändert. Zum Besseren, sagten die Bewohner. Zum Schlechteren, sagten die Ladenbesitzer und der Inhaber der Autowerkstatt und der Mann, der die Gaststätte für Lastwagenfahrer betrieben hatte.
Jetzt konnten die Leute von Woodbridge einkaufen gehen und die Straße überqueren, ohne ihr Leben zu riskieren oder ihre Hunde an die sichere Leine nehmen zu müssen. Kinder mit braunen, bis auf die Augenbrauen heruntergezogenen Samtkappen trabten an den Wochenenden auf allerlei zottigen Rössern zu den Treffen ihres örtlichen Ponyclubs, und die ersten Veranstaltungen im Freien, Gartenpartys und Wohltätigkeitsfeste, trieben bereits üppige Blüten. Aus der Fernfahrerkneipe war ein teures Feinkostgeschäft geworden, den baufälligen Tabakladen hatte ein netter junger Mann aufgekauft, der sich mit Antiquitäten versuchte, und der Pfarrer war schon dabei, für den nächsten Sommer ein Festspiel zu planen, um das dreihundertjährige Bestehen seiner kleinen, spätgotischen Kirche zu feiern.
Woodbridge war wieder zu seinem Recht gekommen.
An einem kühlen Februartag zeigte die Kirchturmuhr gerade zehn Minuten vor zwölf an, als ein großer, schäbiger Volvo beim Sattler um die Ecke bog und zwischen den breiten, kopfsteingepflasterten Bürgersteigen langsam die Hauptstraße entlangfuhr. Der junge Mann am Steuer konnte die ganze, langgezogene Biegung überblicken, denn kein brausender Verkehrsstrom behinderte seine Sicht. Er sah die reizvolle Vielfalt der Häuser und die Geschäfte mit den Schaukästen, die verlockende Aussicht und weidengesäumte Wiesen, die in der Ferne schimmerten. Hoch oben am winterlichen Himmel, über den ein paar Wolken segelten, dröhnte ein Flugzeug Richtung Heathrow. Sonst war es sehr still, und es schien kaum jemand unterwegs zu sein.
Er kam an einem frisch gestrichenen Pub vorbei, vor dessen Tür links und rechts Lorbeerbäume in Kübeln standen, an einem Friseursalon mit der Aufschrift «Carole Coiffures», an der Weinhandlung mit dem Fenster aus grünem Flaschenglas und an einem mit überteuerten Relikten aus besseren Tagen vollgestopften Antiquitätengeschäft.
Dann erreichte er das Haus. Er fuhr dicht an den Bürgersteig heran und stellte den Motor ab. Das Geräusch des Flugzeugs verebbte brummend in der morgendlichen Stille. Ein Hund bellte, ein Vogel zwitscherte hoffnungsvoll von einem Baum herunter, als habe er sich von dem bisschen Sonnenschein vorgaukeln lassen, der Frühling sei schon ausgebrochen. Der junge Mann stieg aus, schlug die Wagentür zu, blieb stehen und betrachtete die glatte, symmetrische Fassade des Hauses mit den gefälligen Proportionen und dem halbkreisförmigen Glaseinsatz in der Haustür. Es stand direkt am Rande des Bürgersteigs, von dem ein paar Stufen zum Eingang hinaufführten, und an seinen hohen Schiebefenstern verwehrten hauchdünne Vorhänge den Einblick.
Ein Haus, so dachte er, das nie etwas preisgegeben hatte.
Er erklomm die Stufen und klingelte. Die Klingelplatte war aus Messing und ebenso auf Hochglanz poliert wie der Türklopfer in der Form eines Löwenkopfes. Der gelbe Anstrich der Tür glänzte wie neu, warf keine Blasen und wies keinen einzigen Kratzer auf. Im Schatten des Hauses, wo die Sonne nicht hinkam, war es kühl. Der junge Mann fröstelte trotz seiner dicken Jacke und klingelte noch einmal. Gleich darauf hörte er Schritte, und im nächsten Augenblick ging die gelbe Tür auf.
Ein Mädchen stand vor ihm und blickte ziemlich mürrisch drein, als habe sein Klingeln sie bei etwas unterbrochen oder gestört und als wollte sie ihn so schnell wie möglich abwimmeln. Sie hatte langes, weißblondes Haar, trug ein T-Shirt, das über ihrem Babyspeck schier aus allen Nähten platzte, eine Kittelschürze, Kniestrümpfe und scharlachrote, lederne Clogs.
«Ja?»
Er lächelte und sagte: «Guten Morgen», und ihre ungeduldige Miene wich augenblicklich einem ganz anderen Ausdruck. Sie hatte gemerkt, dass er weder der Kohlenmann war noch jemand, der für das Rote Kreuz sammelte, sondern ein hochgewachsener, ansehnlicher junger Mann mit langen Beinen in abgewetzten Jeans und einem Bart wie ein Wikinger. «Ist Mrs. Archer zu Hause?»
«Bedaure», und sie sah auch so aus, als bedauerte sie es sehr, «sie ist leider nicht hier. Sie ist heute nach London gefahren. Einkaufen.»
Das Mädchen mochte etwa achtzehn und dem Akzent nach Skandinavierin gewesen sein. Wahrscheinlich Schwedin.
Mit, wie er hoffte, entwaffnender Zerknirschung sagte er: «Was bin ich doch für ein Pechvogel! Ich hätte anrufen sollen, aber ich dachte, ich probier’s mal auf gut Glück und treffe sie vielleicht zu Hause an.»
«Sind Sie ein Freund von Mrs. Archer?»
«Na ja, ich hab die Familie früher ganz gut gekannt, vor Jahren. Aber wir haben uns … irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt kam ich gerade hier vorbei, auf dem Weg vom Westen drüben nach London, und da dachte ich mir, es wäre nett, mal reinzuschaun und guten Tag zu sagen. War mir nur so in den Sinn gekommen. Ist nicht weiter wichtig.»
Zögernd schickte er sich an, wieder zu gehen. Wie er gehofft hatte, hielt das Mädchen ihn zurück.
«Wenn sie nach Hause kommt, kann ich ihr ja erzählen, dass Sie da waren. Sie wird rechtzeitig zum Tee wieder hier sein.»
Er hätte es nicht besser planen können, denn genau in diesem Moment begann die Kirchturmuhr zur Mittagsstunde zu schlagen.
«Es ist erst zwölf», sagte er. «Ich kann kaum so lange hier herumlungern. Aber macht nichts, ich bin vielleicht wieder mal in der Gegend.» Er blickte die Straße hinauf und hinunter. «Hier war doch früher mal ein kleines Restaurant …»
«Das gibt es nicht mehr. Es ist jetzt ein Feinkostgeschäft.»
«Na ja, vielleicht kriege ich im Pub ein Sandwich. Anscheinend ist es lange her, dass ich gefrühstückt habe.» Er lächelte auf sie hinunter. «Also dann, auf Wiedersehen. War nett, Sie kennengelernt zu haben.» Er wandte sich um, als wollte er weggehen. Da spürte er so deutlich, als wären es seine eigenen Gedanken, wie sie überlegte, sich zu einer Entscheidung durchrang. Schließlich sagte sie: «Ich könnte …»
Einen Fuß schon auf der obersten Stufe, drehte er sich noch einmal um.
«Was könnten Sie?»
«Sind Sie wirklich ein alter Freund der Familie?» Sie wartete nur darauf, von ihrem Zweifel befreit zu werden.
«Ja, das bin ich wirklich. Aber ich habe keine Möglichkeit, es Ihnen zu beweisen.»
«Hören Sie, ich bin gerade dabei, das Mittagessen für mich und den Kleinen zu richten. Wenn Sie wollen, können Sie mitessen.»
Er sah sie tadelnd an, und sie wurde rot. «Jetzt sind Sie aber sehr verwegen. Man hat Sie doch sicher ein ums andere Mal vor fremden Männern an der Tür gewarnt.»
Sie machte ein unglückliches Gesicht. Offenbar hatte man sie gewarnt. «Es ist bloß so, wenn Sie ein Freund von Mrs. Archer sind, dann würde Mrs. Archer wollen, dass ich Sie hereinbitte.» Sie fühlte sich einsam, und wahrscheinlich langweilte sie sich. Anscheinend fühlten sich alle Au-pair-Mädchen einsam und gelangweilt. Das war ein Berufsrisiko.
«Sie brauchen sich meinetwegen keine Scherereien aufzuhalsen», sagte er.
Unwillkürlich begann sie zu lächeln. «Ich glaube nicht, dass ich mir welche aufhalse.»
«Und wenn ich nun das Silber stehle? Oder wenn ich plötzlich versuche, zudringlich zu werden?»
Aus unerfindlichen Gründen erschreckte sie diese Möglichkeit nicht im Geringsten. Sie schien sie für einen Scherz zu halten, der sie eher beruhigte. Sie kicherte sogar leise und fast verschwörerisch. «Wenn Sie das tun, dann schreie ich, und dann kommt mir das ganze Dorf zu Hilfe. In Woodbridge weiß jeder, was jeder tut. Hier wird unablässig getratscht. Quassel, quassel. Keiner hat ein Geheimnis.» Sie trat zurück und öffnete die gelbe Tür weit. Der lange, hübsche Flur lag einladend vor ihm.
Er zögerte gerade lange genug, dass es echt wirkte, dann zuckte er mit den Schultern, sagte: «Na gut», und folgte ihr über die Schwelle, mit der Miene eines Mannes, der sich letzten Endes widerstrebend hatte überreden lassen. Sie schloss die Tür. Er schaute ihr ins Gesicht. «Aber Sie müssen vielleicht die Folgen tragen.»
Von dem kleinen Abenteuer ein wenig aufgekratzt, lachte sie wieder. Ganz Gastgeberin, fragte sie: «Wollen Sie nicht ablegen?»
Er zog die Jacke aus, und sie hängte sie auf.
«Kommen Sie mit in die Küche! Möchten Sie vielleicht ein Bier?»
«Ja gern, danke.»
Sie führte ihn durch den Korridor in den hinteren Teil des Hauses, in die moderne Küche, die in den nach Süden gelegenen Garten hinausging und jetzt von bleichem Sonnenlicht durchflutet war. Alles strahlte Sauberkeit und Ordnung aus; glänzende Flächen, ein funkelnder Herd, fleckenloser Stahl und poliertes Teakholz. Der Fußboden war mit blauen und weißen Fliesen ausgelegt, die portugiesisch anmuteten. Auf dem Fensterbrett standen Topfpflanzen, und vor dem Fenster war ein Tisch für das Mittagessen gedeckt. Der junge Mann sah den Hochstuhl, das glänzende Plastikset, den kleinen Löffel und den Becher mit einem Motiv von Beatrix Potter.
«Haben Sie hier ein Baby zu versorgen?», fragte er.
Sie stand am Kühlschrank und nahm eine Dose Bier für ihn heraus. «Ja.» Dann schloss sie die Kühlschranktür und griff nach einem Zinnkrug, der an einem Haken an der blankgescheuerten Anrichte aus Kiefernholz hing. «Mrs. Archers Enkel.»
«Wie heißt er denn?»
«Thomas. Er wird aber Tom gerufen.»
«Und wo ist er jetzt?»
«In seinem Bettchen. Er hält seinen Vormittagsschlaf. Ich gehe aber gleich hinauf und hole ihn, denn er wird bald sein Essen haben wollen.»
«Wie alt ist er?»
«Zwei.» Sie reichte ihm die Bierdose und den Krug. Er machte die Dose auf und goss vorsichtig ein, ohne dass sich eine Schaumkrone bildete.
«Er ist wohl nur vorübergehend hier, nicht wahr? Seine Eltern sind sicher verreist oder was.»
«Nein, er lebt ständig hier.» Ihr lächelndes Gesicht mit den Grübchen nahm einen bekümmerten Zug an. «Es ist sehr traurig. Seine Mutter ist tot.» Sie runzelte die Stirn. «Komisch, dass Sie das nicht wissen.»
«Ich hab’s Ihnen ja gesagt, ich war mit den Archers nicht mehr in Verbindung, seit ich sie zuletzt gesehen habe. Ich hatte keine Ahnung. Tut mir leid.»
«Sie kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auf dem Rückweg von einem Urlaub in Jugoslawien. Sie war ihr einziges Kind.»
«Ach, deshalb kümmern sie sich um das Enkelkind?»
«Ja.»
Er nahm einen Schluck Bier, kühl und köstlich. «Was ist mit dem Vater?»
Das Mädchen hatte ihm den runden Rücken zugewandt und beugte sich hinunter, um im Backofen nach etwas zu schauen. Ein herrlicher Duft erfüllte die Küche, und ihm lief das Wasser im Munde zusammen. Er hatte nicht gemerkt, wie hungrig er war.
«Die beiden lebten getrennt», erzählte sie. «Ich weiß nichts über ihn.» Sie schloss den Backofen und richtete sich wieder auf. Erneut warf sie ihm einen forschenden Blick zu. «Ich dachte, das wüssten Sie.»
«Nein. Ich weiß überhaupt nichts. Ich war eine Weile im Ausland. Ich war in Spanien und in Amerika.»
«Ach so.» Sie schaute auf die Uhr. «Kann ich Sie einen Moment allein lassen? Ich muss raufgehen und Thomas holen.»
«Wenn Sie sicher sind, dass Sie mir trauen können und ich mich nicht an den silbernen Löffeln vergreife», neckte er sie, und sie lächelte wieder fröhlich. «Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden», sagte sie in ihrer erfrischenden Art.
«Wie heißen Sie?», fragte er.
«Helga.»
«Sind Sie Schwedin?»
«Ja.»
«Die Archers haben Glück, dass sie jemanden wie Sie haben.»
«Ich habe auch Glück. Es ist ein guter Job, und sie sind sehr freundlich zu mir. Manche Mädchen erwischen schreckliche Stellen. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen.»
«Besuchen Sie nachmittags noch Kurse?»
«Ja. Englisch und Geschichte.»
«Ihr Englisch hört sich für mich perfekt an.»
«Ich studiere Literatur. Jane Austen.»
Sie sah so zufrieden mit sich selbst aus, dass er lachen musste. «Sausen Sie los, Helga, und holen Sie den Kleinen. Auch wenn er nicht hungrig ist, ich bin am Verhungern.» Aus irgendeinem Grund wurde sie wieder rot, dann ging sie hinaus und ließ ihn in der blitzblanken, sonnigen Küche allein.
Er wartete, hörte ihre Schritte auf der Treppe und auf dem Fußboden im Raum über ihm. Dann hörte er sie mit ruhiger Stimme sprechen und Vorhänge aufziehen. Sofort setzte er sein Bier ab, schlich auf leisen Sohlen wieder den Korridor entlang und öffnete die Tür am Fuße der Treppe. Er trat ein. Da waren sie, die Chintzbezüge, das Klavier, die ordentlichen Bücherregale, die bescheidenen Aquarelle. Im alten, offenen Kamin aus dem vorigen Jahrhundert war Holz aufgeschichtet, aber noch nicht angezündet. Dennoch war der Raum warm, zentralgeheizt, und duftete intensiv nach Hyazinthen.
Die Sauberkeit, die Ordnung, die Atmosphäre wohlerzogener, wohlhabender Spießigkeit machten ihn rasend wie eh und je. Sehnsüchtig hielt er Ausschau nach verheddertem Strickzeug, nach herumliegenden Zeitungen, nach einem Hund oder einer Katze auf ihrem angestammten Kissen. Aber da war nichts dergleichen. Nur das langsame Ticken der Uhr auf dem Kaminsims zeugte davon, dass sich hier überhaupt etwas bewegte.
Leise schlich er durch den Raum. Auf dem Klavier stand eine ganze Sammlung von Fotografien. Mr. Archer mit Zylinder, einen unbedeutenden Orden, den ihm die Königin im Buckingham-Palast verliehen hatte, auf der stolzgeschwellten Brust; sein Schnurrbart glich einer Zahnbürste, und der Cut spannte über dem vorstehenden Bauch. Mrs. Archer als verschleierte Braut. Das Baby auf einem Bärenfell. Und Jeannette.
Der junge Mann nahm das retuschierte Porträt in die Hand und schaute darauf hinunter. Hübsch, denn sie war immer hübsch gewesen. Sogar verführerisch, auf ihre besondere, anspruchsvolle Art. Er erinnerte sich an ihre Beine, die umwerfend gewesen waren, und an die Form ihrer sorgfältig manikürten Hände. Aber an viel mehr auch nicht. Nicht an ihre Stimme, nicht an ihr Lächeln.
Er hatte sie geheiratet, weil die Archers nicht wollten, dass ihre Tochter ein uneheliches Kind bekam. Als man ihnen schonend die niederschmetternde Nachricht beigebracht hatte, dass ihr kostbares, einziges Kind eine Affäre mit diesem grässlichen Oliver Dobbs hatte, ja sogar mit ihm zusammenlebte, da stürzte ihre heile, kleine Welt ein. Mrs. Archer erlitt eine crise de nerfs, die sie ins Bett zwang, doch Mr. Archer besann sich auf die kurzen Jahre seines Soldatenlebens, richtete Krawatte und Rücken gerade und führte Oliver zum Lunch in seinem Londoner Club aus.
Oliver, dem das keinerlei Eindruck und nicht den geringsten Spaß machte, nahm die anschließende Unterredung mit der Gleichgültigkeit eines vollkommen unbeteiligten Beobachters auf. Schon damals kam sie ihm so unwirklich wie eine Szene aus einem altmodischen Theaterstück vor.
Mr. Archer murmelte etwas von einziger Tochter und ging hastig zum Angriff über. Er hatte immer Großes mit ihr vorgehabt. Nicht, dass er jemanden anklagen wollte, zu späte Einsichten halfen einem schließlich nie weiter, doch es erhob sich immerhin die Frage, was Oliver wegen des Kindes zu tun gedachte.
Oliver erklärte ihm, dass er seiner Meinung nach überhaupt nichts tun könne. Er arbeite in einer Fisch-und-Fritten-Bude und könne es sich nicht leisten, irgendwen zu heiraten, geschweige denn Jeannette.
Mr. Archer räusperte sich und versicherte, er wollte ihm weder zu nahe treten noch neugierig erscheinen, aber ihm wäre nicht entgangen, dass Oliver aus einer guten Familie stammte, und er wüsste, dass Oliver eine renommierte Schule besucht hätte. Gab es denn einen Grund, warum er in einer Frittenbude arbeiten musste?
Oliver erklärte ihm, ja, es gäbe einen Grund. Er wäre Schriftsteller, und der Job in der Frittenbude wäre genau die Art anspruchsloser Tätigkeit, die er brauchte, um den Lebensunterhalt zu verdienen und dabei schreiben zu können.
Da räusperte Mr. Archer sich erneut und kam auf Olivers Eltern zu sprechen, und Oliver erzählte ihm, dass seine Eltern, die in Dorset lebten, nicht nur mittellos, sondern auch unversöhnlich wären. Da sie von einer Pension leben mussten, die sein Vater von der Armee bezog, hatten sie sich selbst nichts gegönnt, um genügend Geld zusammenzukratzen, damit sie ihn auf diese exklusive Schule schicken konnten. Als er ihr schließlich mit siebzehn den Rücken gekehrt hatte, waren sie untröstlich gewesen und hatten versucht ihn zu überreden, wenigstens eine vernünftige, solide Laufbahn einzuschlagen. Er sollte zur Armee gehen, vielleicht zur Marine, oder Bilanzbuchhalter, Banker oder Anwalt werden. Doch er konnte nur Schriftsteller sein, denn damals war er bereits ein Schriftsteller. Letzten Endes hatten sie sich geschlagen gegeben, wollten mit ihrem Sohn nichts mehr zu tun haben, hatten ihn mit den sprichwörtlich leeren Händen an die Luft gesetzt und lehnten seither beharrlich schmollend jeden Umgang mit ihm ab.
Nachdem Olivers Eltern offensichtlich abgehakt waren, schlug Mr. Archer eine andere Richtung ein. Liebte Oliver Jeannette? Würde er ihr ein guter Ehemann sein?
Nein, sagte Oliver, er glaubte nicht, dass er einen guten Ehemann für sie abgäbe, weil er so furchtbar arm sei.
Daraufhin räusperte Mr. Archer sich zum dritten und letzten Mal und kam zur Sache. Falls Oliver bereit wäre, Jeannette zu heiraten, und dem Baby zu einem rechtmäßigen Vater verhalf, dann würde er, Mr. Archer, dafür sorgen, dass es … hm … finanziell gesehen, dem jungen Paar gutginge.
Wie gut, fragte Oliver. Und Mr. Archer deckte seine Karten auf, wobei er Oliver über den Tisch hinweg beharrlich in die Augen sah, während seine rastlosen Hände das Weinglas hin und her schoben, eine Gabel geraderückten und ein Brötchen zerkrümelten. Als er fertig war, sah sein Gedeck wie ein Trümmerfeld aus, aber Oliver hatte begriffen, dass er einen guten Fang machte.
Da er in Jeannettes Wohnung in London leben und regelmäßige Einkünfte beziehen würde, die jeden Monat auf seinem Bankkonto eingingen, konnte er den Job in der Frittenbude aufgeben und endlich sein Theaterstück zu Ende schreiben. Er hatte bereits ein Buch zustande gebracht, doch das lag noch bei einem Agenten. Das Theaterstück war etwas anderes, etwas, das er aufs Papier bannen musste, bevor es ihm die Seele aus dem Leib fraß wie ein scheußlicher Krebs. So war das eben mit dem Schreiben. Oliver war nie glücklich, wenn er kein Doppelleben führte. Ein wirkliches Leben, mit Frauen und mit Essen und Trinken unter Freunden in Pubs, und jenes andere Leben, in dem es von seinen eigenen Figuren wimmelte, die lebendiger und verständnisvoller waren als irgendjemand, dem er normalerweise begegnete. Und, so dachte er, gewiss interessanter als die Archers.
Bei Tisch waren sich die beiden Männer einig geworden. Später wurde diese Einigung mit Brief und Siegel beim Anwalt bekräftigt. Oliver und Jeannette wurden ordnungsgemäß auf einem Standesamt getraut, und das war anscheinend das Einzige, was für die Archers zählte. Die Ehe hatte nicht länger als ein paar Monate gehalten. Noch ehe das Baby zur Welt kam, war Jeannette zu ihren Eltern zurückgekehrt. Langeweile könnte sie ertragen, hatte sie gesagt, auch Einsamkeit, aber Beschimpfungen und körperliche Gewalt, das war mehr, als sie zu erdulden bereit gewesen war.
Oliver hatte kaum gemerkt, dass sie gegangen war. Er blieb in ihrer Wohnung und schrieb, nun völlig ungestört, in aller Ruhe sein Stück zu Ende. Als es fertig war, verließ er die Wohnung, schloss die Tür ab und schickte Jeannette per Post den Schlüssel. Dann fuhr er nach Spanien. Er hielt sich in Spanien auf, als das Baby geboren wurde, und war noch immer dort, als er in irgendeiner schon Wochen alten Zeitung las, dass seine Frau bei der Flugzeugkatastrophe in Jugoslawien ums Leben gekommen war. Inzwischen war Jeannette für Oliver nur noch eine Frau gewesen, der er vor langer Zeit zufällig begegnet war, und er hatte festgestellt, dass ihn der tragische Unfall kaum berührte. Jeannette gehörte der Vergangenheit an.
Außerdem saß er damals längst an seinem zweiten Roman. Also hatte er vielleicht fünf Minuten an sie gedacht, dann war er dankbar in die Gesellschaft der weitaus spannenderen Figuren zurückgekehrt, die ausschließlich in seinem Kopf ihr Wesen trieben.
Als Helga herunterkam, saß er, die Sonne im Rücken, wieder auf der Sitzbank unter dem Küchenfenster und ließ sich sein Bier schmecken. Die Tür ging auf, und das Mädchen erschien mit dem Kind auf dem Arm. Der Junge war größer, als Oliver ihn sich vorgestellt hatte. Er trug eine rote Latzhose und einen weißen Pullover. Sein Haar leuchtete in einem rötlichen Goldton, wie ein neuer Penny, doch Oliver konnte sein Gesicht nicht sehen, weil er es in Helgas reizendem Hals vergrub.
Helga lächelte Oliver über Thomas’ Schulter hinweg zu.
«Er ist schüchtern. Ich hab ihm erzählt, dass Besuch da ist, und er mag Sie nicht ansehen.» Sie neigte den Kopf nach hinten und sagte zu dem Kind: «Schau doch mal, du Dummerchen! Es ist ein netter Mann. Er ist hergekommen, um mit uns Mittag zu essen.»
Der Kleine wehrte sich greinend und vergrub sein Gesicht noch tiefer. Helga lachte, trug ihn zu seinem Hochstuhl und setzte ihn hinein, sodass er sie schließlich loslassen musste. Er und Oliver sahen einander an. Das Kind hatte blaue Augen und machte einen kräftigen Eindruck. Oliver wusste nicht viel über Kinder. Genaugenommen gar nichts. Er sagte: «Hallo.»
«Sag hallo, Thomas!», forderte Helga ihn auf. «Er spricht nicht gern», fügte sie hinzu.
Thomas starrte den Fremden an. Die Seite seines Gesichts, mit der er auf dem Kissen gelegen hatte, war rot. Er roch nach Seife. Helga legte ihm ein Lätzchen aus Plastik um, doch er wandte die Augen nicht von Oliver ab.
Helga ging zum Herd, um das Essen zu holen. Sie zog einen Kartoffelauflauf mit Hackfleisch und eine Schüssel Rosenkohl aus dem Backofen. Dann schöpfte sie von allem ein wenig in eine runde Schale, zerquetschte es mit einer Gabel und stellte es auf die kleine Tischplatte an Thomas’ Hochstuhl. «Jetzt iss mal schön!», sagte sie und drückte ihm seinen Löffel in die Hand.
«Wird er nicht gefüttert?», fragte Oliver.
«Aber nein. Er ist schon zwei, er ist doch kein Baby mehr. Nicht wahr, Thomas? Zeig dem Mann, wie schön du allein essen kannst!» Prompt legte Thomas den Löffel wieder hin. Ohne zu blinzeln, fixierten seine blauen Augen Oliver, und Oliver fing an, sich unsicher zu fühlen.
«Na, komm», sagte er, setzte seinen Bierkrug ab, griff nach dem Löffel, tat etwas Fleisch und Kartoffeln drauf und hielt ihn Thomas vor den Mund. Der Mund öffnete sich, und schon war der Löffel leer. Während Thomas kaute, starrte er unverwandt Oliver an. Der gab ihm den Löffel zurück. Thomas schluckte, und dann lächelte er. Das Lächeln bestand zum größten Teil aus Auflauf, doch es ließ auch zwei hübsche Perlreihen kleiner Zähne erkennen.
Helga stellte Olivers Teller vor ihn hin und bekam das Lächeln mit.
«Na bitte, er hat sich schon mit Ihnen angefreundet.» Sie brachte noch einen Teller und setzte sich an den Kopf des Tisches, sodass sie Thomas helfen konnte. «Er ist ein freundlicher Junge.»
«Was macht er denn den ganzen Tag?»
«Er spielt, und er schläft, und am Nachmittag wird er in seinem Sportwagen spazieren gefahren. Für gewöhnlich geht Mrs. Archer mit ihm raus, aber heute mache ich es.»
«Schaut er schon Bücher an?»
«Ja, er mag Bilderbücher, aber manchmal zerreißt er sie auch.»
«Hat er Spielsachen?»
«Er spielt gern mit kleinen Autos und mit Bausteinen. Teddybären oder Plüschhasen und solche Sachen mag er allerdings nicht. Wissen Sie, ich glaube, er fasst nicht gern etwas Pelziges an.»
Oliver machte sich über den Auflauf her, der sehr heiß war und köstlich schmeckte. Er fragte: «Verstehen Sie viel von Kindern?»
«Zu Hause, in Schweden, da habe ich jüngere Geschwister.»
«Haben Sie Thomas gern?»
«Ja, er ist ein lieber Junge.» Sie strahlte Thomas an: «Du bist ganz lieb, nicht wahr, Thomas? Und er schreit nicht dauernd wie manche Kinder.»
«Es muss ziemlich … langweilig für ihn sein, von den Großeltern aufgezogen zu werden.»
«Er ist noch zu klein, um schon zu wissen, ob es langweilig ist oder nicht.»
«Aber es wird langweilig werden, wenn er älter ist.»
«Als Einzelkind aufzuwachsen ist immer traurig. Aber es gibt ja noch mehr Kinder im Dorf. Er wird Freunde finden.»
«Und Sie? Haben Sie Freunde gefunden?»
«Es ist noch ein anderes Au-pair-Mädchen hier. Wir gehen miteinander in die Schule.»
«Haben Sie keinen Freund?»
Auf ihren Wangen zeigten sich Grübchen. «Mein Freund ist zu Hause in Schweden.»
«Er wird Sie vermissen.»
«Wir schreiben uns. Und es ist ja nur für sechs Monate. Wenn die sechs Monate um sind, fahre ich nach Schweden zurück.»
«Was geschieht dann mit Thomas?»
«Ich nehme an, Mrs. Archer wird ein anderes Au-pair-Mädchen einstellen. Möchten Sie noch was von dem Auflauf?»
Das Essen ging weiter. Zum Nachtisch gab es dann Obst, Joghurt oder Käse. Thomas mampfte ein Joghurt, während Oliver eine Orange schälte. Helga stand am Herd und brühte Kaffee auf.
«Leben Sie in London?», fragte sie Oliver.
«Ja, ich habe eine Kellerwohnung in der Nähe der Fulham Road.»
«Fahren Sie da jetzt hin?»
«Ja. Ich war für eine Woche in Bristol.»
«Auf Urlaub?»
«Wer würde schon im Februar auf Urlaub nach Bristol fahren? Nein, im Fortune Theatre studieren sie ein Stück von mir ein. Ich war dort, um es noch ein bisschen zu überarbeiten. Die Schauspieler haben sich beklagt, dass sie sich an meinem Text die Zunge brechen würden.»
«Ein Schriftsteller?» Sie machte große Augen. «Sie schreiben Theaterstücke? Und die werden auch aufgeführt? Sie müssen sehr gut sein.»
«Ganz meine Meinung.» Er stopfte sich Orangenstücke in den Mund. Ihr Geschmack und das bittere Aroma der Schale erinnerten ihn an Spanien. «Aber worauf es wirklich ankommt, ist das, was andere davon halten, die Kritiker und die Leute, die dafür bezahlen, wenn sie ins Theater gehen.»
«Wie heißt das Stück?»
«Das falsche Spiel. Fragen Sie mich bloß nicht, wovon es handelt, denn ich habe nicht genug Zeit, es Ihnen zu erzählen.»
«Mein Freund schreibt auch. Er schreibt Artikel über Psychologie für die Unizeitung.»
«Die sind sicher hochinteressant.»
«Aber es ist nicht dasselbe wie Theaterstücke schreiben.»
«Nein, nicht ganz.»
Thomas war mit seinem Joghurt fertig. Helga wischte ihm das Gesicht sauber, nahm ihm das Lätzchen ab und hob ihn aus dem Hochstuhl. Schließlich stand er neben Oliver und stützte sich auf dessen Knie, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Durch die abgewetzten Jeans konnte Oliver spüren, wie warm seine Hände waren und wie fest die kleinen Finger zupackten. Thomas schaute zu Oliver auf und lächelte wieder, dass er Grübchen bekam und die kleinen Zähne aufblitzten. Er streckte einen Arm nach Olivers Bart aus, und Oliver bückte sich, damit er ihn erreichen konnte. Thomas lachte. Oliver hob ihn hoch und setzte ihn auf sein Knie. Er fühlte sich fest und warm an.
Helga freute sich anscheinend riesig darüber, dass die beiden sich so schnell angefreundet hatten. «Jetzt hat er wirklich Freundschaft mit Ihnen geschlossen. Wenn ich ein Buch hole, können Sie ihm die Bilder zeigen, während ich das Geschirr in die Spülmaschine räume. Danach muss ich mit ihm spazieren gehen.»
Eigentlich wollte Oliver schon aufbrechen, sagte aber: «Na schön.» Also ging Helga hinaus, um ein Buch zu suchen, und er und Thomas blieben allein.
Der kleine Junge war von seinem Bart hellauf begeistert. Oliver zog Tom hoch, sodass er auf seinen Knien stand und ihre Augen auf gleicher Höhe waren. Thomas zerrte am Bart. Oliver schrie auf. Thomas lachte. Er versuchte, wieder daran zu ziehen, doch Oliver griff nach seiner Hand und hielt sie fest. «Das tut weh, du Biest.» Thomas sah ihm unverwandt in die Augen. Leise fragte Oliver: «Weißt du, wer ich bin?», und Thomas lachte wieder, als wäre diese Frage ein großartiger Witz.
Helga kam mit dem Buch zurück und legte es auf den Tisch, ein großes Buch mit leuchtendbunten Haustieren auf dem Hochglanzeinband. Oliver schlug es irgendwo auf, und Thomas, der inzwischen wieder auf seinem Knie saß, beugte sich vor und betrachtete die Bilder. Während Helga ihre Arbeit tat, die Teller wegräumte und die Auflaufform auskratzte, blätterte Oliver die Seiten um, nannte dabei die Namen der Tiere und zeigte auf das Bauernhaus, das Gatter, den Baum und auf den hohen Heuhaufen. Beim Bild eines Hundes rief Thomas «Wau, wau», und der Anblick einer Kuh entlockte ihm ein langgezogenes «Muuh». All das verlief äußerst freundschaftlich.
Dann erklärte Helga, es sei nun an der Zeit, Thomas nach oben zu bringen und für den Spaziergang umzuziehen. Sie nahm ihn auf den Arm und trug ihn fort. Oliver blieb sitzen und wartete darauf, dass sie wieder herunterkamen. Sein Blick schweifte durch die mustergültige Küche und hinaus in den ebenso mustergültigen Garten, und er dachte darüber nach, dass Helga in ein paar Monaten das Haus verließ und dann das nächste Au-pair-Mädchen kam. Und das würde immer so weitergehen, bis Thomas acht Jahre und damit alt genug war, um in irgendeine angesehene und wahrscheinlich nutzlose Schule geschickt und auf ein Studium vorbereitet zu werden. Er stellte sich seinen Sohn dort vor, eingesperrt, etikettiert, dem Fließbandbetrieb konventioneller Erziehung ausgeliefert, in dem man von ihm erwartete, dass er sich die richtigen Freunde aussuchte, die allgemein anerkannten Spiele spielte und nie die Tyrannei sinnloser Traditionen hinterfragte.
Oliver war ausgebrochen. Mit siebzehn war er abgehauen, allerdings nur, weil er zweierlei Waffen einsetzen konnte, das Schreiben und die unbeirrbare, rebellische Entschlossenheit, seinen eigenen Weg zu gehen.
Aber wie würde sich Thomas schlagen?
Die Frage bereitete ihm Unbehagen, und er verwarf sie als rein hypothetisch. Ihn ging es schließlich nichts an, welche Schule Thomas besuchte, das war ihm sowieso egal. Er zündete sich eine Zigarette an und schlug völlig gedankenlos wieder Thomas’ Bilderbuch auf; diesmal klappte er den Buchdeckel auf. Mit schwarzer Tinte stand auf dem weißen Vorsatzblatt in Mrs. Archers gestochener Handschrift:
Thomas Archer
Zu seinem zweiten Geburtstag
von Granny.
Und das war ihm ganz plötzlich doch nicht egal. Wut stieg in ihm auf, sodass er, wenn Jeannettes Mutter jetzt neben ihm gestanden hätte, auf sie losgegangen wäre, mit Worten, wie nur er sie zu benutzen verstand, notfalls auch mit Fäusten.
Er ist nicht Thomas Archer, du bigottes Miststück. Er ist Thomas Dobbs. Er ist mein Sohn.
Als Helga mit Thomas herunterkam, dem sie eine Art Skioverall angezogen und eine Wollmütze mit Bommel aufgesetzt hatte, erwartete Oliver sie bereits in der Diele. Er hatte den Mantel schon an und sagte: «Ich muss jetzt gehen. Ich muss nach London zurück.»
«Ja, natürlich.»
«Es war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mich zum Essen eingeladen haben.»
«Ich werde Mrs. Archer erzählen, dass Sie da waren.»
Er begann zu grinsen. «Ja, tun Sie das.»
«Aber … Ich weiß ja gar nicht, wie Sie heißen. Um es ihr auszurichten, meine ich.»
«Sagen Sie bloß Oliver Dobbs.»
«Ja, Mr. Dobbs.» Sie stand am Fuß der Treppe, zögerte einen Moment und sagte dann: «Ich muss noch den Kinderwagen aus der Abstellkammer holen und meinen Mantel. Würden Sie Thomas einen Augenblick halten?»
«Natürlich.»
Er hob das Kind aus ihren Armen und drückte es an seine Schulter.
«Ich bin gleich wieder da, Thomas», versprach Helga, wandte sich um und verschwand unter der geschwungenen Treppe hinter einer halbhoch verglasten Tür.
Ein hübsches, vertrauensseliges, dummes Mädchen. Oliver hoffte, dass sie nicht zu streng zu ihr sein würden. Du kannst bleiben, solange du willst, mein Schatz. Mit seinem Sohn auf dem Arm schritt er durch die Diele, machte die gelbe Haustür auf, ging die Stufen hinunter und stieg in sein Auto ein.
Helga hörte ihn wegfahren, merkte aber nicht, dass es Olivers Auto war. Als sie mit dem Kinderwagen zurückkam, war von dem Mann und von dem kleinen Jungen nichts mehr zu sehen.
«Mr. Dobbs?»
Er hatte die Eingangstür offengelassen, und die bittere Kälte des Nachmittags strömte ins Haus.
«Thomas?»
Doch draußen war nur noch der leere Bürgersteig, die stille Straße.
2 Freitag
Nichts auf der Welt ist so anstrengend, fand Victoria Bradshaw, wie nicht genug zu tun zu haben. Es ist unendlich viel anstrengender als zu viel zu tun zu haben, und dieser Tag war ein klassisches Beispiel dafür.
Der Februar war eine schlechte Zeit, um Kleider zu verkaufen. Vermutlich eine schlechte Zeit, um überhaupt etwas zu verkaufen. Weihnachten war vergessen und der Winterschlussverkauf nur noch eine grausige Erinnerung. Dabei hatte der Morgen so vielversprechend mit ein bisschen Sonnenschein und einer dünnen Schicht Raureif begonnen, doch bis zum frühen Nachmittag waren Wolken aufgezogen, und inzwischen war es so nasskalt, dass alle, die nur einen Funken Verstand besaßen, zu Hause am Kamin oder in der zentralgeheizten Wohnung blieben und die Zeit mit Kreuzworträtseln, Kuchenbacken oder Fernsehen verbrachten. Das Wetter ermutigte sie nicht im Geringsten dazu, ihre Frühjahrsgarderobe zu planen.
Die Zeiger der Uhr rückten auf fünf vor, und draußen ging der trübe Nachmittag rasch in nächtliches Dunkel über. Auf der gewölbten Schaufensterscheibe des Modegeschäfts stand SALLY SHARMAN, in großen Buchstaben, die, von drinnen betrachtet, seitenverkehrt aussahen, wie Spiegelschrift, und jenseits dieser Hieroglyphen lag der regenverhangene Beauchamp Place. Passanten kämpften mit ihren Schirmen gegen den böigen Wind an und mühten sich mit Paketen ab. Eine lange Autoschlange wartete darauf, dass die Verkehrsampel an der Brompton Road auf Grün schaltete. Da kam eine wetterfest vermummte Gestalt im Laufschritt die Stufen von der Straße zum Eingang herauf und hastete durch die Glastür, als wäre sie auf der Flucht. Bevor sie die Tür zuschlagen konnte, strömte ein Schwall kalter Luft herein.
Es war Sally in ihrem schwarzen Regenmantel und mit einem riesigen Hut aus Rotfuchspelz. «O Gott, was für ein Tag!», rief sie aus, klappte ihren Schirm zu, streifte die Handschuhe ab und begann den Mantel aufzuknöpfen.
«Wie war’s?», fragte Victoria.
Sally hatte den Nachmittag in Gesellschaft eines jungen Designers verbracht, der beschlossen hatte, mit seiner Kollektion in den Großhandel einzusteigen.
«Nicht schlecht», berichtete sie, während sie ihren Mantel zum Abtropfen über den Schirmständer hängte. «Gar nicht schlecht. Eine Menge neue Ideen, gute Farben. Eher Kleider für reifere Semester. Ich war überrascht. Weil er noch so jung ist, habe ich gedacht, er hätte nur Jeans und derbe Hemden, aber nein, ganz und gar nicht.»
Sie nahm ihren Hut ab, schüttelte die Regentropfen aus dem Pelz und entpuppte sich letzten Endes als die hoch aufgeschossene, elegante Erscheinung, die sie für gewöhnlich war. Enge Hosen, die in hohen Stiefeln steckten, und ein weitmaschiger Pullover, der an jeder anderen wie ein alter Scheuerlappen ausgesehen hätte, an Sally aber hinreißend wirkte.
Sie hatte ihre Laufbahn als Mannequin begonnen und sich seither sowohl die Figur einer Bohnenstange als auch die eigentlich hässlichen, vorstehenden, aber sehr fotogenen Wangenknochen bewahrt. Vom Mannequin hatte sie den Sprung auf die Titelseiten einer Modezeitschrift geschafft und dann unter Einsatz all ihres erworbenen Wissens, ihrer zahlreichen Beziehungen und eines angeborenen Geschäftssinns einen eigenen Laden eröffnet. Sie war beinahe vierzig, geschieden und gab sich sehr sachlich, war aber dabei viel weichherziger, als sie sich gern von irgendjemandem anmerken ließ. Victoria arbeitete schon seit fast zwei Jahren bei ihr und hatte sie sehr gern.
Jetzt gähnte Sally. «Eigentlich hasse ich Arbeitsessen. Da fühle ich mich immer schon am helllichten Nachmittag verkatert, und irgendwie schafft mich das für den Rest des Tages.»
Sie griff in ihre übergroße Handtasche und holte Zigaretten und eine Abendzeitung heraus, die sie auf den gläsernen Ladentisch legte. «Und was war hier los?»
«Praktisch nichts. Ich habe das beigefarbene Hängekleid verkauft, und dann kam noch so ‘ne Tante rein, die eine halbe Stunde lang sinnlos für den Paisleymantel geschwärmt hat, aber wieder abzog und meinte, sie würde es sich noch einmal überlegen. Der Nerzkragen hat sie gestört, weil sie angeblich Tierschützerin ist.»
«Sagen Sie ihr, wir trennen ihn ab und nähen ihr stattdessen einen Kunstpelz drauf!»
Sally ging nach hinten in das kleine Büro, das durch einen Vorhang vom Laden abgeteilt war, setzte sich an ihren Schreibtisch und begann die Post zu öffnen.
«Hören Sie, Victoria, ich habe mir überlegt, dass das eine ausgezeichnete Zeit für Sie wäre, ein paar Wochen freizunehmen. Das Geschäft wird bald wieder in Schwung kommen, und dann kann ich Sie nicht weglassen. Außerdem haben Sie Gott weiß wie lange keinen Urlaub mehr gehabt. Nur, im Februar ist es halt nirgendwo sehr spannend. Vielleicht könnten Sie Ski laufen gehen oder zu Ihrer Mutter nach Sotogrande fahren. Wie ist es im Februar in Sotogrande?»
«Windig und nass, glaube ich.»
Sally blickte von ihrer Post auf. «Sie haben also keine Lust, im Februar zwei Wochen freizunehmen», stellte sie resigniert fest. «Ich höre es Ihnen an.» Victoria widersprach ihr nicht. Sally seufzte. «Wenn ich eine Mutter mit einem Traumhaus in Sotogrande hätte, würde ich sie jeden Monat besuchen, wenn ich könnte. Außerdem sehen Sie so aus, als brauchten Sie mal Urlaub. Ganz blass und dünn. Ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich Sie um mich habe, als würde ich Sie ausbeuten.» Sie schlitzte den nächsten Brief auf. «Ich dachte, wir haben die Stromrechnung bezahlt. Ich bin sogar sicher, dass wir sie bezahlt haben. Da muss sich der Computer geirrt haben. Der muss verrückt geworden sein. Das kommt bei Computern ja manchmal vor.»
Zu Victorias Erleichterung war die Frage, ob sie nun aus heiterem Himmel Ende Februar Urlaub machte oder nicht, für den Augenblick vergessen. Sie griff nach der Zeitung, die Sally hingelegt hatte, und weil sie nichts Besseres zu tun hatte, blätterte sie müßig darin herum und überflog die üblichen Katastrophenmeldungen, große wie kleine. In Essex gab es eine Überschwemmung, in Afrika drohte wieder einmal ein gewaltiger Steppenbrand, ein Earl in mittleren Jahren heiratete zum dritten Mal, und in Bristol hatten im Fortune Theatre die Proben zu Oliver Dobbs’ neuem Stück Das falsche Spiel begonnen.
Es gab keinen Grund, warum Victoria ausgerechnet diese winzige Meldung bemerkte. Sie stand unauffällig am Ende der letzten Spalte auf der Unterhaltungsseite. Keine Schlagzeile. Kein Foto. Nur Olivers Name, der ihr aus dem kleinen Druck entgegensprang wie der Schrei eines alten Bekannten, den man zufällig wiedertrifft.
«… es ist eine letzte Mahnung. So eine Frechheit, uns eine letzte Mahnung zu schicken! Ich weiß genau, dass ich vorigen Monat einen Scheck ausgestellt habe.» Victoria schwieg, und Sally schaute zu ihr hinüber. «Victoria …? Was starren Sie denn so an?»
«Nichts. Nur eine Notiz in der Zeitung über einen Mann, den ich von früher kenne.»
«Ich hoffe, er ist nicht im Gefängnis gelandet.»
«Nein, er schreibt Theaterstücke. Haben Sie schon mal was von Oliver Dobbs gehört?»
«Ja, natürlich. Der schreibt doch fürs Fernsehen. Ich habe neulich abends einen seiner Kurzfilme gesehen. Und er hat das Drehbuch für diese fabelhafte Dokumentation über Sevilla verfasst. Was hat er angestellt, dass er in die Zeitung kommt?»
«In Bristol wird ein neues Stück vom ihm inszeniert.»
«Wie ist er denn?», fragte Sally geistesabwesend, mit den Gedanken noch halb bei der Unverschämtheit der Londoner Elektrizitätsgesellschaft.
«Attraktiv.»
Da horchte Sally auf, denn sie hatte viel übrig für attraktive Männer. «So attraktiv, dass es Sie erwischt hat?»
«Ich war damals achtzehn und leicht zu beeindrucken.»
«Waren wir das nicht alle, Schätzchen, in der grauen Vorzeit unserer Jugend? Nicht, dass das etwa auf Sie zuträfe. Sie sind ja noch ein blühendes Kind, Sie glückliches Geschöpf.» Mit einem Mal verlor sie das Interesse an Oliver Dobbs, an der letzten Mahnung und an dem ganzen Tag, der schon viel zu lange gedauert hatte. Sie lehnte sich zurück und gähnte. «Hol’s der Teufel! Machen wir den Laden zu, und gehen wir nach Hause! Dem Himmel sei Dank, dass es ein Wochenende gibt! Die Aussicht auf zwei Tage Nichtstun erscheint mir plötzlich absolut paradiesisch. Ich werde mich heute Abend in die Badewanne legen und dabei fernsehen.»
«Ich dachte, Sie gehen aus.»
Sallys Privatleben war ebenso munter wie kompliziert. Sie hatte gleich mehrere Freunde, von denen keiner etwas von der Existenz der anderen zu wissen schien. Wie ein geschickter Jongleur hielt sie alle in Bewegung, und um sich die Peinlichkeit zu ersparen, ungewollt ihre Namen zu verwechseln, nannte sie jeden «Darling».
«Nein, Gott sei Dank nicht. Und Sie?»
«Ich soll auf einen Drink bei Freunden meiner Mutter reinschauen. Das wird wohl nicht besonders aufregend werden.»
«Na ja», sagte Sally, «man kann nie wissen. Das Leben steckt voller Überraschungen.»
Am Beauchamp Place zu arbeiten hatte unter anderem den Vorteil, dass man von hier aus zu Fuß in die Pendleton Mews gehen konnte. Das Apartment dort gehörte Victorias Mutter, aber Victoria bewohnte es allein. Meistens genoss sie den Fußmarsch. Wenn sie Abkürzungen und schmale Seitenstraßen benutzte, brauchte sie nur eine halbe Stunde, und das verschaffte ihr am Anfang und am Ende eines Tages etwas Bewegung und frische Luft.
An diesem Abend war es allerdings so kalt und nass, dass ihr der bloße Gedanke daran, durch Wind und Regen zu stapfen, ein Gräuel war; also wurde sie ihrem Vorsatz, nie ein Taxi zu nehmen, untreu, gab ohne großen Widerstand der Versuchung nach, lief bis zur Brompton Road und hielt schließlich einen Wagen an.
Wegen der Einbahnstraßen und des chaotischen Verkehrs dauerte die Fahrt bis zur Pendleton Mews etwa zehn Minuten länger, als Victoria zu Fuß für die Strecke gebraucht hätte, und sie kostete so viel, dass Victoria dem Fahrer einfach eine Pfundnote in die Hand drückte und ihn das bisschen Wechselgeld abzählen ließ. Er setzte sie an dem Torbogen ab, der die kleine Gasse von der Straße trennte, sodass sie immer noch ein Stückchen zwischen Pfützen und über nassglänzendes Kopfsteinpflaster gehen musste, bevor sie endlich ihre heißersehnte blaue Haustür erreichte. Sie schloss auf, tastete nach dem Schalter und knipste das Licht an; dann stieg sie die steile, schmale, mit einem abgetretenen beigefarbenen Teppich belegte Treppe hinauf und kam oben direkt in dem kleinen Wohnzimmer an.
Kaum hatte sie Schirm und Einkaufskorb abgestellt, da zog sie die Chintzvorhänge zu, um die Nacht auszusperren. Der Raum strahlte sogleich Schutz und Geborgenheit aus. Sie zündete den gasbeheizten Kamin an, betrat die winzige Küche und setzte Kaffeewasser auf; dann schaltete sie den Fernseher ein und gleich wieder aus, legte eine Rossini-Ouvertüre auf den Plattenteller und ging in ihr Schlafzimmer, um den Regenmantel und die Stiefel auszuziehen.
Der Wasserkessel heischte im Wettstreit mit Rossini pfeifend um Aufmerksamkeit. Victoria machte sich einen Becher Instantkaffee, kehrte zum Kamin zurück, fischte Sallys Abendzeitung aus dem Einkaufskorb und schlug den Bericht über Oliver Dobbs und sein Stück in Bristol auf.
Ich war damals achtzehn und leicht zu beeindrucken, hatte sie zu Sally gesagt, aber sie wusste jetzt, dass sie damals auch einsam und wehrlos gewesen war, eine reife Frucht, die zitternd an ihrem Stängel hing und nur darauf wartete, dass sie hinunter fiel.
Und ausgerechnet Oliver hatte lauernd unter dem Baum gestanden, um sie aufzufangen.
Achtzehn und in ihrem ersten Semester an der Kunstakademie. Ohne jemanden zu kennen, äußerst schüchtern und unsicher, hatte Victoria sich sowohl geschmeichelt gefühlt als auch davor gefürchtet, als ein älteres Mädchen sie vielleicht aus Mitleid halbherzig aufgefordert hatte, zu einer Party zu kommen.
«Weiß der Himmel, wie’s wird, mir ist nur gesagt worden, ich kann einladen, wen ich will. Man soll irgendwas zu trinken mitbringen, aber es macht wahrscheinlich auch nichts, wenn du mit leeren Händen kommst. Jedenfalls ist es eine gute Gelegenheit, ein paar Leute kennenzulernen. Ich schreib dir die Adresse auf. Der Kerl heißt Sebastian, aber das spielt keine Rolle. Schnei einfach rein, wenn dir danach ist. Wann immer du magst, auch das spielt keine Rolle.»
Auf diese Weise war Victoria in ihrem ganzen Leben noch nie eingeladen worden. Sie beschloss, nicht hinzugehen. Dann besann sie sich anders. Und dann bekam sie wieder kalte Füße. Letzten Endes zog sie doch saubere Jeans an, stibitzte eine Flasche vom besten Rotwein ihrer Mutter und machte sich auf den Weg.
Sie landete in einer Dachwohnung in West Kensington, klammerte sich an ihrer Flasche Bordeaux fest und kannte niemanden. Noch keine zwei Minuten war sie dort, als jemand sagte: «Das ist aber unheimlich nett von dir!», und ihr die Weinflasche abnahm, doch sonst redete niemand auch nur ein einziges Wort mit ihr. Der Raum war verraucht, und es wimmelte vor ernst aussehenden Männern und Mädchen mit aschfahlen Gesichtern und langen Haaren, die an Seetang erinnerten. Sogar ein oder zwei schmuddelige Babys krabbelten herum. Es gab nichts zu essen, und sobald sie sich erst einmal von ihrem Bordeaux getrennt hatte, war auch weit und breit nichts Trinkbares mehr zu sehen. Victoria konnte das Mädchen nicht finden, das ihr vorgeschlagen hatte, hierher zu kommen, und sie war zu schüchtern, sich zu irgendeiner der Gruppen dazuzusetzen, die dicht gedrängt und ins Gespräch vertieft auf dem blanken Boden hockten, auf Kissen oder auf dem einzigen, durchgesessenen Sofa, aus dem auf der Sitzfläche die Sprungfedern herausschauten. Doch sie scheute sich auch davor, einfach ihren Mantel zu holen und wieder zu gehen. Ihr stieg der süßliche, heimtückische Geruch von Marihuana in die Nase, während sie an einem Erkerfenster stand und sich in nervenaufreibenden Visionen von einer drohenden Razzia verlor, als plötzlich jemand sagte: «Dich kenne ich noch nicht, oder?»
Erschrocken fuhr Victoria herum, so ungeschickt, dass sie dem Mann beinahe das Glas aus der Hand geschlagen hätte.
«Oh, tut mir leid …»
«Macht nichts. Hab’s ja nicht verschüttet. Wenigstens nicht sehr viel», fügte er großmütig hinzu.
Er lächelte, als sei das ein Witz gewesen, und sie lächelte zurück, dankbar für jeden freundlichen Annäherungsversuch. Dankbar auch dafür, dass der einzige Mann, der sie in dieser verwahrlosten Gesellschaft angesprochen hatte, weder schmutzig noch verschwitzt oder betrunken war. Im Gegenteil, er konnte sich durchaus sehen lassen. Er war sogar attraktiv. Sehr groß, sehr schlank, mit rötlichem Haar, das bis zum Kragen seines Pullovers reichte, und mit einem überaus gepflegten Vollbart.
«Du hast ja gar nichts zu trinken», stellte er fest.
«Nein.»
«Willst du nichts?»
Sie sagte wieder nein, weil sie wirklich nichts wollte und auch deshalb, weil sie befürchtete, er könnte sonst weggehen, um ihr etwas zu holen, und dann nie mehr wiederkommen.
Er schien sich zu amüsieren. «Magst du das nicht?»
Victoria betrachtete sein Glas. «Ich weiß nicht genau, was das ist.»
«Wahrscheinlich weiß das keiner. Aber es schmeckt wie …»
Er nahm einen Schluck, nachdenklich wie ein berufsmäßiger Vorkoster, rollte ihn im Mund herum und ließ ihn schließlich durch die Kehle laufen. «… wie rote Tinte mit Anisbonbons.»
«Und wie bekommt es deinem Magen?»
«Darüber zerbrechen wir uns den Kopf erst morgen früh.» Er sah auf sie hinunter, überlegte angestrengt und runzelte die Stirn. «Ich kenne dich wirklich nicht, oder?»
«Nein. Vermutlich nicht. Ich bin Victoria Bradshaw.» Es machte sie sogar verlegen, ihren eigenen Namen zu nennen, doch der junge Mann schien nichts dabei zu finden.
«Und was treibst du so?»
«Ich habe gerade in der Kunsthochschule angefangen.»
«Das erklärt, wieso du in diese Fete geraten bist. Gefällt es dir?»
Sie sah sich um. «Nicht besonders.»
«Ich habe zwar die Kunsthochschule gemeint, aber wenn es dir hier nicht gefällt, warum gehst du dann nicht nach Hause?»
«Ich dachte, das sei nicht sehr höflich.»
Er lachte sie aus. «Weißt du, in dieser Art von Gesellschaft zählt Höflichkeit nicht so viel.»
«Ich bin erst zehn Minuten da.»
«Und ich erst fünf.» Er trank aus. Dabei beugte er seinen imposanten Kopf nach hinten und kippte sich den Rest des üblen Gebräus so mühelos in die Kehle, als wäre es ein kühles Bier. Dann stellte er das Glas auf das Fensterbrett. «Los, wir hauen ab!» Er schob eine Hand unter ihren Ellbogen und drängte Victoria geschickt zur Tür. Ohne sich auch nur andeutungsweise zu entschuldigen oder von jemandem zu verabschieden, gingen sie weg.
Draußen auf dem schäbigen Treppenabsatz wandte sie sich zu ihm um.
«So habe ich das nicht gemeint.»
«Was hast du nicht gemeint?»
«Das heißt, ich habe nicht gewollt, dass du gehst. Ich wollte gehen.»
«Woher weißt du denn, dass ich nicht auch gehen wollte?»
«Aber es war doch eine Party.»
«Aus dieser Art von Partys bin ich seit Ewigkeiten rausgewachsen. Los, beeil dich, machen wir, dass wir an die frische Luft kommen!»
Auf dem Bürgersteig, im sanften Dämmerlicht einer Spätsommernacht blieb sie erneut stehen und sagte: «So, jetzt geht’s schon.»
«Und was soll das heißen?»
«Dass ich mir hier ein Taxi nehmen und nach Hause fahren kann.»
Er begann zu lächeln. «Hast du Angst?»
Victoria wurde wieder ganz verlegen. «Nein, natürlich nicht.»
«Wovor läufst du dann weg?»
«Ich laufe vor gar nichts weg. Bloß …»
«Willst du nach Hause?»
«Ja.»
«Kannst du aber nicht.»
«Warum nicht?»
«Weil wir uns jetzt eine Kneipe suchen, in der wir Spaghetti oder so was Ähnliches kriegen. Dort bestellen wir eine anständige Flasche Wein, und dann erzählst du mir deine Lebensgeschichte.»
Ein freies Taxi tauchte auf. Der junge Mann winkte es heran, und es hielt. Er verfrachtete sie hinein. Nachdem er dem Fahrer eine Adresse genannt hatte, fuhren sie etwa fünf Minuten schweigend dahin. Dann hielt das Taxi. Er scheuchte sie wieder hinaus, bezahlte die Fahrt und führte sie in ein kleines, schlichtes Restaurant, in dem an den Wänden ein paar Tische standen. Schwaden von Zigarettenrauch hingen in der Luft, und es roch nach gutem Essen. Sie bekamen einen Tisch in der Ecke, wo nicht genug Platz für seine langen Beine war, aber irgendwie schaffte er es doch, sie so zu verstauen, dass die vorbeieilenden Kellner nicht darüber stolperten. Er bestellte eine Flasche Wein, bat um die Speisekarte und zündete sich eine Zigarette an. Dann wandte er sich ihr zu und sagte: «Also!»
«Also was?»
«Erzähl schon! Deine Lebensgeschichte.»
Sie merkte, dass sie lächelte. «Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht einmal, wie du heißt.»
«Oliver Dobbs.» Ziemlich freundlich fuhr er fort: «Du musst mir alles erzählen, weil ich ein Schriftsteller bin. Ein waschechter Schriftsteller, der auch gedruckt wird, mit einem Agenten, einem haushoch überzogenen Bankkonto und einem zwanghaften Hang zum Zuhören. Weißt du, niemand hört richtig zu. Die Leute geben sich die größte Mühe, anderen etwas zu erzählen, und keiner hört ihnen zu. Hast du das gewusst?»
Victoria dachte an ihre Eltern. «Ja, ich glaube schon.»
«Siehst du, du glaubst es. Aber du bist dir nicht sicher. Keiner ist sich jemals irgendeiner Sache sicher. Sie sollten mehr zuhören. Wie alt bist du?»
«Achtzehn.»
«Als ich dich vorhin gesehen habe, dachte ich, du wärst jünger. Wie du da in der miesen Haschischhöhle am Fenster gestanden hast, hab ich dich für fünfzehn gehalten. Ich war nahe daran, die Fürsorge anzurufen und ihnen zu erzählen, dass sich ein klitzekleines Schulmädchen nachts auf der Straße rumtreibt.»
Der Wein kam, eine schon entkorkte Literflasche, die einfach auf den Tisch geknallt wurde. Oliver griff danach und füllte die Gläser. «Wo wohnst du?», fragte er.
«In der Pendleton Mews.»
«Wo ist das?»
Sie erklärte es ihm, und er pfiff durch die Zähne: «Wie schick! Ein Mädchen, das leibhaftig aus Knightsbridge kommt. Ich wusste gar nicht, dass die auf die Kunstakademie gehen. Du musst unheimlich reich sein.»
«Natürlich bin ich nicht reich.»
«Warum wohnst du dann in dieser teuren Gegend?»
«Weil das Haus meiner Mutter gehört. Nur, sie lebt gerade in Spanien, deshalb bin ich drin.»
«Seltsam, seltsam! Und warum lebt Mrs. Bradshaw in Spanien?»
«Sie heißt nicht Mrs. Bradshaw, sie heißt Mrs. Paley. Meine Eltern haben sich vor sechs Monaten scheiden lassen. Meine Mutter hat wieder geheiratet, einen gewissen Henry Paley, und der hat ein Haus in Sotogrande, weil er gern die ganze Zeit Golf spielt.» Victoria beschloss, alles auf einmal hinter sich zu bringen. «Und mein Vater ist zu einem Cousin gezogen, der ein halb verrottetes Gut in Südirland besitzt. Er hat angedroht, Polopferde zu züchten, doch er war schon immer ein Mann mit großen Plänen, aber nur wenig Tatkraft, also nehme ich nicht an, dass er es wirklich tut.»
«Und die kleine Victoria ist in London zurückgeblieben.»
«Victoria ist achtzehn.»
«Ja, ich weiß, alt und erfahren. Lebst du allein?»
«Ja.»
«Fühlst du dich nicht einsam?»
«Ich lebe lieber allein als mit Leuten, die einander nicht leiden können.»
Er schnitt eine Grimasse. «Eltern sind etwas Schreckliches, nicht wahr? Meine Eltern sind auch schrecklich, aber sie haben nie etwas so Endgültiges unternommen, wie sich scheiden zu lassen. Sie modern einfach im finstersten Dorset vor sich hin, und alles – ihre beschränkten Verhältnisse, den Preis einer Flasche Gin und die Tatsache, dass die Hennen nicht legen wollen – lasten sie entweder mir oder der Regierung an.»
«Ich mag meine Eltern», wandte Victoria ein. «Sie haben nur aufgehört, einander zu mögen.»
«Hast du Geschwister?»
«Nein.»
«Keinen, der sich um dich kümmert?»
«Ich kann mich sehr gut um mich selbst kümmern.»
Er machte ein ungläubiges Gesicht. «Ich werde mich um dich kümmern», verkündete er großspurig.
Nach diesem Abend sah Victoria Oliver Dobbs zwei Wochen lang nicht mehr und war schon überzeugt, dass sie ihn nie mehr wiedersehen würde. Und dann kam ein Freitag, an dem sie sich so elend fühlte, dass sie wie unter einem inneren Zwang einen völlig überflüssigen Großputz in der Wohnung veranstaltete und danach beschloss, sich die Haare zu waschen.