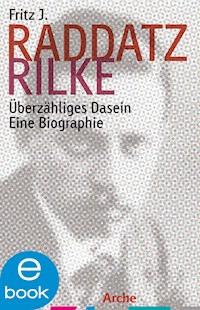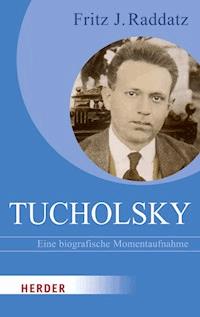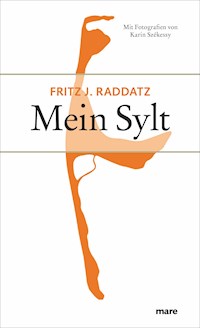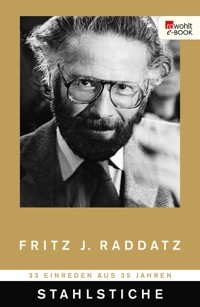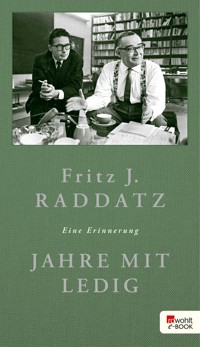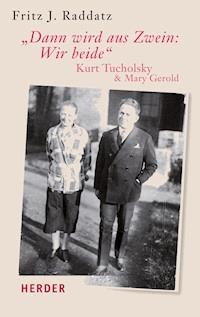9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Heinrich Heine ist ein Plural. Wer irgend meint, ihn hier fassen, dort festlegen zu können, hat nichts von ihm begriffen. ‹In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen› – wenn je das entzieherische Wort eines seiner Nachfahren zutraf, wenn es je die schwebende, nie fixierbare Pirouette des Künstlers gab, deren Schönheit aus Bewegung besteht, deren Delikatesse im Stillstand zerbricht: dann bei Heine. Nichts stimmt bei ihm; alles stimmt. Wer mit hergebrachten Normen zu urteilen sucht, gleicht dem klüglichen Aviatiker, der sagt: ‹Tauben zum Beispiel fliegen falsch.› Heinrich Heine war Artist. Was er wollte, war nichts als die Künstlerperfektion, nichts als die Sprache zum Tanzen bringen – nicht die Zustände. Wer Felsenfestes von Moral und Überzeugung, Gesittung und Gesinnung des Heinrich Heine erwartet, erhält zur Antwort das Kichern des Echos.» (Fritz J. Raddatz)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Fritz J. Raddatz
Heine
Ein deutsches Märchen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Heinrich Heine ist ein Plural. Wer irgend meint, ihn hier fassen, dort festlegen zu können, hat nichts von ihm begriffen. ‹In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen› – wenn je das entzieherische Wort eines seiner Nachfahren zutraf, wenn es je die schwebende, nie fixierbare Pirouette des Künstlers gab, deren Schönheit aus Bewegung besteht, deren Delikatesse im Stillstand zerbricht: dann bei Heine. Nichts stimmt bei ihm; alles stimmt. Wer mit hergebrachten Normen zu urteilen sucht, gleicht dem klüglichen Aviatiker, der sagt: ‹Tauben zum Beispiel fliegen falsch.› Heinrich Heine war Artist. Was er wollte, war nichts als die Künstlerperfektion, nichts als die Sprache zum Tanzen bringen – nicht die Zustände. Wer Felsenfestes von Moral und Überzeugung, Gesittung und Gesinnung des Heinrich Heine erwartet, erhält zur Antwort das Kichern des Echos.»
(Fritz J. Raddatz)
Über Fritz J. Raddatz
Fritz J. Raddatz war der widersprüchlichste deutsche Intellektuelle seiner Generation: eigensinnig, geistreich, gebildet, streitbar und umstritten. Geboren 1931 in Berlin, von 1960 bis 1969 stellvertretender Leiter des Rowohlt Verlages. Von 1977 bis 1985 Feuilletonchef der ZEIT. 1986 wurde ihm von Franςois Mitterrand der Orden «Officier des Arts et des Lettres» verliehen. Von 1969 bis 2011 war er Vorsitzender der Kurt-Tucholsky-Stiftung, Herausgeber von Tucholskys «Gesammelten Werken», Autor in viele Sprachen übersetzter Romane und eines umfangreichen essayistischen Werks. 2010 erschienen seine hochgelobten und viel diskutierten «Tagebücher 1982–2001». Im selben Jahr wurde Raddatz mit dem Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihm «Jahre mit Ledig». Der Autor verstarb im Februar 2015.
Inhaltsübersicht
Es ist mir nichts geglückt in dieser Welt.
Heine an seine Mutter
Die Mouche hieß nicht Mouche, Mathilde nicht Mathilde, und Heinrich Heine hieß nicht Heinrich Heine. Auf seinem Geburtsschein steht Harry, und auf dem Grabstein stand Henri. Er war Jude, aber getauft; »baptisé, non converti«. Er stammte aus bravem Kleinbürgertum, aber die Ortsangabe »van« im mütterlichen Geburtsnamen änderte er in ein adliges »von«. Er war geboren als der »erste Mann des Jahrhunderts«, wie er sich zu nennen liebte, doch sein Geburtsdatum liegt wohl wesentlich früher; exakt ist es bis zur Stunde nicht verifiziert. Er starb mit gleich vier als wahr überlieferten »letzten Worten« auf den Lippen; zumindest zwei davon schillernde Aperçus, die von ihm erfunden sein könnten: »N’ai pas peur, ma chère«, sagte er zu seiner betenden Frau, »Dieu me pardonnera; c’est son métier.« – »Pouvez-vous siffler?« fragte der Arzt: »Hélas, non: pas même les pièces de Monsieur Scribe.« Der letzte Brief ist eine Bitte, 25 Victor-Emanuel-Eisenbahnaktien zu kaufen, und die letzte Melodie, die ein Leierkasten vor dem Fenster des Sterbenden spielte, war des gehaßten Meyerbeers »Das Gold ist nur Chimäre«. Er demütigte den Baron Rothschild vor Gästen, indem er dessen Erzählung beim Diner, das Wasser der verschmutzten Seine sei an der Quelle klar und rein, süffisant mit einem »Ihr Herr Vater soll auch ein so rechtschaffener Mann gewesen sein, Herr Baron« kommentierte; und er intervenierte gleichzeitig (und erfolgreich) bei seinem Verleger Campe gegen die Veröffentlichung eines Anti-Rothschild-Pamphlets. Er badete das Kind von Karl Marx und nannte den »ein Scheermesser«. Er hieß sich hundearm, doch hatte er im Jahre vor seinem Tode ein Einkommen von DM200000,–, viele Jahre hindurch nicht viel darunter; der Minister und Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe verdiente zu seinen Lebzeiten weniger. Er galt als der politisch-revolutionäre Dichter Deutschlands – und wurde weder ausgewiesen noch verhaftet, noch auf polizeilichen Listen geführt; statt dessen verhandelte er mit Metternich und der preußischen Regierung und sagte schon im Jahre 1846, »ich bereue es, die wenigen politischen Gedichte veröffentlicht zu haben, die ich schrieb«. Er stellte wie kein Dichter vor ihm so keck wie melancholisch sein Ich heraus, aber das »Ich« seiner Gedichte ist nicht das seine: »Bei mir wenigstens paßt es nie.« Ein Leben hinter Larven.
Heinrich Heine, der unbekannte Dichter.
Heinrich Heine ist ein Plural. Wer irgend meint, ihn hier fassen, dort festlegen zu können, hat nichts von ihm begriffen. »In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen« – wenn je das entzieherische Wort eines seiner Nachfahren zutraf, wenn es je die schwebende, nie fixierbare Pirouette des Künstlers gab, deren Schönheit aus Bewegung besteht, deren Delikatesse im Stillstand zerbricht: dann bei Heine. Nichts stimmt bei ihm; alles stimmt. Wer mit hergebrachten Normen zu urteilen sucht, gleicht dem klüglichen Aviatiker, der sagt: »Tauben zum Beispiel fliegen falsch.« Heinrich Heine war Artist. Was er wollte, war nichts als die Künstlerperfektion, nichts als die Sprache zum Tanzen bringen – nicht die Zustände. Wer Felsenfestes von Moral und Überzeugung, Gesittung und Gesinnung des Heinrich Heine erwartet, erhält zur Antwort das Kichern des Echos.
Heines pseudonyme Fallenstellerei – seine ersten Gedichte erschienen unter dem aus »Düsseldorf« und »Harry Heine« gebildeten Häßlichkeitsanagramm »Sy Freudhold Riesenharf« – erinnert durchaus an das Versteckspiel eines anderen, der oft zu seinem »Nachfahren« ausgerufen wurde, der aber selber dazu sagte, »Heinrich Heine war ein Jahrhundertkerl – ich bin ein Talent«; auch er protestantisch getaufter Sohn aus jüdischem Bürgertum, auch er Doktor der Jurisprudenz, gefürchteter Journalist und Frankreichemigrant, dessen Grab nicht in Deutschland liegt: an Kurt Tucholsky. Der Schulaufsatz »Heine und Tucholsky – Gemeinsames und Trennendes« ist hier nicht zu schreiben, zu konstatieren aber ist Gemeinsames: extreme Verletzlichkeit, verdornt durch Aggressivität. Eine große Inszenierung, um hinter Schalmeienspiel und Zwinkertanz eines zu verbergen: sich. Grundgefühl war: Angst. »Indessen, man wird sie nicht lieben«, so hieß die erste (gesprochene) Kritik zu Heines Gedichten.
Bei Heine geht das Inszenatorische weit. Es beginnt mit der ersten Zeile – und es endet nie. Sein allererstes Gedicht, vom Dreizehnjährigen den Eltern dargebracht, stammt – nicht von ihm. Man konnte es bereits im Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1777 finden. Die musische Mutter, perfekt in lateinischer, englischer und französischer Lektüre, Schülerin Rousseaus und Verehrerin Goethes – dessen Bücher sie vor dem Vater verbarg –, war wesentlich eine Kunstfigur des später berühmten Sohnes. »Meine Mutter hat schönwissenschaftliche Werke gelesen, und ich bin ein Dichter geworden; meines Onkels Mutter dagegen hat den Räuberhauptmann Cartouche gelesen, und Onkel Salomon ist Bankier geworden«, das ist ein Aperçu. Die Familiengeschichte berichtet anderes. Wenn es etwa so schön im »Wintermärchen« heißt:
»Zu Bückeburg stieg ich ab in der Stadt,
Um dort zu betrachten die Stammburg,
Wo mein Großvater geboren ward;
Die Großmutter war aus Hamburg« –
so stimmt nur der Reim. Die »Stammburg« ist ein bescheidenes einstöckiges Häuschen, in dem eine kleine Kneipe untergebracht ist, und die heißt »Zur Falle«.
Von den Zeitgenossen, die Betty Heine kannten, weiß keiner von besonderer Bildung zu berichten, gar von Flötenspiel und Rousseau-Lektüre. Vor der im übrigen dem Sohne auch gegraust hätte – niemanden haßte er so wie den Rigoristen Rousseau, Vordenker der Montagnards und Ahn der Saint-Just und Robespierre:
»Das sind die Folgen der Revolution
Und ihrer fatalen Doktrine;
An allem ist schuld Jean Jacques Rousseau,
Voltaire und die Guillotine.«
Heines Mutter beherrschte Deutsch so mangelhaft wie etwa Karl Marx’ Mutter, sie schrieb es mit hebräischen Buchstaben und hatte Angst vor der Poesie. Sie war übrigens verwandt mit der Großmutter Walter Benjamins, so wie Heine auch ein entfernter Verwandter von Karl Marx war. Romane riß sie dem Sohn aus den Händen, Schauspiel oder Teilnahme an Volksspielen verbot sie, und Mägde, die Gespenstergeschichten erzählten, wurden gescholten.
Bischof, Napoleonischer General oder Bankier sollte der Sohn werden, und dafür, für das Studium, verkaufte sie – wie es heißt – ihren Schmuck; da der Student Heinrich Heine aber mit einem ansehnlichen Scheck vom Onkel Salomon ausgestattet war, ist es eher wahrscheinlich, daß Betty Heine damit ihrem bankrottmachenden Ehemann helfen wollte. Sie war es, die das letzte Stückchen Zucker, das »man« nicht nahm, den »Respekt« nannte; und nicht der respektlose Harry, sondern sein Bruder Max war es, der ihn sich doch nahm. »Mama, denk’ Dir, er hat den Respekt aufgegessen« – der gehorsame Harry berichtete das atemlos.
Heines Leben ist von zahllosen Legenden umrankt, und ihr Produzent hieß – Heinrich Heine. Weder gibt es Zeugen für die von ihm selber berichtete jugendliche Aufmüpfigkeit, mit der der Schüler die Frage »Wie heißt der Glaube auf französisch« sechsmal hartnäckig beantwortet habe: »le crédit«, noch hat er des kranken Vaters wegen seine Italienreise abgebrochen oder um des pflegebedürftigen Vetters Carl Heine willen während der Cholera-Epidemie in Paris ausgeharrt. Während er in Paris eher kärglich lebte, veranlaßte Heine Schilderungen seines üppigen Lebensstils durch Freund Lewald, der die Prahlereien von Mätressen, üppigen Salons mit kostbaren Kaminen und Möbeln und luxuriöser Lebensführung so gut verbreitete wie später Alexander Weill Artikel über Heine unter seinem Namen publizierte, die von Heine selber stammten. Als Joseph Neunzig ihn erstmals auf Elfenbein porträtierte, bat Heine ausdrücklich, ja den satirischen Zug um den Mund nicht zu vergessen.
Es mag mit dieser Lust an – trügerischer – Selbstdarstellung zusammenhängen, daß bis zur Stunde nicht sicher ist, wie Heine überhaupt aussah. Eine Vexier-Anthologie ließe sich zusammenstellen aus den widersprüchlichsten »Zeugenaussagen«. Die Haarfarbe – ganz unabhängig etwa vom Alter – wechselt zwischen lichtbraun, braun, dunkelbraun, blond, »bescheiden«, hellblond, glatt schwarz, dunkelbraun, hochblond, hellbraun, blond, dunkel, blond, kastanienbraun, blond mit weiß durchmischt. Kaum ein Zeitgenosse, der auch nur einigermaßen mit den anderen übereinstimmt. Demnach war Heine – immer im vergleichbaren Lebensabschnitt – sowohl dick wie dünn; blaß wie rosig-gesund; aufrecht gehend und gebückt; schön und unscheinbar – ja häßlich; ein germanischer Apoll und typisch jüdisch; kurzsichtig, von strahlender Blauäugigkeit und mit stechend-schwarzem Semitenblick; glattrasiert und schnurrbärtig; nie eine Brille tragend, ein Brillenfuchs, ein Lorgnon benutzend sowie eine goldene Brille; lockig, glattsträhnig, kurzgeschnitten, mit langem wallendem Haar; von bleichem, abgemagertem Antlitz, das die Spuren frühzeitiger Genüsse zeigte und mit dem wohlig-rosig-rundlichen Gesicht eines Mannes, der kaum Alkohol trank, nicht rauchte und »nie Weiber genossen« hat. Im selben Jahr berichtet derselbe Chronist, er habe Heine nie mit einem Bart gesehen, und das Gesicht sei von einem grauen Bart eingefaßt. Dasselbe wird von Heines nachweislich fünfzehn verschiedenen Pariser Wohnungen fabuliert, von deren üppigem Komfort und ihrer eher bürgerlichen Bescheidenheit, der Unbehaglichkeit eines Hotel garni und den Kaminen, Fauteuils und Samtportieren:
»Man wüßte nichts Besonderes von dieser einfachen Wohnung zu sagen, wenn nicht eine alte pockennarbige Mohrin mit einem buntseidenen Tuche um den Kopf als Magd beim Oeffnen der Thüre erschienen wäre und nicht von Zeit zu Zeit aus dem Zimmer Madame Heine’s der gelle Schrei eines Papagei herübertönte.«
Heine war, glaubt man den höchst plastischen Bildern seiner Umgebung, von schlottriger Nachlässigkeit in allen Kleiderfragen und stets nach der neuesten Mode gekleidet, allenfalls mit ziegelroter Mütze bedeckt, während er den eleganten hohen Filzhut mit breiter Krempe, Bolevar genannt, trug; Spitzenjabots, fein gekräuselte Manschetten, spitze Stiefel und schwarze Weste mit hoher weißer Krawatte – und ein kleiner häßlicher Jude mit dunkelgrünem Rock bis auf die Füße, voll lächerlicher Aufdringlichkeit, der wiederum selbst die etwas gewagten drei Silberhäkchen am Samtkragen seines Überrocks gegen die von George Sand bespöttelte Geschmacklosigkeit verteidigte. Einer seiner zuverlässigsten, wenn auch braven Biographen hat sogar festgestellt, daß keines der zeitgenössischen Porträts, Kupferstiche oder ähnliches auch nur annähernd Schlüsse über Heines Äußere zuläßt. Den Heine des »Buchs der Lieder« – wie soll man ihn sich vorstellen?
»Dieser blasse junge Mann, mit dem feingeschnittenen Gesichte, den verschwimmenden Augen, den weichen blonden Haaren, den feinen, in Glacéhandschuhen steckenden Händen, in eleganter schwarzer Kleidung, eine Rose im Knopfloch, eine andere zwischen den spielenden Fingern, der sich so vornehm nachlässig auf dem Canapé wiegt, der statt zu sprechen nur lispelt und über Alles so vornehm ab-lispelt, dieser Metternich en miniature – das wäre mein jugendlich frischer, frivol kecker Liederdichter!«
Tatsächlich mag das für Leben und Werk eines großen Schriftstellers gleichgültig sein – wäre diese Ambivalenz nicht charakteristisch für den Schriftsteller auch. Nicht nur die Auskünfte seiner Zeitgenossen über ihn sind schwankender Boden. Zerrspiegel und Geisterbahn, optische wie sinnliche Verführung, Riese oder Zwerg auf heimlichen Krücken, Leidender oder Spielender: auch Heines »wahrste« Impulse sind Kunst. Ob es das war, was Rahel Varnhagen meinte, wenn sie zögernd und warnend schon vom jungen Heine sagte, hier habe die Natur trotz so reicher Anlagen in ihrer Hast einige wesentliche Zutaten verabsäumt? Sie schreibt ganz sanft und zugleich ganz bestimmt im März 1829 an ihren Mann:
»Für Heine gibt es nur ein Heil, er muß Wahrheitsboden gewinnen, auf dem innerlich ganz fest gegründet sein, dann mag er sein Talent in der Welt auf die Streife schicken, um Beute zu holen und Mutwillen zu üben; hat er aber jene Burg nicht im Hinterhalt, so wird er bald gar keine Stätte haben, kann seinen Gewinn gar nicht lassen, muß ihn und sich nach Umständen in die Schanze schlagen, wird endlich als gemeiner Ruhestörer auf Steckbriefe eingefangen, und nimmt ein jämmerliches Ende! Warne ihn, wenn er noch hören will.«
Man kennt das Wort seines Freundes und Übersetzers Gérard de Nerval, von dem man sich so leicht erschüttern läßt; Heine habe ihm gestanden, daß er und Nerval an derselben Krankheit litten:
»Wir sangen beide die Hoffnungslosigkeit einer Jugendliebe tot, wir singen noch immer und sie stirbt doch nicht!«
Das, so weiß man, betrifft Amalie, die Cousine, die Tochter des Millionärsonkels Salomon, die Lebensliebe. Oder Lebenslüge?
Es geht hier nicht darum herauszubohren, in welcher Mitte die Wahrheit liegt zum Thema »Heine und die Frauen«, zwischen Grabbes Verdikt etwa, Heines Poesie seien keine Gedichte, sondern »Abwichsereien eines Thee-Titanen«, der eigenen Renommiererei und dem bittersten, deshalb vielleicht aufrichtigsten Fazit am Ende seines Lebens: »Wirklich geliebt habe ich nur Tote oder Statuen.«
Es geht vielmehr um simple Tatsachen. Als Heines berühmter Seufzer »sie liebt mich nicht« erklang, kannte er Amalie knapp drei Monate. Keineswegs »im wunderschönen Monat Mai« war in seinem »Herzen die Liebe aufgegangen« – Amalie war erst im August 1816 nach Hamburg gekommen. Der Brief an Sethe stammt aus dem November. 18 Monate zuvor hat Heine ihrer Schwester Friederike ins Stammbuch geschrieben:
»Holde Mädchen geben’s viele; doch nur eine Rika. So müssen die Engel seyn … Ach! Laß mich kommen ins Himmelreich, o Herr! Wo solche Engel sind.«
Fast neun Jahre danach ist es die nächste Schwester, Therese – vermutlich die »Evelina« der Widmung des »Buch le Grand«, dessen Motto lautet »Sie war liebenswürdig, und er liebte sie; er aber war nicht liebenswürdig, und sie liebte ihn nicht«. Da war das alles lange her, fast so lange wie diese Erinnerung an seine »Marie A.«, deren spöttische Distanziertheit nicht nach Verklärung klingt, sondern einer Erklärung gleicht:
»Ich bin im Begriff diesen Morgen eine dicke Frau zu besuchen, die ich in 11 Jahren nicht gesehen habe, und der man nachsagt ich sey einst verliebt in sie gewesen. Sie heißt Me. Friedländer aus Königsberg, so zu sagen eine Cousine von mir. Den Gatten ihrer Wahl hab ich schon gestern gesehen, zum Vorgeschmack. Die gute Frau hat sich sehr geeilt und ist gestern just an dem Tage angelangt, wo auch die neue Ausgabe meiner ›jungen Leiden‹ von Hoffman & Campe ausgegeben worden ist. – Die Welt ist dum und fade und unerquicklich und riecht nach vertrockneten Veilchen.«
Nein, der un-erhörte Zehn-Wochen-Flirt war nicht Heines Lebensmitte noch Lebenswunde. »Ja, wenn die weitklaffende Todeswunde meines Herzens sprechen könnte, so spräche sie: ich lache.« Diese jungen Damen in ihrer schloßartigen Villa an der Elbe waren Kunstfiguren, zierliche Püppchen auf einem Karussell; der Motor, der es antrieb, saß anderswo. Rudolf Walter Leonhardt sieht das in seiner Studie klar:
»Während das rote Sefchen in den ›Memoiren‹ so beschrieben wird, daß man es nach der Beschreibung zeichnen könnte, erstarren die Cousinen zu Klischees von Mädchen mit roten Mündchen, mit Äuglein süß und klar. Es steht zu fürchten, daß sie viel von dem zuweilen arg auf die Geschmacksnerven gehenden Tandaradei der Diminutive im ›Buch der Lieder‹ unschuldig genug zu verantworten haben.«
War es eher das Palais in Hamburg-Ottensen, dem Heinrich Heines Liebe galt? Zweierlei ist über jeden Zweifel erhaben: in jenen Jahren versuchte Heine – der sich dem anglophilen Hamburg zuliebe auch Henry nannte –, koste es was es wolle, Boden unter die Füße zu bekommen. Und wenn er je einen Menschen außer seiner Mutter geliebt hat, dann war es der Mann, der ihm dazu verhelfen konnte: Salomon Heine; zu ihm hatte er die spannungsreichste Beziehung seines Lebens, voll glühender Leidenschaft und mit kaltem Haß, voll Neid, Bewunderung und Verachtung, wie sie nur eingebettet in eine starke Emotion entstehen kann. Über-ich und Über-Vater. Verwandter und Antipode. Die einzigen Tränen, die Heine je wirklich geweint, vergoß er allerdings nicht bei dessen Tode, sondern bei der Nachricht, daß er im Testament nahezu übergangen worden sei:
»… fiel ich ohnmächtig nieder und Mathilde mußte mir mit Essig die Schläfe reiben und um Hülfe rufen …«
Aber der Satz »Dieser Mann spielt eine große Rolle in meiner Lebensgeschichte und soll unvergeßlich geschildert werden« ist so gewiß ehrlich gemeint wie der hochfahrend-wütende Satz »Das Beste, was an Ihnen ist, besteht darin, daß Sie meinen Namen tragen«. Sottisen und spitze Stiche gingen ein Leben lang zwischen Onkel und Neffen hin und her; ob ein genüßliches »Aber, ohne Schmeichelei, Henry, der Platen hat dir gut getrefft« oder ein schnippisches »Lieber Onkel, geben Sie mir 100000 Mark und vergessen Sie auf ewig Ihren Sie liebenden Neffen Heinrich Heine«. Selbst der Brief des Onkels während eines Parisbesuchs, in dem auch belobigt wird, »Deine Frau hatt sich gut aufgeführt … ist ein gutes Schicksche …«, liest sich zwar bizarr, aber eher frozzelnd als bösartig:
»An den Mann, der gefunden, daß das Beste was an mir ist, daß ich sein Name führe –
Hamb. den 26. (Dez.) 1843
Heute Mittag den zweite Tag Jontoff, wird gegessen:
Krebser Suppe, mit Rosinen theilweise in die Krebsen – Das edle Ochsen Fleisch der Hamburger – Geräuchertes Fleisch – dabei Karstanien – noch Gemüse – Englischen Buding, mit Feuer – Fasanen, 2 Stück – ein Hase, der wirklich von – meine Leute im Garten geschossen ist. – Salat, Musgadchens, hatt oder – wird schon mehrere aufsetzen, – Champanir, Port wein Mad. wein – und guten Rothwein. Dann wird die hohe Famillie mit ihre Gegenwart das Teater besuchen.«
Gemeinhin hat sich die Heine-Biographienschreibung darauf geeinigt, das Klischee vom armen Dichter zu übernehmen, den der steinreiche Onkel – und der Verleger – haben halb verhungern lassen. Wobei immerhin die Frage erlaubt sein muß, wieso eigentlich ein Onkel Zeit seines Lebens »unterhaltspflichtig« ist – noch dazu einem Neffen, der entgegen der selbstfabrizierten Mythe keineswegs mittellos war. Gleichwohl unterstützte Salomon Heine fast sein ganzes Leben hindurch die gesamte Familie seines Bruders, Heines Vaters. Der war ja eher, was man heute einen drop-out nennen würde, damals einen Tunichtgut nannte, dem seine energische Frau beispielsweise den Unterhalt sinnloser und teurer Reitpferde verbieten mußte:
»Samson hatte neben seinem Manchester noch viele andere Passionen: Karten und Schauspielerinnen, Pferde und Hunde und das Soldaten-Spiel. …
Samson Heine liebte das Militär: als klingende Wachtparade, als klirrendes Wehrgehenke, als straff anliegende Uniform.«
Wie auch immer – Salomon Heine zahlte, als sein Bruder Samson bankrott machte; zahlte den Umzug und Unterhalt der gesamten Familie; als Samson zusammenbrach, zahlte er seiner Schwägerin, Heines Mutter, 31 Jahre lang eine Witwenpension; zahlte für alle drei Neffen das Studium [Jura, Medizin, Landwirtschaft] – Harry verfügte während seines Studiums über einen recht großzügigen Wechsel von ca. 20000,– DM jährlich; zahlte, als sowohl Harry wie sein Bruder ihre vom Onkel finanzierten Geschäfte in den Bankrott steuerten.
Vom Standpunkt des reichen selfmademan war wohl die skurrile Bemerkung »Wenn der dumme Junge was gelernt hätte, brauchte er nicht zu schreiben Bücher« zu verstehen; Heine quittierte derlei mit höhnischer wie lachender Bestätigung:
»Ich trete bei ihm ein, umarme ihn; er bittet mich Platz zu nehmen, wir plaudern. ›Nun, mein lieber Neffe, du tust immer noch nichts in Paris?‹ – Pardon, lieber Onkel, ich schreibe Bücher. – ›Na also, ich sagte es ja: Du tust immer noch nichts.‹
Bei diesen Worten lachte Heine aus vollem Halse. ›Das Komischste dabei ist: mein Onkel hat recht‹, fuhr er fort. ›Hol mich der Teufel, wenn man heute wieder eine Ilias schriebe, täte man in der Tat nichts. Man wäre ein blöder Tor.‹«
Vom Standpunkt des Künstlers wiederum, der – zu Recht – annahm, des Namens Heine werden Generationen sich dereinst jedenfalls nicht des Bankiers Salomon wegen erinnern, waren es eher klägliche Wechsel. Heine verdiente viel Geld – aber er verbrauchte mehr. Nicht erst in Paris, wo der Champagner floß, Mathilde nur in die teuersten Restaurants geführt wurde und ein Kleid den »Lohn« eines Poems kostete.
Trotzdem nannte er seinen Onkel einen bedeutenden Menschen,
»… der bey großen Gebrechen auch die grösten Vorzüge hat. Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, fast mehr als ich selbst weiß. Wir haben auch in Wesen und Charakter viel Aehnlichkeit. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gemüthsweichheit und unberechenbare Verrücktheit – nur daß Fortuna ihn zum Millionär, und mich zum Gegenteil, d.h. zum Dichter gemacht, und uns dadurch äußerlich in Gesinnung und Lebensweise höchst verschieden ausgebildet hat.«
Es war sicherlich keine »Zensur«, die ihn eine sogar milde Bosheit gegen den »Griesgram« im »Wintermärchen« von der handschriftlichen zur Druckfassung mildern ließ. Die Disproportion zwischen dem Riesenvermögen und den gelegentlichen Dotationen des Onkels allerdings ist in der Tat beträchtlich; er stiftete zwar für allerlei Taubstummen-, Blinden- und Krankenanstalten, richtete gar das Hamburger Israelitische Krankenhaus ein (was Heine in einem schwachen Dankbarkeitspoem vermerkte) –, aber die damit verglichen immer noch gigantischen Beträge des Vermächtnisses von insgesamt 30 Millionen Mark – je 900000 Taler für jeden Haupterben, aber 1000 Taler für eine Blindenanstalt – lassen an jene »bürgerliche Wohltätigkeit« denken, die wir aus einem anderen Gedicht kennen:
»Sieh! Da steht das Erholungsheim
einer Aktiengesellschafts-Gruppe;
morgens gibt es Haferschleim
und abends Gerstensuppe.
Und die Arbeiter dürfen auch in den Park …
Gut. Das ist der Pfennig.
Aber wo ist die Mark –?«
Doch für den mittellosen jungen Poeten hatte all das ja noch eine andere Verlockung. Nicht nur ging es um Pferd und Wagen, Bälle, »Champanir«, Villa und Stadtpalais. Das betrachtete Heine ganz offensichtlich mit abwesender, gar abweisender Ironie.
Die andere Verlockung: dies war eine, nein: die erfolgreichste, mächtigste Form der Emanzipation. Hier lag das Faszinosum. Wir haben gesagt – Amalia hin, Therese her –, daß Heinrich Heine Boden, gesellschaftlichen Boden unter die Füße bekommen wollte, um jeden Preis. Er war begabt, er war jung, er wollte seinen Platz auf dieser Welt. Aber er war Jude. Selbst in Hamburg – das noch besser dastand als Frankfurt – wurde der Kampf gegen die Gleichberechtigung der Juden erbarmungslos geführt. Zwar war Hamburg durch Napoleonisches Dekret vom 10. Dezember 1810 in das französische Kaiserreich »eingemeindet«. Die Hamburger Juden erhielten, wie es für ihre französischen Glaubensgenossen selbstverständlich war, die volle bürgerliche und politische Gleichberechtigung (womit übrigens ihre eigene Gesetzgebung für Familien- und Erbrecht erlosch). Aber kaum war Napoleon gestürzt, war es auch mit diesen Freiheiten zu Ende. Noch im Archivexemplar einer Dissertation, in der die Verbitterung der jüdischen Bevölkerung angesichts ihrer Beteiligung an den Freiheitskriegen und ihrer Benachteiligung danach referiert wird, hat sich ein Anonymus unserer Tage mit einem Bleistift-Fragezeichen verewigt. Aber man muß nicht in die ferne Gegenwart schweifen. Im Jahre 1835 führte eine Denkschrift des Redaktionsmitglieds Rießer der Hamburger Börsenhalle, in der bescheiden die Zulassung der Juden zum Handwerk und zur Advokatur erbeten wurde, zu Exzessen. Der Kaffeewirt der »Alsterhalle« erhöhte den Preis seines Kaffees für jüdische Gäste um das 15fache und ließ sie schließlich durch sein Personal aus dem Restaurant werfen. Es kam zu einem Pogrom, zu Plünderungen und Verhaftungen (der Juden!). Beschlußfassungen über eine etwaige Verbesserung der jüdischen Bürgerrechte vertagte der Senat. Das Palais eines stadtbekannten Wohltäters wurde übrigens verschont; wer hat darin gewohnt?
Weitaus schlimmer sah es etwa in Frankfurt aus. Anfang des Jahrhunderts waren die Juden in ein baumloses Ghetto eingesperrt, sie durften sich auf keinem Wall, in keiner Grünanlage sehen lassen. Sonntags ab 16.00 Uhr wurde das Ghetto zugesperrt, und das Tor durfte nur passieren, wer nachweislich zur Post oder zur Apotheke mußte. Genau 24 Juden durften pro Jahr heiraten. Auch hier brachte das Jahr 1810 eine Änderung – für den Betrag von 450000,– Gulden war der Fürstprimas von Daibers zu einem Vertrag bereit, der das volle Bürgerrecht gewährte. Kaum war die Stadt durch die Verbündeten befreit, entzog man die teuer erkauften Rechte (und behielt das Geld).
Eine 1815 eingereichte Rechtsklage an den neu eingesetzten Bundestag brachte nach 9jähriger Verhandlung einen Teilerfolg. Noch 1831 konnte Ludwig Börne spotten:
»Merkwürdige Dinge sollen ja in Frankfurt wegen der Juden vorgehen. Ist es wahr, daß die Wittwer und Wittwen sollen heirathen dürfen, so oft und sobald sie Lust haben? Ist es wahr, daß Juden und Christen sollen Ehen unter einander schließen dürfen, ohne weitere Ceremonien? Ist es wahr, daß der Senat dem gesetzgebenden Körper den Vorschlag gemacht, die Juden den christlichen Bürgern ganz gleich zu stellen, und daß von 90 Mitgliedern nur 60 dagegen gestimmt? Das wäre ja für unsere Zeit eine ganz unvergleichliche Staats-Corporation, die unter 90 Mitgliedern nur 60 Dumme zählte. Ein ganzes Drittheil des gesetzgebenden Körpers hat dem Geiste der Zeit unterlegen; das ist ja ärger als die Cholera morbus – werden die alten Staatsmänner jammern!«
Diese Philippika hat ihre nahezu wörtliche Entsprechung im »Atta Troll«:
»Ja, sogar die Juden sollen
Volles Bürgerrecht genießen
Und gesetzlich gleichgestellt sein
Allen andern Säugetieren.«
Und Berlin, das freie, große Berlin, Treffpunkt liberaler Geister?