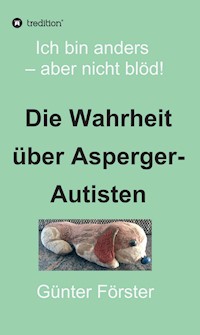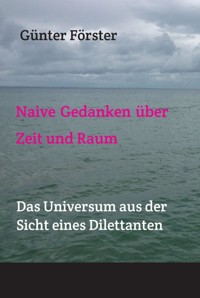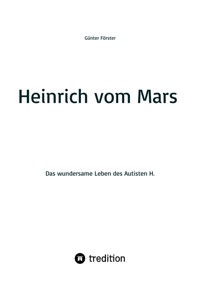
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich vom Mars, ist eine Fantasiegeschichte, gespickt mit historischen Wahrheiten. Auch Persönlichkeiten die wirklich gelebt haben sich involviert. Ihre Handlungen sind teilweise wahr, teilweise frei erfunden. So scheint es auch bei den wundersamen Erlebnissen Heinrichs zu sein, der zwischen den beiden Weltkriegen im hessischen Erzhausen nahe Darmstadt zur Welt kommt. Schon bald stellt sich heraus, dass der Junge anders ist als die andern. Während er oft einfache Dinge nicht versteht, erbringt er bei seinen speziellen Interessen wahre Meisterleistungen. Mit anderen Kindern will er möglichst wenig zu tun haben. Lieber beobachtet er stundenlang Erwachsene bei ihrem Tun. Mit fünf erzählt er zum ersten Mal, dass er eines Tages auf dem Mond spazieren gehen will. Dieser Wunsch begleitet ihn sein ganzes Leben und wird dabei immer stärker und selbstverständlicher. Auch als er später versteht, dass der Mond absolut unbewohnbar ist, tut er so, als würde dieses Problem gar nicht existieren. Und tatsächlich erzählt Heinrich von angeblichen Erlebnissen, die normalerweise unmöglich sind. Im Laufe der Zeit scheinen sich seine Behauptungen allerdings tatsächlich zu bestätigen. Eines Tages findet sich Heinrich in einer fremden Welt wieder. Doch nicht, wie er es sich schon so lange gewünscht hatte, auf dem Mond. Auf der Erde ist er aber ebenfalls nicht. Heinrich ist auf dem Mars! Doch kann das wirklich sein? Oder sind es nur Fantasievorstellungen des jungen Autisten Heinrich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Auch von Günter Förster erschienen:
Naive Gedanken über Zeit und Raum
Das Universum aus der Sicht eines Dilettanten
Die Wahrheit über Asperger-Autisten
Ich bin anders – aber nicht blöd!
Für Karin
Günter Förster
Heinrich vom Mars
Das wundersame Leben des Autisten H.
© 2024 Günter Förster
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-384-09355-4
Hardcover
978-3-384-09356-1
e-Book
978-3-384-09357-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Das dauert noch (Sommer 1930)
Heinrich allein im Laden (Sommer 1935)
Zwei Kaiser beim Studieren (1920er bis 1930er Jahre)
Der Wauwau (1935)
Das unheimliche Etwas (29. Mai 1966)
Zur falschen Zeit am falschen Ort (1. Juni 1966)
Traurige Zeiten (Sommer 1942)
Wien (Ende Mai 1942)
Wauwaus Grab
Lieschen
Artur war wütend (Oktober 1966)
Warmer Sommerregen (Spätsommer 1942)
Der Rote Blitz (September 1944)
Am Hahnwiesenbach (Nachmittag des 12. September 1944)
Wo ist Lieschen?
Die unmögliche Möglichkeit
Brandnacht (Nacht vom 11. auf den 12. September 1944)
Der Atomkeller (1945)
Von ganz oben (September 1944)
Der Ortspolizist
Die zweite Sichtung (3. August 1945)
Wolfgangs Fußball (Freitag, der 22. November 1946)
Ratlosigkeit
Der Porträtist (Montag, der 30. Juni 1947)
Apfel-Gin (2329)
Einmal München und zurück (Juli 1947)
Die Münze
Carrera 6
Eine eigene Abteilung
Der Wonneproppen (28. Februar 1967)
Der Saustall (1949)
„Ferry“ Porsche (1950)
Wer ist Herr Schmidt (1951 – 1952)
Montag, der 15. Dezember 1952.
Bernhard
Die Besprechung (Anfang 1953)
Der Wurf (1953)
Erscheinungen (1953 bis 1969)
Lieschen geht (1953 bis Oktober 1957)
Arturs Wunsch (Sommer 1969)
Die Nachricht (Mitte November 1957)
Die Zeichnung (1966)
Späte Einsicht (Spätsommer 1969)
GSI (1969 bis 2029)
Der Versuch (Montag, der 11.06.2029)
Jenischpark (29.03.2329)
Entwicklungen
Wichtige Personen
Wichtige Ereignisse
Heinrich vom Mars
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Das dauert noch (Sommer 1930)
Wichtige Ereignisse
Heinrich vom Mars
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Das dauert noch (Sommer 1930)
„Der hat ja die Nabelschnur um den Hals!“, sagte die Hebamme. Dann war es ein paar Sekunden still.
Es war ein Sommertag im Jahre 1930. Seit fünf Stunden war die Hebamme nun schon bei Gerlachs. Elisabeth hatte am Morgen um halb acht nach ihr rufen lassen, weil sie nervös wurde und über Wehen klagte. Ihr Mann Franz lief sogleich die gut dreihundert Meter die Straße hinunter. Es war schon recht schwül an diesem Morgen. Die Sonne schien und der Boden dampfte. Es hatte heftig geregnet in der Nacht, sodass die Straße mit zum Teil tiefen Pfützen übersät war. Wollte man nicht hineintreten, musste man einen Zickzackkurs gehen. All das interessierte Franz nicht. Vielleicht hatte er es nicht einmal bemerkt. So wie die Tatsache, dass er in seinen alten Hausschlappen unterwegs war, und geradewegs die Straße entlang stampfte, notfalls auch durch die Pfützen hindurch. Er musste schnellstmöglich zur Hebamme, nur das zählte!
Am Haus der Hebamme angekommen, hämmerte er mit der Faust an die Haustür. Weil nicht sofort jemand öffnete, trommelte Franz ein weiteres Mal gegen die Tür, diesmal noch eine Spur energischer.
Endlich waren von innen Stimmen zu hören. Gernot, der Ehemann der Hebamme, öffnete die Haustür, deren lichte Öffnung der große, übergewichtige Mann fast vollständig ausfüllte. Hinter ihm stand Wilhelma, die Hebamme. Sie hatte eine Kittelschürze an, während Gernot noch im Schlafanzug herumlief. Noch bevor die beiden etwas sagen konnten, brach es aus dem aufgeregten Franz heraus: „Es geht los, Wilma muss mit mir kommen, Liesbeth hat schon Wehen, das Kind kommt gleich. Bitte nimm deine Sachen Wilma und komm schnell zu uns mit.“
Die beiden ließen sich von Franz’ Hektik nicht beirren. Während sich Wilhelma in aller Ruhe fertig machte, zog Gernot Franz in die Küche. Dann holte er seinen selbstgebrannten Zwetschgenschnaps und drei Gläser hervor. „So Franz, jetzt beruhigst du dich erst einmal und trinkst einen Schnaps mit uns. Die Wilma hat schon einige hundert Kinder geholt, und zu spät gekommen ist sie meines Wissens noch nie. Sie weiß schon was zu tun ist, zum Wohl.“
„Aber so früh am Morgen …“, wollte Franz protestieren.
„Keine Widerrede, trink!“ Gernot schob ihm eines der drei Schnapsgläser hin.
„Na gut.“
Beide Gläschen wurden rasch geleert, das dritte blieb für Wilhelma unberührt stehen.
Sie hatte ihre Hebammentasche geholt und sich abmarschbereit gemacht und trat nun ebenfalls in die Küche. Gernot füllte die beiden geleerten Gläser erneut und Franz wollte wieder protestieren. Jetzt war es Wilma, die meinte: „Stell dich nicht so an Franz. Einen Schnaps zur Beruhigung und dann ab zu Liesbeth!“ Diesmal wurden alle drei Gläser geleert, und als sich die Hebamme mit Franz sogleich auf den Weg machte, schloss Gernot hinter den beiden die Haustür und gönnte sich noch ein letztes Gläschen, bevor er sich noch ein paar Minuten aufs Ohr haute.
Beim Haus der Gerlachs angekommen sah die Hebamme sogleich nach der hochschwangeren Elisabeth, der anzumerken war, dass Sie über die Ankunft der beiden sehr erleichtert war.
„Das dauert noch“, sagte die Hebamme nach einer ersten Untersuchung zu Elisabeth. „Ich kann noch zwei Stunden nach Hause gehen, mit Gernot ausgiebig frühstücken und ein paar Dinge erledigen. Vor zehn Uhr werde ich hier nicht gebraucht.“ Zu Franz gewandt meinte sie weiter: „Bis dahin kannst du bei deiner Frau bleiben und ihr beistehen, das reicht derweil. Und den Herrn Doktor den holen wir erst dazu, wenn ich wieder da bin. Dann entscheide ich, wann er dabei sein soll, nur so zur Sicherheit.“
Damit waren Gerlachs nun beide überhaupt nicht einverstanden. Franz behauptetet gleich in die Metzgerei zu müssen, und Liesbeth war davon überzeugt, unmittelbar vor der Niederkunft zu stehen. „Um Himmels Willen, du kannst doch jetzt nicht heimgehen frühstücken“, entfuhr es Franz entsetzt. „Lass mich nur schnell was anziehen, dann richte ich uns ein reiches Frühstück. Wir haben echten Bohnenkaffee und gestern hatten wir Schlachtung - die frischen Leberwürste … ohh, bleib. Du wirst es nicht bereuen. Und für den Gernot gebe ich dir nachher noch ein paar Würste mit heim!“
Wilma musste innerlich schmunzeln und hätte fast laut losgelacht. Das war ja wieder mal klar, so ist es immer. Die Leute wollen sie als Hebamme, weil sie schon seit über drei Jahrzehnten fast alle Kinder in Erzhausen und Umgebung geholt hatte. Es waren mittlerweile mehr als tausend! Wenn jemand sein Handwerk verstand, dann war sie es. Jeder Hausarzt, der zu einer Geburt gerufen wurde, war froh und erleichtert, wenn Wilma als Hebamme fungierte. Aber wenn sie den werdenden Eltern mitteilte, dass sie viel zu früh gerufen wurde, und sie nochmal für ein paar Stunden verschwinden könnte, dann wussten plötzlich alle werdenden Eltern, dass sie sich täuschen musste, und keinesfalls mehr von der werdenden Mutter weichen durfte, bis das Kind auf der Welt ist. War es das erste Kind, so wie bei Elisabeth, so machte dies die Anspannung der werdenden Eltern nur noch größer.
Außer ihrer enormen fachlichen Kompetenz und Erfahrung, hatte Wilhelma auch eine unbeschreiblich lockere und liebenswerte Art. Aus diesen Gründen war sie weit über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt, nicht zuletzt durch ständige Weiterempfehlungen. Sie hatte sogar schon bei wohlhabenden Städtern gearbeitet. Dutzende Male in Darmstadt, aber sie wurde auch schon nach Wiesbaden und Mainz gerufen.
Erst neulich wurde sie sogar von einer reichen Kaufmannsfamilie nach Frankfurt verpflichtet. Der Kaufmann ließ sie täglich mit seinem Automobil abholen. Der fast neue Opel Regent hatte einen Achtzylinder-Reihenmotor mit 5.972 cm3 Hubraum. Der Motor basierte auf einem Rennmotor von 1921. Der Kaufmann ließ das Fahrzeug gegen 1.000 Mark Aufpreis als Sonderwunsch mit dem von Opel angebotenen zuschaltbaren Schnellgang von Maybach ausstatten. Damit hatte der Wagen effektiv sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge. Die Höchstgeschwindigkeit erhöhte sich dadurch auf 130 Kilometer pro Stunde!
Es war die tägliche Attraktion in dem kleinen Ort, wenn die Hebamme morgens abgeholt und abends wieder gebracht wurde. So mancher Mann hätte nur allzu gerne einmal eine Probefahrt mit dem Regent gemacht. Obwohl damals noch kaum ein Mann die von Kaiser Wilhelm II im Jahre 1909 eingeführte landesweit gültige Fahrerlaubnis besaß.
Das ging so über eine Woche lang. Danach hielt die Hebamme eine baldige Niederkunft für möglich. So wurde ihr in der Villa des Kaufmanns ein Zimmer gerichtet, damit Sie bis zur Geburt bleiben konnte. Selbstverständlich wurde sie auch zu den Essenszeiten mit zu Tisch gebeten, und auch sonst gab es keinerlei Entbehrungen, im Gegenteil. Es dauerte dann noch weitere fünf Tage, bis das neue Familienmitglied begrüßt werden konnte. Ein prächtiger Junge. Die Geburt verlief reibungslos und schnell, ohne jede Komplikation.
An all das hatte sich Wilma schlagartig erinnert, als ihr Franz das reichhaltige Frühstück mit echtem Bohnenkaffee in Aussicht gestellt hatte. Sie hatte noch nichts gefrühstückt an diesem Morgen, und so war das Angebot vom werdenden Vater genau das, was die Hebamme jetzt hören wollte. Sie beabsichtigte ja auch gar nicht ernsthaft nochmal eine Weile nach Hause zu gehen, aber das brauchten Gerlachs natürlich nicht zu wissen.
So wurde das reichhaltige Frühstück aufgetischt, wobei Franz nicht zu viel versprochen hatte. Die drei frühstückten gemeinsam und dann legte sich Elisabeth wieder um und bekam in unregelmäßigen Abständen Vorwehen. Franz verkroch sich in der Wurstküche, wo er angeblich viel zu tun hatte. Den Metzgerladen hatte er heute zu gelassen und ein selbstgeschriebenes Schild, Wegen Geburt heute geschlossen, an der Ladentür befestigt. Gegen elf Uhr schickte die Hebamme Franz zum Doktor, mit der Bitte in einer viertel Stunde da zu sein. Als die beiden pünktlich im Haus der Gerlachs ankamen, verzog sich Franz wieder in die Metzgerei. Als Metzger war er sicher nicht zimperlich und war es gewohnt reichlich Blut zu sehen. Aber eine menschliche Geburt war etwas ganz anderes. Er konnte die Schreie seiner in den Wehen liegenden Frau kaum ertragen. Diese wurden lauter und die Abstände kürzer, und Franz war überzeugt, dass die Zeit heute viel langsamer verging als an allen anderen Tagen.
Um halb eins öffnete sich der Muttermund, und die Schädeldecke des Kindes war für einen Augenblick sichtbar. „Feste pressen!“, feuerte die Hebamme die werdende Mutter an. Liesbeth presste, was das Zeug hielt, aber es reichte nicht. Bei der darauffolgenden Wehe hörte die Schwangere nicht auf zu schreien. Sie schien das Baby regelrecht heraus brüllen zu wollen – und es klappte! Es ging alles sehr schnell. Dieses Mal kam das Kind in einem Flutsch heraus. Ein paar helfende Handgriffe und Anweisungen der Hebamme …
„Der hat ja die Nabelschnur um den Hals!“, sagte die Hebamme. Dann war es ein paar Sekunden still. Die frischgebackene Mama schrie nicht mehr. Arzt und Hebamme schwiegen, und Vater Franz kauerte auf einem Hocker in der Wurstküche. Die Hebamme machte in geübtem Ablauf die Nabelschnur vom Hals, legte sich das blutverschmierte Kind auf den einem Arm, gab ihm mit der freien Hand einem Klaps auf den Po – und sogleich holte das Baby tief Luft und fing lauthals an zu schreien!
„Ein Bub, es ist ein Bub!“, sagte die Hebamme als Nächstes. Nachdem die Nachgeburt herauskam, legte Wilhelma den Jungen erst einmal bei Elisabeth auf den Bauch. So sahen sich das neugeborene Kind und seine Mama zum ersten Mal gegenseitig in die Augen. Als die Babyschreie die Wurstküche erreichten, hielt es Franz nicht mehr aus und eilte zu den anderen. Mit Freudentränen in den Augen sah er zu, wie die Hebamme das Kind wusch und dann in ein trockenes Tuch wickelte. Nun konnte er es plötzlich kaum abwarten seinen Heinrich – so würde sein Sohn heißen – endlich in die Arme zu nehmen. Franz lies die Metzgerei an diesem Tag geschlossen, kümmerte sich liebevoll um seine Frau, und vergaß auch nicht, der Hebamme die versprochenen Würste für ihren Mann mitzugeben.
Heinrich allein im Laden (Sommer 1935)
Die Jahre vergingen und der kleine Heinrich wuchs heran. Seine ersten Lebensjahre waren unauffällig und normal. Er lernte in angemessener Zeit laufen und sprechen, wenngleich er nur sprach, wenn es unbedingt sein musste. Als der Junge vier oder fünf war, fiel den Eltern jedoch auf, dass er manchmal unbeholfen wirkte. Seine grob- und feinmotorischen Koordinationsfähigkeiten schienen ungeschickt. In Gesprächen vermied er Blickkontakt. Am meistens wunderte sich seine Mutter damals jedoch darüber, dass der keine Heinrich offensichtlich kaum Interesse daran hatte, mit Gleichaltrigen zu spielen. Wenn Elisabeth die Möglichkeit hatte sich mit anderen Müttern und deren Kindern zu treffen, wollte Heinrich stets viel lieber bei den Erwachsenen sein, oder er verkroch sich allein in eine Ecke, bis es endlich wieder heimging.
Franz überlegte immer wieder, ob Heinrich ein Geschwisterchen bekommen sollte. Vielleicht würden die Leute sonst reden, denn welches Ehepaar hatte nicht mindestens drei oder mehr Kinder. Andererseits war sich Elisabeth unsicher. Sie war schon bei Heinrichs Geburt über dreißig Jahre alt. Eigentlich zu alt, um weitere Kinder zu bekommen. Außerdem – was störte ihn das Gerede der Leute. Immerhin war sein Kind ein Junge. Somit war für die Übernahme der Metzgerei gesorgt. „Metzgermeister Heinrich Gerlach“! Franz würde stolz sein auf seinen Sohn! Und so gab es keinen Grund, über weiteren Nachwuchs nachzudenken.
Doch manchmal hatte Franz Zweifel. Irgendwas stimmte nicht mit dem kleinen Heinrich, aber keiner wusste, was das genau war. Auch Wilhelma und der Hausarzt wussten nichts. Nur so viel: Heinrich hatte ein paar Besonderheiten. Nicht nur, dass er den Kontakt mit anderen Kindern mittlerweile regelrecht ablehnte, immer noch Blickkontakt mied und wenig sprach. Er lehne es auch ab, Fleisch zu essen, mit der Begründung es würde sich im Mund komisch und unangenehm anfühlen. Das ärgerte Franz bisweilen sehr. Wusste er doch, dass seine Frau nur bestens Fleisch aus der eigenen Metzgerei zubereitete, welches er persönlich hergestellt hatte. Wenn er den Jungen diesbezüglich zur Rede stellte, schaute der ihm bei seinen knappen Antworten noch nicht einmal in die Augen. An sich wäre die Sache kein Problem gewesen, aber wie sollte Heinrich später den Kunden hochwertiges Fleisch verkaufen, wenn es selbst davon überzeugt war, es würde nicht schmecken und sich im Mund komisch anfühlen?
Um die Zeit von Heinrichs Geburt herum, gab es eine Wirtschaftskrise weltweiten Ausmaßes. Diese Krise dauerte ungefähr drei Jahre lang. Auch Deutschland versank damals in Arbeitslosigkeit und politischem Chaos. Gerlachs ging es aber relativ gut. Franz machte gute Arbeit zu fairen Preisen. Er war auch bei den Leuten dafür bekannt, sich notfalls mit einem Teil der Wurst- und Fleischwaren bezahlen zu lassen, wenn die finanzielle Situation der Schweinebesitzer, die ihre Tiere zur Schlachtung zu ihm trieben, nicht mehr hergab.
Am liebsten spielt Heinrich im Alter von ungefähr fünf Jahren Metzgersfrau. Zuerst dachte sich seine Mutter nichts dabei. Sie war sicher, dass sich das Interesse an diesem Spiel bald verlieren würde. Aber es wurde immer wichtiger für Heinrich. Egal ob draußen die Sonne schien und die Vögel sangen, oder ein warmer Regen zum Pfützenhüpfen einlud. Ob andere Kinder auf der Straße Suchen, Fangen oder Ball spielten – Heinrich interessierte das alles nicht. Er verbrachte täglich Stunden im Metzgerladen. Dabei beobachtete er ganz genau seiner Mutter und die Kunden, und lauschte jeder Bewegung und jedem gesprochen Wort ganz genau.
Wenn keine Kunden da waren und seine Mutter den Laden verließ, um andere Arbeiten im Haus zu erledigen, bis die Ladenglocke wieder läutete, weil der nächste Kunde das Geschäft betrat, blieb Heinrich allein im Laden zurück. Er hatte ein kleines Kinderstühlchen, das längst einen festen Platz hinter der Theke bekommen hatte. Dort saß der Junge fast täglich stundenlang. Während seine Mutter die Kunden bediente, wurden oft anregende und ausdauernde Gespräche geführt. Heinrich wurde einfach nicht müde, das Geschehen unaufhörlich zu beobachten. Dabei nuschelte er oft lange Monologe vor sich hin. Allerdings so leise und undeutlich, dass kein Wort zu verstehen war.
Eines Tages staunte Elisabeth nicht schlecht. Sie wollte endlich einmal wissen, was der Junge machte, wenn er so lange allein im Laden war. Sie öffnete die Verbindungstür zum Laden deswegen ganz vorsichtig nur einen kleinen Spalt. Da sah sie, dass der keine Heinrich nicht mehr auf seinem Kinderstuhl saß, sondern hinter der Theke stand, genau dort, wo sie normalerweise bediente.
Der Junge sagte: „Klingeling – Guten Morgen, Frau Sandner – Morgen, Frau Gerlach – Was darfs denn heute sein, Frau Sandner? …“
Und dann folgte ein kompletter nachgesprochener Dialog, genau so, wie er vor ein paar Tagen zwischen ihr und Dorothea Sandner bei deren Einkauf entstanden war. Bevor der nächste Kunde den Laden betrat, konnte sie drei weitere Gespräche zwischen ihr und Kunden belauschen, die Heinrich nachsprach. Dabei war sie sich sicher, dass der Junge die Gespräche vollständig und korrekt nachgesprochen hatte. In ihrer Erinnerung hatte er weder etwas hinzugefügt noch etwas weggelassen. Als der nächste Kunde den Laden betrat, unterbrach der Junge sein Spiel abrupt, eilte auf sein Stühlchen, und wartete schweigend, bis seine Mutter zum Bedienen in den Laden kam.
Elisabeth würde über Heinrichs Verhalten bei nächster Gelegenheit mit ihrem klugen Bruder Karl sprechen. Sie erwartete seinen Besuch in wenigen Tagen.
Zwei Kaiser beim Studieren (1920er bis 1930er Jahre)
Liesbeth hatte vier Geschwister. Drei ältere Schwestern und den Bruder Karl. Karl war das Nesthäkchen der Familie und fast fünf Jahre jünger als Elisabeth. Sie bemerkte schon früh, dass Karl ganz besonders klug war. Er war ein ausgesprochen guter Schüler. Wenn er wieder eine Eins bekommen hatte, nannte sie ihn im Spaß oft, arroganter kleiner Klugscheißer. Dabei war er kein bisschen arrogant. Im Gegenteil war er stets bescheiden und hilfsbereit. Das wusste natürlich auch Elisabeth, und er wusste, dass sie es wusste, und ihr Spruch nur Spaß sein sollte. Aus Karl würde einmal etwas werden, das wusste Elisabeth. Und so kam es dann auch.
Das Lernen fiel Karl stets leicht und machte ihm große Freude. Zwar war er in allem Fächern gut, aber die Naturwissenschaften hatten es ihm besonders angetan. Biologische, physikalische und chemische Vorgänge waren in seinen Augen Gesetzmäßigkeiten aus dem Zauberkasten Gottes, wie er es gerne nannte. In diesen Fächern war er immer Klassenbester. So wunderte sich auch keiner, als er auf das Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt wechselte, wo er im Jahr 1920 ein exzellentes Abitur machte.
Das Interesse an den Naturwissenschaften war bei Karl immerwährend gewachsen und so war sein Ziel klar: Er würde Naturwissenschaften studieren. Oft und lange hatte er in seiner Zeit auf dem Gymnasium überlegt, ob er Biologie, oder Physik und Chemie studieren wollte. Dabei wurde ihm klar, dass Biologie zwar interessant sein könnte, aber Physik und Chemie würden seiner damaligen Meinung nach mehr und spannendere Forschungsmöglichkeiten bieten. Am Ende kam er dann nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss, nur Chemie zu studieren. In die Chemie würde er seine ganze Kraft und seinen Forschungsdrang stecken, um ein erfolgreicher Chemiker zu werden. Auch hatte er sich schon umgehört und sich Gedanken dazu gemacht, an welcher Universität er studieren wollte. Die Wahl fiel auf die Technische Hochschule Hannover, wo er dann zum Sommersemester 1920 sein Studium begann.
Zur gleichen Zeit begann dort auch ein junger Mann aus Düsseldorf sein Chemiestudium. Bald kamen die zwei ins Gespräch, wo sich dann herausstellte, dass beide Verwandte in Mainz am Rhein hatten. Der junge Mann war in Boppard am Rhein geboren und als Kind mit seinen Eltern nach Düsseldorf umgezogen. Außer dem gemeinsamen Studium verband die beiden Erstimmatrikulierte auch ein ähnlicher Humor. Als sie zum ersten Mal miteinander in ein Gespräch vertieft waren, fragte der junge Mann Karl, wie er eigentlich hieße. Darauf stand Karl stramm und sagte: „Gestatten Karl, wie der Kaiser – Karl der Große!“ Worauf der junge Mann gleichfalls stramm stand und meinte: „Gestatten Friedrich Wilhelm, wie der Kaiser!“ Die beiden lachten und waren von diesem Moment an fast unzertrennlich. Freilich konnten beide nicht wissen, dass sie fortan eine lebenslange tiefe Freundschaft verbinden würde.
Friedrich Wilhelm war allerdings nur sein Taufname und offiziell hieß er kurz Fritz. So sollte ihn auch Karl nennen, und so war er auch an der Hochschule eingetragen. Als Fritz. Genauer gesagt: Fritz Straßmann.
Karl und Fritz waren fleißig und bei allen beliebt. Oft lernten die beiden gemeinsam. Semester um Semester steigerten sie sich regelrecht in eine Art Rausch. Die Chemie war ihr Leben und sie stachelten sich im positiven Sinne oft gegenseitig an. Die beiden verstanden sich so gut, dass sie sich vornahmen, auch nach dem Studium gemeinsam zu forschen und zu arbeiten, wo auch immer dies sein mochte. So vergingen die Jahre. Karl richtete es so ein, dass er zweimal jährlich seine Angehörigen in der Heimat besuchte. Auch seine Schwester Elisabeth besuchte er sehr gerne. Im Jahr 1929 beendete Karl sein Studium mit der Promotion zum Dr.-Ing. und sein Freund Fritz tat es ihm gleich.
Als Fritz im gleichen Jahr ein Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem angeboten wurde, wollte er eigentlich ohne Zögern zusagen. Aber die Freundschaft zu Karl war ihm sehr wichtig. Er wusste, dass Karl Verständnis haben würde, wenn es das Stipendium annähme. Wahrscheinlich würde er ihn sogar dazu drängen. Dass sich die beiden seinerzeit vorgenommen hatten auch nach dem Studium gemeinsam forschen und arbeiten zu wollen war damals kein bedingungsloses Versprechen, sondern eher ein Wunschtraum. Umso größer war die Freude, als sich herausstellte, dass beide die Stelle in Berlin gemeinsam antreten durften. Es wurde nur vereinbart, dass nach außen hin nur Fritz erwähnt wurde, womit die zwei gut leben konnten. So nahmen beide 1929 ihre Arbeit am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem auf.
Fritz und Karl reizte es sehr, unter dem bekannten Chemiker Otto Hahn zu arbeiten, der bereits seit 1912 wissenschaftliches Mitglied und seit 1928 Direktor des Instituts war. Otto Hahn war gebürtiger Frankfurter und somit wie Karl und Fritz im Rhein-Main-Gebiet geboren. Hahn wurde am 8. März 1879 geboren, also fast zeitgleich mit Albert Einstein, der genau sechs Tage später im Ulm das Licht der Welt erblickte. Er, Otto Hahn, hatte bereits zahlreiche Isotope entdeckt und 1908 den radioaktiven Rückstoß. 1917 entdeckte er das Element Protactinium, und 1921 die Kernisomerie beim „Uran Z“.
Karl und Fritz erlernten das Arbeiten mit radioaktiven Isotopen und deren Anwendung zur Altersbestimmung von Mineralien und Gesteinen. Wenngleich die Stipendien Ende 1932 ausliefen, wollten und durften die beiden am KWI weiterarbeiten, wo sie schließlich 1935 Assistentenstellen erhielten. Bereits im Herbst 1934 begannen die beiden in einer Arbeitsgemeinschaft mit Otto Hahn und der Kernphysikerin Lise Meitner eine vierjährige Suche nach Transuranen. Lise Meitner und Otto Hahn verband eine Zusammenarbeit die bereits 1907 begann und über Jahrzehnte andauerte. Die Suche brachte jedoch wenig zu neuen Erkenntnissen über Transurane, führte dafür aber im Dezember 1938 zur Entdeckung der Kernspaltung des Urans.
Der Wauwau (1935)
Elisabeth hörte gar nicht mehr auf ihren Bruder zu drücken. Sie freute sich sehr, dass er es einrichten konnte sie wieder einmal zu besuchen. Das letzte Mal war das zu Weihnachten 1934 der Fall, also vor über einem halben Jahr. Sie hatten viel zu bereden miteinander, nicht nur über die eigenartigen Verhaltensweisen von ihrem Sohn Heinrich.
Sie konnte gar nicht glauben, was Karl in seinen jungen Jahren schon alles erreicht hatte. Seit sechs Jahren arbeiteten er und sein Freund Fritz nun schon mit dem berühmten Chemiker Otto Hahn zusammen. Auch Lise Meitner, die erste Professorin für Physik in Deutschland, gehörte zu seinem Team. Sogar mit dem weltberühmten Physiker Albert Einstein, der 1921 den Nobelpreis für Physik bekam, hatte er schon zu Abend gegessen! Einstein arbeitete bis 1933 ebenfalls in Berlin, am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Einstein und Hahn waren auch beide viele Jahre gemeinsam wissenschaftliche Mitglieder der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Elisabeth war mächtig stolz auf ihr Bruderherz!