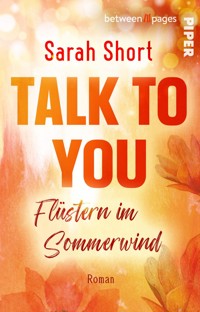6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Toten haben viele Geheimnisse. Katharina kennt zu viele davon. In den Sommerferien zieht sie mit ihrer Familie zurück nach Heidelberg. Sie hofft auf einen Neuanfang, findet sich aber schon nach kurzer Zeit in einem Gebilde aus Lügen wieder. Alles scheint mit dem winzigen Schlüssel zusammenzuhängen, der unverhofft in ihre Hände gelangt ist. Bald erkennt Katharina, dass sie so schnell wie möglich herausfinden muss, wo sie wirklich steht und wem sie vertrauen darf. Als die ominösen Geisterjäger beginnen, sie zu verfolgen, zieht sich die Schlinge immer enger um Katharina und ihre Familie. Inmitten von Chaos und Angst, in einem heraufziehenden Krieg zwischen Diesseits und Jenseits, Himmel und Hölle, findet sie Verbündete und Freunde und eine Liebe, für die es sich zu kämpfen lohnt. Am Ende muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen, um die Menschen, die sie liebt, zu beschützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Hekates Erbe
Der Schlüssel zur Welt
Sarah Short
Copyright © 2018 by
Lektorat: Julia Mayer
Korrektorat: Lillith Korn
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-857-2.
Alle Rechte vorbehalten
Für meine Mutter
»Wir glauben an den einen Gott,
den Vater,
den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.«
Auszug aus dem Nicänischen Glaubensbekenntnis
(Evangelische Kirche in Deutschland)
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Quellenverzeichnis
Danksagung
Prolog
Der Wald war in unwirkliches, grünes Dämmerlicht getaucht, als ich mich durch das dichte Unterholz vorwärtskämpfte. Nicht stehen bleiben, immer weiter. Hinter mir knackten Äste, raschelten Blätter, doch jedes Mal, wenn ich über die Schulter sah, sah niemanden. Es gab nur mich und das endlose Grün. Der Wald strotzte vor Leben. Der Duft nach Erde und Beeren, von Wachsen und Vergehen, erfüllte die Luft. Ein solcher Wald sollte summen und klingen vor Vogelgezwitscher und den leisen und lauten Geräuschen der vielen Tiere, die ihn bevölkerten. Aber ich hörte und sah kein einziges Lebewesen. Ich war mutterseelenallein. Und doch wieder nicht. Schritte, mal nah, mal fern von mir, Schritte eines Unsichtbaren – oder gar mehrerer. Ich hörte sie so deutlich, dass ich sie mir nicht einbilden konnte. Unruhe wuchs in mir, ließ mich schneller gehen. Ich suchte nach etwas Wichtigem, konnte aber nicht benennen, nach was. Gleichzeitig verspürte ich den Drang, über meine Schulter zu sehen. Nichts. Nicht einmal ein Schatten. Diesen Wald kannte ich und ahnte, dass er nicht von dieser Welt war. Er befand sich in einer Welt, die mir nicht fremd vorkam, obwohl ich sie nie betreten hatte. Je häufiger ich diesen Wald sah, desto mehr wuchs in mir der Wunsch, ihn endlich in der Realität zu besuchen. Was wollte ich hier? Obwohl ich wusste, dass ich träumte, dachte ich unablässig darüber nach, während ich wie getrieben weiterstapfte und mein rascher Atem in meinen Ohren dröhnte.
Kapitel Eins
Sechsundvierzig. Gerade war das sechsundvierzigste Auto über die Hauptverkehrsachse gerollt, an der unser neues Haus lag. Da kam das nächste. Siebenundvierzig. Die lärmenden Motorroller und die Lastwagen hatte ich gar nicht mitgezählt. Genervt schob ich meine Beine unter der warmen Bettdecke hervor, stand auf und schloss endlich das Fenster. Jetzt wurde es ein wenig leiser in meinem Zimmer, Schlaf fand ich trotzdem keinen. Dort, wo ich herkam, war es nachts ruhig, von gelegentlichen Tiergeräuschen und dem Raunen der Bäume im Wind mal abgesehen. Meine Familie hatte dort gelebt, wo sich sprichwörtlich Fuchs und Hase ›Gute Nacht‹ sagen, in einem Kaff mitten im Schwarzwald.
Vor drei Wochen hatte ich diese Idylle verlassen müssen, denn mein Vater war als Studienrat an ein Gymnasium in Heidelberg versetzt worden, wo er ab morgen Latein und Geographie unterrichten sollte. Meine Stiefmutter und meine beiden Brüder hatte die Aussicht auf ein Leben in der Stadt in regelrechte Ekstase versetzt. Die Einzige, die darauf gut und gerne verzichten konnte, war ich. Ich hasste Veränderungen, besonders, wenn sie plötzlich kamen.
Ich rollte mich auf die andere Seite, doch der ersehnte Schlaf ließ auf sich warten. Statt Ruhe zu geben, drehte mein Gehirn im Dunkeln erst richtig auf. Ein stummes Selbstgespräch begann, mit dem Ergebnis, dass ich mich nicht so anstellen sollte. Schließlichzog jeder halbwegs vernünftige Teenager das Stadtleben dieser Einöde vor.
Nur war ich kein halbwegs vernünftiger Teenager. Sondern irgendetwas anderes.
Seufzend fuhr ich mir durch die Haare. Selbst mit geschlossenem Fenster hatte ich es nicht ruhig genug zum Einschlafen. Die Geräusche der vorbeifahrenden Autos traten in den Hintergrund, stattdessen drangen das Knacken und Knarzen der Dielen und Wände des über hundert Jahre alten Hauses an mein Ohr. Selbst meine Möbel verhielten sich nicht still, als müssten sie sich in der neuen Umgebung erst zurechtrücken. Ich setzte mich auf und knipste das Nachtlicht an.
Natürlich redete ich mir ein, dass es an dem regen Verkehr auf der Rohrbacher Straße lag, der mich ebenso vom Schlafen abhielt wie dieses unverschämt laute Gebäude, aber ich brauchte mir nichts vorzumachen: Ich fand nicht zur Ruhe, weil ich morgen früh zum ersten Mal in meine neue Schule gehen musste. Es war nicht die erste neue Schule, sondern die vierte, die Grundschule mitgerechnet; ich kannte das Spiel. Und ich hatte Angst davor. Angst davor, dass es genau lief wie immer. Sozialphobie. Dass meine Abnormität einen wissenschaftlichen Namen hatte, half mir seltsamerweise, dagegen anzukämpfen. Ich hatte Pläne für morgen, denn ich wusste schon lange, dass ich alleine die Verantwortung trug für meine Isolation, weil es mir bisher nie gelungen war, Bekanntschaften aufzubauen. Freunde zu finden, arglos mit jemandem in Kontakt zu treten: Für mich beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Meine stümperhaften Annäherungsversuche wurden entweder gleich abgewürgt oder wegen meiner eigenen Schüchternheit eingestellt. Natürlich machte sich keiner die Mühe, zu mir durchzudringen, wenn er im Grunde genommen nichts mit dem komischen Mädchen zu tun haben wollte, das höchstens ab und zu einen Blick über die Mauer warf, die zwischen ihm und den anderen Kindern stand. Irgendwann hatte ich mich hinter meiner Mauer recht gemütlich eingerichtet und aus der Not eine Tugend gemacht. Oft genug hatte ich mir den Kopf darüber zerbrochen und kam jedes Mal zu dem Schluss, dass ich durchaus Freunde haben konnte, nur waren sie eben anders. Oder online. Von Angesicht zu Angesicht erweckte ich stets das Misstrauen meiner Mitmenschen.
Müßig, über die Vergangenheit nachzudenken. Jetzt war ich hier und hatte wieder die Chance auf einen Neubeginn. Morgen würde ich mich nicht blöd anstellen. Die Mauer erschien mir nicht mehr so hoch wie früher. Und ich hatte gelernt, Türen einzubauen. Ich hatte es irgendwie geschafft, in der zehnten Klasse anzukommen, und wollte mir selbst und meinen Eltern einen weiteren Schulwechsel ersparen. In den Ferien hatte ich mich bewusst an belebten Plätzen aufgehalten, in Schwimmbädern, in Parks und in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Heidelberger Schloss und – mein persönliches Highlight – einer bis zum Bersten mit chinesischen Touristen gefüllten Bergbahn. Ich machte Fortschritte. Allein schon deshalb würde ich mich morgen ganz normal verhalten, ohne Schweißausbrüche und Magenkrämpfe. »N – o – r – m – a – l«, buchstabierte ich lautlos vor mich hin. Lächeln, gleich antworten, wenn man mich etwas fragte, und alles ignorieren, was ich als normaler Mensch nicht hören oder sehen können sollte. Die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt.
Ein Blick auf meinen Funkwecker sagte mir, dass ich noch gute fünf Stunden hatte, bis ich aufstehen musste. Nachdem ich im Kopf etwa die Hälfte meiner Urban-Fantasy-Romane aufgezählt hatte, wurden meine Glieder endlich schwerer. Ein Gähnen stahl sich aus meinem Mund und sogar mein Hirn hatte ein Einsehen. Morgen durfte ich mir keinen Fehler erlauben.
Im Nebenzimmer hörte ich Joshua leise schnarchen. Ein beruhigendes Geräusch. Ich knipste das winzige Nachtlicht aus. Gerade als ich glaubte, jeden Augenblick einzuschlafen, schreckte ich wieder hoch und stöhnte auf. Das durfte doch nicht wahr sein. Wieder machte ich das Licht an und spähte über den Rand meines Hochbetts.
Vor dem Fenster neben den Regalböden, beschienen vom Mondlicht, das durch die Lamellen der Klappläden drang, stand eine mollige Gestalt in Hut und Mantel und schaute mich interessiert an. Ein harmlos aussehender Herr mit runder Nickelbrille. Sein graumeliertes Haar hatte er mit reichlich Pomade gebändigt. Mein Blick blieb daran haften, als er zum Gruß den Hut lüftete. Ich hätte es wissen müssen. Wir waren schließlich in einen Altbau gezogen! So freundlich wie möglich sprach ich den ungebetenen Gast an: »Guten Abend. Kann ich etwas für Sie tun oder wollen Sie mir einfach den Schlaf rauben?« Okay, freundlich ging gerade nicht.
Der Mann lachte leise. Obwohl mit ihm beileibe nicht der Erste von der Sorte in meinem Zimmer auftauchte, jagte mir sein Lachen einen Schauer über den Rücken.
Er antwortete in dieser eigenartig nachhallenden Stimme, die ihnen allen gemein war: »Ich habe mich die letzten Nächte zurückgehalten, um Sie nicht zu erschrecken. Jedes Mal, wenn jemand Neues in meine Wohnung einzieht, versuche ich mich vorzustellen. Schließlich sollten wir gut miteinander auskommen.« Das wäre ja noch schöner, wenn er sich hier als Poltergeist betätigen wollte.
»Danke für Ihre Rücksicht«, entgegnete ich diplomatisch.
Im Gegensatz zu mir schien das Herrengespenst einigen Redebedarf zu haben. Als wäre es ihm zu warm, legte er Hut und Mantel auf meinem Schreibtisch ab und nahm auf dem wackeligen Korbstuhl unter dem Fenster Platz, der natürlich nicht ächzte, wie er es getan hätte, wäre der Geist mit diesem respektablen Bauch ein lebender Mann. Unter seinem Mantel trug er einen feinen Nadelstreifenanzug und ein rotes Plastron. Höflich hörte ich dem Geist zu. Wenn ich über den Nachhall hinaushörte, klang er ziemlich brummig.
»Es ist wunderbar, dass Sie mich sehen und hören können. Mein Name ist Gottfried Wilhelm Böttcher. Ich habe dieses Haus erbaut und viele Jahre darin gewohnt. In dieser Wohnung. Sie gefiel mir am besten. Jetzt freue ich mich, dass eine anständige und gebildete Familie hier eingezogen ist.«
Wie schön für ihn. Ich unterdrückte ein Schnauben. So nett er sich anhörte, wollte ich, dass er verschwand und mich in Ruhe ließ.
»Hören Sie, was wollen Sie von mir? Immerhin wissen Sie, dass ich Sie richtig sehen kann, nicht nur als Schatten oder schemenhafter Umriss. Wollten Sie sich vorstellen oder gibt es etwas, das Sie noch erledigen müssen?« Die meisten Geister verfolgten ihre Ziele einfach nach dem Tod weiter, nur hatten sie weitaus weniger Möglichkeiten, sie zu erreichen, als noch zu Lebzeiten. Dann traten sie an Menschen wie mich heran. Dabei hatte ich jetzt wirklich keine Lust, einem Gespenst zu helfen, seine Angelegenheiten zu regeln. Wahrscheinlich war meine Miene diesbezüglich leicht zu durchschauen.
Der Geist antwortete liebenswürdig: »Ich wache über dieses Haus. Ich glaube aber, dass Sie für unsereins bald von Nutzen sein werden. Es braut sich etwas zusammen. Sie sammeln sich. Die Clavicula ist in Erscheinung getreten und alles ist auf der Jagd nach ihr. Ich werde Sie wieder aufsuchen. Gute Nacht, Fräulein Wolf.«
»Aber … Warten Sie!« Die Gestalt verblasste. Typisch. Erst mir so etwas hinwerfen und dann verschwinden. Ich ließ mich in die Kissen fallen und raufte mir die Haare. Ich fürchtete mich nicht mehr vor solchen Geistererscheinungen. Dafür gehörten sie schon zu lange zu meinem Leben. Meistens freuten sich die Toten einfach, dass sie mit jemandem reden konnten. Manche waren zu Freunden geworden. Als einzige Verwandte hatte mich ausgerechnet meine leibliche Mutter nie besucht. Bis heute ersehnte und fürchtete ich eine Begegnung mit ihr. Ich kannte keine andere Mutter als Irmgard, die zweite Frau meines Vaters. Genau genommen war mein jüngerer Bruder Matthias nur mein Halbbruder, denn Irmgard war seine richtige Mutter. Zum Glück hatten diese biologischen Fakten niemals für einen von uns eine Rolle gespielt. Mein großer Bruder Joshua und ich nannten Irmgard »Mama«, seit ich denken konnte. Es gab einen Ort, an dem ich dazugehörte und das war meine Familie. Hier hatte ich nie einen Grund gehabt, mich zu fürchten. Als ich daran dachte, musste ich lächeln. Wieder drehte ich mich auf die linke Seite und versuchte vergeblich, endlich einzuschlafen. Bei aller Müdigkeit hatten sich die Worte des älteren Herrn in meinem Kopf eingenistet. Es braut sich etwas zusammen … Vermutlich nichts Gutes. Wer sammelte sich? Und was war eine Clavicula? Er hätte ruhig mal ein bisschen mehr preisgeben können. Das würde ich gleich morgen in meiner Geisterkladde notieren. Und Clavicula googeln.
Der Wecker klingelte viel zu früh, aber ich freute mich darüber, dass er mich aus dem monotonen Grün des Traumwaldes befreite. Es handelte sich nicht um einen richtigen Albtraum, doch war er auf eine ganz eigene Art beängstigend. Zum einen, weil er jede Nacht wiederkehrte und mich jedes Mal ratloser zurückließ. Zum anderen wegen der Atmosphäre. Alles fühlte sich wahnsinnig echt an. Ich sah nicht nur Bäume, Sträucher und Blätter, ich hörte auch meine Schritte und die von anderen, was mich jedes Mal im dichten Laub vorwärtstrieb. Ich roch sogar den Wald und spürte meine schneller werdenden Atemzüge. Das war gespenstisch. Als würde ich Nacht für Nacht eine Reise unternehmen, ohne mein Bett zu verlassen. Die eindrücklichen Bilder ließen mich seit Wochen nicht los, aber eigene Nachforschungen hatten bisher nichts gebracht. Ich schüttelte mich leicht, um endgültig wach zu werden. Heute durfte ich mich nicht in Traumbildern verlieren.
Schweigsam saßen wir am großen Esstisch in der Küche und frühstückten. Papa raschelte mit der Tageszeitung, hinter der er sich verschanzt hatte. Er achtete genauso wenig auf mein mürrisches Gesicht wie meine Stiefmutter. Irmgard, als Einzige im Morgenmantel, sprang mit wippendem Zopf immer wieder auf, um etwas zu holen und Brotdosen für uns herzurichten, obwohl wir dafür längst zu alt waren. Joshua hatte vor ein paar Wochen seinen achtzehnten Geburtstag gefeiert, ich selbst war sechzehn und Matthias fast fünfzehn Jahre alt. Ich sah Irmgard abwesend zu, wie sie zielgerichtet durch die Küche ging, vom Kühlschrank zum Tisch und wieder zur Spüle, um Äpfel zu waschen. Sie war eine kräftige und hochgewachsene Frau mit Rundungen genau an den richtigen Stellen, die ich nie besitzen würde. Mit ihren goldblonden Haaren und den ausdrucksvollen blauen Augen erschien sie mir manchmal ein bisschen wie eine stolze Wikingerin. Ich fand sie schön. Jeder sah auf den ersten Blick, dass wir nicht verwandt waren, rein äußerlich stellte ich das genaue Gegenteil meiner Stiefmutter dar. Sie zeigte sich auch wesentlich redseliger als ich.
Gerade diskutierte sie mit Matthias über unsere neue Schule. Sie lagen sich oft in den Haaren. Mein jüngerer Bruder ähnelte im Wesen seiner Mutter einfach zu sehr. Mein Vater hielt sich vornehm zurück. Ihn schien der Zeitungsartikel mehr zu fesseln als das Genörgel seiner Kinder. Anstatt dem Disput zwischen Mama und meinem kleinen Bruder zu folgen, wollte ich lieber wissen, was Papa da las. Während ich ihn mit meinem Blick fixierte, hörte ich in seinen Gedanken einen Teil des Artikels: »… zwei Männer im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gestern Morgen tot aufgefunden. Die Todesursache wird zur Stunde noch untersucht. Die Tatsache, dass die Leichen nicht versteckt wurden, gibt der Polizei Rätsel auf. Es gibt derzeit weder Hinweise auf Suizid noch auf Mord. Dieser neue Fund reiht sich ein in eine Serie von unerklärlichen Todesfällen oder dem plötzlichen Auftauchen von Schwerverletzten, die seit Anfang des Jahres die Kriminalbeamten in der Region in Atem halten. Bislang hielten die zuständigen Behörden die Vorfälle aus ermittlungstaktischen Gründen weitgehend unter Verschluss. Doch nun möchte man bei der Aufklärung auf die Mithilfe der Bevölkerung setzen. Der Sprecher des Polizeipräsidiums …« Leider übertönte Mama mit lauter Stimme den Rest des Artikels, weil sie augenscheinlich keine Lust mehr hatte, sich mit Matthias auseinanderzusetzen: »Du könntest mich ruhig mal unterstützen, Julius!«
Papas Gedanken rissen so schlagartig ab, dass ich zusammenzuckte. Von ihm kam aber nur ein abwesendes »Hm?«.
Irmgard seufzte. »Das haben wir doch alles tausendmal besprochen. Das Schopenhauer-Gymnasium ist eine gute Schule, Julius und ich waren selbst dort und möchten das auch für unsere Kinder.«
Papa sah sich genötigt, etwas beizusteuern: »Denkt mal an mich: Es sieht einfach besser aus, wenn ich meine Kinder nicht an anderen Gymnasien unterbringe. Könnt ihr euch mal in meine Lage …«
Irmgard fiel ihm ins Wort: »… versetzen? Und jetzt kommt mal in die Puschen, es ist Viertel nach sieben!«
»Fahrt nicht zu spät los! Wir wollen einen guten ersten Eindruck hinterlassen«, meldete Papa sich noch einmal zu Wort.
Ja, es würde gar nicht leicht werden, ihm aus dem Weg zu gehen.
Matthias war noch nicht mit Irmgard fertig, denn er führte meinen Gedanken laut fort: »Na und? Musstet ihr uns deswegen ausgerechnet dort anmelden? Es gibt doch genug Schulen hier!«
Wo er recht hatte … Doch ich sagte nichts dazu. An unserer Schulwahl gab es nichts mehr zu rütteln. Wortlos steckte ich mir den letzten Bissen meines Honigtoasts in den Mund.
Joshua war anscheinend ebenfalls über seiner leeren Müslischale aufgewacht und erwiderte: »Ich hab gesagt, ich geh auch aufs Helmholtz, das ist viel näher als das Schopenhauer! Oder meinetwegen auch ans Hölderlin. Hauptsache nicht an dieselbe Schule wie Papa. Aber ihr wolltet ja nicht auf uns hören!«
Mir war es eigentlich egal, aber das sagte ich nicht.
Mama lächelte nachsichtig. Das konnte sie, schließlich war sie aus allen Diskussionen darüber als Siegerin hervorgegangen.
»Es wird euch gefallen. Und jetzt ab mit euch!« Damit scheuchte sie uns aus der Küche.
Papa faltete die Zeitung ordentlich zusammen und steckte sie in seine kackbraune, lederne Aktentasche, die er seit seiner Ausbildung nicht durch ein neueres Modell ersetzt hatte, was man ihr deutlich ansah. Danach verabschiedete er sich von uns.
Dieser Zeitungsartikel beschäftigte mich trotz der allgemeinen Aufbruchsstimmung. Das roch nach paranormaler Aktivität. Ich musste unbedingt mehr darüber erfahren. Vielleicht hatte es sogar etwas mit den kryptischen Andeutungen unseres Hausgespensts zu tun.
Grübelnd ging ich um die Ecke in mein Zimmer. Ich hatte es noch nicht fertig eingerichtet. Das Bücherregal stand in Einzelteile zerlegt an der Wand neben dem Schreibtisch und ich lächelte kurz, weil niemand sich vorstellen konnte, dass heute Nacht ein Geist dort gestanden hatte.
An jedem freien Platz stapelten sich Umzugskartons auf dem frisch versiegelten Fischgrätparkett, bis oben hin gefüllt mit Büchern, Bettwäsche und Krimskrams.
Ich warf einen Collegeblock, den zweiten Band von ›Der Herr der Ringe‹, den ich gerade mal wieder las, mein Frühstück und ein ledernes Schlampermäppchen in meine Umhängetasche aus Leinen. Dann fing ich an, auf der Suche nach meinem Fahrradhelm einen Karton nach dem anderen zu öffnen.
Ich nahm mir vor, an diesem Nachmittag endlich das Bücherregal aufzubauen. Spätestens nach dieser durchwachsenen Nacht kapitulierte ich endgültig. Eigentlich wollte ich gar nicht zurück in unser altes Dorf. Wenn ich ehrlich war, vermisste ich nichts, bis auf die Ruhe, die Berge und den dichten Wald. Etwas niedrigere bewaldete Berge hatte ich auch hier vor der Haustür. Ein Spaziergang heute Mittag wäre genau das Richtige, um nach dem ersten Schultag abzuschalten. Falls mein Vater mich nach der heutigen Zeitungslektüre überhaupt noch alleine irgendwohin gehen ließ. Nur um seine Familie nicht zu beunruhigen, hatte er nichts darüber erzählt und war von seiner etwas nervigen Angewohnheit abgewichen, uns möglichst oft aus der Zeitung vorzulesen. Heute hätte ich ausnahmsweise gerne zugehört.
Kapitel Zwei
Als ich in den Flur trat, stieß ich beinahe mit Joshua zusammen, der ebenfalls wie blind aus seiner Zimmertür eilte. Ich fand es schön, dass jeder von uns ein eigenes Reich bekommen hatte. Papa betonte immer wieder, was für einen Lottogewinn diese Wohnung im dritten Stock darstellte, mit fünf Zimmern und nahe an der Innenstadt; ein Vorteil, den nicht einmal ich schlechtreden konnte. Ich würde mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, statt stundenlang im Überlandbus zu sitzen. Joshua stieß mir sanft seinen Ellbogen in die Seite.
»Erde an Katha, aufwachen! Hör mal, wenn dir heute in der Schule einer blöd kommt, weißt du ja, wo du mich findest.« Ganz der große Bruder. Ich lächelte ihn an. »Das ist lieb von dir. Aber ich komme gut alleine zurecht. Ich bin nicht mehr fünf.«
Er grinste. »Ob du deshalb alleine zurechtkommst, weiß ich trotzdem nicht.«
»Blödmann!« Ich lächelte trotzdem weiterhin. Er wollte mich immer beschützen. Nicht dass ich oft mit jemandem aneinandergeriet. Ich hielt mich lieber im Hintergrund, wartete erst mal ab und beobachtete die Menschen. Ich versuchte, sie nicht zu brüskieren. Genau das war mehr als einmal passiert und hatte mir nichts als Ärger gebracht. Als ich vor versammelter Mannschaft mit einem Geist gesprochen hatte, wie damals in der siebten, zum Beispiel. Von da an hatte mich die ganze Klasse für verrückt gehalten. Oder als mich Luis in der sechsten Klasse für eine Hexe gehalten hatte, weil ich gewusst hatte, dass sein Kaninchen gestorben war.
Ich benahm mich vorsichtig, fast misstrauisch gegenüber allen Unbekannten. Vor allem, weil sie nie lange Unbekannte blieben. Mir graute davor, mich gleich in diese Masse an fremden Menschen stürzen zu müssen. Natürlich wünschte ich mir Freunde, aber am liebsten hielt ich mich fernab von anderen Leuten. Es war einfacher.
»Sag mal, pennst du noch?«, fragte Joshua. »Matthias ist schon unten, komm jetzt endlich!« Er rüttelte leicht an meiner Schulter. Zusammen mit seinem besorgten Gesichtsausdruck rauschten seine Gedanken zu mir herüber: »Wehe, du verbockst es wieder! Reiß dich zusammen, kleine Elfe, damit dich nicht gleich wieder jeder für einen Freak hält, okay?«
Laut rief er: »Tschüss, Mama!«, und verließ die Wohnung durch die weiß lackierte Tür mit den Scheiben aus buntem Tiffanyglas in einem hübschen Blumenmuster. Ich schüttelte den Kopf und schlüpfte in meinen hüftlangen Zweireiher. Anschließend zog ich meine Lederstiefelchen an und folgte meinem Bruder die knarrenden Holztreppen hinab. Manchmal erschien es mir, als würde ich meiner Familie beim Leben zuschauen, ohne selbst richtig dabei zu sein.
Draußen empfing mich milchiger Sonnenschein, der durch ein hartnäckiges Hochnebelfeld hindurchschien. Wenigstens war es nicht so kalt wie befürchtet. Ich betrachtete noch einmal unser neues Zuhause. Von außen sah das vierstöckige Haus etwas heruntergekommen aus. Die hellbraune Fassade benötigte dringend einen neuen Anstrich, die Dachrinne bog sich durch und der Balkon im Stockwerk unter uns sah ziemlich absturzgefährdet aus. Gar nicht zu reden von dem Geist, mit dem wir die Wohnung teilten. Aber den sah und hörte ja keiner außer mir.
Als wir durch die Gaisbergstraße in Richtung Bismarckplatz radelten, sprang das Gedankenkarussell wieder an. Diesmal drehte es sich um eine ganz bestimmte Person. Genau genommen hatte ich außer Herrn Böttcher nämlich bereits einen neuen Bekannten in dieser Stadt. Jemanden, der noch nicht vor mir Reißaus genommen hatte. Jedenfalls nicht so offensichtlich wie andere vor ihm.
In den Sommerferien, während Handwerker unsere Wohnung renoviert hatten und meine Eltern ständig zwischen Südbaden und Nordbaden gependelt waren, hatten wir unser Quartier bei Oma Waltraud im Oberen Gaisbergweg aufgeschlagen. Während der schier endlosen Sommertage, die wir auf die Spedition mit unseren Möbeln und Umzugskartons gewartet hatten, hatte ich entweder meine Brüder ins »Tiergartenschwimmbad« begleitet oder, was ich eindeutig vorzog, auf eigene Faust die Umgebung erkundet. Stundenlang war ich durch die Natur gewandert oder unser Viertel gestreift. Am häufigsten hatte es mich in den Wald gezogen. Nur in der kühlen, leicht feuchten Luft unter den dicht belaubten Bäumen hatte sich meine ständige innere Anspannung gelegt. Ich genoss die Natur genau wie heute und nutzte gleichzeitig diese Muße, um nachzudenken. Ich liebte es, mich fast geräuschlos auf den verschlungenen Trampelpfaden zu bewegen und meine Sinne auf Wanderschaft zu schicken. Ich stellte mir oft vor, wie ich mit den Steinen, der Erde und den Pflanzen verschmolz, wie die Nymphen der griechischen Sagen. Optisch gelang mir das manchmal, in den Tuniken oder Kleidern in Grün- und Blautönen, die ich meistens trug.
Aber damals wollte ich einmal am Tag gesehen werden, immer dann, wenn ich ihn traf.
Er ging nie direkt an mir vorbei, sondern nickte mir immer aus einiger Entfernung zu. Näher als drei bis vier Meter kam ich nicht an ihn heran. Was einerseits schade war, andererseits auch beruhigend, schließlich war er ein Fremder. Er sprach nicht, doch er lächelte mich stets freundlich an und hob die Hand zum Gruß. Der Junge musste in etwa so alt sein wie ich, er trug immer dunkelblaue Jeans und ein rotes T-Shirt, das sich deutlich von dem Grün der Umgebung abhob. Seine rabenschwarzen Haare waren lockig und gerade kurz genug, um ihm nicht ständig in die Augen zu fallen. Er war groß gewachsen, ich schätzte ihn auf gut einen Meter neunzig. Am einprägsamsten war sein Gesicht. Ein ebenmäßiges, männliches Gesicht mit einem markanten Kinn, hohen Wangenkochen und hellen Augen, deren Farbe ich aufgrund der Strecke zwischen uns nie richtig erkennen konnte.
Nach einigen Tagen freute ich mich auf diese kurzen Augenblicke, in denen er lächelnd auftauchte und gleich darauf seinen Weg durch den Wald fortsetzte wie ich. Ich mochte diesen Jungen, obwohl ich ihn nicht kannte. Immer sah ich ihm nach, bis er zwischen den Bäumen verschwand. Und mit jedem Tag wuchs der Wunsch, über meinen Schatten zu springen und ihm nachzugehen. Aber das traute ich mich nicht. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, ihn anzusprechen. Dazu war ich viel zu furchtsam. Allein schon die Vorstellung, einem Fremden länger in die Augen zu sehen, ließ meine Hände zittern. Auf Abstand war alles okay. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich mutiger wurde, je länger ich jemanden aus der Ferne analysiert hatte. Ich brauchte Zeit. Ihm schien es ähnlich zu gehen und das machte ihn noch sympathischer.
Ich würde warten, so lange, bis er bereit war, näher auf mich zuzugehen als ein paar Meter. Oder bis ich es schaffte, etwas zu ihm zu sagen. Dabei hatte ich viel Zeit, mir Gedanken über ihn zu machen. Sehr viel Zeit. Wo er wohl wohnte, auf welche Schule er ging, was er überhaupt für ein Mensch war und so weiter und so fort. Ich empfand es als sicherer, nur über jemanden nachzudenken als wirklich mit ihm zu sprechen. Es ersparte mir die Enttäuschung, wenn er lieber darauf verzichtete, mit mir zu reden. Oder wenn ich keinen Ton herausbrachte und am Ende doch davonlief.
Ich hatte bisher niemandem von diesen Begegnungen erzählt, aus gutem Grund. Mein großer Bruder Joshua würde genau wie meine Eltern nicht viel davon halten, dass ich mich im finsteren Forst mit jungen Männern traf. Jedenfalls würden sie es so auslegen, egal, wie gut sie mich kannten. Bestimmt hatte der Junge irgendeinen Vogel, aber den hatte ich auch und darum sah ich es als Begegnung zweier Gleichgesinnter. Wir beide suchten den Frieden des Waldes, die Abwesenheit von Menschen. Vielleicht schloss ich aber von mir auf andere. Außerdem war ich nicht blöd. Hätte ich schon beim ersten Mal irgendwelche Feindseligkeit gespürt, wäre ich woanders spazieren gegangen, ganz einfach. Im Übrigen konnte ich es nicht ausschließen, dass es sich um einen Geist handelte.
Natürlich hätte meine Familie dafür wenig Verständnis. Dass ich mich schon früh von allen abgesondert hatte, ließen sie mir durchgehen, versuchten mich aber immer wieder zu Gemeinschaftsaktivitäten wie Schul-AGs zu überreden. Ihnen zuliebe hatte ich es immer wieder versucht, so lange, bis ich es sein lassen durfte. Einzig Musik hatte mich bislang ansatzweise mit anderen Menschen zusammengebracht. Daran wollte ich anknüpfen. Ich hielt mich auch daran fest, dass niemand je die Diagnose »Sozialphobie« gestellt hatte. Es war nur angeklungen, dass ich unter anderem darunter leiden könnte. Ich wusste eigentlich, es lag mehr an dem Gefühl des Andersseins. Eines Tages würde ich meine Mauer überspringen. Eines Tages. Von der Weststadt aus brauchte man weniger als zehn Minuten bis zur Schule. Weil die Fahrradständer am Sophienhaus bereits überfüllt aussahen, stellten wir unsere Räder am Vordereingang des Hauptgebäudes ab, stapften die Treppe mit dem Brunnen hinauf und betraten das Schulhaus. Wir sahen die Schule nicht zum ersten Mal von innen, Papa hatte uns vor den Sommerferien alle mit zur Anmeldung genommen. Als wir jetzt am Büro des Hausmeisters vorbeigingen, horchte ich in mich hinein, um den Adrenalinpegel zu checken. Entgegen all meiner Befürchtungen fühlte ich mich relativ wohl und begann mich vorsichtig auf den heutigen Tag zu freuen.
»Hier riechts voll alt«, meinte Matthias und rümpfte die Nase. Mein Mund verzog sich hingegen zu einem breiten Lächeln. Es roch genau richtig. Ein bisschen süßlich, ein bisschen nach Putzmittel und Schulmief. Es roch wirklich alt. Und ich liebte alte Sachen. Mir gefielen der Fußboden aus Steinzeug im Schachbrettmuster, die halbhohen Holzvertäfelungen und die Buntsandsteinsäulen. Selbst das schmiedeeiserne Treppengeländer und die ausgetretenen Steinstufen fand ich schön. Gewohnheitsmäßig hielt ich Ausschau nach Unsichtbaren. Im unfreundlichen Licht der Energiesparlampen zeigte sich aber niemand. Diesmal begleitete mich nicht einmal meine Großmutter an einem ersten Schultag. Im zweiten Stock trennten wir uns. Nur ungern ließ ich meine Brüder ziehen, die mich wie zwei Leibwächter in die Mitte genommen hatten, während wir das Schulhaus durchquerten. Mein Klassenzimmer lag direkt neben dem Treppenaufgang. Matthias machte sich als Erster mit einem »Ciao!« auf den Weg in seinen Klassenraum.
Viel Glück, wünschte mir Joshua in Gedanken. Er war der Einzige, der mich nicht für durchgeknallt hielt. Er kommunizierte gern mit mir auf diese Weise, auch wenn das leider nur einseitig ging. Mein ganzes Leben lang hatte ich mir jemanden gewünscht, mit dem ich meine Gedanken teilen durfte, wie Joshua seine mit mir teilte. Aber jetzt sollte ich meine Abnormität mal kurz vergessen und reingehen, denn ich merkte, dass ich etwas zu lange vor der angelehnten Tür verharrte. Durch den Türspalt drang vielstimmiges Gerede, wahrscheinlich durchmischt mit Gedankenfetzen, die ich jedoch noch niemandem zuordnen konnte. Ein paar Jungs unterhielten sich recht laut über den Zeitungsartikel von heute Morgen und stellten wilde Verschwörungstheorien an. Leider konnte ich nicht sagen, ob meine Vermutung, dass womöglich Geisterwesen dahintersteckten, nicht wahnwitziger war als die Illuminaten Theorie meiner neuen Mitschüler. Ich holte mein Herr-der-Ringe-Exemplar aus meiner Umhängetasche und umklammerte das zerlesene Buch wie einen Talisman, als ich die Tür aufstieß und in das lichtdurchflutete Zimmer trat.
Kapitel Drei
Durch die nach Osten ausgerichteten Fenster drang gleißendes Sonnenlicht herein, was jedoch niemanden davon abgehalten hatte, sämtliche Deckenlampen einzuschalten. Der Parkettfußboden knarrte unerhört laut unter meinen vorsichtigen Schritten. Die meisten Gespräche verstummten, leiser wurde es für mich nicht. Unzählige Gedanken und Gefühle prasselten auf mich ein. Neugier, Interesse, aber auch leise Feindseligkeit. Ich blendete alles aus, so gut es ging. Dabei kämpfte ich gegen den Drang, mich einfach umzudrehen und fluchtartig den Raum zu verlassen. Mein Magen rumorte. Hektisch schluckte ich gegen die aufkommende Übelkeit an.
Ein im Vergleich zu den anderen groß gewachsenes Mädchen mit einer Schmetterlingshaarschleife löste sich aus einer Gruppe von vier Schülerinnen, die am geöffneten Fenster standen. Sie kam auf mich zu, um mich zu begrüßen und näher in Augenschein zu nehmen. Es nervte mich, dass ich wegen meiner geringen Körpergröße zu ihr aufschauen musste. Sie überragte mich, wie die meisten, um Haupteslänge. Dennoch bemühte ich mich um ein freundliches Lächeln. Sie konnte nichts dafür. Und für meine Unbeholfenheit konnte sie auch nichts.
»Hi! Du bist die Neue, nicht?«, sprach sie mich mit glockenheller Stimme an. Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr sie fort: »Wie heißt du?« Für den Bruchteil einer Sekunde fiel ihr Blick auf das Buch in meinem Arm, aber sie sagte nichts dazu.
»Ähm … Katharina«, brachte ich hervor. »Und du?«
Meine vor Aufregung zitternden Hände umfassten das Buch fester. Ich benahm mich lächerlich, ich wusste es, und ärgerte mich deshalb umso mehr über mich selbst. Ich fing an zu schwitzen und hoffte, dass sie es nicht bemerkte.
»Vanessa. Ich bin Klassensprecherin, jedenfalls, wenn ich dieses Jahr wiedergewählt werde.« Sie lächelte vergnügt. Obwohl ich es eigentlich nicht wollte, scannte ich sie auf eventuell versteckte Böswilligkeit. Ich würde gerne sagen, dass ich nur paranoid war, aber Menschen lügen in einem fort und es ist nicht leicht, wenn man von Kindesbeinen an jede Lüge durchschaut und genau weiß, dass ein freundlich daherkommendes Gegenüber einen insgeheim zum Teufel wünscht. Doch hier fand ich am allermeisten Interesse. Gut zu wissen. Ich musste wohl etwas mehr sagen, damit sie mich nicht gleich für komisch hielt.
»Äh, was haben wir jetzt?«, erkundigte ich mich wenig einfallsreich. Am ersten Schultag wusste das normalerweise nicht mal die designierte Klassensprecherin.
»Jetzt kommt gleich unsere Klassenlehrerin, Frau Winter. Die gibt uns den neuen Stundenplan und unsere Bücher und all das. Du kannst dich für AGs eintragen und so weiter. Am ersten Tag passiert nie viel. Hast du dir schon einen Platz ausgesucht?« Sie war wirklich nett. Erstaunlich. Ich las extra nicht ihre Gedanken, um die positive Stimmung zu erhalten.
»Kann ich mir einen aussuchen?«, fragte ich unsicher und verfluchte mich innerlich. Ich benahm mich wie ein verängstigter Erstklässler! Doch Vanessa reagierte nicht mit einem abfälligen Kommentar, sondern bot mir einige Plätzen an. Ich entschied mich für die erste Reihe, damit ich alles mitbekam und niemanden aus der Klasse in die Verlegenheit brachte, dort sitzen zu müssen, weil ich ihm den Stammplatz geklaut hatte. »Vielen Dank«, sagte ich und hängte meine Tasche über die Stuhllehne. Vanessa hakte sich vertraulich bei mir unter, was mich dermaßen verblüffte, dass ich mich nicht wehrte, und zog mich zu ihren Freundinnen, die immer noch am Fenster standen und in ein reges Gespräch vertieft waren. Sonst fasste mich niemand einfach so an, doch ich wollte sie nicht vor den Kopf stoßen. Hoffentlich spürte sie nicht meinen rasenden Puls.
»Hey, das ist unsere Neue, Katharina«, stellte sie mich vor, ehe ich selbst den Mund aufmachen konnte. Sie sagten mir ihre Namen. Stockend berichtete ich unter Vanessas aufmunternden Blicken, woher ich kam und dass ich mich freute, alle kennenzulernen, obwohl ich mich viel lieber hinter dem hässlichen, beigefarbenen Vorhang versteckt hätte, als auch nur einen Ton zu sagen. Doch sie nahmen mir mein scheues Verhalten nicht übel, sondern ließen mich wie selbstverständlich dabeibleiben und ihrem Geplauder lauschen. Der Anfang war gemacht. Besonders spannend fand ich es zwar nicht, schließlich kannte ich keine einzige Person, über die sie redeten. Also guckte ich unauffällig in ihre zugegebenermaßen gut frisierten Köpfe. Langsam wurde mir unangenehm warm, wenngleich der Schweißausbruch vorbei war, weshalb ich mein Mäntelchen auszog und mir über den Arm hängte.
Annalena, blond wie Vanessa und mit einer niedlichen Flechtfrisur, saß rechts von mir auf dem weiß lackierten Heizkörper. Ihr Name war neben Vanessas der einzige, den ich mir gemerkt hatte. Sie dachte recht wenig und konzentrierte sich tatsächlich sehr auf das Gespräch, das nun unvermittelt abbrach, weil sich alle zur Tür umdrehten. Erst nahm ich an, der Lehrer wäre gekommen und wollte mich schon hektisch auf den Weg zu meinem Platz machen, als auch mein Blick zur Tür wanderte.
Deshalb waren sie alle erstarrt. Die meisten Schüler, auch die Jungen, hatten aufgehört zu reden und viele sogar aufgehört zu denken. Das passierte recht selten. Aber schnell sprang die Gedankenmühle wieder an. Obwohl keiner ein Wort sagte, war es lauter als zuvor.
Ich widerstand dem Impuls, mir die Ohren zuzuhalten. Das würde nichts bringen und komisch aussehen.
Ein Junge war hereingekommen. Auf den ersten Blick sah er ganz normal aus, besser als die anderen im Raum, doch er hatte etwas an sich, das die meisten einzuschüchtern schien. Er nickte allen ernst und schweigend zu. Das Gestarre war er anscheinend gewohnt und ging völlig unbeeindruckt schnurstracks zu seinem Tisch. Direkt neben meinem in der ersten Reihe.
Ich konnte nichts dagegen tun, dass ihm meine Augen ebenso folgten wie die aller anderen. Denn ich kannte ihn bereits. Ich hatte das Gefühl, mich am Heizkörper festhalten zu müssen. Dort vorne hatte kein Geringerer Platz genommen als der fremde Junge aus dem Wald. Er existierte also tatsächlich.
In schwachen Momenten hatte ich ihn für einen Geist gehalten, um sein distanziertes Verhalten zu erklären. Und hier hatte ich den Beweis, dass ich falschlag: Er bestand aus Fleisch und Blut und unbestreitbar lebendig. Außerdem schien er mächtig Eindruck zu schinden. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, etwas über ihn in Erfahrung zu bringen, ohne ihn gleich selbst zu überfallen. Dass er kein unbeschriebenes Blatt war, sah jeder.
Als ich meinen Blick von seiner Gestalt lösen konnte, schaute ich fragend meine neuen Klassenkameradinnen an. Da keine freiwillig irgendein Wort über den seltsamen Jungen verlor, war ich gezwungen, auf anderem Wege etwas über ihn zu erfahren. Dass nicht nur ich mich für ihn interessierte, stand außer Frage. Annalena hatte plötzlich sehr viele Gedanken in ihrem Kopf: O mein Gott, er ist wieder da! Ich dachte, er wäre weggezogen?! Und er sieht immer noch so unverschämt gut aus …Ich hielt mich davon ab, zustimmend zu nicken. Es gab nichts Schlimmeres, als auf jemandes Gedanken zu antworten. Auch das war mehr als einmal passiert.
Jetzt lösten sich alle aus ihrer kurzzeitigen Starre. Viele nahmen ihre Gespräche wieder auf, als wäre nichts geschehen. Nun, fast.
Wildes Tuscheln drang aus allen Ecken des Raumes und plötzlich tat mir der Junge leid. Vanessa meinte jedoch zum Glück, ich müsste dringend aufgeklärt werden und flüsterte mir ins Ohr: »Das ist Milán Farkas. Er kam letztes Schuljahr in unsere Klasse, erst kurz vor den Sommerferien, aber angeblich lebt seine Familie schon ewig in Heidelberg, dabei haben die gar keinen deutschen Namen. Er musste die Schule wechseln, da ist einiges vorgefallen, wenn du weißt, was ich meine. Er ist … irgendwie nicht normal.« Sie drehte ihren Finger neben ihrer Schläfe, um anzudeuten, dass Milán eine Schraube locker hatte. »Es sind eine Menge Gerüchte über ihn im Umlauf. Ich traue ihm jedenfalls nicht über den Weg. Am besten tust du das auch nicht.«
Mein Gesicht musste einen ziemlich erschrockenen Ausdruck angenommen haben, denn Vanessa sah sich genötigt, mir beruhigend ihre Hand auf den Unterarm zu legen. Ich bekam eine Gänsehaut und sie zuckte unmerklich zurück.
»Keine Angst, ich glaube nicht, dass er kriminell ist oder so, auch wenn andere das nicht ausschließen. Ich würde mich trotzdem von ihm fernhalten.« Bevor ich ihr nun doch ein paar Fragen stellen konnte; von denen hatte ich nach Miláns Auftritt und Vanessas unerwarteter Ansprache nämlich reichlich (zum Beispiel, ob es hier nicht anders zuging als in dem Dorf, aus dem ich kam), betrat besagte Frau Winter das Klassenzimmer. Annalena schloss das Fenster und setzte sich neben Vanessa in die zweite Reihe, von wo aus sie mir freundlich zulächelte. Trotz meiner Neugier und dem festen Vorsatz, mir eine eigene Meinung über den fremden Jungen zu bilden, den ich so interessant gefunden hatte, wagte ich es nicht sofort, Milán direkt anzusehen. Lieber holte ich meinen Collegeblock und mein Mäppchen heraus. Ich wartete auf den Knoten in meinem Bauch, auf die Fluchtgedanken, auf die Angst. Ich war nachdenklich, etwas beklommen, aber nicht wegen Miláns Anwesenheit, sondern wegen der Abneigung, die ihm entgegenschlug, sobald er den Raum betreten hatte. Das war spannend. Dann überwand ich mich und riskierte doch einen offeneren Blick. Er schaute auf die Tafel, an die Frau Winter gerade das Datum schrieb.
Hm, ein Vampir ist er schon mal nicht, dazu hat er eine zu gesunde Gesichtsfarbe, dachte ich amüsiert. Hoffentlich musterte ich ihn nicht zu auffällig. Er sah auch von Nahem wirklich gut aus, das ließ sich nicht bestreiten. Es war aufregend, ihn endlich aus nächster Nähe zu betrachten. Milán sah exakt aus wie der Waldjunge. Er hatte die gleichen tiefschwarzen Haare, die er wild auf seinem Kopf arrangiert hatte. Vielleicht hatte er sich auch einfach nicht gekämmt. Nicht einmal die vielen Sommersprossen machten ihn weniger attraktiv. Seine Lippen waren schön geschwungen, sodass sich sogar mir der Gedanke aufdrängte, wie es wohl wäre, ihn zu küssen. Wie schamlos! Sofort wurde ich rot. Kein Wunder, dass den Mädels der Mund offenstand, wenn er den Raum betrat. Seine Blicke wirkten hart und unnahbar, geradezu abweisend. Und doch gab es niemanden, der ihn nicht ansah. Ich selbst war gegen meinen Willen gebannt. Ich schaute ihn weiter an und hoffte, dass er es nicht mitbekam.
Alles an ihm wirkte intensiv. Das Schwarz seiner Haare, der leichte Bronzeton seiner Haut, das leuchtende Blaugrün seiner Augen. Diese Farbe! So lange hatte ich über seine Augenfarbe gerätselt. Und jetzt konnte ich mich nicht davon losreißen. Diese Augen waren das Ungewöhnlichste, das ich je bei einem Menschen gesehen hatte. Wie gut er erst aussah, wenn er lächelte … Vielleicht war ich die Einzige in diesem Klassenraum, die sein Lächeln kannte.
Schämte er sich, zu zeigen, dass er mich kannte? Oder verwechselte ich ihn doch? Oder wusste er nicht, dass ich das Mädchen war, das er täglich traf? Vielleicht war er einfach kurzsichtig und zu eitel, eine Brille zu tragen. Ein unterdrücktes Kichern stahl sich aus meinem Mund. Hastig wandte ich mich ab, weil er irritiert die Stirn runzelte. Mist, er hatte mein Starren bemerkt.
Die ganze Situation war trotzdem zum Totlachen. Das kannte ich doch schon aus der einschlägigen Literatur: Seltsamer Junge verschreckt die halbe Schule und trägt irgendein dunkles Geheimnis mit sich herum. Nur eine doofe Neue, in diesem Fall ich, gibt nichts auf die Vorurteile der Alteingesessenen und stellt Nachforschungen an. Miláns Geheimnis konnte nicht besonders finster sein. Jedenfalls nicht finsterer als meins. Wahrscheinlich zog er eine Riesenschau ab und gefiel sich auch noch in der Rolle des mysteriösen Einzelgängers. Natürlich war ich prompt auf ihn hereingefallen. Schon ein bisschen lächerlich. Trotz allem, was ich mir selbst über ihn zusammengereimt und was Vanessa über ihn berichtet hatte, konnte ich kein Misstrauen empfinden. Er sah nett aus. Jedenfalls nicht wie ein Axtmörder oder jemand, der nachts aus seinem Sarg steigt, um jungen Frauen das Blut auszusaugen. Was hatten die nur mit ihm? Es lag sicher nicht nur an seiner Aura, mehr an etwas, das er getan hatte oder in das er verwickelt gewesen war. Vanessa hatte schließlich gemeint, es wäre etwas vorgefallen. Solange ich das nicht wusste, gab es keinen Grund für mich, ihn anders zu behandeln als meine anderen Mitschüler. Mit gegenüber verhielten sie sich bisher überraschend freundlich, das war ganz und gar ungewohnt. Ich riss mich aber auch schwer am Riemen, um ja nicht mit Verrücktheiten aufzufallen. Und anscheinend gab Milán ein weitaus freakigeres Bild ab als ich.
Leider musste ich mit dem Nachgrübeln aufhören, weil die Lehrerin nach ein paar Begrüßungsworten ihre Aufmerksamkeit auf mich richtete. Ich schaute ihr zum ersten Mal ins Gesicht, rund und so vertrauenserweckend wie der Rest ihrer Erscheinung. Frau Winter trug eine weiße, langärmelige Bluse, dazu einen grauen Bleistiftrock und flache Pumps in schlichtem Schwarz. Ich schätzte sie auf mindestens fünfzig. Ihr adretter Pagenschnitt war hundertprozentig blondiert. Eine Lesebrille baumelte an einer silbernen Schnur vor ihrem üppigen Busen. Frau Winter war bei uns nicht nur Klassenlehrerin, sondern unterrichtete auch Englisch und Französisch.
»Möchtest du dich kurz vorstellen, Katharina?«, fragte sie mit ruhiger Stimme.
Ich würde mir zwar lieber ohne Betäubung einen Zahn ziehen lassen als vor der Klasse zu stehen und über mich zu sprechen, aber ich wollte nicht bockig wirken. Ich verknotete meine Hände, um mir Halt zu geben, schluckte gegen die aufsteigende Übelkeit an und betete, dass ich weder in Ohnmacht fiel noch mich übergeben musste. Zittrig stand ich auf. Als ich mit wackligen Beinen um die Tischreihe herum zur Tafel ging, spürte ich Miláns Blicke im Rücken. Auch als ich mich umdrehte, starrte er mich unverhohlen an. Von einem Lächeln keine Spur. Mein Mund und meine Kehle trockneten aus. Ich hustete unterdrückt. Miláns eisiger Blick trug nicht gerade zu meinem Wohlbefinden bei. Er schien mich wirklich nicht zu kennen. Wie konnte das sein? Da schaute ich lieber zu Vanessa und Annalena. Letztere nickte mir zu, wie um mich zu bestärken. Das war richtig lieb von ihr.
Ich räusperte mich vorsichtig, damit mir nicht der Mageninhalt hochkam. Jetzt spürte ich geradezu wie meine Wangen sich rot verfärbten und mein Herzschlag ungeahnte Höhen erreichte. Blöde Nervosität! Dabei war das jetzt meine Chance, einen guten Eindruck zu machen.
Mit krächzender Stimme sagte ich die Sätze auf, die ich mir seit Tagen zurechtgelegt hatte: »Ich heiße Katharina Wolf und bin in den Sommerferien mit meiner Familie nach Heidelberg gezogen. Mein Vater hat hier an der Schule eine Stelle bekommen und jetzt wohnen wir in der Weststadt. Und das wars eigentlich auch schon.« Meine peinlichen wie langweiligen Hobbys, nämlich lesen, das Verfassen von Fantasy-Fanfictions und eines Geisterforschungsbuches verschwieg ich lieber. Ich musste es mir ja nicht gleich am ersten Tag mit allen verscherzen. Niemand stellte eine Frage, weshalb ich mich erleichtert wieder hinsetzte.
Innerlich beschäftigte ich mich weiter damit, wie ich auf die anderen gewirkt hatte. Abgesehen von offenkundig verängstigt.
An meinem Outfit gab es schon mal nichts auszusetzen. Auf Anraten von Joshua hatte ich ein wenig Wimperntusche aufgelegt und trug meine langen, fast schwarzen Haare offen. Ich hatte jedoch nicht bedacht, dass sie nach einer Fahrt mit Fahrradhelm wahrscheinlich nicht mehr besonders toll aussahen. Erster Minuspunkt. Mein türkiser Pullover war unauffällig, meine Beine steckten in einer engen, schwarzen Röhrenjeans. Damit sollte ich wirklich nicht negativ auffallen. Man könnte mich höchstens für etwas zu dünn halten. Zweiter Minuspunkt.
Zum dritten Minuspunkt durfte es nicht kommen, der bestand nämlich darin, unbedacht Dinge auszusprechen, die ich nicht wissen oder wahrnehmen dürfte. Das war ein absolutes No-Go. Dieser Punkt blieb der schwerste, wobei ich darin mittlerweile viel Übung hatte. Obwohl ich es hasste, dass ich mich für andere so verbiegen musste, war mir klar, dass es sein musste.
Mit meinen Haaren schirmte ich mich vor Miláns Blicken ab. Er starrte mich immer noch an.
Kapitel Vier
Dennoch brachte ich es nicht über mich, seinen Blick zu erwidern. Musste ich auch nicht. Dass ich diesmal nicht mein altbewährtes Rezept befolgt hatte, nämlich abzuhauen und mich irgendwo zu verstecken, brachte mir ein innerliches Schulterklopfen ein. Auf einmal entschlossen, mich nicht noch mehr zum Deppen zu machen, warf ich meine Haare zurück und ignorierte ihn, so gut es ging. Ich hatte schon Schlimmeres erlebt. Wir hatten noch nie miteinander gesprochen, es konnte also gut sein, dass er das beibehalten wollte, ob ich nun neben ihm saß oder nicht. So richtete ich meine Aufmerksamkeit auf Frau Winter.
Wir mussten den Stundenplan von der Tafel abschreiben und welche Hefte und Ordner wir besorgen sollten, danach ging es an die Buchverteilung. Nachdem alle ihre Bücher bekommen hatten, kamen die Listen mit den AG-Angeboten. Ich überlegte schwer, ob ich mich für das Sinfonieorchester eintragen sollte, immerhin spielte ich seit Jahren Querflöte, hatte es damals im örtlichen Musikverein aber nicht lange ausgehalten. Wollte ich hier nicht einen echten Neuanfang? Als die Orchesterliste zu mir kam, zuckte ich unmerklich mit den Schultern und schrieb mich ein. Ich stutzte, als Milán neben mir einen Kugelschreiber zückte und sich unter meinem Namen eintrug. Das »A« in seinem Namen trug einen Akzent. Ich sah zu Frau Winter, die ins Klassenbuch schrieb, während die AG-Liste weiter durch die Klasse wanderte. Dann schielte ich nach rechts hinüber zu Milán, der auf seinem karierten Block herumkritzelte. Selbst mit Kugelschreiber sah seine Zeichnung nicht schlecht aus. Ich wollte ihn schon darauf ansprechen, als ich mich im letzten Moment zurückhielt. Er vermittelte mir nicht das Gefühl, dass er mit mir reden wollte. Und ich wollte mich selbst nicht überfordern.
Nach der Doppelstunde holte ich meine Brotdose aus der Tasche und stand auf, um Vanessa, die mich zu sich winkte, und ihren Freundinnen nach draußen zu folgen. Der Platz neben mir war leer. Ich sah noch mal hin. Der Typ war entweder verdammt schnell oder er hatte die Fähigkeit, sich in Luft aufzulösen. Schon ein bisschen gruselig. Ich schüttelte mich leicht, als ich mein Mäntelchen anzog. In jedem Fall würde ich mich hier nicht langweilen.
Auf dem Schulhof traf ich einen gut aufgelegten Joshua. Er schien auf mich gewartet zu haben. Verstohlen beobachtete ich die Reaktionen meiner neuen Mitschülerinnen auf meinen Bruder. Ich grinste in mich hinein, als ich Annalenas schmachtende Blicke bemerkte. Was das anging, erlebte ich mit Joshua immer dasselbe. Mein Bruder unterschied sich in den meisten Dingen grundlegend von mir. Er war ein typischer Sonnyboy mit kurzen Haaren, die immer ein wenig unordentlich aussahen, und feinen Gesichtszügen. Letztere hatte er auf keinen Fall von Papa, der mich eher an einen raubeinigen Seefahrer erinnerte. Mit seinen kastanienbraunen Augen bekam Joshua den schönsten Hundeblick der Welt hin. Doch den musste er nicht oft einsetzen, denn fast immer hatte er ein freundliches Lächeln und einen lockeren Spruch auf den Lippen. Es war einfach seine Art, offen auf die Leute zuzugehen, er schloss schnell neue Bekanntschaften und gehörte immer zu denen, die auf jede Party eingeladen wurden. Selbst in unserem Dorf war er mit den meisten gut ausgekommen, die für mich nur scheele Blicke übriggehabt hatten.
Joshua lächelte mich schief an. Er ließ mich seine Gedanken hören: Schon Anschluss gefunden? Laut meinte er: »Ich hab nix mehr zu essen. Wisst ihr vielleicht, wo es hier in der Nähe einen Bäcker gibt?« Dazu lächelte er Annalena, Vanessa und die anderen zwei (verflixtes Namensgedächtnis) gewinnend an. Ich verdrehte die Augen. Gegen seinen Charme kam kaum jemand an. Kopfschüttelnd folgte ich Joshua und seinem neuen Fanclub in die Fahrtgasse.
Die Sonne schien und wärmte mir angenehm den Rücken. Ich fasste neben Joshua Schritt, um mich nach seinem bisherigen Schultag zu erkundigen: »Und du? Auch neue Leute gefunden?«
»Klar. Ich wollte nur nach dir sehen. Außerdem treffen sich die meisten gerade, um zu rauchen, da hatte ich keinen Bock drauf. Bis jetzt kenne ich auch nur meinen Deutschkurs, unser Deutschlehrer ist unser Tutor, also so was wie der Klassenlehrer. Der muss halt alles organisieren. Keine Ahnung, wie die anderen Kurse aussehen«, antwortete er ausführlicher als sonst, was sicher auch an Vanessa lag, die an seinen Lippen hing. Ich würde ihr gerne sagen, wie dämlich das war und dass mein Bruder sich sicher nicht mit einer Zehntklässlerin einlassen würde. Aber natürlich verkniff ich mir das. Ich wollte Freunde finden. Und schonungslose Ehrlichkeit macht einsam.
»Was hast du noch mal für vierstündige Kurse gewählt?«, fragte ich daher diplomatisch. Wegen seines Auslandsjahrs in England startete Joshua ein Jahr später in die Kursstufe als die meisten seiner Mitschüler, aber das kam ihm sehr entgegen. In meinen Augen war er der faulste Gymnasiast unter der Sonne und es blieb mir ein Rätsel, wie er trotz seiner Arbeitshaltung nicht mal an einem englischen Internat durchgefallen war.
Er spielte das Spiel mit und antwortete brav: »Geschichte, Englisch und Chemie.«
Vanessa witterte ihre Chance, sich einzuklinken: »Wow, Chemie. Das ist mir zu schwer. Ich werde wahrscheinlich keine Naturwissenschaft vierstündig nehmen.«
»Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit zu wählen«, antwortete mein Bruder freundlich, aber auch ein wenig herablassend. Was natürlich niemandem außer mir auffiel. Um nicht loszuprusten, öffnete ich meine Vesperbox und biss in das riesige Käsebrot, das Mama mir eingepackt hatte. In Joshuas Gegenwart fühlte ich mich sicher genug, um essen zu können und es ein bisschen zu genießen, mit anderen unterwegs zu sein.
Beim Bäcker kaufte Joshua sich zwei große Pizzastücke, dabei hatte er sicherlich mehr in seiner Dose vorgefunden als ich. Keine Ahnung, wo er das ganze Essen unterbrachte. Leider musste er uns nun verlassen, weil drei Jungen aus seinem Deutschkurs vor dem Darmstädter Hof Centrum standen und ihn zu sich riefen.
»Bis später, Mädels«, rief er nonchalant und ging mit schnellen Schritten davon. Die Gedanken meiner Begleiterinnen verdarben mir beinahe den Appetit. Mit großer Mühe verkniff ich mir ein ›Hört auf, ihm hinterherzugucken und über seinen Hintern nachzudenken‹. Allerdings lenkte es mich davon ab, dass ich ihn gerne noch ein bisschen als Moderator bei mir gehabt hätte. Obwohl … Gerade bekam ich es auch ohne ihn hin.
»Ist das dein großer Bruder?«, fiel Annalena gleich über mich her. Ich konzentrierte mich auf das, was sie sagte.
Was gar nicht so einfach gestaltete, weil sie sich anscheinend schon Hals über Kopf in Joshua verguckt hatte und ihre Gedanken mich förmlich anschrien: Wow, sieht der süß aus! Er ist so nett! Und wie er mich angeschaut hat …
»Ja, ist er. Wenn ich dir einen Rat geben darf, verlieb dich lieber nicht in ihn. Er wechselt die Freundinnen wie die Unterhosen. Ich glaube, er hat es noch nie mit einem Mädchen wirklich ernst gemeint. Tut mir leid, dass ich das so drastisch sagen muss. Aber ich kenne ihn sehr gut.«
Sie schob die Unterlippe vor. »Na ja, er ist sowieso zu alt für mich. Aber du kannst nicht abstreiten, dass er echt schnuckelig aussieht.«
Darüber wollte ich wirklich nicht reden, also hielt ich einfach den Mund.
Sie sprach schon weiter: »Was war das eigentlich mit Milán vorhin? Er hat dich so ewig angeschaut, keine Ahnung. Das hab ich noch nie bei ihm gesehen. Eigentlich guckt er nicht mal unsere Lehrer wirklich an. Und wenn, dann finster. Hat er mit dir gesprochen?«
»Nee. Habs aber auch nicht drauf angelegt. Vanessa meinte ja, er wäre nicht ganz dicht. Und er wirkt tatsächlich ein bisschen seltsam auf mich. Wisst ihr denn gar nichts über ihn? Ich meine, er war doch schon eine paar Wochen mit euch an der Schule.« So gesprächig verhielt ich mich sonst nicht, aber Milán hatte, schon länger als die Mädchen ahnten, mein Interesse geweckt und ich würde mir sicher nicht die Blöße geben und ihn selbst befragen.
Zurück auf dem Schulhof beeilten wir uns, weil es bereits zum ersten Mal geklingelt hatte. Obwohl ich heute Nacht gefürchtet hatte, wieder unbeabsichtigt jeden wegzustoßen, führte ich im Augenblick ein richtiges Mädchengespräch mit echten Mädchen. Ich sollte ein Kreuzchen in meinen Taschenkalender machen.
Vanessa packte raschelnd den Rest ihrer Brezel zurück in die Papiertüte und erzählte bereitwillig, was sie wusste: »Natürlich ist der nicht ganz dicht. Er hat mit niemandem ein Wort gewechselt, außer Hallo und Tschüss. Er ist schon fast siebzehn, er ist letztes Jahr sitzengeblieben. An seiner alten Schule soll er früher anders gewesen sein, jedenfalls bevor er geflogen ist. Ein paar von uns sind im Sommer heimlich zu seinem Haus gefahren. Er wohnt gegenüber vom Bergfriedhof in einer Villa, ziemlich weit oben am Waldrand. Sieht von außen aus wie ein Spukhaus, voller Efeuranken und ganz schön düster. Wir haben nur geguckt, dabei hätte ich gern mal geschellt, aber bestimmt hätte er uns nicht reingelassen.«
Sie machte eine Pause, während der sie sich die Brezeltüte unter den Arm klemmte und ihre Sprudelflasche aufschraubte. Sie hob den Zeigefinger, damit wir warteten, trank einen Schluck und führte ihre Erzählung fort: »Einmal hab ich hier in der Schule seinen Vater gesehen, auf dem Sekretariat. Sah für sein Alter sehr gut aus, aber Gott, war der Furcht erregend. Hat jeden mit seinem Blick durchbohrt, der ihn angesehen hat. Timo meinte, der Typ hat ihn angestarrt, als würde er alles über ihn wissen. Und Timo hat vor niemandem Angst.«
Aha. Meine Augenbrauen wanderten immer weiter nach oben.
Dass sie Milán lieber nachspionierten, als mal über ihren Schatten zu springen und mit ihm zu reden, empörte mich. Daher klang ich giftiger als beabsichtigt: »Das ist alles? Keiner hat sich die Mühe gemacht, Milán mal anzusprechen, was er so macht und so weiter?« Ich staunte über mich selbst. Normalerweise ging ich Konflikten aus dem Weg. Gefühle wie Wut machten mir Angst. Ich gab ihnen wenig Raum und wenn andere sie zeigten, konnte es passieren, dass ich mich irgendwo verkroch. Aber jetzt hatte ich plötzlich den Mumm, Fremden Vorhaltungen zu machen. Was vielleicht nicht sehr klug war, wenn ich mich nicht wieder auf ein Schuljahr im sozialen Exil einstellen wollte. Sofort ruderte ich zurück. »Ähm, also das war jetzt kein Vorwurf an euch, ich verstehe es nur nicht.« Meine Hände zitterten wieder. Ich hielt meine Brotdose fest umklammert.
»Versucht haben es schon ein paar von den Jungs und Vanessa auch, aber er hat immer abgeblockt. Er hat eine Art an sich, dass man sich ihm eigentlich gar nicht nähern will«, gab Annalena zu. Sie wollte noch mehr sagen, kniff aber den Mund zusammen. Ich hörte es trotzdem: Ich habe ein bisschen Angst vor ihm.Ich kann ihn nicht durchschauen.
Das konnte ich ihr nicht verdenken. Als Antwort nickte ich. Seine ungewöhnlichen blaugrünen Augen kamen mir wieder in den Sinn. In dem kurzen Moment, in dem ich ihm ins Gesicht gesehen hatte, hatten sie sich mir eingeprägt. Um die schwarze Pupille lag ein tiefgrüner Ring, während der Rest seiner Iris blau, fast schon türkis, schimmerte. Doch er hatte mich dazu gebracht, schnell wegzuschauen und einen gewissen Abstand zwischen ihn und mich zu bringen. Ich fürchtete mich nicht direkt vor ihm wie meine Mitschüler, aber ich wollte ihm keinen Grund geben, sauer auf mich zu sein. Irgendwie erinnerte er mich an meine Cousine Amélie. Irmgard hatte einmal gesagt, sie wäre eine Eiskönigin, aber Amélie hatte einfach gewusst, dass sie früh sterben und allen anderen damit Schmerz zufügen würde, wenn sie sie zu nahe an sich herangelassen hätte. Jedenfalls hatte sie mir das einmal erzählt. Annalena und Vanessa liefen vor zur Toilette, während ich langsamer in Richtung Schulhaus ging. Ich ließ meine Gedanken zu dem Tag zurückschweifen, an dem ich den Beweis dafür bekommen hatte, dass auch ich etwas ausstrahlte, das andere Leute fernhielt.
Es war der Tag gewesen, an dem meine Cousine beerdigt wurde. Ende Mai, es war sonnig, erstes Freibadwetter.
Obwohl ich erst fünf gewesen war, hatte sich alles damals in mein Gedächtnis eingebrannt. Die lange, stille Autofahrt zur Familie nach Heidelberg, das Meer von trauernden, schwarz gekleideten Menschen, die mit bunten Blumen bemalte Urne, die schiere Verzweiflung auf dem Gesicht meiner Tante. Und über allem: Amélie selbst. Amélie, die mit trauriger Miene ihrer eigenen Beerdigung beiwohnte, unsichtbar für alle. Für alle außer mir.
Sie hatte sich hinter einer Säule verborgen, neben meinem Sitzplatz in der Einsegnungshalle. Nur ich konnte damals sehen, wie sie mir traurig zulächelte, ihrer Mutter die Hand auf die Schulter legte und ihren Vater umarmte, ohne dass er es wahrnahm. Wie sie neben ihnen her schritt, ihrer eigenen Urne hinterher.
Amélie war wie eine große Schwester für mich gewesen, zehn Jahre älter und immer viel cooler, als ich es je sein würde. Das hatte ich schon früher gewusst, als sie gestorben war. Für mich war sie nie eine Eiskönigin, sondern meine beste und einzige Freundin. Und sie hatte mich nicht verlassen. Sie blieb bis heute bei mir und hatte an diesem Tag meine Sicht der Dinge gründlich geändert. Ich lernte an diesem Tag, dass alles, was ich sah, wirklich existierte und dass die Welt für mich größer und voller war als für andere Menschen. Das war großartig und erschreckend zugleich. Amélie und all die anderen gingen nicht für immer fort, sie hatten lediglich ihren sterblichen Körper im Diesseits zurückgelassen und blieben mir aufs Engste verbunden, bis ich eines Tages ebenfalls ins Jenseits hinübergehen würde. Trotzdem wäre es tausendmal schöner, wenn Amélie noch leben würde. Ich hoffte wirklich, dass Milán ihr Schicksal erspart blieb. Das wünschte ich niemandem.
Ich hatte mich so in meinen Erinnerungen verloren, dass ich den Weg ins Klassenzimmer eher unbewusst zurückgelegt hatte. Milán saß auf seinem Platz und zeichnete. Frau Winter stand in den Startlöchern, die Spinde zu verteilen. Auffordernd klapperte sie mit einer Holzkiste voller Schlüssel, bis das letzte Geflüster aufgehört hatte. Neugierig linste ich herüber zu Miláns Zeichnung. Er hatte sie erweitert, sodass sie nun fast das gesamte Blatt einnahm. Ich bestaunte den natürlich aussehenden Baum mit den vielen geschwungenen Ästen, der kaum belaubt, dafür aber mit exotischen Paradiesvögeln bestückt war. Dabei sahen sie so echt aus, als würden sie gleich lebendig werden und aus dem Papier herausfliegen. Einer erinnerte mich an diese grünen Papageien, die sich in Heidelberg eingebürgert hatten. Ich musste den Papagei ziemlich genau betrachtet haben, denn Miláns Züge umspielte ein leichtes Lächeln, das den harten Ausdruck in seinem Gesicht verwandelte. Wenn er lächelte, sah er gar nicht mehr unnahbar und einschüchternd, sondern vertraut aus. Ohne nachzudenken, lehnte ich mich näher. Milán sagte immer noch nichts, begann aber, die Vögel auf dem Blatt sorgfältig zu beschriften.
»Webervogel« stand unter einem Vogel, der ein kunstvolles, kugelförmiges Nest an einem Ast baute, »Halsbandsittich« schrieb er neben den fliegenden Papagei. Ah! Halsbandsittich! Wenn ich das nächste Mal auf den Bergfriedhof ging, um die zahlreichen Omas, Opas, Uromas, Uropas und Urgroßonkel zu besuchen, würde ich nach ihnen Ausschau halten. Dort gab es nämlich eine kleine Kolonie. Ich lächelte nun ebenfalls. Es erfüllte mich mit ungekannter Wärme, Milán auf einmal so nahe zu sein und vielleicht das Eis zu brechen. Ermutigt riss ich ein Stück Papier hinten aus meinem Block heraus und schrieb in meiner großen, unordentlichen Schrift darauf: Tolle Vögel!
Den Zettel schob ich zu ihm herüber und wartete gespannt auf seine Reaktion.
Sein Lächeln vertiefte sich und offenbarte weiße Zähne und niedliche Kringel in den Mundwinkeln.
Ich musste mich krampfhaft davon abhalten, ihn anzugaffen wie Annalena vorhin meinen Bruder. Das Letzte, was ich wollte, war eines dieser hirnlosen Hühner zu sein, die einem Typen aus der Hand fraßen, sobald er ihnen ein wenig freundliche Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ. Das hatte ich, wenn auch unfreiwillig, bereits oft genug miterleben müssen.
Milán drehte das Papierchen um und schrieb tatsächlich etwas darauf. Es fühlte sich an wie ein kleiner Sieg. Bis ich den Brief umdrehte.