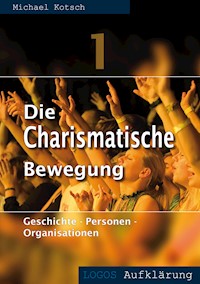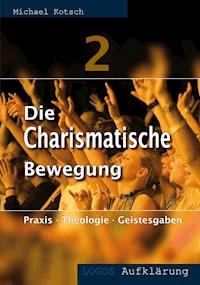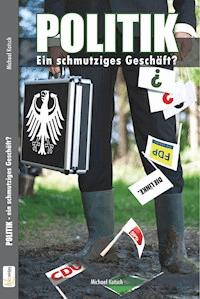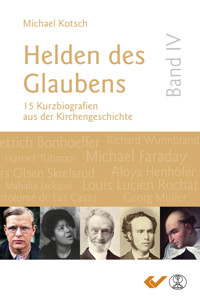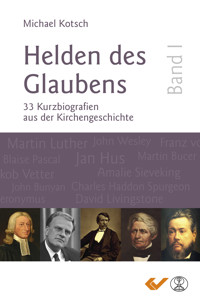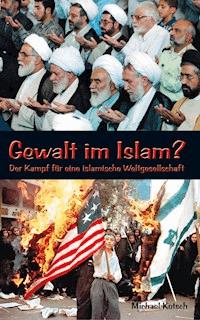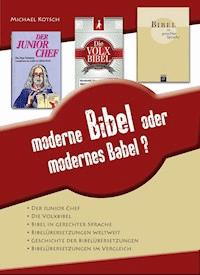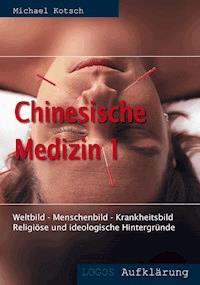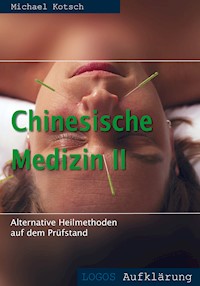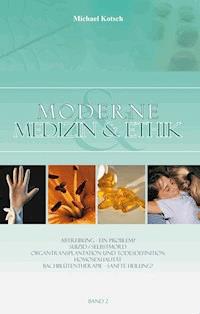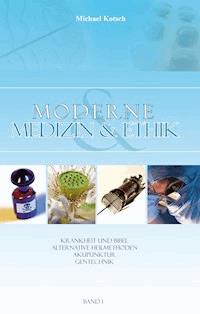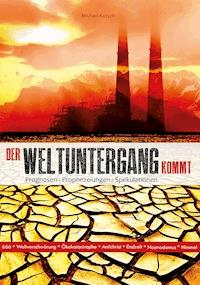Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Auch im dritten Band von Helden des Glaubens kommen Christen aus fast allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte repräsentativ zur Sprache. Darunter sind Prediger, Philosophen, Naturwissenschaftler, Militärs, Sozialreformer, Professoren, Reformatoren und Missionare. Sie stammen aus Deutschland, England, Dänemark, der Schweiz, den USA und Indien. Sie alle wollten mit ihrem Leben Gott ehren. In ihrer Andersartigkeit fordern sie heute lebende Menschen dazu heraus, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was gegenwärtig so natürlich und selbstverständlich erscheint, es mit dem Blick auf die Bibel aber nicht sein sollte. Diese Kurzbiografien eignen sich, um einen schnellen Überblick über das Leben engagierter Christen zu gewinnen. Von der gewählten Länge her bieten die Lebensbilder genügend Material für eine Vorstellung im Schulunterricht oder im Hauskreis, in einer Frauen- oder Jugendstunde. U. a. mit Philipp Melanchthon, Isaac Newton, Søren Kierkegaard, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Solche Lebensbilder ermutigen. Der lebendige Gott wirkt mächtig in ganz verschiedenen Typen. Oft waren es auch ganz einfache Leute, mit manchen Schwächen behaftet. Doch das Wort Gottes wirkte völlig Neues. Es stimmt: Wer an Jesus glaubt, von dem fließen Ströme lebendigen Wassers. Auch bei uns möchte Gottes Geist viel Frucht schaffen. Jeder ist dabei ein Original.“
Winrich Scheffbuch
Mitgründer der Hilfswerke „Hilfe für Brüder“ und
„Christliche Fachkräfte International“
„Die Bände 1 und 2 habe ich mit meiner Frau gemeinsam gelesen. Die Beschreibungen der Lebensläufe von Menschen, die Gott berufen hat, ihren Mitmenschen ein Hinweis auf den wahren Gott zu sein, hat uns sehr inspiriert und unser Leben mit Jesus beflügelt. Ein Leben mit Jesus ist spannend, wie die Biografien der ‚Helden des Glaubens‘ zeigen. Ihr Vorbild macht Mut, mit Gottes Hilfe die Spannungen des Lebens zu meistern. Ihr Vorbild fordert heraus, in allen Bereichen des Lebens ganz Christ zu sein, wie Lukas es in Apostelgeschichte 15,26 schreibt: ‚… die ihr Leben ganz für unseren Herrn Jesus Christus eingesetzt haben.‘“
Joachim Loh
Unternehmer und Christ
„Ich lese mit Begeisterung, welche Originale Gott durch sein Wort und seinen Geist in vergangenen Zeiten geschaffen und geformt hat. Dadurch wächst meine Freude darauf, dass er auch heute und in Zukunft sein Werk an uns und durch uns tut.“
Ulrich Parzany
früherer Generalsekretär des CVJM
Bildnachweis
Sämtliche Fotos – wenn nicht anders ausgewiesen – sind gemeinfreibzw. lizenziert unter cc-by-sa-3.0 bzw. 2.5 oder 2.0, WikimediaCommons. Nähere Angaben am Ende des Buches.
Kotsch, Michael
Helden des Glaubens
12 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte – Band III
Best.-Nr. 275545 (E-Book)
ISBN 978-3-98963-545-6 (E-Book)
Soweit nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzungverwendet: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R. Brockhaus in derSCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
1. Auflage (E-Book)
© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg
Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben,können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]
Inhalt
Vorwort und Einleitung
Geschichte lohnt sich
1Justin der Märtyrer (100–165)
– Philosophisch für Gott argumentieren
2Ansgar (801–865)
– Missionar des Nordens
3Philipp Melanchthon (1497–1560)
– Engagement für Toleranz und Wahrheit
4Isaac Newton (1643–1727)
– Der Physiker Gottes
5Johann Albrecht Bengel (1687–1752)
– Jeder Buchstabe der Bibel ist ein Schatz
6Elizabeth Fry (1780–1847)
– Ein Herz für Gefangene
7Johann Hinrich Wichern (1808–1881)
– Ein Rettungshaus für Hamburg und den Rest der Welt
8Søren Kierkegaard (1813–1855)
– Philosophischer Glaube und Kritik kirchlicher Tradition
9Henry Dunant (1828–1910)
– Ein Träumer gründet das Rote Kreuz
10General Charles Gordon (1833–1885)
– „Entdecker“ des Gartengrabes
11Charles Thomas Studd (1860–1931)
– Radikales Leben für die Weltmission
12Bakht Singh (1903–2000)
– Neutestamentliche Gemeinden für Indien
Bildnachweise
Vorwort und Einleitung
Inzwischen sind die ersten beiden Bände von Helden des Glaubens bereits in mehreren Auflagen erschienen. Immer wieder bekomme ich positive Rückmeldungen und Anregungen für meine weitere Arbeit an Porträts prägender Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte. Natürlich freut es mich sehr, dass meine mit erheblichem Aufwand zusammengestellten Bücher gelesen werden und offensichtlich vielen Christen zur Horizonterweiterung und auch zur persönlichen Ermutigung dienen.
Im hier vorliegenden dritten Band der Helden des Glaubens finden sich weniger, dafür ausführlichere Lebensbilder. Dabei handelt es sich noch immer um Kurzbiografien, die faktisch zuverlässig, aber doch eben auch leicht und schnell lesbar sein sollen. Allerdings habe ich mich diesmal entschieden, die vorgestellten Personen mit etwas mehr Details aus ihrem Leben und Denken zu porträtieren.
Erneut finden sich in diesem Band der Helden des Glaubens typische und prägende Vertreter ihrer Epoche. Insofern ist das Buch nicht nur eine Biografie-Sammlung, sondern gleichzeitig auch eine chronologische Darstellung der Kirchengeschichte. Hier kann man Christen aus vergangenen Jahrhunderten literarisch begegnen. Immer stehen die Porträtierten dabei auch für spezifische Fragen und Vorstellungen ihrer Zeit.
Wie schon beim ersten und zweiten Band, so gilt natürlich auch hier: Über die Auswahl der dargestellten Personen kann man verschiedener Meinung sein. Bei den Vorarbeiten fiel es mir nicht immer leicht, mich für eine Person und damit gegen viele andere zu entscheiden. Ganz sicher gibt es noch weit mehr Christen, an die es sich durchaus zu erinnern lohnt. Geplant ist für die kommenden Jahre immerhin auch noch ein vierter Band der Helden des Glaubens, in dem voraussichtlich weitere bedeutende Personen der Kirchengeschichte von mir besprochen werden.
Auch im dritten Band von Helden des Glaubens kommen Christen aus fast allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte repräsentativ zur Sprache. Darunter sind Prediger, Philosophen, Naturwissenschaftler, Militärs, Sozialreformer, Professoren, Reformatoren und Missionare. Sie stammen aus Deutschland, England, Dänemark, der Schweiz, den USA und Indien. Natürlich sind auch sie nur fehlerhafte und doch begabte Menschen, die dennoch von Gott gebraucht wurden, um seine Gemeinde in dieser Welt zu bauen und zu prägen. Sie alle wollten mit ihrem Leben Gott ehren. Dieses Anliegen wird sicher auch durch ihre hier stattfindende Vorstellung unterstützt.
In diesem Buch geht es mir nicht so sehr um eine umfassende Biografie des betreffenden „Helden“. Aufgrund der beabsichtigten Kürze müssen an dieser Stelle natürlich viele Aspekte ihres Wirkens unter den Tisch fallen. Das gleiche gilt für manche problematischen Aussagen und Verhaltensweisen der beschriebenen Personen. Primär habe ich mich bei meiner Darstellung auf den Lebenslauf, die wesentlichen Glaubensüberzeugungen und auf das konzentriert, was diese Helden des Glaubens für Christen des 21. Jahrhunderts Positives und Herausforderndes hinterlassen haben. Manchmal betrifft das vermutlich auch Aspekte, die heute lebenden Menschen fremd und seltsam erscheinen, obwohl sie oftmals durchaus in der Bibel zu finden sind.
Vielleicht ist es gerade ein Kennzeichen echter Helden des Glaubens, dass sie keine perfekten Menschen waren. Denn gewöhnlich gebraucht Gott fehlerhafte Individuen, zu biblischen Zeiten ebenso wie in der Kirchengeschichte. So wird David als „Mann nach dem Herzen Gottes“ bezeichnet (Apostelgeschichte 13,22), obwohl er in seiner Laufbahn fast keine Sünde ausgelassen hatte, von Lüge und Raub bis zu Ehebruch und Mord. So ist auch nicht jeder Aspekt der hier vorgestellten Personen vorbildlich oder biblisch richtig. Doch trotz ihres begrenzten Lebens und Denkens haben diese Menschen durchaus positive Spuren hinterlassen.
Natürlich gibt es immer auch konfessionelle und zeitgeschichtliche Besonderheiten jeder Person, die von mir bei diesen Lebensbildern aber nur beiläufig erwähnt werden. Offensichtlich kann man beispielsweise von einem Menschen des Mittelalters nicht ernsthaft erwarten, dass er wie ein Christ des 21. Jahrhunderts denkt oder lebt. Vielleicht liegt hier aber auch gerade ein besonderer Reiz für die Beschäftigung mit Glaubenden vergangener Zeiten. In ihrer Andersartigkeit fordern sie heute lebende Menschen dazu heraus, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was gegenwärtig so natürlich und selbstverständlich erscheint, es mit dem Blick auf die Bibel aber nicht sein sollte.
Um mögliche Missverständnisse gleich zu Beginn zu vermeiden, hier noch ein Wort zu den Wunderberichten, die gerade in den Lebensbeschreibungen früher Christen häufig anzutreffen sind: Aus heutiger Sicht und im Blick auf die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von frühchristlichen und mittelalterlichen Mirakelerzählungen ist die Grenze zwischen echter Historizität und legendarischer Ausschmückung einer Vita kaum mehr eindeutig festzustellen. Jedenfalls unterstreichen sie die Bedeutung der vorgestellten Person und stehen vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit Umständen, die auf ein außergewöhnliches Wirken Gottes durch diese Person hinweisen. Ob sich solche Wunderberichte – an die biblische Überlieferung anknüpfend – einfach als „Gepflogenheit“ eingebürgert haben, kann man berechtigterweise vermuten, aber auch nicht von vorneherein unterstellen. Ein wunderbares Eingreifen Gottes in der Geschichte sollte eben auch nicht prinzipiell ausgeschlossen werden, wie es bei rationalistisch orientierten Historikern gewöhnlich geschieht.
Auf Literaturverweise und theologische Fachbegriffe wurde so weit wie möglich verzichtet, um das Buch für ein möglichst großes Publikum lesbar zu machen. Es wird hier auch nicht jede Nuance einer vorgestellten Person beleuchtet oder jede momentan in der historischen Forschung laufende Diskussion aufgegriffen.
Die in den entsprechenden Kapiteln angeführten Zitate stammen überwiegend von der dort porträtierten Person. In einzelnen Fällen wurden Orthografie und Formulierungen an die heute übliche Ausdrucksweise angeglichen, ohne den Inhalt dabei wesentlich zu verändern.
Diese Kurzbiografien eignen sich, um einen schnellen Überblick über das Leben engagierter Christen zu gewinnen. Von der gewählten Länge her bieten die Lebensbilder genügend Material für eine Vorstellung im Schulunterricht oder im Hauskreis, in einer Frauen- oder Jugendstunde. Sie informieren schnell und wecken manchmal auch Neugierde auf mehr. Jeweils vier Literaturhinweise bieten einen Ansatz für die intensivere Beschäftigung mit der betreffenden Person.
Als Anregungen zum Weiterdenken wurden am Ende jeder Kurzbiografie einige Thesen formuliert, die sich aus dem Leben und Denken der vorgestellten Person ergeben. Dabei handelt es sich nicht um theologisch abgesicherte Darlegungen, sondern um den Versuch, einige geistliche Aspekte, die den Porträtierten wichtig waren, für die Situation des heute lebenden Lesers fruchtbar zu machen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und persönlichen Gewinn beim Eintauchen in das spannende Leben christlicher Männer und Frauen aus den vergangenen zwanzig Jahrhunderten.
Michael Kotsch
Geschichte lohnt sich
2000 Jahre Handeln Gottes mit Menschen umfasst die Kirchengeschichte. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Zeit können wir Gott besser kennenlernen und nacherleben, wie er Geschichte gestaltet, Schritt für Schritt auf sein Ziel mit der Welt zugeht und in das Leben von einzelnen Menschen eingreift.
Durch die Kirchengeschichte lernen wir zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich unabdingbar zum christlichen Glauben gehört, und dem, was kulturell und geschichtlich geprägt, also zeit- und ortsabhängig ist. Wir lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.
„Warum gibt es so viele Kirchen?“ – „Warum haben Christen Hexen verbrannt und Kreuzzüge durchgeführt?“ – „Was wollte Luther eigentlich?“ … Mit solchen und ähnlichen Fragen werden Christen häufig in der Gemeinde und auf der Straße konfrontiert. Kirchengeschichte will Antworten darauf geben und dadurch Orientierung vermitteln sowie Hilfen für darauf bezogene Gespräche bieten.
Lernen können wir beispielsweise von den Missionsprinzipien der Christenheit im Frühmittelalter und im 18./19. Jahrhundert. Auch Luthers reformatorische Erkenntnis von der Rechtfertigung des Sünders ist wichtig für unsere Tage, ebenso Calvins Betonung der Ethik, Wesleys Evangelisation, Fliedners Diakonie usw. Kirchengeschichte kann so zum Ansporn für eigene Aktivitäten werden.
Das Leben von Christen in der Vergangenheit kann und soll als Vorbild dienen. Wir werden herausgefordert, ihrer Bereitschaft, auf Gott zu hören, ihrer Korrekturfähigkeit, ihrer Hingabe oder ihrer Konsequenz nachzueifern. Negative Vorbilder können uns davor warnen, eigene Macht und eigenes Ansehen zu suchen, zu viele Kompromisse zu schließen oder Konflikte durch Gewalt zu lösen.
Wenn wir sehen, wie Gott über Jahrhunderte hinweg in die Geschichte eingegriffen hat, Christen geführt und bewahrt, scheinbar aussichtslose Situationen verändert, Menschen erneuert und die Welt trotz aller Bedrohungen erhalten hat, dann stärkt das unser Vertrauen in die Macht, in die Liebe und in die Zuverlässigkeit Gottes. Gott ist derselbe damals und heute; so wie er vor Jahrhunderten helfend und tröstend eingegriffen hat, tut er es auch heute noch.
Indem wir beobachten, wie Christen in anderen Zeiten und anderen Kulturen gelebt haben, müssen wir anerkennen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, als ernsthafter Gläubiger zu leben. So gewinnen wir positiven Abstand zu unserer eigenen Tradition und Lebensweise, unserer Kleidung, unserer Musik, der Art und Weise, Gottesdienst zu feiern, den Tag einzuteilen oder die Freizeit zu gestalten. Plötzlich fällt die Vielfalt möglicher Ausdrucksformen eines konsequent christlichen Lebens viel stärker ins Auge. Wenn wir bemerken, dass nicht jede unserer Überzeugungen und Handlungsweisen die einzig mögliche für Christen ist, dann können wir eher Menschen in ihrer Andersartigkeit akzeptieren und uns selbst in Fragen korrigieren lassen, die von unserer Zeit und Kultur geprägt sind, von denen wir bisher aber annahmen, dass sie unabdingbar zum Glauben gehören.
1
Justin der Märtyrer
(100–165)
Philosophisch für Gott argumentieren
Viele Menschen geben lediglich vor, sich für den Sinn des Lebens zu interessieren. Zumeist dominiert bei ihnen weit mehr die Sorge um ein kurzfristiges, irdisches Glücksgefühl. Wer wirklich und ernsthaft nach der Wahrheit sucht, der hat gute Chancen, auf diesem Weg auch fündig zu werden. Allerdings braucht man dazu entsprechende Ausdauer und den Mut, eigene Irrtümer einzusehen. Wie sich ein Mensch im ersten Jahrhundert konsequent auf die Suche nach der letzten Wahrheit machte und dabei fündig wurde, zeigt diese Lebensgeschichte des wahrscheinlich ersten christlichen Philosophen.
Kindheit im Heiligen Land
Justin wurde um das Jahr 100 n. Chr. herum als Sohn eines gewissen Priscus in der Stadt Flavia Neapolis geboren (heute Nablus/palästinensisches Autonomiegebiet). Seine Eltern waren römische Bürger. Die Ortschaft im damaligen Palästina und heutigen Israel war 72 n. Chr. – nach Ende des Jüdischen Kriegs von Kaiser Vespasian als Bollwerk gegen extremistische Juden – gegründet worden. Sie lag nahe an den Ruinen des ehemaligen samaritanischen Heiligtums von Sichem. Das geografische und kulturelle Umfeld des frühesten Christentums war Justin aufgrund seines Heimatortes bestens vertraut.
Nablus im 19. Jahrhundert
Justin wuchs mit der offiziellen römischen Staatsreligion und ihrer mythologischen Götterwelt auf und erhielt eine klassischphilosophische Schulbildung. Er war ein neugieriger, aber auch skeptischer Jugendlicher. Ihm genügte es nicht, einfach nur die elterliche Tradition zu übernehmen.
In seiner Jugend setzte Justin sich mit verschiedenen, damals verbreiteten Weltanschauungen1 auseinander. Zeitweilig schloss er sich einem Stoiker2 an, der ihm allerdings nichts Sinnvolles über Gott sagen konnte. Ein Peripatetiker3 ließ schon bald erkennen, dass er vor allem am Geld seiner Schüler interessiert war. Zeitweilig lernte Justin auch bei einem Pythagoreer4 und einem gelehrten Platoniker5. Schließlich zog sich Justin in einen kleinen Ort am Mittelmeer zurück, um dort in Ruhe über all die philosophischen Entwürfe nachdenken zu können. Hier traf er auf einen alten Mann, der ihm mit Begeisterung von der „Philosophie“ alttestamentlicher Propheten erzählte. Justin fühlte sich dadurch zutiefst angesprochen. Einige der bisher noch unbeantworteten Lebensfragen klärten sich nun.
Bekehrung durch christliche Philosophie
Viele plausible Erkenntnisse der Philosophie fand Justin im christlichen Glauben bestätigt. Einen Teil der göttlichen Wahrheit hatten demnach bereits die griechischen Philosophen erkannt, beispielsweise das Wesen der menschlichen Seele oder die Gerechtigkeit Gottes. Zur vollständigen Erkenntnis der geistlichen Zusammenhänge und des Wesens Gottes sei der normale Mensch allerdings nicht in der Lage, war Justin überzeugt. Ohne den Heiligen Geist und die Offenbarung Gottes sei es schlichtweg unmöglich, diese letzten Dinge korrekt zu erkennen. Hier kommen für ihn die alttestamentlichen Propheten und die Jünger Jesu ins Spiel. Sie sind übernatürlich berufene Menschen, die vom Geist Gottes geführt Wahrheiten aufschrieben, die nicht allein irdischen Überlegungen entsprangen. Insofern verbindet der christliche Glaube, nach Justin, sowohl höchste philosophische Erkenntnis als auch authentische Offenbarung Gottes. Tatsächlich hätten geniale Denker wie Sokrates oder Plato bereits in ihrer Zeit wichtige Gedankenanstöße durch die alttestamentlichen Propheten erhalten. Die Idee des Wesens Gottes, der Schöpfung, der Seele, des „Logos“ usw. hätten sie von Mose übernommen, war Justin überzeugt. „Dies ist die einzige wirklich zuverlässige und nützliche Philosophie, die ich gefunden habe.“
Lebenslang schätzte Justin die Philosophie. Er hielt das konsequente Denken für einen idealen Zugang zu Gott. Seiner festen Überzeugung nach ist aber allein der christliche Glaube letztlich die einzige wirklich zuverlässige Philosophie. Vor allem die innere Stimmigkeit der Bibel und die Furchtlosigkeit der Christen angesichts ihrer unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung überzeugten Justin schließlich. Außerdem imponierten ihm die Authentizität, die Feindesliebe und hohe Moral der frühen Christen. „Die nun, deren Lebenswandel nicht so befunden wird, wie Jesus gelehrt hat, sollen nicht als Christen angesehen werden, auch wenn sie mit der Zunge die Lehre Christi bekennen.“
Flucht aus der Heimat
Kurz nach der Bekehrung zum christlichen Glauben musste Justin seine Heimat höchstwahrscheinlich infolge des jüdischen Bar-Kochbar-Aufstandes (132–136) verlassen. Nachdem die römische Armee diese messianische Revolte niedergeschlagen hatte, wurden Juden scharf verfolgt und oftmals ganz aus ihrem Land vertrieben. Ein Aufenthalt in Jerusalem wurde Juden strikt untersagt. Im Zusammenhang mit diesen Unterdrückungsmaßnahmen gingen die römischen Behörden auch gegen Christen vor, die man oftmals irrtümlich als eine jüdische Sekte betrachtete. Auch schon während des Aufstandes verließen viele Christen das Land, weil sie von fanatischen Juden gefoltert wurden und zum Widerruf ihres Glaubens gebracht werden sollten.
Justin verbrachte daraufhin eine längere Zeit in Kleinasien und Griechenland. Insbesondere Ephesus und Korinth werden in seinen Schriften mehrfach genannt.
In den 150er-Jahren zog Justin in die Hauptstadt, also nach Rom, und eröffnete dort eine christlich geprägte Philosophenschule. Geeignete Räume mietete er oberhalb des Timotinischen Bades, wie zeitgenössische Quellen angeben. In seiner Lehrtätigkeit war Justin weitgehend unabhängig von der örtlichen Kirchenleitung. Wie es sich in der Antike für echte Philosophen gehörte, lehrte auch Justin kostenlos. Bei dieser Tätigkeit sollte es eher selbstlos darum gehen, Menschen zur Wahrheit zu führen, als seinen eigenen Lebensunterhalt zu sichern.
Das Wesen der Philosophie
Mit seiner philosophischen Lehre will Justin nicht nur informieren, sondern überzeugen und Menschen zu einem wahrhaftigen, christlichen Leben bewegen. Die von ihm praktizierte Philosophie sollte keine rein akademische Fachwissenschaft sein. Justin ging es weit mehr um grundlegende Lebensfragen und um praktisch anwendbare Prinzipien. Irgendwie betrachtet Justin „alle Menschen, die der göttlichen Vernunft gemäß gelebt haben“, als „Gläubige“, sowohl die alttestamentlichen Propheten als auch die griechischen Philosophen. Sie haben dem vertraut, was Gott ihnen in ihrer Zeit mitgeteilt hat. Natürlich werden auch sie letztendlich nur durch Jesus Christus gerettet. Echte Vernunft und nicht nur intellektueller Selbstbetrug, das ist für Justin nur bei dem Gott zu finden, der sich in der Bibel den Menschen offenbart hat. „Wer wirklich fromm und philosophisch empfindet, dem empfiehlt die Vernunft, die göttliche Wahrheit allein zu ehren und zu lieben. Er wird es ablehnen, bloß überkommenen Meinungen zu folgen, wenn er erkennt, dass sie verkehrt sind.“
Für Justin ist der christliche Glaube eine logische, allgemein einsichtige Wahrheit. Die Bibel selbst ist nicht hinterfragbar und wahr in allen ihren Aussagen. Sie geht unmittelbar auf Gott zurück, der sich darin an die Menschen wendet. Die glaubhaft und vielfach bezeugten Wunder Jesu sind für Justin ein sicherer Nachweis seiner Göttlichkeit.
Justin der Philosoph
Überall auf öffentlichen Straßen und Plätzen konnte man in der Antike auf diskutierende Philosophen treffen. Viele von ihnen lebten äußerst bescheiden und konzentrierten sich ganz auf die Suche nach Wahrheit. Auch Justin hielt regelmäßig solche öffentlichen Reden und debattierte mit interessierten Zuhörern. Aufgrund seiner Bildung wurde Justin in Rom allgemein als Philosoph anerkannt. In gewisser Weise waren für ihn diese öffentlichen Gespräche eine legitime Möglichkeit intellektuell anspruchsvoller, christlicher Mission.
Forum Romanum
Auch nach seiner Bekehrung verstand sich Justin als Philosoph. Als äußeres Kennzeichen trug er weiterhin den bekannten Philosophenmantel. Für Justin gab es keinen unüberbrückbaren Zwiespalt zwischen dem christlichen Glauben und echter Philosophie. Allein schon die prinzipielle Möglichkeit gründlichen Nachdenkens führte er auf Gottes Wirken zurück. Justin war es wichtig, seiner Umwelt eine grundsätzliche, intellektuelle Offenheit zu signalisieren. Christen sollten sich nicht durch Denkfaulheit auszeichnen, sondern durch überzeugende Argumente. Gerade darin besteht für Justin eine besondere Stärke des christlichen Glaubens. Er greift allgemein einsichtige Wahrheiten auf und führt sie dann auf einer höheren Ebene nachvollziehbar zusammen. Immer wieder betonte Justin, dass er jederzeit bereit sei, mit allen Menschen zu diskutieren und vorbehaltlos nach Wahrheit zu suchen. Er scheute keine Auseinandersetzung und zog sich auch nicht vorschnell auf nicht begründbare Dogmen zurück. Damit eröffnete er zahlreichen gut gebildeten Römern den Weg zum christlichen Glauben.
In einer Diskussion bezog sich Justin beispielsweise auf Jesu Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Auch der Verstand und das Wissen um die Wahrheit der Bibel seien solche Gaben Gottes. Der Christ sei nun verpflichtet, dieses Wissen bestmöglich einzusetzen, argumentiert Justin. Natürlich kann man niemanden dafür verantwortlich machen, wenn Zuhörer der Wahrheit Gottes keinen Glauben schenken. Trotzdem aber soll man seiner Verantwortung nachkommen und die Wahrheit christlichen Glaubens bestmöglich jedem erklären, der dazu bereit ist.
Justin der Schriftsteller
Justin verfasste seine apologetischen Schriften, um Christen zu helfen, über ihren Glauben zu sprechen, und um Suchenden beim Weiterdenken behilflich zu sein. In seinen Abhandlungen bemüht sich Justin, möglichst sachgemäß auf alle Fragen einzugehen, die damals zwischen Christen und ihren Gegnern diskutiert wurden.
Der Aufbau von Justins Schriften ist nicht immer einfach nachzuvollziehen. Wie oftmals auch in realen Diskussionen springt er gelegentlich von einem Thema zum nächsten oder geht erst einmal auf Nebenargumente ein, ehe er wieder zur ursprünglich gestellten Frage zurückkehrt.
Justin, Werke
In seiner Apologie widmet sich Justin ausführlich der Spannung zwischen menschlicher Willensfreiheit und göttlichem Determinismus. Auch antike Philosophen diskutierten diese Frage. Dabei tendierten die Stoiker eher zum Fatalismus. Alles sei schlussendlich festgelegt. Der Mensch sei seinem Schicksal quasi machtlos ausgeliefert. Justin betont demgegenüber die Willensfreiheit des Menschen – auch noch nach dem Sündenfall. Zwar habe Gott einen Heilsplan und erwähle Menschen für sein Reich. Darüber hinaus aber habe jeder die Möglichkeit und damit auch die Verantwortung zur Bekehrung und zum Gehorsam. Gott zeige allen Menschen ihre Schuld auf und biete ihnen dann Sündenvergebung an. Unter anderem sieht sich Justin als ein Sprachrohr Gottes, das auf die unbedingte Notwendigkeit von Reue und Bekehrung hinweist. Die Annahme oder Ablehnung der Gnade Gottes bestimmt dann über die Situation der menschlichen Seele nach dem irdischen Tod. Seine schriftstellerische Tätigkeit begriff Justin als konsequente Fortsetzung philosophisch ausgerichteter Reden und Diskussionen über den christlichen Glauben.
Die Wahrheit des Evangeliums
In seinen apologetischen Abhandlungen begründet Justin die Wahrheit des christlichen Glaubens unter anderem mit der großen Zahl erfüllter biblischer Prophetien. Anders sei es schlichtweg nicht erklärbar, dass die Autoren des Alten Testaments Jahrhunderte vorher auf Details des Lebens Jesu hinweisen konnten. Außerdem spielen für Justin die zahlreichen glaubwürdigen Zeugenaussagen der Zeitgenossen Jesu eine erhebliche Rolle. Einige von ihnen waren erst kurz zuvor verstorben. Immer noch konnte man zu Beginn des 2. Jahrhunderts mit Menschen sprechen, die den Jüngern Jesu selbst begegnet waren. Ohne diese authentischen Zeugen käme wohl kaum jemand auf die Idee, in dem gekreuzigten Jesus Christus Gott zu erkennen, der freiwillig zur Bezahlung der menschlichen Sünde starb. Viele der Jünger Jesu waren einfache, wenig gebildete Menschen. Dass sich diese eine solche Geschichte einfach ausgedacht haben könnten, sei äußerst unwahrscheinlich; zumal sie dabei keinerlei persönliche Vorteile hatten, sondern ganz im Gegenteil sogar von ihrem eigenen Volk unterdrückt wurden. Ein weiteres wichtiges Argument für die Wahrheit des christlichen Glaubens sind nach Justin die erstaunlichen Lebensveränderungen bekehrter Christen. Bösartige und verbrecherische Menschen werden zu liebevollen, opferbereiten Gläubigen. So etwas könne man ohne einen realen Eingriff Gottes nicht befriedigend erklären.
Wie schon Paulus im Römerbrief, so betont auch Justin die natürliche Offenbarung Gottes. Durch die Beobachtung der Natur und durch logisches Nachdenken haben die heidnischen „Wegbereiter Christi“ bereits von der Existenz eines einzigen wahren Gottes, von Gut und Böse und der grundsätzlichen Verantwortung des Menschen gewusst. In gewisser Weise könnte man deshalb Philosophen wie Sokrates oder Heraklit als „Christen vor Christus“ bezeichnen. Um aber die ganze Wahrheit verstehen zu können, führe kein Weg am göttlichen „Logos“ (griech.: Wort, Wissen, Weisheit) vorbei. Im eigentlichen Kern sei der Logos identisch mit Jesus Christus (vgl. Johannes 1). Nach dem Tod Jesu finde sich der Logos, die Wahrheit Gottes, vor allem in der heiligen, von Gott geoffenbarten Schrift, dem Alten Testament und den Überlieferungen der Jünger Jesu. Jetzt, wo Gottes ganzer Heilsplan bekannt gemacht worden sei, so Justin, dürfe man allerdings nicht mehr bei der beschränkten Teilerkenntnis antiker Philosophen stehenbleiben. Stattdessen müsse man sich nun vor allem mit den biblischen Aussagen Jesu und seiner Jünger beschäftigen.
Gespräche mit dem Juden Tryphon
Justin entwickelte seine Überzeugung nicht nur in der Auseinandersetzung mit den Entwürfen der antiken Philosophen, sondern auch in Diskussionen mit Juden. In späteren Jahren sah er seine Aufgabe unter anderem darin, Juden die biblische Überlegenheit christlichen Glaubens nahezubringen. In seinem Dialog mit dem Juden Tryphon betont Justin seinem hypothetischen jüdischen Gesprächspartner gegenüber zuerst einmal ihre gemeinsamen Denkgrundlagen: den Glauben an den einen Gott, an die Erwählung, an die Wichtigkeit der menschlichen Seele, die Realität der Sünde, die Heilsgeschichte usw.
Das später literarisch verarbeitete Gespräch mit Tryphon fand vermutlich in einem Mittelmeerhafen statt. Justins Gesprächspartner stellt sich als Jude aus Palästina vor, der das Land nach dem gescheiterten Bar-Kochbar-Aufstand (132–136) verlassen und sich dann in Griechenland niedergelassen hatte. In seiner Auseinandersetzung mit Tryphon lag Justin viel an einer ehrlichen, gegenseitigen Wertschätzung. Trotz aller offen geäußerten Kritik sollten die Argumente sachlich und ohne persönliche Polemik vorgebracht werden. In den Diskussionen konnte Justin immer wieder auf seine detaillierten Kenntnisse der römischen Provinz Palästina zurückgreifen. Ihm waren sowohl die verschiedenen jüdischen Parteien als auch die Spannungen zwischen Juden- und Heidenchristen bestens bekannt.
Justin der Märtyrer
Das Alte Testament ist für Justin die wichtigste Schrift der christlichen Gemeinde. Gerade die jüdischen Propheten sind mit ihren klaren Aussagen über Jesus Christus ein Garant für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Göttliche Autorität haben für Justin darüber hinaus die Reden und das Vorbild Jesu, die man in den vier bis heute bekannten Evangelien findet. Direkt und indirekt bezieht Justin sich immer wieder positiv auf die Briefe des Apostels Paulus. Auch die Johannesbriefe waren ihm wohl bekannt. Justin berichtet, dass christliche Gemeinden zu Beginn des 2. Jahrhunderts im Gottesdienst insbesondere aus den alttestamentlichen Propheten und aus den Evangelien vorgelesen haben. Justin kannte auch mündliche und außerbiblische Überlieferungen Jesu und der Apostel. Berichte über die Geburt Jesu in einer Höhle, die zeitweilig auch als Stall diente, hielt er für durchaus glaubwürdig.
Im 2. Jahrhundert war das Judentum im Römischen Reich deutlich bekannter und etablierter als der christliche Glaube. Indem Justin Christen erklärt, wie sie zu den Überlieferungen des Alten Testaments stehen, erfüllt er eine äußerst wichtige Aufgabe. Gleichzeitig gibt er den frühen Christen gute Argumente an die Hand, mit denen sie jüdischen Vorwürfen begegnen konnten, sie würden die Aussagen der Propheten verfälschen. Natürlich dienten Justins Ausführungen auch der christlichen Mission unter Juden.
Zuerst hebt Justin in seiner literarischen Diskussion mit Tryphon eine gewisse Kontinuität biblischer Offenbarung klar hervor. Der christliche Glaube beruhe auf den Aussagen der jüdischen Autoren des Alten Testaments. Die Schriften Moses und der Propheten sind für Justin weit älter als die der großen griechischen und römischen Philosophen. Deshalb müsse das Alte Testament als eigentliche historische Grundlage allen Redens über Gott, über die Seele, die Wahrheit und die Erlösung betrachtet werden – auch bei den Denkern Griechenlands.
Allerdings dürfe, Justin zufolge, nicht vergessen werden, dass die Gesetze des Mose durch den „neuen Bund Christi“ aufgehoben seien. Deutlich haben Israels Propheten ein erstes Kommen Jesu im Leiden und ein zweites in Herrlichkeit vorausgesagt. Das Leiden Christi und sein Tod am Kreuz wurden durch die Opfer des Alten Testaments bereits symbolhaft angekündigt. Jetzt müsse man die christliche Gemeinde als das neue, geistliche Israel betrachten, auf das sich alle noch ausstehenden Prophezeiungen des Alten Testaments bezögen, ist Justin überzeugt. Nach der Himmelfahrt Christi hätten aus diesem Grund auch die göttlichen Wunder und Geistesgaben unter den Juden weitgehend aufgehört.
Jesus im Alten Testament
In aufwendiger Arbeit erstellte Justin ein umfassendes Kompendium aller alttestamentlichen Aussagen über Jesus Christus. Wie im Judentum allgemein üblich, griff er dabei auch auf allegorische und typologische Interpretationen zurück. Beispielsweise sind für ihn sowohl der Baum des Lebens im Paradies als auch der in den Psalmen erwähnte Baum am Wasser, der Stab Moses und die Gedenksäule von Bethel letztlich prophetische Hinweise auf das Kreuz Christi. Selbst wenn das für den heutigen Leser nicht unbedingt plausibel klingt, sah Justin in Melchisedek, Josef und Jeremia überzeugende typologische Vorbilder von Jesus Christus. Ihr Auftreten sei somit ein deutlicher prophetischer Hinweis auf den Heilsplan Gottes.
Justin kritisiert Juden, die Jesus zwar „Messias“ nennen, ihn dann aber nur als besonders gottgefälligen Menschen betrachten. Die Heilige Schrift spricht nach Justin ganz klar von der göttlichen Präexistenz Jesu. Er habe schon lange vor Beginn der Schöpfung gelebt. Mehrere alttestamentliche Propheten bezeichneten ihn eindeutig als Gott. Sei Jesus nur ein ganz besonderer Mensch gewesen, dann könne er weder sündlos sein, noch könne er für die Schuld aller Menschen sterben. Ganz deutlich spricht sich Justin auch gegen die Auffassung mancher Juden aus, Jesus sei lediglich ein anderer Name für Gott. Demgegenüber hebt Justin hervor, dass Jesus Gott ist, dass er sich dabei aber auch deutlich von Gott dem Vater unterscheide. Zweifellos sei der Sohn immer vollkommen im Einklang mit dem Vater. Gleichzeitig sei Jesus aber mehr als lediglich eine von Gott ausgehende Kraft oder eine Erscheinungsweise seines Vaters.
Wenn Gott im Alten Testament Fragen stellt oder Pläne präsentiert, wie beispielsweise im Schöpfungsbericht, dann ist das für Justin kein Zeichen der Unwissenheit. Solche Gespräche sind vielmehr ein deutlicher Hinweis auf die verschiedenen Personen Gottes. Gott redet dann mit sich selbst als Vater und Sohn. Gelegentlich wird der Sohn in der Bibel deshalb auch Logos, bzw. Wort Gottes, genannt.
Judenchristen rät Justin davon ab, sich weiterhin beschneiden zu lassen und den Sabbat zu halten. Den Aussagen der Apostel entsprechend habe Jesus die Gläubigen von den rituellen Forderungen des Alten Bundes befreit. Wer sich trotzdem nach den jüdischen Gesetzen richten wolle, dürfe andere Christen nicht drängen, sich ihnen anzuschließen, um dadurch vorgeblich einen höheren Grad des Glaubens zu erreichen. Gesetzestreue Judenchristen solle man in einer überwiegend heidenchristlichen Gemeinde akzeptieren. Heidenchristen, die sich nach jüdischen Geboten richten, werden nach Justin vielleicht auch gerettet. Christen aber, die ganz zum Judentum überträten, würden damit Jesus verleugnen und den wahren Glauben verlassen.
Alltägliche Christenverfolgung
Mit seinen bis heute erhaltenen Schriften gibt Justin wertvolle Einblicke in das Gemeindeleben der frühen Christen. Dort beschreibt er die Gottesdienste Mitte des 2. Jahrhunderts. Justin berichtet von der Unterstützung der Witwen, Kranken und Gefangenen, von Taufen und Gastfreundschaft, von Spenden und Ämtern. An konkreten Fällen erläutert Justin auch, wie man sich die damaligen Christenverfolgungen vorzustellen hat. So kam es beispielsweise zu einem Prozess, weil eine Frau, die Christin geworden war, sich von ihrem unmoralisch lebenden Mann trennen wollte. Mehrere Gläubige, die für die Frau aussagten und sich dabei sehr deutlich auf biblische Prinzipien bezogen sowie das Heidentum klar kritisierten, wurden deshalb im Verlauf des Prozesses hingerichtet.
Gründe der Christenverfolgungen
Die Tatsache, dass Christen in der Geschichte der vergangenen 2000 Jahre immer wieder massiv verfolgt wurden, wirft natürlich die Frage nach den Gründen auf. Bei näherer Untersuchung fällt allerdings auf, dass die feindliche Haltung – Christen gegenüber – sehr unterschiedlich motiviert war. Besonders häufig spielten folgende Faktoren eine wichtige Rolle.
Unwissenheit: Viele Menschen ärgerten sich über die Absonderung der Christen und über deren vorgebliches Überlegenheitsgefühl. Anderen Römern war das Ergehen der Christen weitgehend gleichgültig. Sie kannten keine Christen persönlich und hatten deshalb deren Verfolgung nichts entgegenzusetzen. Wilde Spekulationen über den Glauben und den Kult der Gemeinden waren damals im Umlauf. Die Unwissenheit dem christlichen Glauben gegenüber war eine wichtige Voraussetzung zur Verbreitung vieler Vorurteile und Fehldeutungen.
Christenverfolgung im Römischen Reich
Missverständnisse: Viele abenteuerliche Gerüchte waren im 2. Jahrhundert über die von der „sündigen Welt“ abgeschieden lebenden Christen im Umlauf. Sie seien Atheisten, hieß es beispielsweise (Ablehnung des Götterkultes und der Götterbilder). Sie seien Mörder und Kannibalen (Abendmahl: „Das ist mein Blut …“; Taufe: „Der alte Mensch ist gestorben“). Christen seien sexuell ausschweifend, wurde gemunkelt (Bruderkuss). Sie begingen heimlich Inzest, vermuteten manche (Anrede als Bruder und Schwester). Christen seien politische Verschwörer (geschlossene Treffen für Abendmahl und Bibelstunde). Sie seien gefährliche Menschenhasser (deutliche Predigten von Sünde und dem baldigen Untergang der Welt). Außerdem müsse man Christen als Staatsfeinde betrachten (Ablehnung des Kaiserkults, zu dem alle verpflichtet waren). Diese und andere Sensationen und Halbwahrheiten verbreiteten sich, einmal in Umlauf gesetzt, rasend schnell. Sie wurden begierig aufgenommen und gerne geglaubt.
Verärgerung: Insbesondere die Gegner und Konkurrenten der ersten Christen entwickelten zuweilen einen regelrechten Hass auf die Gemeinde. Juden fühlten sich durch den Anspruch der Christen, den wahren Messias gefunden zu haben, herausgefordert und verfolgten die Gläubigen deshalb als vorgebliche Irrlehrer. Griechische und römische Priester ärgerten sich über die lautstarke Kritik der Christen an der antiken Götterverehrung und dem exzessiven Opferkult. Viele Priester, Seher, Goldschmiede, Architekten, Bettler und Händler, die mit ihrem Lebensunterhalt vom antiken Götterglauben abhängig waren, fürchteten um Einkommen und Ansehen. Griechische Intellektuelle waren aufgrund der in ihren Augen primitiven christlichen Botschaft und deren Kritik an der griechischen Philosophie zutiefst verärgert. Auch zahlreiche Privatleute waren schnell bereit, die Christen zum Schweigen zu bringen, weil es ihnen lästig war, immer wieder auf Schuld und Sünde angesprochen oder mit der Hölle bedroht zu werden.
Politisches Kalkül: Regierungsvertreter instrumentalisierten die Christen in vielerlei Hinsicht, um eigene politische Ziele zu erreichen. Einerseits konnte man durch die Verfolgung der verhältnismäßig unbedeutenden Christengemeinde eindrucksvoll und weitgehend risikofrei scheinbare Durchsetzungskraft und Stärke demonstrieren. Andererseits konnten politische Gegner ohne Probleme als Christen diffamiert und dadurch langfristig ausgeschaltet werden. Nebenher konnte bei einem solchen Prozess das persönliche Vermögen der betreffenden Personen vom Staat eingezogen werden. Durch die Verfolgung der Christen konnten strategisch-politische Allianzen mit Juden und Philosophen als einflussreichen Gegnern des Christentums geschlossen werden. Ferner ließ sich durch den Kampf gegen die relativ harmlosen Christen hervorragend von eigenen innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken. Schlussendlich standen die Christen durch ihren geistlichen Ausschließlichkeitsanspruch der ideologischen Einheit des Römischen Reiches (durch den Staats- bzw. Kaiserkult) und der verhältnismäßig toleranten Religionspolitik im Wege.
Suche nach einem Sündenbock: Nicht nur von Kaiser Nero (37–68) wurden die Christen gerne als Sündenböcke herangezogen. Viele römische Herrscher nach ihm wählten genau dieselbe Strategie. Wie zu allen Zeiten, war es auch schon damals in der Politik üblich, andere für eigenes Versagen verantwortlich zu machen. Neben vielen zeitlich und lokal eng begrenzten Vorwürfen war während der ersten drei Jahrhunderte immer wieder zu hören, die Christen trügen Schuld an religiösen Streitigkeiten und Unruhen, am Verfall des Römischen Reiches, das seit ihrem Auftreten vermehrten Krisen ausgesetzt sei, und schließlich seien sie wohl auch verantwortlich für alle anderen Unfälle, militärischen Niederlagen und Naturkatastrophen: „Wenn der Tiber die Mauern überflutet, wenn der Nil die Felder nicht überschwemmt, wenn der Regen ausbleibt, bei Erdbeben und Hungersnot, wenn eine Seuche wütet, gleich schreit man: Die Christen vor die Löwen!“6
Falsche Vorwürfe gegen Christen
Eine seiner Apologien richtete Justin direkt an Kaiser Antoninus Pius (86–161) und an den römischen Senat. Dabei appellierte er an den Wunsch des Herrschers, als fromm und philosophisch gebildet angesehen zu werden. Sollte das zutreffen, dann müsste sich diese Wahrheitsliebe und Weisheit auch im Umgang mit den Christen zeigen, argumentierte Justin. „Ob ihr Herrscher wirklich Hüter der Gerechtigkeit seid, das wird sich zeigen. Ich bin nicht gekommen, um euch in dieser Schrift zu schmeicheln oder nach dem Mund zu reden, sondern um eine Forderung vorzubringen: Ihr sollt erst nach einer genauen und gerechten Prüfung ein angemessenes Urteil über uns fällen. […] Schlussendlich könnt ihr uns wohl töten, nicht aber schaden.“
In seinen Ausführungen stellt Justin fest, dass zahlreiche Juden erschreckende Gerüchte über Menschenfresserei und Hurerei verbreiteten, um Stimmung gegen Christen zu machen. Dazu würden unter anderem Geständnisse von Sklaven christlicher Herren missbraucht, die man vorher gefoltert oder bestochen habe. Justin will allerdings auch nicht ausschließen, dass Anhänger obskurer christlicher Sekten vereinzelt tatsächlich solche Schandtaten begangen hätten. Herrscher und Richter aber seien moralisch verpflichtet, Christen nicht nur aufgrund solcher pauschalen Verdächtigungen zu verurteilen. In jedem einzelnen Fall müssten sie die behaupteten Verbrechen nachweisen, wenn man sie auch weiterhin als gerecht und weise ansehen sollte. „Wenn wir Christen ferner wirklich Männer schändeten und schamlos mit Frauen verkehrten, würden wir damit nur Zeus und den anderen Göttern nacheifern und könnten uns dabei zu unserer Rechtfertigung sogar noch auf die anerkannten Schriften Epikurs und anderer griechischer Dichter berufen.“
Die ziemlich absurde Beschuldigung der Gottlosigkeit und des Atheismus weist Justin vehement zurück. Dabei stützt er sich unter anderem auf Argumente, die vorher schon von griechischen Philosophen vorgebracht worden waren. Einerseits würden die heiligen Schriften der Christen ziemlich deutlich belegen, dass sie an einen Gott glauben. Andererseits sei gerade der unter Römern verbreitete Polytheismus, so Justin, logisch und moralisch äußerst fragwürdig: Nachweislich leben Anhänger der griechischen und römischen Religion viel unmoralischer als die Christen. Die verschiedenen Göttermythen widersprechen sich deutlich und können deshalb nicht gleichzeitig wahr sein. Die Götterstatuen bestehen lediglich aus totem Stein, Holz oder Metall und können deshalb wohl keine echten Götter sein. Sie können weder essen, noch fühlen oder handeln. Während Christen vor allem beten, töten Anhänger heidnischer Religionen Tiere, zuweilen auch Menschen, führt Justin weiter aus. Christen zeichnen sich durch Treue und Liebe in der Familie aus, während bei den Griechen und Römern selbst die Götter eifersüchtig und ehebrecherisch sind. „Denn nicht nur, wer tatsächlich die Ehe bricht, ist nach Jesus verworfen, sondern auch wer nur plant, die Ehe zu brechen, weil für Gott nicht bloß die Handlungen, sondern auch schon die Gedanken offenbar sind. Und gar viele Männer und Frauen, die von Jugend auf Schüler Christi gewesen sind, bleiben mit sechzig oder siebzig Jahren keusch.“
Für Justin sind die polytheistischen Religionen nicht nur unlogisch und ethisch schädlich; schlussendlich sind sie eine Erfindung der Dämonen, um die Menschen von Gott fernzuhalten. Mit dieser Einschätzung stand Justin damals übrigens nicht alleine da. Auch platonische Philosophen jener Zeit behaupteten einen dämonischen Ursprung der polytheistischen, abergläubischen Volksreligion.
Justins Angaben zufolge wurde Christen auch vorgeworfen, dass sie zu einer verschwörerischen Geheimsekte gehören würden, die die Öffentlichkeit scheue und den politischen Umsturz plane. Ihr Gott sei vollkommen kraftlos. Schließlich sei er nicht einmal in der Lage, den eigenen Anhängern effektiv zu helfen. Doch nicht ein vorgeblich schwacher Gott, sondern böse Dämonen sind nach Justin für die Verfolgung der Christen verantwortlich. Außerdem sei das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Schlussendlich werde Gott die jetzigen Christenmörder zur Rechenschaft ziehen und der biblischen Wahrheit zum Durchbruch verhelfen. Momentan aber zeige er seine Stärke, indem er den Verfolgten Kraft gebe, das erlittene Unrecht zu ertragen. Auch Irrlehrer wie Menander und Markion (85–160) würden von Dämonen gesteuert, um der christlichen Gemeinde zu schaden, ist Justin überzeugt: „Von einem gewissen Menander aber, der auch Samaritaner war aus dem Flecken Kapparetäa, einem Schüler des Simon Magus, wissen wir, dass auch er, unter dem Einfluss der Dämonen stehend, in Antiochien auftrat und durch seine Zauberkunst viele beeindruckte; der sogar seine Anhänger zu dem Glauben brachte, dass sie nicht sterben würden und dass er ein Gott sei.“
Dämonen wollen Christenverfolgung
Wer ehrlich seinen Verstand gebraucht, muss schlussendlich die Wahrheit der Offenbarung Gottes eingestehen, argumentiert Justin. Primäres Ziel der Verteidigung des christlichen Glaubens ist nicht die körperliche Rettung der Gläubigen vor Verfolgung und Tod. Grundsätzlich haben Christen keine Angst vor dem Sterben, weil sie sicher wissen, wohin sie dann gehen. Justin aber will Herrscher und Richter vor ungerechten Urteilen und der daraus folgenden Strafe Gottes bewahren. Allerdings trifft die staatliche Justiz nach Justin auch nur eine Teilschuld, weil sie unwissentlich von Dämonen verführt wurde. Jetzt gäbe es nur zwei echte Optionen. Entweder solle man die Wahrheit des christlichen Glaubens offen anerkennen, oder man müsse Christen konsequent als Lästerer staatlicher Ordnungen verurteilen. Christen freizusprechen, obwohl man ihre Überzeugung ablehnt, sei eigentlich inkonsequent. Trotz realer Gefahren für Leib und Leben versteckt sich Justin nicht hinter fadenscheinigen Ausreden oder bittet aus Angst um billige Gnade. Äußerst mutig fordert er Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Justin ist fest überzeugt, im Recht zu sein, auch wenn die öffentliche Stimmung so deutlich gegen ihn steht.
Wenn sich die Herrscher gegen den christlichen Glauben wenden, dann handeln sie ungerecht und unlogisch. Damit verstoßen sie gegen ihre persönlichen Grundsätze und schaden den eigenen Interessen. Gerade die Christen sind schließlich ihre treuesten Bürger.
Warnung vor christlichen Esoterikern
Vollkommen zutreffend erkannte Justin die Gefahren durch pseudochristliche Irrlehrer. Deshalb argumentierte er mit großem Engagement gegen Menander mit seinen magisch-esoterischen Vorstellungen. Gnostische Lehrer wie Valentinian (100–160) oder Basilides (85–145) verspotten Gott durch ihr unmoralisches Leben und ihre widersprüchlichen Aussagen. Markion wirft er vor, die biblische Lehre verlassen zu haben. Deutlich kritisiert Justin dessen Behauptung, es gebe zwei miteinander konkurrierende Götter, einen bösen Schöpfer und einen reinen, immateriellen Geist. Deshalb müsse man sich gegen den Gott der Schöpfung wenden, forderte Markion. Es gelte, alles Jüdische und Alttestamentliche abzustreifen und nur noch nach Jesus, dem vorgeblich rein geistigen Gott zu streben. Markion sei ein scheinheiliger Wolf, der unter den ahnungslosen Lämmern der Gemeinde wildere, warnt Justin mit deutlichen Worten. Er spiele sich als großer Lehrer auf. Dabei verstehe er aber nicht einmal die Grundlagen des christlichen Glaubens.
Justin der Märtyrer
Gerade die Propheten des Alten Testaments beweisen nach Justin mit ihren Ankündigungen die Kontinuität zwischen alter und neuer Zeit, zwischen Gott dem Schöpfer und Gott Jesus Christus. Die Häretiker meinen, die Seelen der Gläubigen würden direkt nach dem Tod in den Himmel kommen. Mit Blick auf die Lehren Jesu und der Apostel ist Justin überzeugt, dass erst einmal Jesus auf die Erde wiederkommen müsse. Dann werde Jerusalem als Hauptstadt der Welt ausgebaut. Erst nachdem Jesus tausend Jahre regiert habe, komme es zur Auferstehung der Toten und zum himmlischen Gericht (vgl. Offenbarung 20,11–15). Zum Schluss tröstet Justin seine Leser, dass man sich nicht über dieses geistliche Durcheinander wundern solle, da schon Jesus selbst Irrlehrer wie Basilides und Markion angekündigt habe (z. B. Matthäus 7,15–23).
Weitere Bücher
Alten Quellen zufolge hat Justin auch apologetische Schriften gegen die Samaritaner sowie gegen die Irrlehren des Simon, des Menander und des Markion verfasst, die allerdings nicht oder nur fragmentarisch erhalten sind. In zwei Abhandlungen setzt sich Justin kritisch mit Aussagen der klassisch-griechischen Philosophie auseinander. Unter anderem beschäftigt er sich darin mit dem Wesen der Dämonen und mit den Voraussetzungen der Erlösung. In einem weiteren, nicht erhaltenen Buch geht Justin den Eigenschaften und dem Ursprung Gottes nach. Dabei argumentiert er gemäß seinem intellektuellen Anspruch sowohl mit biblischen Aussagen als auch mit Zitaten antiker Philosophen. Eine weitere Abhandlung geht der menschlichen Seele nach sowie ihrem Verhältnis zum Körper und zu Gott.
Der bedeutende christliche Historiker Eusebius von Caesarea (263–339) erwähnt auch noch einige andere von Justin verfasste Schriften. In späteren Jahrhunderten wurden Justin weitere Bücher untergeschoben, offensichtlich mit der Absicht, sich seiner damals anerkannten Autorität zu bedienen.
Justins erklärter Feind
Der kynische Philosoph Crescens erklärte die Christen zu seinen Lieblingsfeinden. Mit seiner scharfen Kritik suchte er nach öffentlicher Aufmerksamkeit. Wo er nur konnte, griff Crescens Christen an und denunzierte sie bei den römischen Behörden. Ohne stichhaltige Begründung warf er ihnen allgemeinen Menschenhass, Unmoral und Atheismus vor. Wie nicht anders zu erwarten, nahmen viele Zuhörer die geäußerten Vorwürfe und Beschuldigungen gerne auf. Schon nach kürzester Zeit wurden aus wilden Spekulationen scheinbar feststehende Tatsachen. Crescens empfand vor allem Justin als lästige Konkurrenz und bemühte sich deshalb, den Philosophen bei den Behörden in Verruf zu bringen.
In einer öffentlichen Diskussion überführte Justin den philosophischen Christenjäger Crescens der Unwissenheit. Er konnte nachweisen, dass viele der ziemlich massiv erhobenen Vorwürfe auf reiner Spekulation beruhten und dass Crescens nicht einmal die Grundüberzeugungen christlichen Glaubens korrekt wiedergeben konnte. Justin ließ es nicht dabei bewenden, der Bevölkerung die Unfähigkeit des selbstverliebten Populärphilosophen vor Augen zu führen. Er kritisierte auch dessen unmoralischen Lebensstil und seine tief sitzende Geldgier.
Wie nicht anders zu erwarten, vergaß Crescens diese Demütigung nicht. Er wartete lediglich auf eine passende Gelegenheit, um es Justin heimzuzahlen. Wenig später, bei einer nächsten Welle staatlicher Verfolgungen, schien seine Chance gekommen zu sein.
Anklage aufgrund des Glaubens
Während der Christenverfolgung unter Kaiser Marc Aurel (121–180) wurde auch Justin festgenommen und als relativ prominenter Bürger persönlich von dem damaligen Stadtpräfekten Quintus Junius Rusticus (100–170) verhört. Mit ihm kamen sieben seiner Schüler ins Gefängnis, unter ihnen Hierax, Paeon und Liberian.
Während des Prozesses wurde Justin schnell zum Wortführer der christlichen Gefangenen. Standhaft begründete er seine Überzeugung und weigerte sich, Jesus als den Retter der Welt zu verleugnen und stattdessen den Kaiser als Gott zu verehren. Vor Zeugen bekannte er seinen festen Glauben an die Auferstehung und an das göttliche Gericht. „Beim Verhör leugnen wir das Evangelium nicht, weil wir uns keiner Schlechtigkeit bewusst sind. Wir halten es aber auch für eine Sünde, nicht in allem anderen die Wahrheit zu sagen, was nach unserer Überzeugung Gott gefällt. Außerdem möchten wir euch mit absoluter Ehrlichkeit von euren ungerechten Vorurteilen befreien.“
Justin weigerte sich strikt, zu unrechtmäßigen Mitteln zu greifen, beispielsweise Gewalt anzuwenden oder Beamte zu bestechen: „Wir dürfen also nicht Widerstand leisten. Jesus hat keineswegs gewollt, dass wir es den bösen Menschen nachmachen. Er hat uns vielmehr ermahnt, durch Geduld und Sanftmut alle von der Schande und von der Lust am Schlechten abzubringen.“
Auch angesichts der drohenden Todesstrafe blieb Justin fest und beständig: „Er aber erklärte, er sei dem Richter dafür noch dankbar in Anbetracht dessen, dass er durch den Tod von derartig schlechten Herrschern befreit werde und zum Vater und König des Himmels wandere.“ Am Ende des Prozesses wurde Justin erst geschlagen und dann aufgrund seiner römischen Staatsbürgerschaft enthauptet. Andere Christen wurden weniger gnädig zum Tod durch Verbrennen verurteilt.
Die mutige Standhaftigkeit dieser Märtyrer blieb den damaligen Gemeinden in guter Erinnerung. Ganz wesentlich trugen Justins Schriften zur Klärung frühchristlicher Theologie bei und zur Ausbreitung des Glaubens unter der gut gebildeten römischen Mittelschicht. Alle späteren Apologeten der frühen Christenheit haben von ihm gelernt. Justin ließ auch einige Schüler zurück, beispielsweise Tatian (120–180), der mit seiner hervorragenden Evangelienharmonie bleibende Spuren hinterließ. Andere Mitstreiter überlieferten, verbreiteten und interpretierten Justins Schriften für die Nachwelt. Keiner von ihnen erreichte allerdings das Format ihres Lehrers oder trug wesentlich zur Weiterentwicklung von Justins Ideen bei.
Ausgewählte Literaturhinweise
Caroline P. Bammel: Justin der Märtyrer, in: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 1, Alte Kirche I, Martin Greschat (Hrsg.), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1984, S. 51–68.
Hans Freiherr von Campenhausen: Griechische Kirchenväter, 8. Auflage, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1993, S. 14–23.
Johannes Geffcken: Zwei griechische Apologeten, Teubner Verlag, Leipzig 1907 (Reprogrografischer Nachdruck. Olms, Hildesheim u. a. 1970)
Bettina Schmidt/Jennifer Schöttke: Martyrium und Martyriumstheologie in der Alten Kirche: Justin, der Märtyrer. Strategien der Verteidigung in seinen Apologien, 3. Aufl., GRIN Verlag, München 2011.
Ansätze zum Weiterdenken
In Zeiten der Aufklärung und des Rationalismus waren es insbesondere Philosophen, die den christlichen Glauben und die Bibel massiv infrage stellten. Der ideologische Atheismus und die zerstörerische Bibelkritik haben ihre Wurzeln vor allem in der Philosophie der vergangenen 200 Jahre. Deshalb wundert es kaum, dass unter den heutigen Frommen Philosophie zumeist mit großer Skepsis betrachtet wird. Nicht ganz zu Unrecht befürchtet man durch ein Philosophiestudium bleibende Schäden am Glauben. Das war nicht immer so und muss auch nicht so bleiben. Tatsächlich gingen die allermeisten Philosophen bis vor etwa einhundert Jahren fest von der Existenz eines Gottes aus. Die meisten von ihnen hielten den christlichen Glauben und die christliche Ethik sogar für die beste aller Erklärungen. Erst durch die überwiegend atheistischen Philosophiedozenten entsteht der Eindruck einer glaubensfeindlichen Wissenschaft. Justin fordert heraus, das logische Denken der Philosophie neu zur Unterstützung der biblischen Wahrheiten heranzuziehen und damit einer intellektuellen Schicht der Gesellschaft zugänglich zu machen.
Vieles im Alten Testament wirkt für den modernen Leser reichlich fremd, gelegentlich sogar peinlich: Kriege, Opfer und strikte Sexualvorschriften beispielsweise. Manche Christen konzentrieren sich deshalb bei ihrer Bibellektüre vor allem aufs Neue Testament. Und tatsächlich fallen hier Liebe, Hilfe und Vergebungsbereitschaft viel stärker ins Auge. Seit der frühesten Christenheit ist deshalb alle paar Jahre die Forderung zu hören, sich stärker vom Alten Testament zu distanzieren, es womöglich sogar ganz aus dem biblischen Kanon zu entfernen. Mit Justin sollten Christen diesen Teil der Bibel allerdings als absolut notwendige Vorgeschichte erkennen und schätzen. Es ist ein und derselbe Gott, der seinen Plan seit der Schöpfung kontinuierlich verfolgt. Gerade auch das Alte Testament zeigt viele Beispiele der großen Liebe Gottes. Hier finden sich für Christen unzählige und oftmals ganz erstaunliche Hinweise auf den Erlösungsplan Gottes und auf das Kommen Jesu. Nicht umsonst zitieren die Evangelisten so häufig aus dem Alten Testament. Damit wollen sie nachweisen, dass sich Gottes Prophezeiungen zuverlässig in der Geschichte Jesu erfüllt haben.
Wer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt läuft, wird sehr schnell bemerken, dass Christen derzeit wieder einmal keine Spitzenposition auf der gesellschaftlichen Beliebtheitsskala einnehmen. Je nach Bildung und Aggressivität ihrer Kritiker wird Christen Wissenschaftsfeindlichkeit, Spaßverachtung, Intoleranz oder Rückständigkeit vorgeworfen. Natürlich gibt es auch wirklich seltsame Gläubige, und ganz sicher stehen viele Christen aus schlechter Erfahrung neuen gesellschaftlichen Entwicklungen zuweilen übertrieben kritisch gegenüber. Wie schon zur Zeit Justins kursieren jedoch auch heute zahlreiche fantasievolle Feindbilder in den Köpfen glaubensferner Mitmenschen. Pausenlos lassen die Medien Christen in einem schlechten Licht erscheinen. Darüber hinaus kennen die meisten Kritiker Gläubige kaum wirklich persönlich. Manche Christen reagieren angesichts der Vorwürfe aggressiv oder mit völligem Rückzug. Beides trägt kaum dazu bei, Vorurteile auszuräumen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Wie schon Justin es durchaus erfolgreich vorgemacht hat, ist es auch heute nötig, Vorurteilen geduldig, sachlich und liebevoll zu begegnen; auch wenn man dabei gelegentlich manche verbalen Schläge einzustecken hat.
In kaum einer Zeit wurden mehr Christen diskriminiert und verfolgt als heute, was natürlich auch an der momentan weltweiten Verbreitung des Glaubens liegt. Nicht nur von Muslimen werden Christen heute angegriffen. Auch in buddhistisch, hinduistisch oder stark atheistisch geprägten Staaten unterdrückt man Christen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. In den meisten Teilen Europas werden Christen eher lächerlich gemacht. Oder es werden Glaubensthemen generell tabuisiert, insbesondere wenn es um christliche Positionen geht. Manchen Gläubigen nervt schon alleine das immens. Justin erstaunt und fordert in diesem Zusammenhang ungemein heraus. Aus Neid und mit völlig falschen Argumenten wurde er vor Gericht gezerrt und teils gewalttätig verhört. In einem illegitimen Prozess wurde er dann zum Tode verurteilt. Trotzdem gab Justin nicht klein bei oder passte sich aus Angst dem geforderten religiösen Mainstream an. Gott gab ihm auch in einer scheinbar aussichtslosen Lage den nötigen Mut und die Weisheit, richtig zu reagieren, auch wenn das seine Gegner schlussendlich nicht zu einem Freispruch bewegte. Zahlreiche Zuhörer aber wurden durch Justins Worte von der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugt.
1Tatsächlich gab es neben der Staatsreligion kleinere akzeptierte Religionen, z. B. das Judentum oder die verschiedenen Mysterienkulte. Hier beziehe ich mich aber vor allem auf die verschiedenen philosophischen Schulen, vor allem unter den Gebildeten.
2Stoiker konzentrierten sich auf die Erforschung der natürlichen Zusammenhänge in der Welt. Sie suchten nach einem universellen Prinzip hinter allem Wahrnehmbaren. Einem Stoiker ging es darum, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernte und mithilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit strebte.
3Als Peripatetiker bezeichnete man die antiken Anhänger der Lehren des Aristoteles (384–322 v. Chr.). Zu Justins Zeit beschäftigten sich diese Philosophen vor allem mit mathematischen Problemen sowie mit historischen Forschungen und der Literaturanalyse.
4Als Pythagoreer werden die Anhänger der Philosophie des antiken Denkers Pythagoras von Samos (570–510 v. Chr.) bezeichnet. Sie waren der Überzeugung, dass der Kosmos eine nach bestimmten Zahlenverhältnissen aufgebaute, harmonische Einheit bildet. Pythagoreer nahmen an, dass in allen Bereichen – in der Natur, im Staat, in der Familie und im einzelnen Menschen – dieselben zahlenmäßig ausdrückbaren Gesetzmäßigkeiten gelten. Deshalb sollten überall Ausgewogenheit und harmonischer Einklang angestrebt werden. Erst die Kenntnis der maßgeblichen Zahlenverhältnisse ermögliche eine weise, naturgemäße Lebensführung. Pythagoreer philosophierten nicht nur, sondern waren bemüht, ihre Ideen auch politisch durchzusetzen. Dabei scheuten sie selbst vor dem Einsatz von Gewalt nicht zurück.
5Platoniker beriefen sich auf die Lehren des antiken Philosophen Plato (428–348 v. Chr.). Dieser behauptete, dass es eine eigentlich reale, geistige Wirklichkeit hinter der sinnlich wahrnehmbaren Welt gebe. Das Materielle sei nur ein vager Abglanz der wirklich letzten Realität, der „Idee“. Plato kritisierte irdischmaterielle Gottesvorstellungen mit Statuen und Tempeln massiv. Auch Gott war für ihn ein eher individuelles, geistiges Wesen. Um zu sicheren Kenntnissen zu gelangen, benutzte Plato einen methodischen Skeptizismus, der alles scheinbar Selbstverständliche durch intensives Nachdenken und Nachfragen auf seine Gültigkeit überprüfte.
6Zitat von Tertullian, der ähnlich, aber zugespitzter argumentiert. Siehe https://www.uni-siegen.de/phil/kaththeo/antiketexte/ausser/11.html?lang=
2
Ansgar
(801– 865)
Missionar des Nordens
Europa gilt traditionell als christlicher Kontinent, auch wenn sich das gegenwärtig durch den Einfluss der Säkularisierung und der Postmoderne stark verändert. Und tatsächlich wurde die Geschichte der europäischen Völker über 1000 Jahre hinweg vielfältig vom christlichen Glauben geprägt. Allerdings verbreitete sich das Christentum in diesem Teil der Welt nicht von einem Tag auf den anderen. In den Ländern Südeuropas entstanden bereits im ersten Jahrhundert zahlreiche christliche Gemeinden. Den hohen Norden und den weiten Osten Europas erreichte der Glaube an Jesus Christus erst rund 1000 Jahre später. Auch hier waren es vor allem einzelne Menschen, die unter großen persönlichen Risiken in den „unheimlichen und unzivilisierten Norden“ zogen, um dort für den liebenden Gott der Bibel zu werben.
Früher Biograf
Ansgars Leben wurde zeitnah und zuverlässig von seinem Schüler und Nachfolger Rimbert (830–888) aufgeschrieben (Vita Ansgarii). Über Jahrzehnte hinweg hatte der seinen Lehrer zu theologischen Konferenzen und auf seinen Missionsreisen begleitet. Beide lasen zusammen in der Bibel, diskutierten regelmäßig und beteten gemeinsam. Im Rückblick schrieb Rimbert: „Lange durften wir uns als Gnadengeschenk des Herrn an seinem guten Hirten Ansgar freuen, von seiner Predigt und seinem Lebenswandel lernen und durch seine Fürbitte Stärkung empfangen. Jetzt sind wir seiner Gegenwart beraubt und merken deutlich, wie sehr wir um seinetwillen Dank sagen müssen. […] Wer seinem Beispiel folgt, wird schon auf Erden ein erfülltes Leben führen. Wer seine Lehren beachtet, der wird sich ohne Zögern an den Maßstäben Gottes orientieren. Wer auf seine Mahnungen hört, wird sich bemühen, die Fallen des Satans zu meiden.“
Kindheit im Kloster
Der spätere Dänenmissionar Ansgar wurde 801 in der Picardie/Nordfrankreich geboren. Seine Familie gehörte, wie der Name nahelegt, zu den Sachsen und war aus wirtschaftlichen Gründen ins Reich der Franken übergesiedelt. Ansgars Mutter wird als fromme, gottesfürchtige Frau beschrieben, die allerdings schon fünf Jahre nach der Geburt ihres Sohnes starb. Die Familie verfügte über einen bescheidenen Wohlstand. Ansgars Vater schickte seinen Sohn zur kirchlichen Ausbildung ins nördlich von Amiens liegende Kloster Corbie. Das Benediktinerkloster war bereits 660 von der aus England stammenden, merowingischen Königin Balthilde (630–680) gegründet worden und hatte damals einen außerordentlich guten Ruf. Inzwischen wurde es von dem Abt Adalhard (752–826) geleitet, einem unehelichen Enkel des fränkischen Herrschers Karl Martell. Im Kloster lebten rund 350 Mönche, Priester und andere Mitarbeiter. Unter anderem verfügte man über eine reich ausgestattete Bibliothek und ein Skriptorium, eine Schreibstube zur Anfertigung wertvoller Buchkopien.
Kloster Corbie
Bekehrung mit neuer Lebensperspektive
Zu Beginn seiner Schulzeit fiel Ansgar kaum auf. Er verhielt sich weitgehend wie die meisten anderen Kinder seines Alters. Ansgar hatte weit mehr Spaß am Spielen und an kleinen Streichen als am Lernen. Erst ein ziemlich eindrücklicher Traum bewirkte bei dem Jungen eine deutliche Veränderung. Im Schlaf sprachen seine verstorbene Mutter und einige andere Personen zu ihm. Sie ermahnten Ansgar mit den Worten: „Wenn du auch zu Gott kommen willst, musst du alle oberflächlichen Vergnügungen lassen und dein Leben ernsthaft verändern. Leichtsinn und Faulheit gefallen Gott gar nicht.“ Ansgar sah in diesem Traum eine dringende Mahnung Gottes und änderte seine Prioritäten radikal. Seinen Mitschülern fiel auf, dass er weniger spielte, dafür aber umso mehr lernte und häufiger betete. Auch später noch hatte Ansgar verschiedentlich Visionen, in denen er Gottes Reden zu erkennen meinte. Nie allerdings hing er das an die große Glocke oder interpretierte es als Zeichen besonderer Geistlichkeit. Nur einigen engen Freunden gegenüber schilderte er diese Träume und verbot ihnen, anderen davon zu erzählen. Jedenfalls fühlte sich Ansgar schon sehr früh in den Dienst Gottes berufen.
Ansgars späterer Schüler Rimbert berichtet: „Einmal sah er eine Gruppe Jungen mit Scherzen und albernem Geschwätz zum Gottesdienst gehen. Das ärgerte Ansgar sehr. Und obwohl er selbst der Jüngste war, mied er alle leichtfertigen Kindereien. Er betete voller Andacht und Ehrfurcht, als wäre er schon viel älter.“
Während der folgenden Jahre wurde Ansgar im Kloster Corbie für seine späteren Aufgaben als Mönch vorbereitet. Dazu gehörte eine Grundausbildung in Lesen und Schreiben, Geografie, Mathematik, Rhetorik und natürlich in Latein. In Grundzügen lernte er die Bibel und die Kirchengeschichte kennen. Mit zwölf Jahren erhielt er die Tonsur, das bis 1973 für katholische Mönche vorgeschriebene Kahlscheren des Hinterkopfes.
Karl der Große und die Christianisierung der Sachsen
In der Zeit Ansgars hatte sich die politische und religiöse Welt Europas stark verändert. Karl der Große (742–814) war 768 König der Franken geworden. Bis heute gilt er als der beeindruckendste Herrscher des ganzen Mittelalters. Er erweiterte das Gebiet der Franken auf den größten Teil Mitteleuropas, auf Nordspanien und Mittelitalien, bis in die heutigen Niederlande und nach Ostdeutschland. Karl förderte Kunst und Bildung, reformierte das Rechtswesen und die Schrift.1 Vor allem aber lag dem König daran, den christlichen Glauben weiter zu verbreiten und zu festigen. Sein großes Vorbild war der fromme König David aus dem Alten Testament, der sein Volk nach den Maßstäben Gottes regieren wollte. Eine Trennung von Staat und Kirche, wie sie heute selbstverständlich erscheint, kam für Karl den Großen überhaupt nicht infrage. Er war überzeugt, seine Regierungsverantwortung von Gott selbst erhalten zu haben, und fühlte sich deshalb verpflichtet, den christlichen Glauben in seinem Reich zu fördern. Wo er es für nötig hielt – wie bei der damals heiß diskutierten Frage der Bilderverehrung –, griff Karl auch schon einmal selbst in die theologische Diskussion ein, selbst wenn er sich dabei gegen den Papst stellten musste.
Karl der Große
Die locker verbundenen Sachsenstämme siedelten damals in dem Gebiet zwischen Nordsee und Harz bzw. Rhein und Elbe. Immer wieder hatten sie schon seit Jahrzehnten Raubüberfälle auf fränkisches Gebiet unternommen. Bereits Karls Großvater, Karl Martell (688–741), war verschiedentlich in Kämpfe mit den Sachsen verwickelt. Hessen und Thüringen gehörten bereits zum Frankenreich. Entlang der Grenze hatte man zahlreiche Festungsanlagen errichtet.
Die sich 32 Jahre hinziehenden Auseinandersetzungen zwischen den christlichen Franken und den heidnischen Sachsen begannen für Karl den Großen im Jahr 772. Mit einem Kriegszug wollte er die schon lange schwelenden Grenzstreitigkeiten ein für alle Mal beenden. Schon bald nahm seine Armee die sächsische Eresburg ein (bei Marsberg im Hochsauerlandkreis) und zerstörte das germanische Heiligtum Irminsul2. Karl eroberte große sächsische Siedlungsgebiete im heutigen Westfalen bis hin zur Weser und nahm einige Söhne sächsischer Adliger als Geiseln, um ihre Familien zur Einhaltung des vereinbarten Friedens zu zwingen. Während sich Karl auf einem Kriegszug in Italien befand, überfielen Sachsen unter der Leitung Widukinds (730–807) trotzdem fränkische Siedlungen, Klöster und Kirchen im Rheinland.
Wenig später ließ Karl der Große auf sächsischem Gebiet die Karlsburg errichten, die spätere Pfalz Paderborn. Von hier aus sollte die Gegend militärisch gesichert und verwaltet werden. Außerdem wurden einige Kirchen und Klöster gebaut, um die Sachsen mit dem christlichen Glauben vertraut zu machen (777). Karl besiegte die aufständischen Sachsen im Jahr 778 erneut. Die fränkische Unterdrückung heidnischer Bräuche und stellenweise vorgenommene Zwangstaufen provozierten eine weitere Rebellion der Sachsen. Während sich Karl auf einem Feldzug gegen die Sorben befand, erreichte Widukind kleinere Siege gegen fränkische Truppen (782). Verärgert ließ Karl daraufhin die als Friedenssicherung genommenen sächsischen Geiseln in Verden an der Aller hinrichten („Verdener Blutgericht“).
In den zurückeroberten Gebieten verordnete Karl der Große für die Misshandlung eines Predigers, die Zerstörung einer Kirche, die Verbrennung einer Leiche oder andere heidnische Riten die Todesstrafe; obwohl ihm sein Berater Alkuin (735–804) und andere Kirchenmänner dringend von solchen Gewaltmaßnahmen abgeraten hatten. 785 kapitulierte Widukind, unterwarf sich Karl und wurde, nicht ganz freiwillig, christlich getauft. Obwohl die Kirche scharf protestierte, hielt der König noch einige Jahre an Zwangstaufen und an der Unterdrückung heidnischer Bräuche fest. Viele Mönche forderten, dass der christliche Glaube stattdessen gut gelehrt, verstanden und freiwillig angenommen werden müsse. Einen letzten, begrenzten Sachsenaufstand unterdrückte Karl 804 und konnte sein Reich währenddessen bis an die Elbe ausdehnen.
Berufung in die Weltmission
Als der jugendliche Ansgar vom Tod Karls des Großen erfuhr (814), spürte auch er die Erschütterung, die viele ergriff, weil sie wussten, dass damit eine Epoche endete, die von einer relativen Sicherheit und Förderung des christlichen Glaubens gekennzeichnet war. Wenig später erschienen dem 13-jährigen Mönch in einer Vision Petrus und Johannes der Täufer, die ihn in den Himmel zu Gott begleiteten. Wie in der Offenbarung beschrieben, sah er die 24 Ältesten auf ihren Thronen und die weiten, goldenen Straßen des himmlischen Jerusalems. Aus einem strahlenden Licht heraus wandte sich Gott mit einem Auftrag an Ansgar: „Gehe hin, um mein Wort auszubreiten. Dann wirst du als Märtyrer sterben und zu mir zurückkehren.“ Obwohl man im Nachhinein natürlich einwenden könnte, dass diese Vision durch die fromme Fantasie eines stark von den Bildern der Bibel bestimmten Jugendlichen produziert worden sein könnte, war es doch so, dass Ansgar darin seine göttliche Berufung zur Heidenmission erkannte.
Nur zwei Jahre später, mit gerade einmal 15 Jahren, wurde der ernste und lernbegierige Ansgar im Kloster als Lehrer für die jüngeren Kinder berufen. Obwohl er sich wirklich bemühte, ein geistlich gutes Leben zu führen und sich an den Maßstäben der Bibel zu orientieren, trat ihm seine Unzulänglichkeit immer wieder vor Augen. Er fühlte sich sündig und unwürdig angesichts der hohen ethischen Forderungen Gottes. In dieser Zeit träumte Ansgar wieder von Jesus, dem er mit ehrlichem Herzen all sein Versagen bekannte und den er um Vergebung bat. Jesus tröstete ihn mit den Worten: „Fürchte dich nicht. Ich bin es, der dir alle deine Sünden vergibt.“