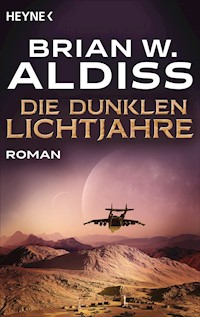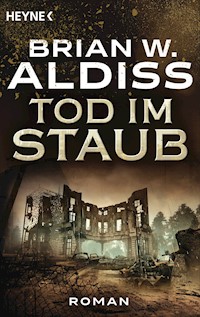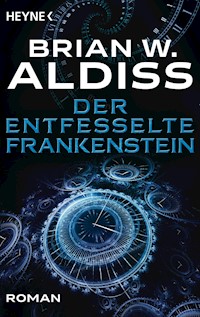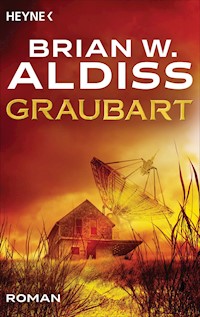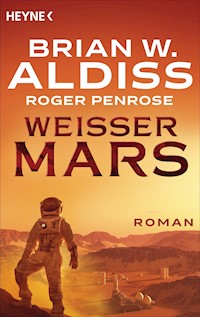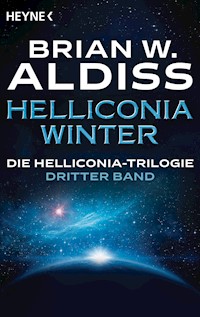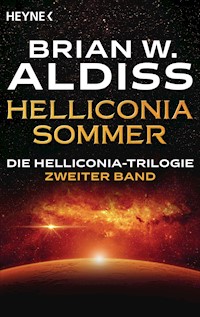
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Planet Helliconia umkreist ein Doppelsternsystem, so langsam, dass die Jahreszeiten Tausende Jahre dauern. Nach einem langen, harten Winter ist die Welt nun wieder erwacht. Die Menschen sind an die Oberfläche zurückgekehrt und entdecken alte Fertigkeiten und Künste wieder, die lange vergessen waren. Mit überlegener Waffengewalt werden die einheimischen Pahgoren zurückgedrängt, die Meere und Kontinente erkundet – und schon bald brechen die erste Kämpfe zwischen den Menschen aus. Der kurze, heiße Sommer auf Helliconia hat begonnen. Er dauert 238 Jahre ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BRIAN W. ALDISS
HELLICONIA:
SOMMER
Die Helliconia-Trilogie
Band 2
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Der Planet Helliconia umkreist ein Doppelsternsystem, so langsam, dass die Jahreszeiten Tausende Jahre dauern. Nach einem langen, harten Winter ist die Welt nun wieder erwacht. Die Menschen sind an die Oberfläche zurückgekehrt und entdecken alte Fertigkeiten und Künste wieder, die lange vergessen waren. Mit überlegener Waffengewalt werden die einheimischen Pahgoren zurückgedrängt, die Meere und Kontinente erkundet – und schon bald brechen die erste Kämpfe zwischen den Menschen aus. Der kurze, heiße Sommer auf Helliconia hat begonnen. Er dauert 238 Jahre …
Die Helliconia-Trilogie von Brian W. Aldiss:
Helliconia: Frühling
Helliconia: Sommer
Helliconia: Winter
Der Autor
Brian Wilson Aldiss, OBE, wurde am 18. August 1925 in East Dereham, England, geboren. Nach seiner Ausbildung leistete er ab 1943 seinen Wehrdienst in Indien und Burma, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb er bis 1947 auf Sumatra, ehe er nach England zurückkehrte, wo er zunächst als Buchhändler arbeitete. Dort begann er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, anfangs noch unter Pseudonym. Seinen Durchbruch hatte er mit Fahrt ohne Ende, einem Roman über ein Generationenraumschiff. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der lange Nachmittag der Erde, für das er 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, und die Helliconia-Saga, mit der er den BSFA, den John W. Campbell Memorial Award und den Kurd Laßwitz Preis gewann. Brian Aldiss starb am 19. August 2017 im Alter von 92 Jahren in Oxford.
Erfahren Sie mehr über Brian W. Aldiss und seine Werke auf
www.diezukunft.de
www.diezukunft.de
Titel der Originalausgabe
HELLICONIA SUMMER
Aus dem Englischen von Walter Brumm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1983 by Brian W. Aldiss
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Nele Schütz, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-25658-6V001
INHALT
Das Buch
Der Autor
Inhalt
I – Die Meeresküste von Borlien
II – Ankömmlinge im Palast
III – Eine voreilige Scheidung
IV – Eine Neuerung im Cosgatt
V – Die Art der Madis
VI – Diplomatische Geschenke
VII – Besuch bei den Toten
VIII – Im Angesicht des Mythos
IX – Verdrießlichkeiten für den Kanzler
X – In Gewahrsam
XI – Reise zum nördlichen Kontinent
XII – Flussfahrt mit Passagieren
XIII – Ein Weg zu besseren Waffen
XIV – Wo die Flambregs leben
XV – Die Gefangenen des Steinbruchs
XVI – Der Mann, der einen Gletscher abbaute
XVII – Todesflug
XVIII – Besucher aus der Tiefe
XIX – Oldorando
XX – Wie Gericht gehalten wurde
XXI – Die Ermordung Akhanabas
Schlussstrophe
Anhang mit Karten und Erläuterungen von Erhard Ringer
Karte Helliconia politisch
Karte Helliconia geographisch
1. Das Doppelsternsystem Freyr/Batalix
2. Helliconia
3. Der Einfluss der Sonnen auf Helliconia
4. Das Helico-Virus
5. Die Bevölkerung Helliconias
6. Helliconische Zeitrechnung
7. Geographie
I
Die Meeresküste von Borlien
Wellen rauschten den Strand hinauf, wichen zurück und kamen wieder. Draußen vor der Küste wurde die Prozession der anlaufenden Brandungswellen von einer mit Vegetation bedeckten felsigen Masse gebrochen. Sie markierte die Grenze zwischen der Flachwasserzone und der offenen See. Einst war der schwärzliche Felsen Teil eines Berges im Landesinneren gewesen, bis vulkanische Eruptionen ihn in die Bucht geschleudert hatten.
In dieser Zeit war der Felsen durch einen Namen domestiziert; er war als ›der Linienfels‹ bekannt. Nach ihm hatte man der Bucht und ihrem unmittelbaren Hinterland den Namen Gravabagalinien gegeben. Jenseits dieses Felsens lag die schimmernde blaue Weite des Meeres der Adler. Die auflaufenden Brecher waren unter ihren Schaumkronen trüb vom Sand, den sie aufgewühlt hatten, bevor sie in weißer Gischt zusammenfielen und ihre schaumbedeckten Ausläufer den Strand hinaufjagten, wo sie ermattet im Sand versickerten.
Nachdem sie die Bastion des Linienfelsens umbrandet hatten, trafen die Wellenfronten in verschiedenen Winkeln auf die Küste, wo sie sich mit verdoppelter Gewalt brachen und schäumend die Füße einer vergoldeten Sänfte umspülten, die von vier Phagoren am Strand niedergesetzt wurde. Die rosigen Zehen der Königin von Borlien tauchten in die Ausläufer der anstürmenden Wogen.
Die enthornten Ancipitalen standen bewegungslos. So sehr sie das Wasser fürchteten, ließen sie es um ihre Füße brodeln, ohne mehr zu tun als gelegentlich mit einem Ohr zu zucken. Obwohl sie ihre königliche Bürde eine halbe Meile vom Palast hergetragen hatten, zeigten sie keine Erschöpfung, und obwohl der leichte Seewind die drückende Hitze kaum zu lindern vermochte, gaben sie durch nichts zu erkennen, dass sie darunter litten. Noch schienen sie im geringsten interessiert, als die Königin ihr Gewand abwarf und nackt von der Sänfte ins Wasser watete.
Hinter den Phagoren stand im trockenen Sand der Majordomo des Palastes und beaufsichtigte zwei menschliche Sklaven bei der Errichtung eines Zeltes, das er mit hellen Madi-Teppichen auslegen ließ.
Die Wellenausläufer umschmeichelten die Knöchel der Königin MyrdalemInggala. ›Königin der Königinnen‹, wurde sie von der bäuerlichen Bevölkerung Borliens genannt. In ihrer Begleitung waren Prinzessin Tatro, ihre Tochter, und einige Damen aus ihrem Gefolge.
Die Prinzessin schrie vor Begeisterung und sprang auf und nieder. Im Alter von zwei Jahren und drei Zehnern betrachtete sie die See als einen riesigen, unbekümmerten Freund.
»Oh, schau diese Welle, Mutter! Es ist die größte! Und die nächste … da kommt sie … oooh! Wie hoch sie sind! Immer größer werden sie, Mutter, schau nur! Schau dir diese an, gleich stürzt sie vornüber und – ooh, da kommt eine noch größere! Schau, schau, Mutter!«
Die Königin nickte ernst zu den begeisterten Ausrufen ihrer kleinen Tochter und hob den Blick in die Ferne. Am südlichen Horizont türmten sich schiefergraue Wolken, Vorboten der beginnenden Monsunzeit. Das tiefe Wasser zeigte ein Farbenspiel, für das ›blau‹ keine zureichende Beschreibung bot. Die Königin sah Azurblau, Aquamarin, Türkis und leuchtendes Grün. Am Finger trug sie einen Ring, den ein Händler in Oldorando ihr verkauft hatte. In diesen Ring war ein Edelstein gefasst – einzigartig und von unbekannter Herkunft –, der zu den Farben der morgendlichen See passte. Sie fühlte, dass ihr Leben und das Leben ihres Kindes sich zur Existenz verhielt, wie der Stein zum Ozean.
Aus jenem Reservoir des Lebens kamen die Wogen, die Tatro begeisterten. Für das Kind war jede Brandungswelle ein separates Ereignis, erfahren ohne Beziehung zu dem, was vorausgegangen war und noch kommen sollte. Jede Welle war die einzige Welle. Tatro lebte noch in der immerwährenden Gegenwart der Kindheit.
Für die Königin waren die Wellen ein unaufhörlicher Ablauf, nicht bloß des Ozeans, sondern der Prozesse des natürlichen Weltgeschehens. Diese Prozesse schlossen ihre Verstoßung durch ihren Gemahl ebenso mit ein wie die über den Horizont marschierenden Armeen, die zunehmende Hitze und das Segel, das in der Ferne zu sehen sie jeden Tag aufs neue hoffte. Von all diesen Dingen gab es kein Entrinnen. Vergangen oder zukünftig, sie waren enthalten in ihrer gefährlichen Gegenwart.
Mit einem Zuruf an Tatro lief sie durch das aufspritzende Wasser und warf sich in die Brandung. Der Ring blitzte an ihrem Finger, als ihre Hände die Gischt zerteilten und sie hinausschwamm.
Jenseits der Brandungszone ging eine angenehm wiegende Dünung. Das Wasser umschloss ihre Glieder und schenkte wohlige Kühlung. Sie spürte die Energien des Ozeans. Eine zweite Linie weißer Schaumkronen weit voraus markierte die Grenze zwischen den Wassern der Bucht und der starken, westwärts ziehenden Meeresströmung, die der Südküste des tropisch heißen Kontinents von Campannlat folgte. MyrdalemInggala schwamm nie weiter hinaus als bis zu dieser Trennungslinie, es sei denn, ihre Vertrauten waren bei ihr.
Ihre Vertrauten trafen jetzt ein, angelockt vom starken Aroma ihrer Weiblichkeit. Sie schwammen näher, und MyrdalemInggala tauchte mit ihnen, umringt von den geschmeidigen, glatten Körpern und ihrer orchestralen Sprache, die ihr noch fremd war. Sie warnten sie, dass etwas geschehen werde, etwas Unangenehmes. Und es sollte von der See her kommen. Soviel verstand sie.
Das Exil hatte die Königin an diesen gottverlassenen Ort im äußersten Süden von Borlien verbannt, in das alte Schloss von Gravabagalinien, das heimgesucht wurde von den Geistern einer Armee, die vor langer Zeit hier zugrunde gegangen war. Das Schloss war alles, was von ihrem geschrumpften Herrschaftsbereich übriggeblieben war. Aber sie hatte eine weitere Domäne entdeckt, hier in der See. Ihre Entdeckung war ganz zufällig gewesen und datierte von dem Tag, als sie während ihrer Periode im Meer geschwommen war. Ihr Geruch im Wasser war es gewesen, was die Vertrauten zu ihr geführt hatte. Mit der Zeit waren sie ihre täglichen Gefährten geworden, Tröstung für alles, was verloren war und alles, was sie bedrohte.
Umringt von den Gefährten, ließ MyrdalemInggala sich auf dem Rücken treiben, dem heißen Licht des hoch am Himmel stehenden Batalix ausgesetzt. Das Wasser gluckste und dröhnte in ihren Ohren. Ihre Brüste waren klein, mit zimtfarbenen Warzen, ihre Hüften breit, die Taille schmal. Die Wassertropfen auf ihrer Haut blitzten im Sonnenschein. Ihre Begleiterinnen vergnügten sich in den Brandungswellen am Ufer. Zwei oder drei schwammen zum Linienfelsen hinaus, aber für alle bildete die Königin den bewusst oder unbewusst wahrgenommenen Bezugspunkt. Ihre hellen Rufe und Schreie durchstießen das gleichförmige Rauschen der Brandung.
Jenseits des breiten Sandstreifens und dem dahinter aufragenden Kliff lag weiß und golden der Palast von Gravabagalinien, das Exil der Königin, wo sie auf ihre Scheidung wartete – oder ihre Ermordung. Von der See her nahm er sich spielzeugartig klein aus.
Die Phagoren standen bewegungslos am Strand. Draußen auf See stand das Dreieckssegel eines Fischerbootes. Die Wolken im Süden schienen sich nicht zu verändern. Alles wartete.
Die Zeit aber blieb nicht stehen. Der Tag nahm seinen Fortgang – keine Person von Stand wagte sich in diesen Breiten ins Freie, wenn beide Sonnen am Himmel standen. Später wurden die Wolken bedrohlicher, und das Segel wanderte nach Osten ab.
Gegen Abend trugen die Wellen einen menschlichen Leichnam ans Ufer. Dies war das Unerfreuliche, vor dem die Vertrauten gewarnt hatten. Sie quietschten vor Widerwillen.
Der Körper trieb um den Linienfelsen, als besäße er noch Leben und Willen, und wurde ins flache Wasser vor dem Strand getragen. Dort schwamm er mit dem Gesicht nach unten, von den Wellen auf und nieder bewegt. Ein Seevogel ließ sich auf seine Schultern nieder.
MyrdalemInggala wurde aufmerksam und schwamm hinüber, um den seltsamen Gegenstand näher zu untersuchen. Eine ihrer Hofdamen war bereits an Ort und Stelle und blickte voll Entsetzen auf den grausigen Fisch herab. Sein dichtes schwarzes Haar war verklebt vom Salzwasser. Ein offenbar gebrochener Arm hing über dem Nacken.
Der Leichnam war bereits in Verwesung übergegangen und unförmig angeschwollen. Garnelenartige kleine Krebse umschwärmten ein aufgerissenes Knie. Die Hofdame streckte den Fuß aus und wälzte den Leichnam im Wasser herum, dass er mit dem Gesicht nach oben trieb. Er verbreitete einen widerwärtigen Gestank.
Eine Masse sich schlängelnder Lampreten hatte sich am Gesicht des Toten festgesaugt und zehrte gierig von Mund und Augenhöhlen. Selbst im hellen Licht und halb aus dem Wasser herausgehoben, ließen sie nicht von ihrer Mahlzeit ab.
Die Königin wandte sich rasch um, als sie kleine Füße näherkommen hörte. Sie umfing Tatro und schwenkte das Kind über ihrem Kopf im Kreis herum, küsste es und lächelte es fröhlich und aufmunternd an, und dann lief sie mit der Kleinen den Strand hinauf. Unterwegs rief sie ihrem Majordomo zu: »Scurbar! Schaff dieses Ding von unserem Strand! Lass es so rasch wie möglich verscharren! Außerhalb der alten Befestigungen!«
Der Diener erhob sich aus dem Schatten des Zeltes und klopfte Sand aus seinem Charfrul.
»Sofort, Majestät«, sagte er mit einer Verbeugung.
Später fiel der von ihren Ängsten getriebenen Königin eine bessere Methode zur Beseitigung des Leichnams ein.
»Bring ihn nach Ottassol zu einem Mann, den ich kenne!«, instruierte sie ihren kleinen Majordomo mit ernstem Blick. »Das ist ein Mann, der Kadaver kauft. Ich werde dir auch einen Brief mitgeben, allerdings nicht für den Anatomen. Du darfst dem Anatomen nicht sagen, woher du kommst, verstehst du?«
»Wer ist dieser Mann, Majestät?«
Scurbars Miene spiegelte äußersten Widerwillen.
»Sein Name ist CaraBansity. Du hast meinen Namen ihm gegenüber nicht zu erwähnen. Er gilt als ein verschlagener Mann.«
Sie bemühte sich, den Zustand ihres beunruhigten Gemütes vor den Dienern zu verbergen und bedachte wenig, dass eine Zeit kommen könnte, da ihre Ehre in den Händen des CaraBansitys ruhen würde.
Unter dem knarrenden hölzernen Palast war der gewachsene Fels wabenförmig ausgehöhlt zu einem Labyrinth kühler Keller. Einige dieser Kellerräume waren angefüllt mit aufeinandergestapelten Eisblöcken, die aus einem Gletscher im entfernten Südkontinent Hespagorat gehauen worden waren. Als beide Sonnen untergegangen waren, stieg Majordomo Scurbar zu den Eiskellern hinab, eine Walöllaterne in der erhobenen Hand. Ihm folgte ein kleiner Sklavenjunge, der sich ängstlich am Saum seines Charfrul festhielt.
In einer Art Notwehr gegen die Plagen und Mühseligkeiten des Lebens war Scurbar mit den Jahren zu einer eingefallenen Brust, einem Spitzbauch und einem runden Rücken gekommen, als wollte er damit seine Bedeutungslosigkeit unterstreichen und weiteren Pflichten entgehen. Diese Abwehr hatte versagt. Die Königin hatte einen Botengang für ihn.
Er legte lederne Handschuhe und eine Lederschürze an. Nachdem er die isolierende Schilfmatte von einem der Eisstapel gezogen hatte, gab er die Laterne dem Jungen in die Hand und ergriff ein Eisbeil. Mit zwei Schlägen trennte er einen der Blöcke von seinem Nachbarn.
Unter angestrengtem Grunzen, das den Jungen vom Gewicht des Eisblocks überzeugen sollte, trug Scurbar seine Last langsam die Treppe hinauf und achtete darauf, dass der Junge die Tür hinter ihm absperrte. Oben wurde er von riesigen Hunden empfangen, welche die dunklen Korridore durchstreiften. Da sie Scurbar kannten, bellten sie nicht.
Er trug den Eisblock durch eine rückwärtige Tür ins Freie. Draußen wartete er, bis er hörte, dass der Sklavenjunge die Tür von innen verriegelte. Dann erst schleppte er seine Last weiter über den Hof. Am Himmel schimmerten die Sterne und tauchten den Hof und die umgebenden Dächer in ein ungewisses Licht. Scurbar verschwand unter einem hölzernen Bogen im dunklen Stallgebäude, wo es nach Mist und warmen Tierleibern roch.
Ein Stallknecht wartete fröstelnd in der Finsternis. Nach Dunkelwerden hielten die Bediensteten des Schlosses sich nicht gern außerhalb ihrer Räume auf, weil es hieß, dass des Nachts die Soldaten der toten Armee aufstünden und auf der Suche nach günstigen Landoktaven umhergingen. In der Dunkelheit schnaubte und stampfte eine Reihe brauner Hoxner.
»Ist mein Hoxner bereit?«
»Jawohl.«
Der Stallknecht hatte ein Packtier für Scurbars Reise vorbereitet. Auf dem Rücken des Tieres war ein Traggestell befestigt, auf dem ein langer geschlossener Flechtkorb ruhte, wie man ihn für den Transport von Waren verwendete, die zur Frischhaltung Eis benötigten. Mit einem letzten Grunzen ließ Scurbar den Eisblock in den Korb gleiten, dessen Boden mit einer Schicht Sägemehl bedeckt war.
»Jetzt hilf mir mit dem Toten, Junge, und stell dich nicht an!«
Der Körper des angetriebenen Unbekannten lag in einer Pfütze von Seewasser in einer Stallecke. Die beiden Männer schleiften ihn herüber, hoben ihn mit angestrengtem Schnaufen auf und legten ihn auf das Eis. Darauf schlossen sie erleichtert den gepolsterten Deckel und banden ihn fest.
»Ekelhaft kalt, das Ding«, sagte der Stallknecht und wischte sich die Hände an seinem Charfrul.
»Für eine Leiche haben nur wenige etwas übrig«, erwiderte Scurbar. Er entledigte sich der Handschuhe und seiner Schürze. »Ein Glück, dass der Deuteroskopist in Ottassol anders darüber denkt.«
Er führte den Hoxner aus dem Stall und vorüber an der Palastwache, deren schnurrbärtige Gesichter nervös aus einer Hütte nahe der Umwallung spähten. Der König hatte seiner verstoßenen Königin nur alte oder unzuverlässige Bedienstete zu ihrem Schutz gelassen. Scurbar selbst war nicht weniger nervös als die Wächter und spähte unausgesetzt umher. Selbst das entfernte Tosen der Brandung machte ihn unruhig. Erst außerhalb des Palastgeländes machte er halt, um zu verschnaufen, und blickte zurück.
Der schwarze Umriss des Gebäudes hob sich wie Laubsägearbeit vom gestirnten Himmel ab. Nur aus zwei nebeneinander liegenden Fenstern drang matter Lichtschein. Dort war die Gestalt einer Frau zu erkennen, die auf dem Balkon stand und landeinwärts blickte. Scurbar nickte zu sich selbst, wandte sich zum Gehen und zog das Lasttier am Zaumzeug auf die Straße nach Ottassol.
Königin MyrdalemInggala hatte ihren Majordomo zu sich kommen lassen. Obgleich sie eine religiöse Frau war, blieb sie abergläubischen Vorstellungen verhaftet, und die Auffindung des Toten im Wasser beunruhigte sie. Sie war geneigt, den Vorfall als ein Vorzeichen des ihr selbst drohenden Todes zu nehmen.
Sie gab der Prinzessin TatromanAdala einen Gutenachtkuss und zog sich zurück, um zu beten. An diesem Abend aber hatte Akhanaba keine Tröstung für sie, obwohl sie einen einfachen Plan ersonnen hatte, wodurch der Leichnam für einen guten Zweck Verwendung finden konnte.
Sie fürchtete, was der König ihr und ihrer Tochter antun könnte. Schutzlos war sie seinem Zorn preisgegeben, und sie verstand, dass ihre Beliebtheit beim Volk sie zu einer Drohung für ihn machte, solange sie lebte. Es gab nur einen, der bereit sein würde, sie zu beschützen, einen General und Armeebefehlshaber des Königs; ihm hatte sie einen Brief geschickt, aber er kämpfte im Westen und hatte nicht geantwortet.
Nun hatte sie Scurbar einen weiteren Brief anvertraut. In Ottassol, hundert Meilen vom Palast entfernt, sollte binnen kurzem einer der Abgesandten des Heiligen Reiches von Pannoval eintreffen, zusammen mit ihrem Gemahl. Sein Name war Alam Esomberr, und er sollte die Scheidungsurkunde bringen und ihr zur Unterschrift vorlegen. Der Gedanke daran ließ sie zittern.
Ihr Brief war an diesen Alam Esomberr gerichtet, und sie bat ihn darin um Schutz vor ihrem Mann. Während ein Kurier von den Patrouillen des Königs angehalten würde, lief ein schmieriger kleiner Mann mit einem Packtier kaum Gefahr, aufzufallen. Und niemand würde nach einer Inspektion des Leichnams daran denken, noch nach einem Brief Ausschau zu halten.
Der Brief war nicht an den Abgesandten Esomberr adressiert, sondern an den Heiligen C'Sarr persönlich. Der C'Sarr hatte Ursache, dem König gram zu sein, und würde einer frommen Königin in Bedrängnis seinen Schutz sicherlich nicht versagen.
Sie stand barfuß auf dem Balkon ihres Schlafzimmers und schaute in die Nacht hinaus. Vielleicht war es lächerlich, dass sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf einen Brief setzte, wo doch die ganze Welt nahe daran sein mochte, in Flammen aufzugehen. Ihr Blick ging zum nördlichen Horizont. Dort glomm YarapRombrys Komet: den einen ein Symbol der Vernichtung, den anderen ein Wahrzeichen der Erlösung. Ein Nachtvogel rief. Die Königin lauschte dem Ruf noch nach, als er verklungen war, wie man einem Messer nachschaut, das unwiederbringlich im klaren Wasser versinkt.
Als sie sich überzeugt hatte, dass der Majordomo aufgebrochen war, kehrte sie zurück zu ihrem Lager und zog die seidenen Vorhänge um das Himmelbett zu. Noch lange lag sie mit offenen Augen.
Die staubige Küstenstraße zog sich wie ein weißes Band durch die Dunkelheit. Scurbar stapfte neben seinem Tragtier einher und versuchte mit ängstlichen Blicken die schwarzen Schatten entlang den Straßenrändern zu durchdringen. Trotzdem erschrak er, als eine Gestalt aus der Dunkelheit trat und ihn aufforderte, stehenzubleiben.
Der Mann war bewaffnet und von militärischem Gehabe. Er war einer von König JandolAnganols Leuten, beauftragt, ein Auge auf alle zu haben, die in Angelegenheiten der Königin kamen und gingen. Er schnüffelte am Flechtkorb. Scurbar erklärte ihm, dass er den Leichnam verkaufen wolle.
»Ist die Königin so arm?«, fragte der Wächter und ließ ihn ziehen.
Scurbar setzte seine Wanderung fort, aufmerksam für Bewegungen in der Dunkelheit der Straßenränder und andere Geräusche als die Hufschläge und das Knarren seiner Traglast. Es gab Schmuggler an der Küste und Schlimmeres. Borlien war entlang seiner Westgrenze in kriegerische Unternehmungen gegen Randonan und Kace verstrickt, und seine Landstriche wurden heimgesucht von Banden marodierender Soldaten und Deserteure.
Als er zwei Stunden gegangen war, führte Scurbar den Hoxner unter einen Baum, der seine Äste über den Weg breitete. Voraus lag eine Steigungsstrecke, an deren Ende die Einmündung der südlichen Straße in die westliche lag, die von Ottassol bis zur Grenze von Randonan führte.
Die Reise nach Ottassol nahm die vollen fünfundzwanzig Stunden des Tages in Anspruch, doch um diese Strecke zurückzulegen, gab es bequemere Möglichkeiten als die der Fußwanderung neben einem Tragtier.
Nachdem er den Hoxner an den Baum gebunden hatte, kletterte Scurbar in eine niedrige Astgabel und wartete. Er schlummerte ein.
Aufgerüttelt vom Rasseln eines herannahenden Fuhrwerks, stieg er vom Baum und wartete am Straßenrand. Das Sternenlicht half ihm, Fuhrwerk und Besitzer auszumachen. Er pfiff, ein antwortender Pfiff kam zurück, und das Fuhrwerk hielt gemächlich an.
Der Besitzer des Fuhrwerks war ein alter Freund aus derselben Gegend Borliens, aus der Scurbar stammte. Er hieß Floercrow, und im Sommer des kleinen Jahres fuhr er jede Woche Landprodukte zum Markt in die Stadt. Floercrow war kein zuvorkommender Mann, aber er war bereit, Scurbar auf dem Fuhrwerk nach Ottassol mitzunehmen, wenn er dadurch ein zusätzliches Tier bekam, das abwechselnd mit seinem eigenen zwischen den Deichselstangen gehen konnte.
Scurbar band sein Tragtier hinten an den Wagen, kletterte an Bord, und Floercrow ließ die Peitsche knallen. Sein geduldiger brauner Hoxner stemmte sich in die Zugseile, und das Fuhrwerk rumpelte weiter.
Trotz der Wärme der Nacht trug Floercrow einen breitkrempigen Hut und einen dicken Umhang. An seiner Seite stand ein Schwert griffbereit in einer eisernen Steckhülse. Seine Ladung bestand aus vier schwarzen Ferkeln, Dattelpflaumen, Gwing-Gwings und Bergen von Gemüse. Die Ferkel baumelten in Netzen hilflos außen am Fuhrwerk. Scurbar zwängte sich neben dem anderen auf den Kutschbock, lehnte sich zurück, zog sich die Kappe über die Augen und schlief.
Er wachte auf, als die Räder mit heftigen Stößen über hartgetrocknete Radspuren ratterten, so dass der ganze Wagenaufbau ins Schwanken geriet. Das Morgengrauen bleichte die Sterne aus dem Himmel; Freyrs Aufgang war nicht mehr fern. Eine Brise kam auf und trug ihnen die Gerüche menschlicher Wohnstätten zu.
Obwohl es noch nicht Tag war, gingen die Bauern bereits zur Arbeit auf die Felder. Sie bewegten sich wie stumme Schatten, und hätte nicht von Zeit zu Zeit ein metallisches Aneinanderschlagen der Arbeitsgeräte, die sie trugen, ihre wahre Natur verraten, so hätte man sie für die Geister von Verdammten halten können, verurteilt, allnächtlich die Stätten der Vergangenheit heimzusuchen. Ihr gleichmäßiger, schleppender Schritt und die geneigten Köpfe spiegelten die Müdigkeit ihres Heimwegs am vorausgegangenen Abend.
Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge, so zogen die Bauern auf ihren schmalen Pfaden zu den Feldern hinaus. Die sich allmählich enthüllende Landschaft bestand aus Hecken, Abhängen und Stützmauern und wurde beherrscht von einer stumpfbraunen Farbe, die jener der Hoxner glich und alles zu überdecken schien. Dies war der Randbereich der großen Lößebene, die den zentralen südlichen Teil des tropischen Kontinents Campannlat bildete. Im Norden erstreckte sie sich beinahe bis zu den Grenzen Oldorandos, und im Osten bis zum Takissa, an dessen Ufern Ottassol lag. Der fruchtbare Boden wurde seit ungezählten Jahren von Bauern bearbeitet, und menschliche Tätigkeit hatte der Landschaft ihre Merkmale aufgeprägt. Böschungen und Dämme und Terrassen waren angelegt worden, um von nachfolgenden Generationen wieder abgetragen oder neu errichtet zu werden. Selbst in Trockenzeiten wie der gegenwärtigen, blieb die Bestellung der Lößböden das einzige Mittel, um die Bevölkerung zu ernähren.
»Brrr«, sagte Floercrow, während das Fuhrwerk auf gewundener Straße durch ein Dorf rumpelte.
Dicke Lehmmauern schützten die Ansammlung niedriger Bauernhäuser und Ställe gegen Räuber. Das Tor war während des vorjährigen Monsuns eingestürzt und seither noch nicht wiederhergestellt. Obwohl noch tiefe Dämmerung herrschte, zeigte sich kein Licht hinter den wenigen kleinen Fenstern, die von der Straße zu sehen waren. Hühner und Gänse suchten nach Nahrung zwischen den geflickten Lehmmauern, die vereinzelt mit religiösen Symbolen bemalt waren.
Eine erfreuliche Entdeckung machten die Reisenden am Ortsausgang. Dort kauerte ein alter Mann hinter einem kleinen Ofen. Er brauchte seine Waren nicht anzupreisen: der Duft, den sie verbreiteten, war Verlockung genug. Er war ein Waffelbäcker. Nicht wenige Bauern, die an ihm vorbei zur Feldarbeit gingen, kauften Waffeln von ihm oder gaben ihm im Austausch Kräuter und Gemüse aus dem Küchengarten.
Floercrow versetzte Scurbar einen Rippenstoß und wies mit dem Peitschenstiel zum Waffelbäcker. Scurbar verstand die Andeutung, kletterte steif vom Kutschbock und ging zu dem Alten, um das Frühstück zu kaufen. Die Waffeln kamen unmittelbar aus dem heißen Rachen des Waffeleisens in die Hände der Käufer. Floercrow aß gierig, dann stieg er auf die Ladefläche des Fuhrwerks, um sich zwischen dem Gemüse einen Schlafplatz zu suchen. Scurbar wechselte die Zugtiere, ergriff die Zügel und setzte das Fuhrwerk wieder in Bewegung. Der Tag schleppte sich von Stunde zu Stunde dahin. Andere Fahrzeuge belebten die Landstraße. Die Landschaft veränderte sich. Zeitweilig führte die Straße durch tiefe Einschnitte zwischen sanft gewellten Lößhügeln, so dass außer den mit Gesträuch bewachsenen Abhängen zu beiden Seiten nichts zu sehen war. Anderswo führte die Landstraße an Hängen entlang oder über Bodenwellen hinweg; dann boten sich weite Ausblicke über das Ackerland.
In allen Richtungen erstreckte sich die sanft gewellte Lößebene, gesprenkelt mit vereinzelten Gehöften, Bäumen und arbeitenden Menschen auf den Feldern. Baumreihen begleiteten Wege und gewundene Bachläufe. Die Anlage der Felder und Terrassen folgte den Konturen des Geländes. Flüsse waren kanalisiert und wurden von Lastkähnen mit rechteckigen Segeln befahren.
Von welcher Art der Ausblick und wie drückend die Hitze auch war – die Temperatur musste an die vierzig Grad herankommen –, die Bauern arbeiteten, solange Licht am Himmel war. Getreide, Obst und Gemüse gediehen nur, wenn zur rechten Zeit gepflügt, gesät, gepflanzt, gejätet und gedüngt wurde. Die Rücken der Menschen blieben gebeugt, ob eine oder zwei Sonnen vom Himmel brannten.
Im Gegensatz zu Batalix' rötlicher Glut war Freyr von einer gnadenlos blendenden Helligkeit. Reisende von Oldorando, das dem Äquator näher lag, berichteten von Wäldern, die unter Freyrs heißen Strahlen in Flammen aufgegangen seien. Viele glaubten, dass Freyr binnen kurzem die Welt verschlingen werde; dennoch mussten Hacke und Sense in Bewegung bleiben, und kostbares Wasser tröpfelte auf zartes Gemüse.
Das Fuhrwerk näherte sich Ottassol. Einzelgehöfte waren in dieser Gegend häufiger als geschlossene Dörfer; sie lagen weithin verstreut zwischen ihren Feldern, die sich bis zum hitzeflimmernden Horizont erstreckten.
Die Landstraße führte allmählich abwärts in einen Einschnitt zwischen zehn Meter hohen lehmigen Böschungen, die zu beiden Seiten von Stolleneingängen durchlöchert waren. Sie hatten das Dorf Mordrec erreicht, das bereits zu den Außenbezirken der Stadt gerechnet wurde. Die Männer kletterten vom Fuhrwerk und banden das Zugtier an, das zwischen den Deichselstangen stand und den Kopf hängen ließ, bis es Wasser bekam. Beide Tiere waren ermattet.
Die Männer betraten hintereinander einen der schmalen Stollen, an dessen Ende Sonnenschein zu sehen war. Bald gelangten sie in einen offenen Hof unter dem Niveau der Erdoberfläche.
Eine Seite des Hofes wurde von einer Schenke eingenommen, die wie das ganze Dorf höhlenartig in den lehmigen Untergrund gegraben war. Das Innere, angenehm kühl, empfing Licht durch die zum Hof gehenden Fenster.
Gegenüber der Schenke waren Wohnungen, auch in den Lehm hineingegraben. Die ockerfarbenen Fassaden waren belebt von blühenden Topfpflanzen, die auf den Fenstersimsen standen.
Das Dorf bestand aus einem Labyrinth unterirdischer Stollen, welche die einzelnen Wohnhöfe miteinander verbanden. Um die Höfe waren Wohnungen angeordnet, und von hier führten in den Lehm gegrabene Treppen zur Oberfläche hinauf, wo die Bewohner von Mordrec ihre Felder bestellten. Über den Wohnungen waren Felder.
Als sie in der Schenke saßen, einen Imbiss nahmen und Wein tranken, sagte Floercrow: »Er stinkt nicht wenig.«
»Ist schon eine Weile tot. Die Königin fand ihn am Strand. Angetrieben. Ich würde sagen, dass er in Ottassol ermordet und von einem Kai in die See geworfen wurde. Die Strömung hat ihn dann die Küste entlanggetragen.«
Sie kehrten zurück zu ihrem Fuhrwerk, banden das Zugtier los und kletterten auf den Kutschbock. »Ein schlechtes Omen für die Königin der Königinnen, soviel ist sicher.«
Der lange Flechtkorb lag mit dem Gemüse hinten auf der Ladefläche. Wasser tröpfelte vom schmelzenden Eis zu Boden, wo sich im Staub eine kleine Pfütze gebildet hatte. Fliegen umsummten das Fuhrwerk.
Floercrow nahm die Zügel auf, schnalzte und sie machten sich wieder auf den Weg.
»Wenn König JandolAnganol jemand aus dem Weg haben will, fackelt er nicht lange.«
Scurbar war bestürzt. »Die Königin ist zu beliebt. Hat überall Freunde.« Er tastete nach dem Brief in seiner inneren Tasche und nickte bekräftigend. Einflussreiche Freunde.
»Und er will statt ihrer ein elfjähriges Mädchen heiraten.«
»Elf und fünf Zehner.«
»Was immer. Es ist abscheulich.«
»Ja, abscheulich ist es schon«, stimmte Scurbar ihm zu. »Elfeinhalb, stell dir vor!« Er schmatzte mit den Lippen und pfiff.
Sie sahen einander an und grinsten.
Das Fuhrwerk schwankte und knarrte Ottassol entgegen, umschwirrt von Schmeißfliegen.
Ottassol war die große unsichtbare Stadt. In kälteren Zeiten hatte die Ebene ihre Gebäude getragen; heute trugen sie die Ebene. Ottassol war ein unterirdisches Labyrinth, worin Menschen und Phagoren lebten. Was an der versengten Oberfläche blieb, waren Wege und Felder, unterbrochen von den rechteckigen Schächten der Lichthöfe im Boden. Um diese gruppierten sich die Fassaden von Häusern, die sonst keine klar umrissenen Grenzen hatten.
Ottassol war ausgehöhlte Erde, das Negativ einer Stadt, die an der Erdoberfläche nicht als eine solche zu erkennen war.
Die Stadt beherbergte 695 000 Einwohner. Ihr Umfang war nicht zu überblicken und nur wenigen Bewohnern wirklich bekannt. Die guten Ackerböden der Umgebung, das Meeresklima und die geographische Lage hatten die Hafenstadt größer werden lassen als Borliens Hauptstadt Matrassyl. Im Laufe der Generationen hatte das Netz der unterirdischen Lehmhöhlen sich mehr und mehr ausgedehnt, oft auf verschiedenen Ebenen, bis es am steilen Flussufer des Takissa seine natürliche Grenze gefunden hatte.
Gepflasterte Gassen führten durch die unterirdische Stadt, einige breit genug, dass zwei Fuhrwerke aneinander vorbeifahren konnten. Scurbar durchwanderte das Labyrinth, den Hoxner mit dem Flechtkorb am Strick führend. Auf dem Markt am Stadtrand hatte er sich von Floercrow getrennt. Passanten drehten sich um und starrten ihm nach, rümpften die Nasen ob des üblen Geruchs, der sich hinter ihm verbreitete. Der Eisblock am Boden des Flechtkorbes war zerschmolzen. Wiederholt drohte Scurbar die Orientierung zu verlieren und musste sich bei Straßenhändlern und anderen ortskundigen Einheimischen nach der Wohnung des Anatomen Bardol CaraBansity erkundigen.
Bettler jeglicher Art riefen die Vorübergehenden um Almosen an, vornehmlich an den Portalen der zahlreichen Kirchen. Es waren verwundete Soldaten, die aus den Kriegsgebieten zurückgekehrt waren, Krüppel, Männer und Frauen, die unter schrecklichem Hautkrebs litten. Scurbar schenkte ihnen keine Beachtung. An allen Ecken und in allen Höfen sangen gefangene Pecubeas in ihren Käfigen. Die Gesänge der Unterarten des Pecubea waren so verschieden, dass die Blinden sich nach ihnen orientieren konnten.
Endlich gelangte Scurbar in den ihm genannten Hof und zu der Tür, die ein Schild mit dem Namen Bardol CaraBansity trug. Er läutete die Glocke.
Ein Riegel wurde zurückgestoßen, die Tür geöffnet. Ein Phagor erschien, gekleidet in ein grobes, hanfleinenes Gewand. Seine stieren kirschroten Augen starrten misstrauisch.
»Was willst du?«
»Ich will den Anatom sprechen.«
Nachdem er den Hoxner an einen Pfosten gebunden hatte, trat Scurbar in einen kleinen überwölbten Raum. Darin stand eine Art Theke, hinter welcher ein zweiter Phagor stand.
Der erste Phagor ging einen Korridor entlang, dessen Wände er mit seinen breiten Schultern streifte. Er stieß einen Vorhang zurück und betrat einen Wohnraum. Der Anatom erfreute sich auf einer Couch des Beischlafs mit seiner Frau. Er wandte den Kopf, ohne in seinen Bewegungen innezuhalten, blickte über die Schulter, hörte sich an, was der nichtmenschliche Diener zu sagen hatte und seufzte resigniert.
»Dass dich der Böse … Na, ich komme schon.« Schwerfällig löste er sich, stand auf und lehnte sich schnaufend gegen die Wand, um unter seinem Charfrul die Hosen hochzuziehen. Darauf zog er bedächtig das Übergewand glatt.
Seine Frau schleuderte ein Kissen nach ihm. »Du Tölpel, warum konzentrierst du dich nicht? Komm wieder her und sag diesen Dummköpfen, sie sollen sich fortscheren!«
Er schüttelte den Kopf, dass seine Hängebacken in schwabbelnde Bewegung gerieten. »Das ist das unerbittliche Uhrwerk der Welt, meine Schöne. Halt es warm, bis ich zurückkomme. Ich habe über das Kommen und Gehen der Menschen nicht zu bestimmen …«
Er ging durch den Korridor und blieb an der Schwelle seines Ladens stehen, um den Neuankömmling zu mustern. Bardol CaraBansity war ein kräftiger Mann, weniger groß als breit und massig, von schwerfälliger Art und mit einem großen, kantigen Schädel, der dem eines Phagoren nicht unähnlich war. Über dem Charfrul trug er einen dicken Ledergürtel, in dem ein Messer steckte. Obwohl er wie ein gewöhnlicher Metzger aussah, genoss CaraBansity einen wohlverdienten Ruf als schlauer und kenntnisreicher Mann.
Mit seiner eingefallenen Brust und dem vorstehenden Spitzbauch bot Scurbar keinen eindrucksvollen Anblick, und CaraBansity gab durch ein ungeduldiges und geringschätziges Schnaufen zu verstehen, dass er seinen Besucher nicht sonderlich hoch einschätzte.
»Ich habe einen Leichnam zu verkaufen, Herr. Einen menschlichen Leichnam.«
CaraBansity machte eine wortlose Geste zu den Phagoren. Sie gingen hinaus und schleppten gemeinsam den Körper herein, den sie auf die Theke legten. Durchnässtes Sägemehl haftete an den Kleidern des Toten.
Der Anatom und Deuteroskopist trat einen Schritt näher.
»Ziemlich angegangen. Wo hast du ihn her, Mann?«
»Aus einem Fluss, Herr. Als ich dort angeln war.«
Der Körper war von den inneren Gasen so aufgebläht, dass er seine Kleider zu sprengen drohte. CaraBansity wälzte ihn auf den Rücken und zog ihm einen toten Fisch aus dem Hemd, den er Scurbar vor die Füße warf.
»Das ist eine sogenannte Lamprete. Für diejenigen unter uns, denen an der Wahrheit liegt, ist es ein Seefisch, kein Süßwasserfisch. Warum lügst du? Hast du diesen armen Kerl umgebracht? Du siehst wie ein Verbrecher aus. Die Phrenologie legt den Schluss nahe.«
»Also gut, Herr, wenn Ihr es vorzieht: ich habe ihn an der Meeresküste gefunden. Da ich ein Diener der unglücklichen Königin bin, wollte ich vermeiden, dass der Umstand allgemein bekannt wird.«
CaraBansity musterte ihn eingehender. »Du dienst MyrdalemInggala, der Königin der Königinnen, du Halunke? Sie hat gute Diener und ein gnädiges Schicksal verdient, die Majestät.«
Er wies zu einem schlecht gemalten Porträt der Königin, das in einer Ecke des Ladens hing.
»Ich diene ihr gut genug. Sagt mir, was Ihr für diesen Leichnam zahlen wollt.«
»Du hast den weiten Weg für zehn Roon auf dich genommen, denn mehr kann ich nicht geben. In diesen schlimmen Zeiten kann ich jeden Tag der Woche Körper zum Aufschneiden bekommen. Und frischere als diesen.«
»Man sagte mir, dass Ihr mir fünfzig zahlen würdet, Herr. Fünfzig Roon, Herr.« Scurbar lächelte verschmitzt und rieb sich die Hände.
»Wie kommt es, dass du hier mit deinem übelriechenden Freund auftauchst, wenn der König und ein Abgesandter des Heiligen C'Sarr in Ottassol erwartet werden? Bist du ein Werkzeug des Königs?«
Scurbar breitete die Hände aus und verdrehte die Augen. »Ich habe Verbindungen nur mit meinem Hoxner draußen. Zahlt mir fünfundzwanzig, Herr, und ich werde mich sogleich auf den Rückweg machen.«
»Ihr Halunken seid alle zu geldgierig. Kein Wunder, dass die Welt zugrunde geht.«
»Wenn das der Fall ist, Herr, dann will ich mich mit zwanzig zufriedengeben. Zwanzig Roon.«
CaraBansity wandte sich zu einem der teilnahmslos dastehenden Phagoren, der sich mit der blassen Zunge die schlitzartigen Nüstern leckte, und sagte: »Gib dem Mann sein Geld und schaff ihn hinaus!«
»Wie viel muzzh ich zahlen?«
»Zehn Roon.«
Scurbar ließ ein Jammergeschrei vernehmen.
»Also gut, fünfzehn. Und du, mein Lieber, empfiehlst mich deiner Königin!«
Der Phagor griff in sein hanfleinenes Gewand und zog eine magere Börse hervor. Er nahm drei Goldmünzen heraus und legte sie in die knorrige Innenfläche seiner dreifingrigen Hand. Scurbar riss die Münzen an sich und ging verdrießlich zur Tür.
CaraBansity befahl einem seiner nichtmenschlichen Assistenten, den Leichnam zu schultern – ein Befehl, dem ohne erkennbaren Widerwillen Folge geleistet wurde –, und folgte ihm durch den halbdunklen, von seltsamen Gerüchen durchwehten Korridor. CaraBansity verstand von Sternen soviel wie von den Eingeweiden, und seine Wohnung, die selbst einem verschlungenen Gedärm nicht unähnlich war, erstreckte sich weit in den gelben Lehm, ausgestattet mit genug Höhlenräumen, dass sie seinen verschiedenartigen Interessen Raum bot. Außerdem hatte sie Ausgänge zu mehreren Gassen.
Sie betraten eine Werkstatt. Durch zwei kleine viereckige Fenster hoch in den festungsartig dicken Lehmwänden fiel Tageslicht ein. Unter den Spreizfüßen der Phagoren glänzten Lichtpunkte, die wie Diamanten aussahen. Es waren Glastropfen, die beim Schmelzen verstreut wurden, wenn der Deuteroskopist Linsen herstellte.
Der Raum war unordentlich und vollgestopft mit den Instrumenten und Werkzeugen der Gelehrsamkeit. Eine Wand war mit den zehn Tierkreiszeichen bemalt. An einer anderen hingen drei Kadaver in verschiedenen Stadien der Zergliederung, ein riesiger Fisch, ein Hoxner und ein Phagor. Der Hoxner war wie ein Buch geöffnet, die Weichteile entfernt, um Rippen und Rückgrat freizulegen. Auf einem Arbeitstisch lagen Papierbogen, auf die CaraBansity detaillierte Darstellungen des toten Tieres gezeichnet hatte, wobei er verschiedene Teile mit farbiger Tinte wiedergegeben hatte.
Der Phagor schwang den Leichnam des Ertrunkenen von der Schulter und hängte ihn kopfüber an zwei Fleischerhaken, die er zwischen Achillesferse und Fersenbein durch das Fleisch bohrte. Die gebrochenen Arme baumelten herab, die gedunsenen Hände ruhten wie fette leblose Krabben am Boden. Auf einen Rippenstoß von CaraBansity ging der Phagor hinaus. Der Anatom mochte die Ancipitalen nicht um sich haben, aber sie kamen billiger als Diener und sogar als menschliche Sklaven.
Nach prüfender Betrachtung des Leichnams zog CaraBansity das Messer aus dem Gürtel und schnitt dem Toten die Kleider herunter. Den Verwesungsgestank beachtete er nicht.
Der Körper war der eines jungen Mannes, zwölf Jahre alt, vielleicht zwölfeinhalb, nicht mehr. Die Kleider waren von derber und ausländischer Qualität, das Haar in einer Art geschnitten, wie man es häufig bei Seeleuten sah.
»Du, mein Lieber, bist wahrscheinlich nicht von Borlien«, sagte CaraBansity zu dem Leichnam. »Deine Kleider sind von der Art, wie man sie in Hespagorat trägt – wahrscheinlich aus Dimariam.«
Der Bauch war so aufgebläht, dass er wie eine Blase über dem ledernen Leibgürtel hing. CaraBansity suchte den Verschluss und machte ihn los. Als das Fleisch herabsank, gab es eine Wunde frei. CaraBansity zog einen Handschuh über und steckte seine Faust in die Wunde. Seine suchenden Finger stießen auf ein Hindernis. Nach einigem Ziehen brachte er ein gebogenes graues Phagorenhorn zum Vorschein, das die Milz durchbohrt hatte und tief in den Leib eingedrungen war. Interessiert betrachtete er den Gegenstand. Die zwei scharfen Kanten machten das Horn zu einer nützlichen Waffe. Sie hatte offensichtlich einen Griff gehabt, der verlorengegangen war, wahrscheinlich im Meer.
Er betrachtete den Toten mit vermehrtem Interesse. Ein Geheimnis war immer nach seinem Geschmack.
Er legte das Horn aus der Hand und untersuchte den Gürtel. Dieser war hervorragend verarbeitet, aber ein Standardartikel, wie man ihn überall kaufen konnte – in Osoilima beispielsweise, wo die Pilger für Nachfrage nach solchen Dingen sorgten. An der Innenseite war eine Tasche, die man zuknöpfen konnte. Er öffnete sie, griff mit zwei Fingern hinein und zog ein rätselhaftes Objekt hervor.
Er legte es in seine schmutzige Handfläche und ging stirnrunzelnd damit zum Licht. Ein Ding wie dieses hatte er noch nie gesehen. Er konnte nicht einmal das Metall bestimmen, aus dem es hauptsächlich gemacht war. Ein Schauer abergläubischer Furcht trübte seinen pragmatischen Verstand.
Als er den Gegenstand unter der Pumpe abwusch und anhaftende Spuren von Sand und Blut entfernte, kam seine Frau Bindla in die Werkstatt.
»Bardol? Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest zurückkommen. Du weißt, was ich für dich warmgehalten habe.«
»Ja, mein Liebes, aber ich habe etwas anderes zu tun.« Er warf ihr sein würdevolles Lächeln zu. Sie war von mittlerem Alter – mit achtundzwanzig und einem Zehner nicht ganz zwei Jahre jünger als er –, und ihr üppiges kastanienbraunes Haar begann seine Farbe zu verlieren; aber er bewunderte die Art und Weise, wie sie sich nach wie vor ihrer reifen Reize bewusst war. Im Augenblick reagierte sie mit übertriebenem Naserümpfen auf die Gerüche im Raum.
»Du schreibst nicht einmal an deiner Abhandlung über Religion, was deine übliche Entschuldigung ist.«
Er grunzte. »Ich ziehe meinen Gestank vor.«
»Du perverser Mensch. Religion ist ewig, Gestank nicht.«
»Im Gegenteil, meine kurzbeinige Schöne, Religionen wechseln die ganze Zeit. Der Gestank ist es, der in alle Ewigkeit derselbe bleibt.«
»Und das gefällt dir?«
Er trocknete den seltsamen Gegenstand an einem Lappen, ohne zu antworten.
»Schau dir das an!«
Sie kam zu ihm und legte die Hand auf seine Schulter.
»Bei den Gebeinen!«, murmelte er in ehrfürchtigem Staunen. Er reichte das Ding seiner Frau, und ihr stockte der Atem.
Ein kleiner Gurt aus kunstvoll miteinander verwobenen Metallgliedern, der sehr einem Armband ähnelte, trug ein flaches, rundliches Gehäuse mit einer transparenten Deckplatte. In dieser glommen drei Zahlenkombinationen.
Sie lasen die Zahlen laut, als er mit derbem Finger darauf zeigte:
06:16: 55 – 12: 37: 76 – 19: 20: 14
Während sie noch ablasen, wechselten einige der Zahlen bereits ihr Aussehen; tatsächlich waren sie in steter zuckender Veränderung begriffen. Die CaraBansitys sahen einander in stummer Verblüffung an. Dann beugten sie sich wieder über das Wunderding.
»Solch einen Talisman habe ich noch nie gesehen«, hauchte Bindla.
Fasziniert starrten sie auf das Spiel der Zahlen. Diese waren schwarz auf einem gelben Hintergrund. Er las sie laut ab.
06: 20: 25 – 13: 00: 00 – 19: 23: 44
Als CaraBansity den Mechanismus ans Ohr hielt, um zu horchen, ob er ein Geräusch machte, begann die Pendeluhr an der Wand hinter ihnen dreizehn zu schlagen. Diese Uhr war ein kunstvolles Werk, in seinen jüngeren Jahren von CaraBansity selbst angefertigt. Sie zeigte in bildhafter Form die Auf- und Untergangszeiten der zwei Sonnen Batalix und Freyr, ferner die Teilung des Jahres, die hundert Sekunden in einer Minute, die vierzig Minuten in einer Stunde, die fünfundzwanzig Stunden des Tages, die acht Tage der Woche, die sechs Wochen eines Zehners, und die zehn Zehner in einem Jahr von vierhundertachtzig Tagen. Schließlich gab es einen Zeiger, der die 1825 kleinen Jahre in einem großen Jahr anzeigte; dieser Zeiger stand jetzt auf 381, was der gegenwärtigen Jahreszahl nach dem Kalender von Borlien und Oldorando entsprach.
Bindla lauschte gleichfalls dem Mechanismus und hörte nichts. »Ist es eine Art Uhr?«
»Das muss es sein. Die mittlere Zahlengruppe zeigt dreizehn Uhr borlienischer Zeit.«
Sie merkte es immer, wenn er ratlos war. Wie ein Kind kaute er auf seinem Knöchel.
Am oberen Rand des Gehäuses waren drei Knöpfe oder kurze Stifte. Sie drückte einen davon.
In den drei Öffnungen erschien eine andere Zahlenserie:
6877 – 828 – 3269
(1177)
»Die mittlere Zahl ist das Jahr, nach irgendeinem alten Kalender oder was. Wie kann das gehen?«
Er drückte noch einmal auf den Knopf und die vorige Serie erschien wieder. Er legte das Armband auf die Werkbank und starrte darauf, aber Bindla hob es auf und streifte es über die Hand. Das Armband passte sich sofort an und schloss sich fest um ihr rundes Handgelenk. Sie schrie vor Schreck auf.
CaraBansity ging zu einem Regal, auf dem er eine Reihe abgenutzter Nachschlagewerke verwahrte. Er überging einen alten Folianten mit dem Titel Das Testament RayniLayans und zog ein in Halbleder gebundenes Exemplar Kalendarische Tabellen für Seher und Deuteroskopisten hervor. Nach einigem Blättern hatte er die gesuchte Seite gefunden und fuhr mit dem Finger eine Zahlenkolonne herab.
Obgleich man nach dem Kalender von Borlien und Oldorando das Jahr 381 zählte, war diese Rechnung nicht allgemein anerkannt. Andere Nationen gebrauchten andere Berechnungsweisen, die in den Tabellen aufgeführt waren. Unter diesen befand sich auch 828. Er fand die Zahl in der Spalte des altertümlichen, längst außer Gebrauch gekommenen ›Denniss-Kalenders‹, der heutzutage mit Zauberei und Okkultismus in Zusammenhang gebracht wurde. Denniss war der Name eines legendären Königs, der einst über ganz Campannlat geherrscht haben sollte.
»Das mittlere Feld bezieht sich auf die Lokalzeit«, sagte er und schüttelte verwundert den Kopf. »Und das Ding hat wahrscheinlich mehrere Tage lang im Seewasser gelegen, ohne in seiner Wirkungsweise beeinträchtigt zu sein. Wo gibt es Handwerker, die ein solches Juwel anfertigen könnten? Irgendwie muss es aus den Zeiten des sagenhaften Denniss überlebt haben …«
Er hielt das Handgelenk seiner Frau, und sie sahen, wie die Zahlen sich geschäftig veränderten. Sie hatten eine Uhr von unvergleichlicher Verfeinerung gefunden, wahrscheinlich von unvergleichlichem Wert, und ganz gewiss von geheimnisvoller Herkunft.
Wo immer die Handwerksmeister lebten, die das Armband gemacht hatten, sie mussten unberührt von dem beklagenswerten Zustand sein, in den König JandolAnganol das Land Borlien gebracht hatte. In Ottassol waren die Verhältnisse noch vergleichsweise gut, weil es eine Hafenstadt war, die mit anderen Ländern Handel trieb. Anderswo sah es schlechter aus; dort herrschten Dürre, Hungersnot und Gesetzlosigkeit. Die Kriege und Grenzstreitigkeiten zehrten an der Kraft des Landes. Ein besserer Staatsmann als der König, beraten von einer weniger korrupten Scritina oder Ständeversammlung, würde mit Borliens Feinden Frieden schließen und sich um die Wohlfahrt der Bevölkerung kümmern.
Dennoch war es nicht möglich, JandolAnganol zu hassen, obwohl CaraBansity regelmäßig versuchte, es zu tun – weil er bereit war, seine schöne Frau, die Königin der Königinnen, aufzugeben, um ein dummes Kind zu heiraten, einen Madi-Mischling. Warum sollte der Adler dies tun, wenn nicht, um die neue Allianz zwischen Borlien und seinem Erbfeind Oldorando zum Besten seines Landes zu festigen? JandolAnganol war ein gefährlicher Mann, darin waren alle sich einig – aber er stand genauso unter dem Zwang der Umstände wie der niedrigste Bauer.
Die Verschlechterung des Klimas trug sicherlich einen guten Teil Schuld an den Missständen. Die mörderische, von Generation zu Generation anwachsende Hitze, unter der sogar die Bäume Feuer fingen …
»Steh nicht und träume!«, rief Bindla. »Komm und hilf mir das Ding vom Arm zu ziehen!«
II
Ankömmlinge im Palast
Das von der Königin so sehr gefürchtete Ereignis bereitete sich bereits vor. König JandolAnganol war auf dem Weg nach Gravabagalinien, um sich von ihr scheiden zu lassen.
Von der borlienesischen Hauptstadt Matrassyl sollte die Reise mit einem Flussboot über den Takissa abwärts nach Ottassol gehen, von dort mit einem Küstenschoner westwärts nach Gravabagalinien. Dort wollte JandolAnganol der Königin vor Zeugen die vom Heiligen C'Sarr unterzeichnete Scheidungsurkunde aushändigen. Darauf würden sie voneinander scheiden, vielleicht für immer.
Dies war des Königs Plan, den er mit ebenso viel Ungestüm wie Missvergnügen vorantrieb.
Begleitet von Fanfarengeschmetter, eskortiert von Mitgliedern seiner Hofgesellschaft in vollem Ornat, wurde König JandolAnganol vom Palast aus in seiner Staatskarosse hinab durch Matrassyls krumme Gassen zum Flusshafen gefahren. Mit ihm in der Karosse saß ein einsamer Gefährte: Yuli, sein Lieblingsphagor. Yuli war nicht mehr als ein Knirps, dessen weißes Fell noch durchschossen war mit dem braunen Haarkleid seiner Säuglingszeit. Man hatte ihn kurz nach der Geburt enthornt, und nun saß er seinem Herrn gegenüber und rückte in nervöser Erwartung der Schiffsreise auf seinem Platz herum.
Als JandolAnganol ausstieg, trat der Kapitän des wartenden Schiffes vor und salutierte schneidig.
JandolAnganol, ein Feind allen unnötigen Zeremoniells, nickte ihm kurz zu und sagte: »Wir können gleich ablegen.« Von diesem selben Anlegeplatz war seine Königin vor fünf Zehnern ins Exil gesegelt. Gruppen von Schaulustigen standen am Flussufer, begierig, den König zu sehen, der solch einen widersprüchlichen Ruf genoss. Der Bürgermeister hatte sich an der Spitze des Stadtrates eingefunden, den Monarchen zu verabschieden. Die Hochrufe waren nicht mit dem ungeheuren Jubel zu vergleichen, der Königin MyrdalemInggala entgegengebracht worden war.
Der König ging an Bord. Eine hölzerne Klapper ertönte, hell und scharf wie Hufschläge auf Kopfsteinpflaster. Die Ruderer legten sich in die Riemen. Die Segel wurden entrollt.
Als das Schiff in den Strom hinausglitt, wandte JandolAnganol sich zum Ufer zurück, und sein starrer Blick suchte den Bürgermeister von Matrassyl, der mit seinem Gefolge am Anlegeplatz verharrte. Als er des Königs Blick auf sich fühlte, neigte der Bürgermeister unterwürfig den Kopf, aber JandolAnganol wusste, wie zornig der Mann war. Der Bürgermeister verübelte seinem Monarchen, dass er die unter äußerer Bedrohung liegende Stadt verließ. Die unzivilisierten Völker von Mordriat nutzten Borliens Krieg mit Randonan im Westen zu ihrem Vorteil und drangen von Nordosten vor.
Als das verdrießliche Gesicht achteraus zu einem winzigen blassen Fleck verschwamm, wandte der König den Blick nach Süden. Er musste sich eingestehen, dass die Haltung des Bürgermeisters gerechtfertigt war. Aus den Hochländern von Mordriat war Nachricht in die Stadt gelangt, dass der Kriegsherr, Unndreid der Hammer, wieder aktiv war. Zur Stärkung der Kampfmoral der borlienesischen Nordarmee wäre es zweckmäßig gewesen, wenn der König selbst oder sein Sohn, Kronprinz RobAydayAnganol, den Oberbefehl übernommen hätte. Aber RobAydayAnganol war an dem Tag verschwunden, als er von seines Vaters Scheidungsplänen erfahren hatte.
»Einen Sohn, dem man vertrauen kann …«, sagte JandolAnganol in den Wind, und ein bitterer Ausdruck kam in seine Züge. Er machte seinen Sohn für diese Reise verantwortlich, die er nun antreten musste.
So richtete der König seinen Blick nach Süden, wo er überzeugtere Treuekundgebungen zu erleben hoffte. Die Schatten der Takelage breiteten kunstvolle Muster über das Deck, die sich verdoppelten, als Freyr in strahlendem Glanz aufging.
Ein seidener Baldachin auf dem Achterschiff schützte den König vor der Sonnenglut, ohne ihn gegen die erfrischende Brise über dem Wasser abzuschirmen. Dort verbrachte der König die meiste Zeit der dreitägigen Reise mit wechselnden Gefährten. Zu seinen Füßen saßen halbnackte menschliche Sklaven an den Rudern, bereit, sich in die Riemen zu legen, sollte der Wind sich legen. Die meisten von ihnen waren aus Randonan. Der Geruch ihrer schwitzenden Leiber wehte bisweilen zum König herauf, vermischt mit dem Aroma von Teer, Holz und Bilgenwasser.
»Wir werden in Osoilima haltmachen«, verkündete der König. In Osoilima, einem Wallfahrtsort am Fluss, wollte er den Heiligen Schrein aufsuchen und Buße tun. Er war ein religiöser Mensch und benötigte den guten Willen Akhanabas, des Allmächtigen, in den Prüfungen, die ihm bevorstanden.
JandolAnganol war von vornehmer, aber grämlicher Haltung. Mit fünfundzwanzig Jahren und einem oder zwei Zehnern war er ein noch junger Mann, aber tiefe Furchen durchzogen sein kraftvolles Gesicht und verliehen ihm einen Anschein von Weisheit, die ihm nach Meinung seiner Feinde nicht gegeben war.
Wie seine Jagdfalken, hatte er eine gebieterische Art, den Kopf zu halten, und dieser war es, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog, als fände das Oberhaupt des Staates seine Verkörperung allein in seinem Schädel. Auch war seinen Augen ein adlerartiger Blick eigen, betont noch durch die scharfe schmale Nase, die buschigen schwarzen Brauen und den kurzgeschnittenen Bart, der einen gefühlvollen Mund umrahmte. Seine Augen waren dunkel und durchbohrend; ihrem schnellen Blick entging nichts, und sie vor allem hatten ihm den Beinamen ›Adler von Borlien‹ eingetragen.
Jene, die ihm nahestanden und die Gabe hatten, den Charakter eines Menschen zu verstehen, behaupteten, dass der Adler immer in einem Käfig gefangen sei, und dass die Königin der Königinnen den Schlüssel zum Käfig besitze. JandolAnganol war mit dem Fluch des Khmir geschlagen, das sich als eine allgemeine, nicht personenbezogene Triebhaftigkeit beschreiben ließ, die in diesen heißen Jahreszeiten nur zu verständlich war.
Oft waren die schnellen, in markantem Gegensatz zu der konzentrierten Ruhe des Körpers stehenden Kopfbewegungen nichts anderes als die nervöse Gewohnheit eines Mannes, der zu sehen hoffte, wohin er sich als nächstes wenden könnte.
Die Zeremonie unter dem hohen Felsen von Osoilima war bald vorüber. Der König, der sich zur Buße von einem Priester hatte geißeln lassen, dass Blutflecken den Rücken seines Gewandes sprenkelten, ging wieder an Bord, und der zweite Teil der Flussreise begann. Da ihm die Hitze und der Gestank im Inneren des Schiffes verhasst waren, schlief der König bei Nacht unter seinem Sonnenbaldachin an Deck, weich gebettet auf eine Daunenmatratze. Sein kleiner Phagor Yuli schlief bei ihm.
Dem Schiff des Königs folgte in angemessener Entfernung ein zweites Schiff. Dieses war ein umgebautes Viehtransportschiff und beförderte die Leibwache des Königs, die Erste Phagorische Garde. Als das Schiff des Königs sich am Nachmittag des dritten Reisetages dem inneren Hafen der Stadt Ottassol näherte, schloss das Begleitschiff auf, um im Falle von Unruhen oder Feindseligkeiten der Bevölkerung zur Stelle zu sein.
In der feuchtheißen, windstillen Luft hingen die Flaggen schlaff von ihren Masten. Eine Menschenmenge hatte sich entlang dem Ufer eingefunden. Zwischen den Bannern und anderen Beweisen der Treue und des Patriotismus waren auf Mauern und Fassaden weniger erfreuliche Parolen zu lesen: DAS FEUER KOMMT; DAS MEER WIRD VERDAMPFEN; LEBEN MIT AKHA ODER TOD MIT FREYR. Die Kirche nutzte eine Zeit allgemeiner Unruhe und Furcht, um hartgesottene Sünder gefügig zu machen.
Zwischen zwei Lagerhäusern marschierte eine Musikkapelle vorwärts und intonierte die Königshymne. Als der König von Bord ging, begrüßte ihn zurückhaltender Applaus, übertönt von einzelnen Hochrufen.
Zur Begrüßung hatten sich Mitglieder der städtischen Scritina sowie durch Reichtum oder Gelehrsamkeit hervorragende Bürger eingefunden. Da sie die Abneigung des Königs gegen umständliches Zeremoniell kannten, beschränkten sie sich auf kurze Ansprachen, und auch der König fasste sich in seiner Antwort kurz.
»Wir sind immer glücklich, unseren wichtigsten Hafen Ottassol zu besuchen und ihn blühen und gedeihen zu sehen. Ich kann nicht lang hier bleiben. Wir leben in einer Zeit großer Ereignisse, die mich zu raschen Entschlüssen und Taten drängen.
Es ist meine unwandelbare Absicht, meine Ehe mit Königin MyrdalemInggala durch ein vom Großen C'Sarr Kilandar IX., dem Oberhaupt des Heiligen Reiches von Pannoval und Höchstem Vater der Kirche Akhanabas, dessen Diener wir sind, herausgegebenes Scheidungsdekret aufzulösen.
Sobald ich dieses Dekret in Gegenwart von Zeugen, die der Heilige C'Sarr bestimmt hat, der gegenwärtigen Königin vorgelegt haben werde, wie das Gesetz es vorschreibt, werde ich Simoda Tal, Kronprinzessin von Oldorando, zu meiner gesetzmäßigen Gemahlin machen. Damit werde ich durch eheliche Bande das Bündnis zwischen unserem Land und Oldorando festigen und unsere gemeinsame Partnerschaft im Heiligen Reich bestätigen.
Vereint werden wir unsere gemeinsamen Feinde besiegen und wie in den Tagen unserer Großväter zu Macht und Größe gelangen.«
Es gab Applaus und Hochrufe, aber die meisten Zuschauer drängten zum Begleitschiff, um die Ausschiffung der königlichen Leibgarde zu sehen.
Der König hatte seinen gewohnten Kidrant abgelegt und trug einen in Gelb und Schwarz gehaltenen Überwurf, der seine sehnigen, muskulösen Arme vorteilhaft zur Schau stellte. Dazu trug er eine anliegende Hose aus gelber Seide. Seine Stulpenstiefel waren aus glanzlosem Leder, und am Gürtel trug er ein Kurzschwert. Sein dunkles Haar war um das goldene Kreisdiadem Akhanabas geflochten, durch dessen Gnade er über das Königreich herrschte. So trat er der Bürgerabordnung entgegen.
Möglicherweise hatten sie mehr von ihm erwartet, vor allem pragmatische Absichtserklärungen und Hilfszusagen angesichts der Probleme und Schwierigkeiten, die das Land bedrängten. Hinzu kam, dass Königin MyrdalemInggala in Ottassol beinahe so beliebt war wie in der Hauptstadt Matrassyl.
Nachdem sie vor ihm auf die Knie niedergesunken waren und der Bürgermeister ihm symbolisch die Schlüssel der Stadt ausgehändigt hatte, wandte JandolAnganol sich mit einer knappen Geste zu seinem Gefolge ab und stolzierte davon.
Vor ihm lag das wenig eindrucksvolle Steilufer aus Lehm. Zwischen der Schiffsanlegestelle und der wartenden Prunkkarosse hatte man eine Bahn aus gelbem Stoff für ihn ausgelegt, aber er mied sie, ging quer über den gepflasterten Hafenplatz zur wartenden Karosse und stieg ein. Der Lakai schloss die Tür, und das Sechsergespann trabte los. Die Karosse fuhr durch einen von Stadtsoldaten flankierten Torbogen in das unterirdische Labyrinth von Ottassol. Die Leibwache folgte in einer Marschkolonne.
JandolAnganol, der gegen viele Dinge eine Abneigung hegte, verabscheute seinen Palast in Ottassol. Dass er am Tor von seinem Königlichen Vikar begrüßt wurde, dem sauertöpfischen AbstrogAthenat, trug nicht zur Besserung seiner Laune bei.
»Der Große Akhanaba segne Euch, Herr, wir frohlocken, Euer Majestät Angesicht zu erblicken und zu einer Zeit, da von der Zweiten Armee in Randonan schlechte Nachrichten eintreffen, den Vorzug Eurer Gegenwart zu genießen.«
»Über militärische Angelegenheiten werde ich von Militärs hören«, sagte der König und schritt an ihm vorbei in die Eingangshalle. Der Palast war kühl und blieb es auch in der heißen Jahreszeit, aber seine unterirdische Natur deprimierte ihn. Sie erinnerte ihn an die zwei priesterlichen Jahre, die er als Heranwachsender in Pannoval verbracht hatte.
Sein Vater, VarpalAnganol, hatte den Palast beträchtlich erweitern lassen. Begierig auf ein Lob seines Sohnes, hatte er ihn gefragt, wie ihm der vergrößerte Palast gefalle. »Kalt, weitläufig, schlecht geplant«, hatte Prinz JandolAnganols Antwort gelautet.
Es war charakteristisch für VarpalAnganol, der nie ein Künstler der Kriegsführung gewesen war, nicht zu erkennen, dass der unterirdische Palast nicht wirksam verteidigt werden konnte.
JandolAnganol erinnerte sich des Tages, als der Palast gestürmt worden war. Er war drei Jahre und einen Zehner alt gewesen und hatte auf einem unterirdischen Hof mit seinem Holzschwert gespielt. Da war eine der glatten Lehmwände durchstoßen worden, und aus der Öffnung war ein Dutzend bewaffneter Rebellen hervorgebrochen. Sie hatten sich unbemerkt durch die Erde herangegraben. Es verdross JandolAnganol bis zu diesem Tag, dass er vor Schrecken geschrien hatte, ehe er mit seinem Spielzeugschwert auf sie losgestürmt war.
Zufällig hatte im Hof gerade die Wachablösung stattgefunden. In erbittertem Kampf waren die Eindringlinge getötet worden. Der in verräterischer Absicht gegrabene Stollen aber war später in die Erweiterungspläne des Palastes eingegliedert worden. Der gefährliche Zwischenfall hatte sich während einer der Rebellionen ereignet, die VarpalAnganol nicht mit hinreichender Härte niedergeschlagen hatte.
Der alte Mann war jetzt ein Gefangener in der Festung von Matrassyl, und die Höfe und Gänge des Palastes von Ottassol wurden von menschlichen und ancipitalen Posten bewacht. JandolAnganols misstrauischer Blick schweifte über die schweigend salutierenden Männer, als er in den gewundenen Korridoren an ihnen vorbeischritt; wenn einer von ihnen auch nur eine falsche Bewegung machte, er war imstande, ihn auf der Stelle zu töten.
Die Nachricht von der schlechten Stimmung des Königs verbreitete sich rasch unter den Palastbediensteten. Man hatte zu seiner Unterhaltung Festlichkeiten vorbereitet. Zuerst aber musste er die Meldungen von den Schlachtfeldern im Westen entgegennehmen.
Eine Abteilung der Zweiten Armee war, als sie durch das Hügelland von Chwart gegen die Hafenstadt Poorich in Randonan vorgegangen war, von einer überlegenen feindlichen Streitmacht angegriffen und aufgerieben worden. Der Kampf hatte bis in die Nacht gedauert, und im Schutz der Dunkelheit waren wenige Überlebende entkommen und hatten das Gros der Truppe warnen können. Ein Leichtverwundeter war noch in derselben Nacht ausgesandt worden, die Nachricht über das System der optischen Telegraphie entlang der südlichen Hauptstraße nach Ottassol zu übermitteln.
»Was meldet General TolramKetinet!«
»Er setzt den Kampf fort, Majestät.«
JandolAnganol nahm die Nachrichten ohne Kommentar und scheinbar gleichmütig entgegen, dann entließ er den Ordonnanzoffizier und stieg zu seiner Hauskapelle hinab, um zu beten und sich geißeln zu lassen. Es war eine ausgesuchte Buße, sich von dem begierigen AbstrogAthenat schlagen zu lassen.
Den Hof kümmerte es wenig, was mit Armeen geschah, die beinahe dreitausend Meilen entfernt waren: wichtiger war es, dass die Festlichkeiten des Abends nicht von der galligen Bitterkeit des Königs verdorben würden. Des Adlers Züchtigung war gut für jedermann.
Eine Wendeltreppe führte hinab zur Schlosskapelle. Dieser bedrückende Ort, ausgestaltet in der Art von Pannoval, war aus dem Lehm gehöhlt, der unter dem Löß lag, und bis zur Gürtelhöhe mit Blei, darüber mit Stein verkleidet. Tropfen kondensierenden Wassers bedeckten die Wände und rannen, ineinanderfließend, in glänzenden Bahnen herab. Lichter brannten hinter dem farbigen Glas von Laternen und projizierten bunte Rechtecke in die feuchte Luft.
Düstere Musik erklang, als der Königliche Vikar aus einem Nebenraum eintrat, sich verbeugte und die Geißel mit den zehn Riemen von ihrem Platz neben dem Altar nahm. Auf dem Altar stand das Rad Akhanabas, dessen zwei gekrümmte Speichen die Nabe mit dem äußeren Kranz verbanden. Hinter dem Altar hing ein in roten und goldenen Tönen gehaltener Gobelin, der den großen Akhanaba in der Herrlichkeit seiner Widersprüche darstellte: den Zwei-in-Einem, der Mensch und Gott war, Kind und Tier, zeitlich und ewig, Geist und Stein.
Der König stand und blickte in das Tiergesicht seines Gottes. Seine Verehrung war aufrichtig. Seit seinen Jugendjahren in einem pannovalischen Kloster beherrschte die Religion sein Denken und Handeln. Er herrschte durch die Religion. Sie hielt den Hof und sein Volk in Knechtschaft.
Die gemeinschaftliche Verehrung Akhanabas war es, die Borlien, Oldorando und Pannoval in einer unbehaglichen Allianz einte. Ohne Akhanaba hätte es nur Chaos gegeben, und die Feinde der Zivilisation hätten ihren Vorteil daraus gezogen.
AbstrogAthenat bedeutete seinem königlichen Büßer, niederzuknien, und las ein kurzes Gebet über ihm.
»Wir treten vor Dich hin, Großer Akhanaba, um Vergebung für unser Versagen zu erbitten und das Blut der Schuld zur Schau zu stellen. Durch die Schlechtigkeit der Menschen bist Du, der große Heiler, verletzt, und Du, der Allmächtige, geschwächt worden. Darum hast Du uns mit Feuer und Eis umgeben, damit wir in unserem materiellen Dasein hier auf dieser Welt erfahren mögen, was Du anderswo in unserem Namen erleidest: die immerwährende Qual von Hitze und Frost. So nimm denn dieses Leiden auf, o Großer Herr, wie wir uns bemühen, das Deine aufzunehmen.«
Die Geißel hob sich über die königlichen Schultern. AbstrogAthenat war ein weichlicher junger Mann, aber mit kräftigen Armen und emsig bemüht, nach Akhanabas Willen zu verfahren.