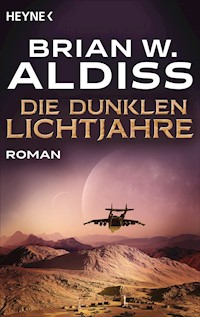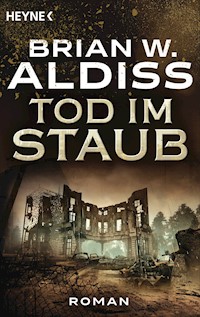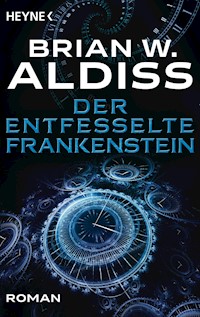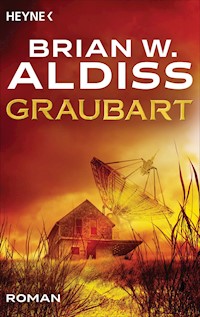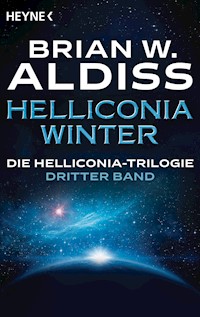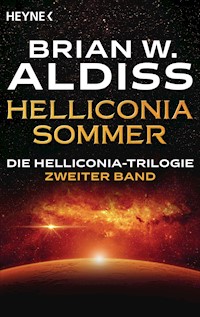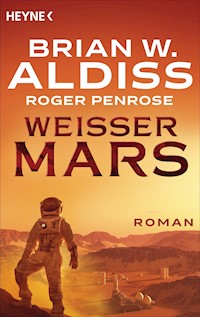
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mitte des 21. Jahrhunderts beschließen die Staaten der Erde, dass der Mars nicht zu einem zweiten »blauen Planeten« umgeformt werden soll, sondern – wie die Antarktis – der Wissenschaft vorbehalten bleibt. Auf diesem »weißen« Mars errichtet eine kleine Gruppe von Männern und Frauen eine Forschungseinrichtung. Sie hoffen, dort jenes Elementarteilchen zu finden, das die letzten Rätsel unseres Universums und unserer Existenz löst. Doch als sie durch eine Katastrophe von der Erde abgeschnitten werden, sind sie gezwungen, eine völlig neue Form menschlicher Gemeinschaft zu entwickeln, um ihr Überleben auf dem Planeten langfristig zu sichern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BRIAN W. ALDISS
In Zusammenarbeit mit
ROGER PENROSE
WEISSER MARS
Roman
Mit einer Charta
für die Besiedlung des Mars von
Professor Laurence Lustgarten
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Mitte des 21. Jahrhunderts beschließen die Staaten der Erde, dass der Mars nicht zu einem zweiten »blauen Planeten« umgeformt werden soll, sondern – wie die Antarktis – der Wissenschaft vorbehalten bleibt. Auf diesem »weißen« Mars errichtet eine kleine Gruppe von Männern und Frauen eine Forschungseinrichtung. Sie hoffen, dort jenes Elementarteilchen zu finden, das die letzten Rätsel unseres Universums und unserer Existenz löst. Doch als sie durch eine Katastrophe von der Erde abgeschnitten werden, sind sie gezwungen, eine völlig neue Form menschlicher Gemeinschaft zu entwickeln, um ihr Überleben auf dem Planeten langfristig zu sichern.
Die Autoren
Brian Wilson Aldiss, OBE, wurde am 18. August 1925 in East Dereham, England, geboren. Nach seiner Ausbildung leistete er ab 1943 seinen Wehrdienst in Indien und Burma, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb er bis 1947 auf Sumatra, ehe er nach England zurückkehrte, wo er zunächst als Buchhändler arbeitete. Dort begann er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, anfangs noch unter Pseudonym. Seinen Durchbruch hatte er mit Fahrt ohne Ende, einem Roman über ein Generationenraumschiff. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der lange Nachmittag der Erde, für das er 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, und die Helliconia-Saga, mit der er den BSFA, den John W. Campbell Memorial Award und den Kurd Laßwitz Preis gewann. Brian Aldiss starb am 19. August 2017 im Alter von 92 Jahren in Oxford.
Sir Roger Penrose wurde am 8. August 1931 in Colchester, Essex, geboren. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach Kanada, wo er aufwuchs, bis er 1945 nach Großbritannien zurückkehrte. Er promovierte 1957 an der Cambridge University in Mathematik, danach lehrte er unter anderem am Gresham und am King’s College und an der Oxford University in England sowie in Princeton und der Penn State University in den USA. Für seine Forschungen wurde er mehrfach ausgezeichnet; für seine Forschungen zusammen mit dem Physiker Stephen Hawking über Raum und Zeit erhielt er 1988 den Wolf-Preis für Physik. Daneben entwickelte er Theorien, wie sich das Bewusstsein mithilfe quantenphysikalischer Modelle erklären lässt. Roger Penrose lebt in Oxford.
Erfahren Sie mehr über Brian W. Aldiss und seine Werke auf
www.diezukunft.de
www.diezukunft.de
Titel der Originalausgabe
WHITE MARS OR: THE MIND SET FREE
Aus dem Englischen von Usch Kiausch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1999 by Brian W. Aldiss & Roger Penrose
Copyright © 1999 des Interviews by Usch Kiausch
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Nele Schütz, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-25653-1V001
INHALT
Das Buch
Die Autoren
Inhalt
Zitat
Karte Vastita Borealis
1. Bericht von Moreton Dennett, Sekretär des Leo Anstruther,über die Ereignisse am 23. Juni 2041
2. Aussage des diensthabenden Captain Buzz McGregor, 23. Mai 2041
Erinnerungen Cang Hais
3. Das EUPACUS-Abkommen: Die morsche Tür
4. Labor Mars
5. Bestechung, Bargeld und Börsenkrach
Aussagen des Tom Jefferies
6. Keine Zukunft ohne Hoffnung
7. Unter der Haut
8. Zuckerbrot und Peitsche
Erinnerungen Cang Hais
9. Wie man den Menschen bessert
10. Mein heimlicher Tanz
11. Tom, Belle und Alpha
12. Schliere gesucht
Aussagen des Tom Jefferies
13. Der Wachturm des Universums
Erinnerungen Cang Hais
14. Eifersucht im ›Oort-Haufen‹
15. Henker gesucht
16. Java-Joes Geschichte
Aussagen des Tom Jefferies
17. Das Leben spielt mal so – mal so
18. Das Gebärzimmer
19. Die Debatte über Sex und Ehe
20. Die R&A-Klinik
21. Ein kollektiver Verstand
Erinnerungen Cang Hais
22. Utopia
23. Nachwort von Beta Greenway, Tochter von Alpha Jefferies
Anhang
Charta der Vereinten Nationalitäten für die Besiedlung des Mars
Wie alles anfing: APIUM
»Vielleicht hat die Zukunft Verwendung dafür …« – Ein Gespräch mit Brian W. Aldiss
Dieses Volk wohnt fünfhundert Meilen östlich von Utopia …
THOMAS MORUS
We are getting to the end of visioning
The impossible within this universe,
Such as that better whiles may follow worse,
And that our race may mend by reasoning
Wird das Unmögliche in diesem Universum vorstellbar,
so könnten bessre Zeiten auf die schlimmen folgen,
könnt' unsere Gattung durch Vernunft gesunden.
THOMAS HARDY
1
Bericht von Moreton Dennett,
Sekretär des Leo Anstruther,
über die Ereignisse am 23. Juni 2041
An diesem Tag beschloss Leo Anstruther, zu Fuß zum Flughafen zu gehen, denn er verhielt sich gern unberechenbar. Ich begleitete ihn und trug seinen Aktenkoffer. Zwei Leibwächter gingen hinter uns, sie folgten in kurzem Abstand.
Unser Weg führte durch verschlungene, schmale Hintergassen. Anstruther hielt seine Hände beim Gehen auf dem Rücken verschränkt, offenbar war er tief in Gedanken versunken. Diesen Teil seiner Insel besuchte er nur selten, er empfand ihn als wenig reizvoll. Es war eine Arme-Leute-Gegend. Man hatte die engen Häuser zu Wohnungen in Schuhschachtelgröße aufgeteilt, die Bewohner überschwemmten die Straßen, um dort ihren Geschäften nachzugehen. Reifenpannendienste, Spielzeugmacher, Schuster, Verkäufer von Flugdrachen, Drogendealer, Bauchladenhändler, Fischer und Garköche verstopften mit ihrem jeweiligen Gewerbe die Durchgangsstraße.
Ich wusste, dass Anstruther eine heimliche Verachtung für diese Leute hegte. Wie schwer sie auch arbeiten mochten, sie würden im Leben nie weiterkommen. Sie hatten kein Ziel vor Augen. Das sagte er oft. Anstruther war ein Mann, der ein Ziel vor Augen hatte.
Auf einem vor Menschen wimmelndem Platz blieb er plötzlich stehen und ließ seinen Blick über die schäbigen Mietskasernen schweifen, die den Platz ringsum säumten. »Es ist nicht einfach so, dass die Armen den Armen helfen, wie die unsinnige Redensart besagt«, bemerkte er an mich gewandt, obwohl seine Augen anderswohin blickten, »es sind auch die Armen, die die Armen ausbeuten. Sie vermieten ihre dreckigen Zimmer zu Wucherpreisen an andere Familien und bringen dadurch ihre eigenen Familien ins Elend, nur wegen ein bisschen zusätzlichen Zasters.«
Ich gab ihm recht. Ihm recht zu geben, war Teil meiner Arbeit. »Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte.«
In dem tristen Marktgewimmel fiel ein freundlich wirkender Stand auf. Ein älterer Mann in Jeans und Khakihemd stand hinter einem kleinen Tisch, der mit Marmeladengläsern voll eingekochter Früchte und frischen Mangos, schwarzen Johannisbeeren, Ananas, Kirschen und einer Handvoll Frischgemüse beladen war.
»Alles aus eigenem Anbau und makellos, Señor. Kaufen Sie, probieren Sie!«, rief der Mann, als Anstruther stehenblieb.
»Wir essen nur Fabrikwaren«, sagte ich zu ihm. Er beachtete mich gar nicht und redete weiter auf Anstruther ein.
»Sehen Sie sich meinen Garten an, mein Herr, sehen Sie selbst, wie makellos und schön er ist.« Der Alte deutete hinter sich auf ein schmiedeeisernes Tor. »Von dort kommt meine Ware. Aus der Erde selbst, nicht aus einer Fabrik.«
Anstruther warf einen Blick auf seine Armbanduhr, die mit einem Piepser ausgestattet war. »Ein Garten!«, sagte er verächtlich. Dann lachte er. »Warum nicht? Kommen Sie, Moreton.« Er verhielt sich, wie gesagt, gern unberechenbar. Er gab den Leibwächtern einen Wink, alarmbereit am Verkaufsstand zurückzubleiben. Einer plötzlichen Eingebung folgend, stieß er das Tor auf und betrat den Garten des Alten. Dann schlug er das Tor hinter uns wieder zu. Das würde den Sicherheitsleuten zu denken geben.
Eine ältere Frau saß auf einem umgestülpten Kübel und sortierte Paprika aus, die sie in einen Topf warf. Süß duftender Jasmin an einer Pergola über ihrem Kopf schützte sie vor direkt einfallenden Sonnenstrahlen. Sie blickte erschrocken auf, dann schenkte sie Anstruther und mir ein freundliches Lächeln.
»Buenos dias, meine Herren. Sie möchten sich bestimmt in unserem kleinen Paradies umsehen. Treten Sie ruhig näher.«
Sie stand auf, streckte ihren Rücken und ging auf uns zu. Unter ihren Runzeln lag ein sympathisches, rundes Gesicht. Zwar wirkte sie aufgrund ihres Alters zerbrechlich, aber sie stand aufrecht und munter da. Sie wischte sich die Hände an einer alten beigefarbenen Schürze ab, die sie sich um die Taille geschlungen hatte, und deutete eine Verbeugung an.
»Paradies, sagen Sie! Da haben Sie aber ein recht beengtes Paradies, gute Frau.« Anstruther maß mit seinem Blick den von Ziegelmauern eingefassten Garten ab.
»Eng, aber lang gestreckt. Für Leute wie Andy und mich reicht es, mein Herr. Wir haben, was wir brauchen, und wollen auch gar nicht mehr.«
Anstruther lachte sein kurzes, bellendes Lachen. »Warum wollen Sie nicht mehr haben, Frau? Mit mehr würden Sie besser leben.«
»Wenn wir mehr haben wollten, dann würden wir nicht besser, sondern nur unzufriedener leben, Sir.«
Sie machte sich daran, den Besuchern ihren Garten zu zeigen. Weiter hinten waren die Mauern von Kletterpflanzen und Weinranken überwuchert. Der Weg führte durch ein planlos wirkendes Durcheinander aus blühenden Büschen und kleinen, Schatten spendenden Laubbäumen, die wiederum von blühenden Obstbäumen überragt wurden. Der Pfad war schmal, so dass wir rote und grüne Paprikapflanzen, an anderer Stelle Maniok und Gruppen von Lavendel und Rosmarin streiften, die bei der Berührung angenehm dufteten. Gemüse wuchs buchstäblich wie Kraut und Rüben zwischen anderen Pflanzen. Das Summen der Bienen, die zwischen den Blumen umherschwirrten, und das Vogelgezwitscher über unseren Köpfen übertönte den Lärm der Straße.
»Ich kann den Anblick nackter Erde nicht ertragen«, erläuterte die Frau. »Als Kind hab ich auf diesem Stückchen Land hier Schwarzwurzeln angepflanzt. Und sehen Sie mal, wie die seitdem gediehen sind. Schwarzwurzeln reinigen das Blut.«
Anstruther schlug nach einer Biene, die ihm zu nah ans Gesicht geflogen war. »Das alles, gute Frau, kostet bestimmt einiges an Düngemitteln.«
Sie lächelte ihm zu. »Nein, nein, Señor. Für solche unnützen Ausgaben haben wir kein Geld. Für unser kleines Grundstück langt als Dünger das, was die Menschen ausscheiden.«
»Sie sind an keine richtige Kanalisation angeschlossen? Sind Sie denn an AMBIENT angeschlossen?«
»Was ist das, AMBIENT?«
»Das globale elektronische Kommunikationsnetz. Sie haben nie davon gehört?«
»Für so etwas haben wir kein Geld, Sir, das müssen Sie verstehen. Und so bescheiden, wie wir leben, brauchen wir's auch gar nicht. Würde es uns zufriedener machen? Nicht ein bisschen. Uns ist's egal, was der Rest der Welt treibt.« Sie suchte in seinem Gesicht nach Spuren von Zustimmung. Er musterte seinerseits eingehend ihr sonnenverbranntes, von Runzeln durchzogenes Antlitz, aus dem ihn braune Augen anstarrten.
»Sie sagen, Sie sind zufrieden?« Er sprach mit einem solchen Ausdruck von Skepsis, als sei ihm diese Vorstellung völlig fremd.
Sie gab keine Antwort, sah ihn nur weiter mit einer Miene an, in der sich eine Mischung aus Verachtung und Neugier ausdrückte – als komme Anstruther von einem anderen Stern. Da ihm ihr prüfender Blick auf die Nerven ging, wandte er sich um und machte sich auf den Rückweg, denselben Pfad hinunter, den wir gekommen waren.
»Ich merke, Sie sind nicht an Gärten gewöhnt, Señor.« In ihrer Stimme lag nun Stolz. »Sie schließen sich wohl in geschlossenen Räumen ein? Wir verlangen nicht viel vom Leben. In unseren Augen ist das, was wir haben, ein kleines Paradies. Verstehen Sie das nicht? Im Boden sind jede Menge Würmer, das ist das Geheimnis. Wir sind fast Selbstversorger, Andy und ich. Wir verlangen nicht viel.«
»Aber es macht Ihnen Spaß, Moral zu predigen«, sagte er halb lachend. »Wie uns allen.«
»Ich bin nur ehrlich, Sir. Schließlich haben Sie sich selbst hierher eingeladen.«
»Ich war neugierig, wollte sehen, wie ihr Leute lebt«, erwiderte er. »Heute bin ich unterwegs, um die Zukunft des Planeten Mars zu erörtern – von dem Sie wahrscheinlich nie gehört haben.«
Doch, sie hatte vom Mars gehört. Sie hielt ihn für uninteressant, da es dort kein Leben gab.
»Keine Würmer, was, gute Frau? Hätten Sie mit Ihrem Leben nichts besseres anfangen können, als in Ihrem eigenen Kot Gemüse zu züchten?«
Sie folgte uns auf dem gewundenen Pfad, strich sich eine Geißblattranke aus dem Gesicht und erklärte belustigt: »Wissen Sie, guter Herr, das ist gesund. Man nennt es Wiederverwertung. Ich hab fast siebzig Jahre in diesem Garten gelebt, ich will nichts anderes. Diese kleine Parzelle war ursprünglich die Idee meiner Mutter. ›Kultiviere deinen Garten‹, sagte sie. ›Stör die Würmer nicht bei der Arbeit. Sei zufrieden mit deinem Los.‹ Und genau das haben Andy und ich befolgt. Wir sehnen uns nicht nach dem Mars. Von dem Gemüse und Obst, das wir verkaufen, können wir ganz gut leben. Wir sind Vegetarier, wissen Sie. Die beiden vornehmen Herren sind doch nicht etwa vom Gemeinderat geschickt, oder?«
In ihrem Ton lag etwas, das Anstruther reizte. »Nein. Ganz bestimmt nicht«, sagte er. »Also haben Sie Ihre ganzen Lebensjahre damit verbracht, zu tun, was Ihre Mutter Ihnen aufgetragen hat! Hatten Sie denn nie eigene Vorstellungen? Was hält denn Ihr Ehemann davon, dass Sie hier seit siebzig Jahren festsitzen und nichts anderes tun, als in der Erde zu wühlen?«
»Andy ist mein Bruder, mein Herr, falls Sie Andy meinen. Und wir sind hier völlig glücklich gewesen und haben niemandem geschadet. Sind auch nie unhöflich zu irgendeinem Menschen gewesen …«
Inzwischen waren wir wieder bei dem winzigen gepflasterten Bereich am Tor angelangt. Wir konnten den Thymian riechen, der in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen spross und den wir mit unseren Füßen zertreten hatten. Anstruther und die Frau sahen einander mit wechselseitigem Misstrauen an. Anstruther war ein großer, stämmiger Mann, viel größer als die vor ihm stehende, zerbrechliche kleine Frau. Er sah, dass sie wütend war. Ich fürchtete, er könnte seinem Ärger über ihre Beschränktheit Luft machen und ihr damit alle Zufriedenheit nehmen. Aber er hielt die Worte zurück. »Nun ja, Sie haben einen hübschen Garten«, sagte er. »Sehr hübsch. Ich bin froh, dass ich ihn mir ansehen durfte.«
Sie freute sich über das Lob. »Vielleicht wird es eines Tages solche Gärten auf dem Mars geben«, bemerkte sie mit einer gewissen Leichtigkeit in der Stimme.
»Kaum anzunehmen.«
»Vielleicht möchten Sie ein paar Bohnen mitnehmen?«
»Ich habe kein Geld bei mir.«
»Nein, nein. Ich meine, als Geschenk. Vielleicht hebt das Ihre Laune – nach all der Fabrikware, die Sie verdauen müssen.«
»Werden Sie nicht geschmacklos. Ihre Bohnen können Sie selber essen.«
Er drehte sich um und gab mir ein Zeichen, das Tor zu öffnen. Draußen warteten schon die beiden Leibwächter.
Anstruthers Flugzeug brachte uns zum UN-Gebäude. Die Mitglieder der Vereinten Nationalitäten trafen sich nur selten persönlich. Sie berieten sich über das AMBIENT-Netz. Nur bei besonderen Anlässen erschienen sie vor Ort, und dies war ein solcher Anlass, denn immerhin sollte über die Zukunft des Planeten Mars beschlossen werden.
Da nur sporadisch Versammlungen einberufen wurden, war das Gebäude klein und nicht besonders imposant – obwohl es aus Rücksicht auf das Prestige der Mitgliedsstaaten sogar noch größer war als nötig.
Vom Apparat an meiner Schulter aus wählte ich die Rechtsauskunft im dritten Stock an und wurde durchgestellt, während Anstruther unten mit anderen Delegierten zusammentraf.
Man übermittelte mir verschiedene Dateien, die EUPACUS betrafen. EUPACUS war ein internationales Konsortium, dessen Mitgliedsstaaten – die Europäische Union, die Pazifischen Randstaaten und die Vereinigten Staaten von Amerika – alle einen Anspruch auf den Mars erhoben.
Als ich eine Datei überflog, in der es um die Rechtsgeschichte der Antarktis ging, fiel mir auf, dass es dort einmal eine ähnliche Situation gegeben hatte. Zwölf Staaten hatten Anspruch auf ein Stück vom Kuchen des Weißen Kontinents erhoben. Im Dezember 1959 hatten Vertreter dieser Staaten einen Antarktis-Vertrag entworfen, im Juni 1961 war er in Kraft getreten. Der Vertrag bedeutete einen bemerkenswerten Schritt nach vorn, in Richtung Vernunft und internationaler Zusammenarbeit. Gebietsstreitigkeiten wurden ad acta gelegt, alle militärischen Handlungen geächtet, die Antarktis wurde ein der Forschung vorbehaltener Kontinent.
Ich ließ mir wichtige Einzelheiten ausdrucken. Vielleicht würden sie sich in der anstehenden Debatte als nützlich erweisen. Was das 20. Jahrhundert geschafft hatte, würden wir in unserer Zeit ganz bestimmt noch besser und in größerem Maßstab erreichen können.
Ich fand meinen Chef in den Empfangsräumen des Erdgeschosses, wo er sich zu koreanischen, japanischen, chinesischen und malaiischen Diplomaten gesellt hatte – sämtlich Angehörige interessierter Pazifischer Randstaaten. Anstruther polierte gerade weiter an seinem strahlenden öffentlichen Bild. Wie bei solchen Begegnungen üblich, traten die Kinnladen in Aktion – es wurde sehr viel gelächelt. Als der Gong zur Sitzung rief, begleitete ich Anstruther in den Großen Saal, wo wir die uns zugewiesenen Plätze einnahmen. Ich setzte mich an einen Tisch in der Reihe hinter ihm und schob ihm die Seiten mit der Rechtsauskunft hinüber. Unberechenbar wie immer, würdigte er sie kaum eines Blickes. »Heute geht es um rhetorisches Geschick, nicht um Tatsachen«, sagte er. Seine Stimme klang distanziert. Er bereitete sich innerlich auf die Debatte vor.
Als alle Delegierten versammelt waren und im Saal Ruhe herrschte, verkündete der Generalsekretär: »Die Vollversammlung der Vereinten Nationalitäten vom 23. Juni 2035 zur Beschlussfassung über den künftigen Status des Planeten Mars ist hiermit eröffnet.«
Der ersten Rednerin wurde das Wort erteilt. Swetlana Julitschewa, die Russland vertrat, war wortgewandt. Sie sagte, mit der Landung auf dem Mars sei eine neue Seite in der Geschichte der Menschheit aufgeschlagen worden, vielleicht sogar ein neuer Band. Alle Nationalitäten hätten sich über den Erfolg der Mars-Mission gefreut, trotz des tragischen Todes ihres Leiters. Jetzt liege der künftige Weg klar vor uns: Es müssten weitere Missionen finanziert und Vorbereitungen dafür getroffen werden, den Mars zu terraformen. Nur so könne er angemessen besiedelt und als Basis für die weitere Erforschung des Sonnensystems genutzt werden. Sie schlug vor, der Mars solle in juristischer Hinsicht dem Zuständigkeitsbereich der UN zugeschlagen werden.
Auch der lettische Delegierte war redegewandt. Er teilte Julitschewas Haltung und sagte, man müsse den raumfahrenden Nationen zu ihrem Unternehmungsgeist gratulieren. Der Verlust von Captain Tracy sei bedauerlich, dürfe weitere Fortschritte jedoch nicht behindern. »Ist die Erschließung dieser neuen Welt nicht Teil eines alten Menschheitstraums?«, lautete seine rhetorische Frage. »Des Traums, den Weltraum zu erobern, wie man es sich in der Phantasie, ob in Büchern oder Filmen, oft vorgestellt hat. In diesem Traum ist die Menschheit kühn vorangeschritten, hat alles Feindselige, das sich ihr in den Weg stellte, bezwungen und einen Planeten nach dem anderen in Besitz genommen. Was nun tatsächlich beginnt, ist die allmähliche Erschließung der Galaxis. Die Terraformung des Mars muss höchste Priorität haben!«
Die argentinische Delegierte, Maria Porua, erlaubte sich, anderer Meinung zu sein. Sie sprach ausführlich über die hohen Kosten, die ein Vorhaben wie die Terraformung verursache, ohne dass ein Erfolg gewährleistet sei. Die Enttäuschungen aus jüngster Zeit – beispielsweise das Versagen des Hypercolliders auf dem Mond, geistiges Kind eines Nobelpreisträgers – müssten zur Vorsicht mahnen. »Auf der Erde gibt es Probleme genug. Es ist weit lohnender, die enormen Investitionen, die wir für außerirdische Abenteuer tätigen müssen, für deren Lösung auszugeben.«
Tobias Bengtson, der schwedische Delegierte, machte den Beitrag seiner Vorrednerin zur Zielscheibe seines Spottes, indem er zu einem großartigen Sprung in eine sich immer weiter ausdehnende Zukunft ausholte. Er erinnerte die Versammlung an die Worte Konstantin Scholkowskis, des großen russischen Luftfahrtingenieurs, der gesagt hatte, die Erde sei die Wiege der Menschheit – aber die Menschheit könne nicht ewig in der Wiege liegen bleiben. »Dieser große Visionär des 19. Jahrhunderts rief der Gattung Mensch erstmals ihre Bestimmung im Weltraum ins Bewusstsein. Im Laufe der Jahre ist der Traum immer realer, präziser und drängender geworden. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns eine so wunderbare Perspektive entgleitet. Ein paar Todesfälle, ein paar Unkosten am Wegesrand dürfen die Nationalitäten nicht davon abhalten, unser aller Bestimmung zu erfüllen. Und diese Bestimmung ist die Eroberung des gesamten Sonnensystems, vom Planeten Merkur bis zur Region jenseits des Magnetfelds der Sonne. Nur so werden sich die Träume unserer Väter – und Mütter – erfüllen.«
Weitere Redner ergriffen das Wort. Viele traten für das Terraformen des Mars ein: »Warum überhaupt zum Mars aufbrechen, wenn nicht deshalb, um mehr Lebensraum zu schaffen?« Viele warnten davor, den Vereinigten Staaten den Mars als Stützpunkt zu überlassen. Andere mahnten, man müsse eine juristische Regelung finden, damit konkurrierende Staaten den Mars nicht als Schlachtfeld statt als Lebensraum benutzten.
»Ich werde von ganz praktischen Dingen reden«, kündigte ein Delegierter aus den Niederlanden an. »Heute habe ich hier viel Gerede über Wolkenkuckucksheime gehört. Die Wirklichkeit sieht doch so aus, dass wir einen kleinen Planeten aufgetan haben, der ganz und gar aus Ödland besteht. Was sollen wir damit anfangen? Er ist zu gar nichts nütze.« Er trommelte mit dem Daumen auf das Rednerpult, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Wer möchte dort schon leben? Man kann nichts anbauen. Allerdings könnten wir auf dem Mars unseren gefährlichen Atommüll abladen. Dort wäre er sicher. Man könnte an einem der Pole einen Müllberg aufschichten – das würde sogar dazu beitragen, dass der Ort künftig ein bisschen interessanter aussieht.«
Jetzt war Leo Anstruther an der Reihe. Der Protest, den der Beitrag des letzten Delegierten ausgelöst hatte, gab ihm Gelegenheit, seine Sache voranzutreiben. Er ging bedächtig zur Rednerbühne. Von dort aus musterte er die Versammlung eingehend, ehe er zu reden begann.
»Ist es unsere Aufgabe, die Träume unserer Mütter und Väter zu erfüllen?«, fragte er. »Hätten wir das immer getan, würden wir dann nicht immer noch in einem Dschungel mitten in Afrika sitzen und uns vor der Sippe auf dem Nachbarbaum fürchten? EUPACUS – und nicht einfach die NASA – hat eine Großtat vollbracht, was Organisation und technische Leistung betrifft, und dazu gratulieren wir von Herzen. Aber keineswegs dürfen wir die Tatsache, dass eine Gruppe von Männern und Frauen auf dem Roten Planeten gelandet ist, mit einer Eroberung gleichsetzen. Genau so wenig dürfen wir den Mars in eine Müllhalde verwandeln. Haben wir denn jegliche Achtung vor dem Universum verloren, das uns umgibt?«
Dann führte mein Chef aus, er hege nichts als Verachtung für jene Menschen, die nur zu Hause herumsäßen. Aber vorwärts zu schreiten heiße nicht, sich einfach immer weiter auszubreiten. Ein solches Ausbreiten mache die Erde bereits kaputt. Jedem müsse klar sein, dass die Wiederholung unserer Fehler auf anderen Planeten kein Fortschritt sei. Bei solchem Vorgehen sei die Menschheit eher mit Karnickeln zu vergleichen, die ein ertragreiches Kornfeld niedertrampeln. »Jetzt haben wir Gelegenheit zu beweisen, dass wir nicht nur in technologischer Hinsicht weitergekommen sind, sondern auch mehr Vernunft angenommen haben. Was ist denn der Kern solcher Eroberungsträume, die die Menschheit gutheißen soll? Sind es nicht Gewalt und Fremdenhass? Wir dürfen uns nicht erlauben, eine Phantasie auszuleben, die von anderen Phantasien gespeist wurde. Der Versuch, solche Wunschträume zu verwirklichen, bedeutet nichts anderes als den Weg in den Abgrund. Und zwar genau in dem Moment, in dem sich ein Höhenweg vor uns auftut, ein Höhenweg, der zum Gipfelpunkt unseres Jahrhunderts führen könnte. Der Geist des 19. und 20. Jahrhunderts war primitiv und blutrünstig und hat unsägliches Elend mit sich gebracht. Davon müssen wir uns lossagen – und hier bietet sich unverhofft eine Gelegenheit.« Er kritisierte die ›allzu leichtfertig benutzte Metapher‹, die behaupte, es sei eine neue Seite im Geschichtsbuch aufgeschlagen worden. Jetzt sei es an der Zeit, das alte Geschichtsbuch wegzuwerfen und als interplanetarische Spezies in spe einen neuen Anfang zu machen. Die Delegierten hätten die Aufgabe, nüchtern abzuwägen, ob sie sich auf eine neue Lebensweise einlassen oder die – oft blutigen – Fehler der Vergangenheit wiederholen wollen.
»Jede Umwelt ist sakrosankt«, erklärte Anstruther. »Der Planet Mars stellt eine sakrosankte Umwelt dar und muss als solche behandelt werden. Der Mars hat nicht Abermillionen von Jahren unberührt existiert, damit er jetzt zur billigen Vorstadt der Erde degradiert wird. Ich empfehle nachdrücklich, den Mars zu schützen und zu bewahren. Genau so, wie die Antarktis seit vielen Jahren geschützt und bewahrt wird. Der Mars muss erhalten werden – als Ort des Wunderbaren und der Meditation. Als Symbol unserer Bereitschaft, das ganze Sonnensystem in dieser Weise zu erhalten. Als Planet der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist der Schlüssel – der einzige Schlüssel – zu unserem Selbstverständnis und zum Verständnis unseres Universums. Unser Nachbarplanet muss der Wissenschaft vorbehalten bleiben – als Weißer Mars.«
Der Generalsekretär unterbrach zur Mittagspause.
Der deutsche Delegierte, Thomas Gunter, kam mit einem Glas in der Hand zu Anstruther vor. Er nickte uns beiden herzlich zu. »Sie haben großes rhetorisches Geschick, Leo«, sagte er. »Bei ihrem Kampf gegen die verrückten Terraformer haben Sie mich auf Ihrer Seite. Obwohl ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass Sie, wie Sie andeuten, den Mars als heilig betrachten. Trotz allem ist es doch nur eine tote Welt – dort gibt es nicht einen einzigen alten Tempel. Nicht einmal ein altes Grab oder ein paar Knochen.«
»Und auch keine Würmer, Thomas, soweit ich weiß.«
»Nach jüngsten Berichten gibt es dort kein Leben irgendwelcher Art, und vielleicht hat es das auch nie gegeben. Marsianer – das ist nur einer dieser Mythen, mit denen wir uns vollgestopft haben. Weiteren Blödsinn dieser Art können wir nicht brauchen.«
Er lächelte Anstruther schief an, als wolle er ihn zum Widerspruch herausfordern. Da Anstruther keine Antwort gab, fuhr Gunter fort: Die erfolgreiche Landung von Menschen auf dem Roten Planeten lasse sich im Grunde bis zu dem deutschen Astronomen Johannes Kepler zurückverfolgen. Der habe – mitten im Wahnsinn des Dreißigjährigen Krieges – die Gesetze der Planetenbewegung formuliert. Kepler sei einer jener Männer gewesen, die, ähnlich wie Anstruther, den verstockten Ansichten ihrer Zeitgenossen die Stirn geboten haben.
Als erster habe Kepler erklärt, die Planeten bewegten sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne stehe. Seinerzeit sei das eine kühne Behauptung mit weitreichenden Folgen gewesen. In ähnlicher Weise werde das, was an diesem Tag im Saal der UN beschlossen werde, weitreichende Folgen haben, ob gute oder schlimme. Wieder einmal seien kühne Stellungnahmen nötig. Gunter empfahl nachdrücklich, die Delegierten nicht mit irgendwelchem Gerede über die Heiligkeit des Mars zu verunsichern. Da vieles – eigentlich alles – der Wissenschaft zu verdanken sei, müsse ihr der Planet vorbehalten bleiben. Man müsse in den Köpfen der Delegierten Zweifel säen, ob der langwierige und mühselige Prozess der Terraformung Erfolge zeitigen werde. »Bislang hat man die Terraformung nur im Labor durchgeführt. Ursprünglich hat ein Science-Fiction-Autor die Idee ausgeheckt. Man muss schon tollkühn sein, wenn man die Terraformung auf einem ganzen Planeten testen will – noch dazu auf dem einzigen Planeten, der für die Menschheit leicht zugänglich ist. Sie könnten die Worte eines Franzosen namens Henri de Chatelier aus dem Jahre 1888 zitieren«, schlug Gunter vor. »Er hat behauptet, in jedem natürlichen System herrsche ein Prinzip des Widerstands gegen weiteren Wandel. Der Mars selbst könnte sich demnach gegen die Terraformung zur Wehr setzen – falls irgend eine Organisation verrückt genug wäre, den Versuch zu wagen.«
Er riet Anstruther, am Schlagwort ›Weißer Mars‹ festzuhalten. Der ›gesunde Menschenverstand‹, den er, genau wie Anstruther, recht jämmerlich fand, werde sich dafür aussprechen, mit dem Mars irgendetwas anzufangen. »Also gut. Was fängt man mit dem Mars an? Man überlässt ihn der Wissenschaft und schickt nur Wissenschaftler auf seine Oberfläche – eine Oberfläche, die bekanntermaßen nicht sonderlich anziehend wirkt. Man darf den Leuten nicht gestatten, dort das Schlimmste anzurichten – etwa ihre hässlichen Bürogebäude, Parkhäuser und Imbissstuben zu errichten. Man muss sie davon genauso abhalten, wie man sie daran gehindert hat, in die Antarktis einzufallen.« Es sei seine und Anstruthers Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass der Mars der Forschung vorbehalten bleibe. Seines Wissens denke ein kalifornischer Delegierter ähnlich wie sie. »Immerhin gibt es Experimente, die nur auf jener Welt durchgeführt werden können«, erklärte er abschließend.
»Welche Experimente meinen Sie?«, wollte Anstruther wissen.
Gunter zögerte mit der Antwort. »Sie werden mich für eigennützig halten, wenn ich die Frage beantworte. Aber das stimmt nicht. Ich wähle dieses Beispiel, weil es sich geradezu anbietet. Vielleicht gehen wir nach draußen auf den Balkon. Hier gibt es zu viele Ohren, die unser Gespräch gern mithören würden. Nehmen Sie eine Samosa-Pastete mit. Ich versichere Ihnen, die sind köstlich.«
»Mein Sekretär begleitet mich immer, Thomas.«
»Wie Sie wollen.« Gunter warf mir einen misstrauischen Blick zu.
Die beiden Männer traten auf den Balkon hinaus, der am nächsten lag. Ich folgte ihnen. Von dort aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den wunderschönen Luisensee, dessen klares Wasser dem Himmel Farbe zu verleihen schien.
»Sie wissen doch bestimmt, was ich mit der Omega-Schliere meine?«, sagte Gunter. »Es ist das letzte Geheimnis eines Teilchens. Wenn es erforscht ist … ist alles erforscht! Ich nehme an, Ihnen ist bekannt, dass ich einer Bank vorstehe, die gemeinsam mit einer koreanischen Investmentgruppe die Suche nach der Gamma-Schliere auf Luna finanziert hat. Gleich nachdem Chin Lim Chung und Dreiser Hawkwood ihre Hypothesen formuliert hatten.« Er biss in seine Samosa-Pastete und sprach mit vollem Mund weiter. »Man nahm an, das Vakuum des Mondes werde ideale Forschungsbedingungen bieten. Leider waren die Dummköpfe dort oben schon eifrig dabei, ihre Hotels, Supermärkte und Parkhäuser für Geländewagen hochzuziehen und überall herumzubohren. Wie Sie sicher wissen, sind die Bauarbeiten für eine U-Bahn fast abgeschlossen. Wir haben viel Geld in unseren supraleitenden Teilchenbeschleunigerring investiert. Hat sich nicht ausgezahlt!«
»Sie haben Ihre Schliere nicht gefunden, wie ich gehört habe.«
»Auf dem Mond kann man sie auch nicht finden. Das Bohren und die Erschütterungen beim Bau der U-Bahn haben sie vertrieben. Die Wissenschaftler sind da zwar anderer Meinung, aber wann geben die schon mal jemandem recht! Wie auch immer, die Schliere wartet noch auf ihre Entdeckung.« Weiter erklärte Gunter, die vor fast zwei Jahrzehnten entdeckte Beta-Schliere habe nur ein weiteres Etwas enthüllt, eine undeutliche Reaktion, eine weitere Schliere. Gunters Bank sei bereit, ein weiteres Forschungsprojekt zu finanzieren, damit ein magnetischer Monopol verborgener Symmetrie dingfest gemacht werden könne.
»Und wenn Sie ihn finden?«, fragte Anstruther, ohne seine Skepsis zu verbergen.
»Dann verändert sich die Welt … Und ich werde es sein, der sie verändert hat!« Er warf sich in die Brust und ballte die Fäuste. »Die Amerikaner und Russen haben versucht, dieses Teilchen oder etwas Ähnliches zu finden. Vergeblich. Es hat fast mystische Bedeutung. Dieses schwer zu fassende kleine Dingsda stellt zwar bislang wenig mehr als eine Hypothese dar, aber man nimmt an, dass es dafür zuständig ist, allen anderen Arten von Teilchen im Universum Masse zuzuweisen. Können Sie sich vorstellen, wie wichtig es ist?«
»Wir reden von etwas, das Welten zerstören könnte?«
Gunter machte eine abwehrende Geste. »In den falschen Händen, ja, ich denke schon. Aber in den richtigen Händen … wird dieses schwer zu fassende Etwas ungeheure Möglichkeiten eröffnen, die Möglichkeit vielleicht, schneller als das Licht durch die ganze Galaxie zu reisen.«
Anstruther schnaubte verächtlich, um zu zeigen, dass er solches Gerede als lächerlich empfand.
»Nun ja, das sind alles nur Annahmen, und ich bin kein Experte«, sagte Gunter zu seiner Verteidigung und fuhr nachdrücklich fort: »Ich bin mit meinen finanziellen Mitteln noch nicht am Ende und möchte, dass die Suche fortgesetzt wird. Man kann sie nur auf dem Mars fortsetzen. Dort können wir die Omega-Schliere aufspüren und einen Schritt über Einsteins Relativitätstheorie hinausgelangen – wenn wir heute dafür kämpfen, den Terraformern den Zugang zum Mars zu verwehren.«
Anstruther warf mir einen Blick zu. Offenbar wollte er mir zu verstehen geben, er sei sich durchaus bewusst, dass Gunter große Töne spuckte. Die einzige Frage, die Anstruther recht kühl stellte, war: »Was spricht denn Ihrer Meinung nach aus praktischer Sicht gegen die Terraformung?«
»Unsere Forschung setzt Stille voraus – eine Stille ohne jede Erschütterung. Der Mars ist der einzige stille Ort, der uns im bewohnbaren Universum geblieben ist, mein Freund!«
Als der Gong zur Fortsetzung der Sitzung rief, war die Stimmung unter den Delegierten, die zurück zu ihren Plätzen strömten, nüchterner als zuvor. Der Delegierte aus Nikaragua verlieh einer allgemeinen Verunsicherung Ausdruck. »Wir sollen ein Urteil über die Zukunft des Mars fällen. Aber trifft das Wort Urteil überhaupt das, was am Ende unserer Debatte herauskommen wird? Geht es uns nicht einfach darum, mit einer Situation schnell fertig zu werden, die in moralischer Hinsicht äußerst kompliziert ist? Wie können wir weise über etwas entscheiden, das eine fast unbekannte Größe ist? Wir sollten daher beschließen, den Mars, wenigstens für eine gewisse Zeitspanne, nicht anzutasten. Ich schlage vor, dass er unter die Jurisdiktion der Vereinten Nationalitäten kommt. Und dass die Vereinten Nationalitäten alle voreiligen Unternehmungen auf diesem Planeten untersagen – zumindest so lange, bis wir uns doppelt und dreifach davon überzeugt haben, dass es dort kein Leben gibt.«
Thomas Gunter stand auf, um diesen Antrag zu unterstützen. »Der Mars muss unter die Jurisdiktion der Vereinten Nationalitäten fallen, wie mein Vorredner vorgeschlagen hat. Jede andere Entscheidung wäre ein Armutszeugnis. Die düsteren Kapitel der Kolonialgeschichte – einschließlich der Verwüstung von Land und der Ausbeutung von Arbeitskräften – dürfen sich nicht wiederholen. Jeder, der zum Mars aufbricht, muss die Gewissheit haben, dass seine Rechte von genau dieser Stelle aus garantiert werden. Indem wir den Roten Planeten der Forschung vorbehalten, lassen wir die Welt wissen, dass die Zeiten rücksichtsloser Landnahme ein für allemal vorbei sind.
Wir wollen einen Weißen Mars.
Bei dieser Entscheidung geht es nicht um wirtschaftliche, sondern um moralische Gesichtspunkte. Manche Delegierten werden sich noch an die erbitterten Wortgefechte anlässlich unserer Entscheidung erinnern, die internationale geographische Datumsgrenze vom Pazifik mitten in den Atlantik zu verlegen. Für diese Entscheidung waren rein finanzielle Interessen ausschlaggebend. Es ging dabei nur darum, der Republik Kalifornien den Handel mit ihren Partnern in den Pazifischen Randstaaten zu erleichtern. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, die um vieles schwerer wiegt. Finanzielle Interessen dürfen dabei keine Rolle spielen. Falls wir wirklich das ganze Sonnensystem und den weiteren Weltraum erforschen wollen, dann sollte der erste Schritt auf diesem Weg unter günstigen Vorzeichen stehen und auf wohlüberlegten Entscheidungen beruhen. Wir müssen dabei mit angemessener Demut und Vorsicht vorgehen und die Wunschvorstellungen der Vergangenheit über Bord werfen. Ich bitte Sie, alle populären Mythen von interplanetarischer Eroberung außer acht zu lassen und für die Erhaltung des Mars zu stimmen – für den ›Weißen Mars‹, wie Leo Anstruther ihn genannt hat. Wenn wir uns dafür entscheiden, entscheiden wir uns für Wissen und Weisheit – und gegen die Habgier.« Gunter nickte Anstruther freundlich zu, als er mit großen Schritten die Rednerbühne verließ.
Weitere Redner gaben ihre Stellungnahmen vom Podium aus ab, doch jetzt ging es in den Wortbeiträgen mehr und mehr um technische Fragen der Verwaltung des Roten Planeten. Als schließlich abgestimmt wurde, ging bereits die Sonne über dem großen, milchig-trüben See jenseits des Sitzungssaals unter. Der Generalsekretär kündigte an, die Vereinten Nationalitäten würden eine eigene Abteilung zur Erhaltung des Mars einrichten, der Vertrag zur Bewahrung eines Weißen Mars werde unverzüglich in Kraft treten.
Kurz darauf nahm der Generalsekretär Thomas Gunter zur Seite und fragte ihn beiläufig, was er davon halte, Anstruther zum Leiter der neuen Abteilung zu ernennen.
»Ich würde davon abraten«, erwiderte Gunter. »Der Mann ist allzu unberechenbar.«
2
Aussage des diensthabenden
Captain Buzz McGregor, 23. Mai 2041
Meine Augen waren den Anblick eines solchen Panoramas nicht gewöhnt. Ich verlor die Orientierung, so als sei meine ganze körperliche Befindlichkeit von meinem Blick abhängig. Als ich die Augen schloss, wurde mir eine weitere Ursache für das seltsame Gefühl klar: Ich stand auf festem Boden, wog aber ein paar Kilo weniger.
Ich riss mich zusammen und versuchte, unsere Umgebung zu erfassen. Hinter den Gestalten meiner Freunde in ihren Schutzanzügen lag eine Welt der Einsamkeit, unendlich und ungeordnet, auf der sich nichts befand, das dem Auge hätte Ruhe bieten können. Da ich nach etwas Vertrautem suchte, ließ ich mehrere phantastische Landschaften – von Dis bis Barsoom – in meinem Kopf Revue passieren, aber das brachte keine Erleichterung. Ein schrecklicher Anblick? O ja, der Mars war schrecklich – aber auch unglaublich komplex, wie das Werk eines diabolischen Künstlers. Ich blickte auf etwas wunderbar Unbekanntes, Unfassbares, das bis jetzt nicht zugänglich gewesen war. Und ich gehörte zu den ersten Menschen, die das alles in sich aufnehmen durften! Und plötzlich merkte ich, wie mich ein Hochgefühl ergriff. Der Gedanke traf mich wie ein Stich ins Herz. Aber ich gehöre ja auch zu einer Gattung, die seltsamer als alles andere ist, das je existiert hat.
Eines Tages würde man diese Öde in eine fruchtbare Welt verwandeln, eine Welt ähnlich der Erde.
Wir lösten uns mühsam aus unserer Trance. Die erste Aufgabe war, den Leichnam von Captain Tracy aus dem Fahrzeug zu laden und in seinem Leichensack auf der Marsoberfläche abzusetzen. Obwohl er schon Ende Dreißig gewesen war, hatte Guy Tracy wie der körperlich zäheste von uns allen gewirkt, aber die Beschleunigung und spätere Drosselung der Geschwindigkeit hatten eine Herzattacke ausgelöst, an der er noch vor unserer Landung gestorben war.
Sein Tod in der Umlaufbahn des Mars hatte wie ein schlechtes Omen für die Mission gewirkt. Doch als wir den Leichnam zwischen die Gesteinsbrocken des Regolith betteten, leuchtete etwas Glasartiges am Himmel auf, als wolle es uns willkommen heißen. Es befand sich sehr tief am Himmel, fast außerhalb unseres Blickfelds, und war, wie wir später herausfanden, eine Aurora. Von der Sonne aufgeladene Teilchen traten in Wechselwirkung mit Molekülen der dünnen Atmosphäre, die sich im schwachen Schwerefeld des Mars gefangen hatten. Die geisterhafte Erscheinung flackerte beinahe auf Schulterhöhe hin und her. Als wir vom Leichensack wegtraten, verblasste sie und verschwand schließlich ganz. Angesichts der Tatsache, dass dieser Planet nur rund vierzig Prozent des Sonnenlichts empfängt, das der Erde so großzügig zugeteilt wird, bedeutete die kleine Festbeleuchtung eine Aufmunterung.
Funksprüche von der Basis unterbrachen unsere feierliche Stimmung. Wir hatten keine große Lust, der Erde zu antworten. Man forderte uns auf mitzuteilen, was schiefgegangen war.
»Um das zu verstehen, müssten Sie hier sein. Dazu muss man die Reise mitgemacht haben. Dazu muss man den Mars in seiner Erhabenheit erlebt haben. Dann merkt man nämlich, dass es falsch wäre, diesen uralten Planeten umzuwandeln, zu terraformen. Das wäre ein schrecklicher Fehler. Nicht nur für den Mars. Für uns. Für die ganze Menschheit.«
Es gab eine langwierige, peinliche Auseinandersetzung. Vom Mars zur Erde und wieder zurück braucht ein Funkspruch vierzig Minuten, in der Zwischenzeit machten wir einiges durch. Plötzlich wurde die Ebene in Dunkelheit gehüllt, es wurde Nacht. Über unseren Köpfen funkelten die Sterne.
Wir warteten. Wir versuchten zu erklären. Die Basis befahl uns, unsere Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen. Wir antworteten (alles wurde aufgezeichnet): »Wir sehen unsere Pflicht darin, Sie darauf hinzuweisen, dass die Landung auf einem anderen Planeten einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit bedeutet. Wir sollten nicht diesen Planeten verändern, sondern versuchen, uns selbst zu ändern.«
Vierzig Minuten verstrichen. Beklommen warteten wir ab.
»Was meinen Sie mit diesem Geschwätz? Warum kommen Sie uns plötzlich auf die moralische Tour?«
Nach kurzer Diskussion antworteten wir: »Es muss einen besseren Weg in die Zukunft geben.«
Weitere vierzig Minuten später dann eine andere Stimme von der Basis: »Von was, zum Teufel, redet ihr überhaupt da oben? Seid ihr alle durchgedreht?«
»Wir haben ja gesagt, dass Sie das nicht verstehen würden.« Wir brachen die Verbindung ab und gingen zu unseren Kojen. Kein Laut störte unseren Schlaf.
Gehälter wie Ausbildung hatten wir vom EUPACUS-Konzern erhalten. Ich kannte und vertraute auf sein technisches Know-how. Weniger Vertrauen setzte ich in die Absichten des Konzerns. Um den Zuschlag für das Marsprojekt zu bekommen, hatte das Konsortium lediglich zusichern müssen, zehn Jahre lang Planung und Abwicklung aller Reisen zum Mars zu übernehmen und für Expeditionen zu sorgen. Es war mir durchaus klar, dass EUPACUS vorhatte, den langwierigen Prozess des Terraformens sozusagen durch die Hintertür einzuleiten. Insgeheim hatten diese Leute die Absicht, Grund und Boden des Mars in veräußerbare Liegenschaften umzuwandeln – nur so würden sich ihre Investitionen rentieren.
EUPACUS war vertraglich das Recht zugesichert worden, auf dem Mars nach Belieben Bodenuntersuchungen und Bohrungen durchzuführen, und der Konzern konnte davon ausgehen, dass niemand Unerwünschtes seine Nase in EUPACUS-Angelegenheiten stecken würde. Sicher waren die Kapitalgeber schon ganz scharf darauf, ihr Geld mit Zins und Zinseszins zurückzubekommen, ohne dass sie sich sonderlich darum scherten, was zu diesem Zweck dort oben eigentlich angestellt wurde. Als ich aufwachte, war ich fest entschlossen, den Aktionären die Stirn zu bieten.
Genau wie alle anderen Angeheuerten hatte unsere Besatzung Computersimulationen eines von EUPACUS gestalteten Mars gesehen und sich davon verführen lassen. Kuppeln und Treibhäuser waren dort hübsch ordentlich in Reih und Glied aufgestellt. Schnell hochgezogene Fabriken produzierten Sauerstoff aus dem Marsgestein. Nukleare Sonnen leuchteten am blauen Himmel. Es dauerte nicht lange, da schritten gebräunte Menschen in T-Shirts durch glänzende Felder. Oder sie stiegen in kleine Kabinenroller und sausten damit durch das Marsgebirge, wo sich bereits Vegetation ausbreitete.
Vor Ort, inmitten dieser erhabenen Öde, schrumpfte der Traum der Generaldirektoren wie ein angestochener Ballon.
Wir waren etwa am Äquator gelandet, in der südwestlichen Ecke von Amazonis Planitia, westlich vom hohen Tharsis-Buckel. Unser Mutterschiff diente als Nachrichtensatellit, genauer gesagt als Zwischensender, so dass wir auf unserer Reise miteinander und mit der Erde Verbindung halten konnten. Überaus notwendig in einer Welt, in der der Horizont – vorausgesetzt, das Gebiet wäre flach gewesen, was es größtenteils nicht war – nur rund vierzig Kilometer entfernt war. In seiner mit dem Mars synchronen Umlaufbahn schien das Schiff, das achtzehn Kilometer über dem Boden schwebte, stillzustehen – ein tröstlicher Anblick in einer Situation, an der so vieles seltsam war.
Ehe wir mit unserer Inspektion beginnen konnten, mussten wir allerdings erst noch unsere geodätische Kuppelkonstruktion aufbauen – eine millimeterdicke Verkleidung sollte sie stützen. Trotz der Gymnastik an Bord waren wir nach dem mehrmonatigen Flug angeschlagen. Diese Schwäche machte den Aufbau der Kuppel zu Schwerstarbeit, zumal uns die Raumanzüge behinderten. Wir hatten noch nicht einmal die Hälfte geschafft, als es Nacht wurde. Wir mussten uns in die Raumkapsel zurückziehen und dort den Morgen abwarten.
Als der Morgen anbrach, gingen wir wieder hinaus. Wir waren entschlossen, uns von den anstrengenden Aufbauarbeiten nicht entmutigen zu lassen. Wir brauchten die Kuppel. Sie würde Schutz vor der größten Kälte und vor Sandstürmen bieten. Mit der Arbeit konnten wir uns Bewegung verschaffen und später in der Kuppel einen Teil der Gerätschaften abladen, die das Leben in der Raumkapsel so nervtötend beengt hatten. Natürlich konnten wir die Kuppel noch nicht mit Luft füllen, deren Druck erträglich war und die man atmen konnte, nicht einmal, nachdem wir sie völlig abgedichtet hatten. Wir schafften die Arbeit nur deshalb, weil sie geschafft werden musste. Als wir die letzten Träger miteinander verschraubt und die letzte Bindung der Plastikverkleidung sicher angebracht hatten, konnten wir auf weitere körperliche Ertüchtigung gut und gern verzichten …
Unsere Anweisung lautete, einen Abschnitt des Planeten zu erforschen. Seine gewaltige Landmasse dehnte sich genauso weitläufig aus wie die der Erde, wenn sie auch nicht ganz so abwechslungsreich wirkte. Es gab darauf Ebenen, Steilhänge, Flussbetten, gigantische Felsschluchten – tiefer als irgend welche auf der Erde – und erloschene Vulkane. Und kein Mensch hatte diese Landschaften je durchquert. Wir schalteten die Fernsehkameras ein und stiegen in die beiden mit Methan betriebenen Geländewagen, um nach Osten zu fahren. Die Intensität dieser Erfahrung wird mir stets in Erinnerung bleiben. Vielleicht sehen die Menschen zu Hause auf ihren Bildschirmen nichts als eine zerstörte Wüste, aber bei uns löste dieser Ausflug starke Emotionen aus. Es war so, als machten wir eine Zeitreise, als reisten wir zurück in eine Zeit, in der es noch kein Leben im Universum gab. Alles lag still, verborgen, aber gestochen scharf vor unseren Augen und wartete. Keiner von uns sprach. Wir erlebten eine andere Art von Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, die auf irgend eine Weise bedrohlich und beruhigend zugleich wirkte. So, als blicke das gewaltige Auge eines alttestamentarischen Gottes auf uns herab.
Als wir in höher gelegenes Gebiet fuhren, nahmen die Gesteinsbrocken auf der Marsoberfläche ab. Was wir durchquerten, ähnelte der von Falten durchzogenen Innenfläche einer greisen Hand. Links und rechts von uns befanden sich ausgetrocknete Wasserläufe, die ein kompliziertes Adernetz bildeten, und kleine Meteoritenkrater. Immer wieder hielten wir an, sammelten Gesteins- und Bodenproben und verstauten sie in einem Außenfach, um sie später zu untersuchen. Dabei hielten wir stets fest, aus welchem Umfeld sie stammten. Da die Bodentemperatur minus sechzig Grad betrug, hatten wir wenig Hoffnung, auf irgendeinen Mikroorganismus zu stoßen.
Je steiler der Hang anstieg, desto langsamer kamen wir voran. Die seitlichen Ränder des gewaltigen Tharsis-Buckels lagen inzwischen in Sichtweite. Majestätisch und schwermütig beherrschte Tharsis den Weg, der vor uns lag – eine besser ausgerüstete Forschungsexpedition würde sich später mit ihm befassen müssen. Sobald wir die anmutige Kuppel des Olympus Mons, eines vor langer Zeit erloschenen Vulkans, entdeckt hatten, wendeten wir und kehrten zu unserer Basis zurück. Der Staub, den wir aufgewirbelt hatten, hing auf den ersten tausend Metern unserer Rückfahrt immer noch in der dünnen Luft.
Ich war für das Labor zuständig. Bei Sonnenuntergang hatte ich angefangen, die ersten Gesteinsproben zu untersuchen. Die Messung mit dem Ionenchromatographen erbrachte kein Anzeichen von Leben. Zum Teil enttäuscht, zum Teil erleichtert gesellte ich mich zu den anderen, um in der Kantine zu Abend zu essen. Wir waren eine merkwürdig stille Gruppe. Wir wussten, dass in der Geschichte der Menschheit etwas Denkwürdiges geschehen war, und wollten das Erlebte verarbeiten.
Vor unserem Ausflug hatten wir noch die Bohrausrüstungen in der Kuppel installiert. Der Summton eines Computers machte uns darauf aufmerksam, dass jetzt Ergebnisse vorlagen und auf ihre Beurteilung warteten. 1,2 Kilometer unter der Oberfläche hatte die Bohrung Wasser ergeben. Die Analyse zeigte, dass das Wasser relativ sauber und träge war. Keine Spuren von Mikroorganismen. Wir freuten uns. Mit einem Wasserreservoir war das Leben auf dem Mars jetzt auch in praktischer Hinsicht vorstellbar. Doch der Terraformung war damit Tür und Tor geöffnet.
Erinnerungen
Cang Hais
3
Das EUPACUS-Abkommen:
Die morsche Tür
Sollten sich die Bürger – beispielsweise der USA – ausschließlich nach den Gesetzen des Mars richten, solange sie sich auf dem Mars befanden? Irgendwann hieß die Antwort: Ja! Der Mars ist keine Kolonie, sondern eine unabhängige Welt. Das war die juristische Entscheidung, die den Grundstein für die Unabhängigkeitserklärung legte. Diese Unabhängigkeitserklärung bestimmt unser Leben auf dem Mars und wird allen anderen Welten, die wir in Zukunft noch besiedeln werden, als Beispiel dienen.
Zu den größten Leistungen des letzten Jahrhunderts gehören die Maßnahmen, die eine Erforschung der Planeten einleiteten. Weniger beachtet wird die Tatsache, dass damals auch ein internationales Rechtssystem entwickelt wurde, das sich als praktikabel erwies.
Von Anfang an waren hier, auf dem Mars, Waffen verboten. Rauchen ist notwendigerweise verboten, nicht nur, weil es die Umwelt verpestet, sondern vor allem deshalb, weil man damit unnötigerweise Sauerstoff verbraucht. Nur schwachprozentiger Alkohol ist erlaubt. Betäubungsmittel, die süchtig machen, sind hier unbekannt. Ein unabhängiges Rechtssystem wurde schnell eingeführt. Bestimmte Arten von Forschung werden gefördert. Der Wissenschaft verdanken wir alles.
Unter der Ägide dieser Gesetze und der Naturgesetze haben wir unsere Gemeinschaft aufgebaut.
Wenn ich an diese frühen Tage zurückdenke, finde ich darin Trost. Meine Tochter Alpha Jefferies – inzwischen heißt sie Alpha Jefferies Greenway – hat den Mars letztes Jahr verlassen, um auf einem anderen Planeten zu leben, den sie zuvor nie gesehen hat. Ich habe Angst um sie auf dieser fremden Welt, obwohl sie jetzt einen Ehevertrag und einen Ehemann hat, der sie beschützt. Als wir noch Kontakt hatten, hat sie mir einmal gesagt, die Erde sei die Welt des Lebens. Ich stelle sie mir als Welt des Todes vor – als Welt des Hungers, des Völkermordes, des Tötens und vieler Schrecken, unten denen unsere Welt hier nicht leidet.
Meine Auseinandersetzungen mit meiner lieben, verschollenen Tochter haben mich dazu gebracht, mich noch einmal diesen ersten Jahren auf dem Mars zuzuwenden. Damals war es aufregend für uns, auf einer fremden Welt zu leben. Wir hatten durchaus noch Mythen im Kopf, die ihren Ursprung auf der Erde hatten, Mythen, die uraltes Leben auf dem Mars betrafen oder alte, landumschlossene Kanäle, die ins Nirgendwo führten. Oder auch die Suche nach großen verschollenen Wüstenpalästen, vielleicht sogar nach den Gräbern der letzten Herren von Syrtis! Nun ja, das war jugendliche Romantik und Teil der überschäumenden menschlichen Phantasie, die diese leere Welt gern bevölkert hätte. Und genau das begeistert mich immer noch: diese große leere Welt, in der wir leben!
Ich möchte mich an dieser Stelle vorstellen. Ich bin die Adoptivtochter des großen Tom Jefferies. Meine erste Bekanntschaft mit dem Leben machte ich in der übervölkerten chinesischen Stadt Chengdu, wo ich zur Lehrerin für behinderte Kinder ausgebildet wurde. Nachdem ich fünf Jahre lang an der Behindertenschule III unterrichtet hatte, sehnte ich mich danach, es auf einem anderen Planeten zu versuchen. Ich bewarb mich für ein Arbeitsprojekt der Vereinten Nationalitäten und wurde angenommen.
Um meinen Sozialdienst abzuleisten, arbeitete ich ein Jahr als Tierpflegerin für eine Hundezucht in der Mandschurei. Das Leben dort war außerordentlich hart. Ich bestand die Prüfungen im Sozialverhalten und wurde eine vollwertige JAE, eine Junge Aufgeklärte Erwachsene. Nach allen anderen Vorbereitungen, einschließlich des vierzehntägigen MIS, des Mars-Instruktionsseminars, durfte ich, gemeinsam mit zwei Freundinnen, an Bord des EUPACUS-Raumschiffes gehen. Ich war mit einer Rückfahrkarte für die Zeit ausgestattet, wenn der Mars in Opposition zur Erde stehen würde.
Wie aufregend! Wie grauenvoll!
Den Mars selbst malte ich mir öde aus, aber ich hatte keine Vorstellung vom Leben in den Kuppeln, das bei meiner Ankunft schon unerwartet bunt war. Als Erinnerung an die halbasiatische Zusammensetzung des Reisebüros Marvelos, das alle zum Mars und zurück zur Erde beförderte, hatte man zwischen den schlichten Wohnblocks leuchtende Lampions aufgehängt. Überall standen wandgroße Aquarien, in denen sich Fische tummelten. Blühende Bäume (Ableger des prunus autumnalis subhirtella) säumten die Straßen. Am liebsten waren mir die genetisch veränderten Aras und die Papageien, die nicht krächzten, sondern mit süßen Stimmen sangen. Sie flogen frei umher und verliehen allem ein bisschen Farbe. Abgesehen von dem angenehmen Vogelgesang, war es in den Kuppeln recht still, da die kleinen Elektrobusse, die ›Jojos‹ (›Spring auf und wieder ab‹), die für den Transport der Menschen sorgten, fast geräuschlos fuhren.
Als ich die Siedlung nach und nach besser kennenlernte, stellte ich fest, dass dieser bunte Teil nur das ›Touristenviertel‹ darstellte. Jenseits davon, hinter der Percy Lowell-Straße, lag das eher karge, nüchterne Viertel der ständigen Marsbewohner.
Das alles war natürlich von Kuppeln und Baukonstruktionen umschlossen. Draußen lag ein Planet, auf dem man nicht atmen konnte und der aus zerklüfteten Felsen bestand. Mir lief ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur hinsah. Im Westen lagen die Ausläufer der Amazonis Planitia, wir befanden uns an ihrem östlichen Rand. Die Kuppeln hatte man am 155. Breitengrad errichtet, achtzehn Grad nördlich des Äquators. Der Ort war windgeschützt. Die heftigen Stürme, von denen die Ausläufer nach Westen hin aufgetürmt worden waren, konnten ihm nichts anhaben. Unser Unterschlupf wies in östliche Richtung, in die Richtung des gewaltigen Olympus Mons. Die klippenartigen Ränder am Fuße des Gebirges waren nur rund 295 Kilometer entfernt. Jeden Abend leuchteten seine durchfurchten Hänge in der bleichen Sonne auf.
Das Pavonis-Observatorium lieferte sofort glänzende Ergebnisse. Die Erforschung der Gasriesen wurde fast zu einem neuen Zweig der Astrophysik. Das Eintauchen in Früh- und Vorzeiten trug zum Verständnis der Geburt des Universums bei. Von der Marsoberfläche aus entsandte Sonden hatten eisenharte Proben eines Ammoniak-Methan-Gemisches vom Pluto mitgebracht. Es enthielt Fremdkörper, die nahelegten, dass dieser ferne Planet seinen Ursprung jenseits des Sonnensystems hatte.
Eine Meteoritenüberwachungsstation nahm den Betrieb auf.
Thomas Gunters Schlierendetektor wurde gerade installiert, als ich meinen ersten Ausflug nach draußen unternahm. Mir war zu Ohren gekommen, dass schlaue Rechtsanwälte an den Einschränkungen herummanipulierten, die das marsianische Recht der wissenschaftlichen Forschung auferlegte. Durch großzügige Auslegung der Bestimmungen wollten sie offenbar durchsetzen, dass, falls nötig, ein größerer Ring gebaut werden konnte. Was auch daran sein mochte: Die Leitung der Forschungsstätte, die fünfhundert Meter von den Kuppeln (dem heutigen Aeropolis) entfernt eingerichtet wurde, hatte der renommierte Teilchenphysiker Dreiser Hawkwood übernommen.
Wegen seiner späteren Bedeutung muss ich an dieser Stelle von einem Gespräch berichten, das irgendwann in jenen frühen Tagen stattfand. Wie die meisten Diskussionen der ersten Jahre wurde es aufgezeichnet, das Dokument ruht jetzt im Archiv des Mars. Vielleicht fanden ähnliche Unterhaltungen auch anderswo statt. Bedeutung erlangten sie im Licht späterer Erkenntnisse.
Vier Wissenschaftler unterhalten sich im Pavonis-Observatorium, das hoch oben auf dem Tharsis-Buckel thront. Die tiefste Stimme ist als die von Dreiser Hawkwood zu erkennen. Er ist ein massiger Mann mit altmodischem Schnauzbart und düsterer Miene.
»Als wir hier hochgefahren sind«, bemerkt eine Frau, »hatte ich dauernd den Eindruck, weiße Objekte zu sehen, so ähnlich wie Zungen. Sie glitten so schnell wie Austern, die in der Speiseröhre verschwinden, unter die Erde. Sagt mir, dass ich geträumt habe.«
»Wir haben festgestellt, dass es auf dem Mars kein Leben gibt. Also hast du geträumt«, erwidert ein Kollege.
»Dann hab ich wohl auch geträumt«, wirft ein anderer ein. »Ich habe ebenfalls gesehen, wie diese weißen Dinger aus dem Boden auftauchten und wieder verschwanden, als wir näherkamen. Das kam mir so unwahrscheinlich vor, dass ich nichts erwähnt habe.«
»Könnten es Würmer sein?«
»Wie das, ohne Mutterboden?«, fragt Dreiser Hawkwood. Er lacht, und seine Kollegen stimmen gehorsam mit ein. »Wir werden mit der Zeit eine natürliche geologische Erklärung für das Phänomen finden. Vielleicht stellen die Dinger eine Art Tropfgestein dar.«
Das vierte Mitglied der Gruppe beteiligt sich bisher nicht an diesem Gespräch. Der Mann sitzt etwas abseits von seinen Freunden und starrt durch das Kantinenfenster auf den Olympus Mons, der nur ein paar Kilometer entfernt ist. »Wir müssen eine Expedition auf die Beine stellen, die sich den merkwürdigen Vulkan ansieht«, bemerkt er. »Die größte Besonderheit auf diesem Planeten – und wir schenken ihr kaum Beachtung.«
Olympus Mons erstreckte sich über eine Fläche von rund fünfhundertfünfzig Kilometern und ragte bis zu 25 000 Metern über der Marsoberfläche auf. Deshalb konnte man ihn schon damals sehen, als nur die Teleskope auf der Erde zur Verfügung standen. Olympus galt als eines der bemerkenswertesten Phänomene im ganzen Sonnensystem. Doch trotz des Interesses der Wissenschaftler schränkte der ständig steigende Bedarf an Sauerstoff und Wasser die Feldforschungsarbeit beträchtlich ein. Der Treibstoff für die Geländewagen bedeutete zusätzlichen Verbrauch von Sauerstoff. Es sollte noch einige Zeit dauern, bis Olympus Mons erforscht wurde – oder wir uns seiner Bedeutung bewusst wurden.
Ich bin nicht daran gewöhnt, mich als Historikerin zu betätigen. Warum habe ich mir diese Aufgabe gestellt? Weil ich damals dabei war, als Tom Jefferies aufstand und erklärte: »Ich werde eine morsche Tür eintreten. Ich werde Licht für die menschliche Gesellschaft hereinlassen. Ich werde dafür sorgen, dass wir das, was wir in unseren Träumen gern sein möchten, auch ausleben: dass wir große und weise Menschen werden – umsichtig, wagemutig, erfindungsreich, liebevoll, gerecht. Menschen, die diesen Namen auch verdienen. Dazu müssen wir nur wagen, das Alte und Schwierige abzuwerfen und das Neue, Schwierige und Wunderbare willkommen zu heißen!«
Aber ich greife voraus. Am besten beschreibe ich einfach, wie es in jenen frühen Tagen auf dem Roten Planeten gewesen ist. Ich möchte all die Schwierigkeiten und Einschränkungen festhalten, mit denen wir, die ersten Menschen auf einem fremden Planeten, konfrontiert waren – und all unsere Hoffnungen.
EUPACUS hat uns hierher gebracht, EUPACUS hat diese Reise in jeder Hinsicht bestimmt. Abgesehen von allem, was später falsch lief, muss man einräumen, dass beim Transit der JAE- und VES-Raumschiffe unter ihrer Leitung nie Verluste von Schiffen oder von Leben zu beklagen waren.
Zweifellos war man der Natur oder den ›ewigen Wahrheiten‹, wie eine meiner Freundinnen es ausdrückte, auf dem Mars sehr nahe. Der Mangel an Sauerstoff und Wasser machte einem ständig zu schaffen. Das Wasser war auf dreieinhalb Liter pro Person und Tag beschränkt; die Gemeinschaftswäscherei verbrauchte weitere drei Liter pro Kopf und Tag. Alle erhielten einen gerechten Anteil an den Vorräten. Das hatte zur Folge, dass nur selten ernsthafte Klagen laut wurden. So spartanisch diese Rationierung auch klingen mag: Im Vergleich zur Wassersituation auf der Erde waren wir noch ganz gut dran. Dort hatte sich aufgrund des langsamen, aber stetigen Bevölkerungswachstums der industrielle Bedarf an Frischwasser bis zu dem Punkt entwickelt, an dem das Wasser überall nur noch dosiert abgegeben werden konnte und so teuer wie Maschinentreibstoff mittlerer Güte war. Praktisch bedeutete das für die wirtschaftlich schwache Hälfte der Erdbevölkerung, dass ihr weniger als die marsianische Ration zugeteilt wurde.
Der Zwang, sparsam mit allem umzugehen, führte dazu, dass wir unser Essen gemeinsam einnahmen. Wir setzten uns in zwei Schichten zu Tisch, ließen uns bei unseren kargen Mahlzeiten viel Zeit und versuchten, sie durch Gespräche zu verbessern. Manchmal las uns jemand aus der Gruppe während des Abendessens etwas vor – aber das kam erst später.
Anfangs war ich schüchtern, als ich mitten unter all diesen fremden Menschen, umgeben von Stimmengewirr, herumsaß. Mit einigen dort habe ich mich später angefreundet (allerdings nicht mit Mary Fangold …), mit Hal Kissorian, Youssef Choihosla, Belle Rivers, mit dem lustigen Crispin Barcunda – ach ja, und vielen anderen. Aber glücklicherweise fand ich zufällig einmal neben einer hübschen Frau mit munterem Gesicht aus der Gruppe der JAEs Platz. Mit ihrer dunkelbraunen Lockenmähne wirkte sie völlig anders als ich mit meinen glatten schwarzen Haaren. Sie half mir, meine Schüchternheit zu überwinden. Offenbar sah sie alles, was mit dem Aufenthalt auf einem fremden Planeten zusammenhing, als wunderbares Abenteuer an. Sie hieß Kathi Skadmorr.
»Ich habe wirklich Glück gehabt«, erzählte sie mir. »Ich komme aus einer ganz armen Familie in Hobart, der Hauptstadt von Tasmanien. Ich bin eines von fünf Kindern.«
Das versetzte mir einen Schock. Da, wo ich herkam, waren fünf Kinder gar nicht erlaubt.
»Ich habe mein soziales Jahr in Darwin abgeleistet«, sagte sie, »und für die IWR, die ›International Water Ressources‹, gearbeitet. Dort habe ich viel über die seltsamen Eigenschaften des Wassers gelernt. Zum Beispiel, dass es in festem Zustand weniger wiegt als in flüssigem. Dass es aufgrund der Kapillarwirkung der Erdanziehung zu trotzen scheint. Wie es Licht leitet …« Sie brach ab und lachte. »Ich langweile dich bestimmt mit all dem.«
»Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, dass du überhaupt mit mir reden willst.«
Sie sah mich lange und eingehend an. »Wir alle müssen hier wichtige Rollen übernehmen. Die Welt ist zusammengeschrumpft. Ich bin mir sicher, dass auch du eine wichtige Rolle spielen wirst. Du musst sie zu einer wichtigen Rolle machen. Genau, wie ich es vorhabe.«
»Aber du bist so hübsch.«
»Das wird mich nicht daran hindern.« Sie gab ein reizendes Kichern von sich.
Fast alle dieser ersten Marsbewohner waren sich darin einig, dass zum Überleben auf dem Mars eine enge Zusammenarbeit notwendig war. Das einzelne Ego musste sich den Bedürfnissen der ganzen menschlichen Gemeinschaft auf dem Mars unterordnen. Durch regelmäßige Fernsehberichte vom Mars wurde die Welt dort unten (wie wir die Erde mit der Zeit nannten) auf die Gerechtigkeit der marsianischen Verwaltung und unsere egalitäre Gesellschaft aufmerksam. Sie hoben sich in bemerkenswerter Weise von der Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf der Erde ab.
Ich will hier nicht von meinen eigenen Problemen erzählen, aber die Reise von der Erde zum Mars hatte mich ziemlich aus dem Gleis geworfen – so sehr, dass man mich an eine Psychurgin überwiesen hatte, eine Frau namens Helen Panorios. Helen hatte eine düstere kleine Kabine auf einem der äußeren Wohntürme, dort empfing sie ihre Patienten. Sie war eine stämmige Frau mit knallrot gefärbtem Haar. Ich sah sie nie anders als in einem schwarzen, zeltartigen Overall. Sie war eine sanftmütige Frau und interessierte sich offenbar tatsächlich für meine Probleme. Die sechsmonatige Reise im Kälteschlaf hatte mich, wie ich ihr erklärte, in einen Angstzustand versetzt. Ich hatte mich von meinem Leben gelöst, und es gelang mir anscheinend nicht, mich wieder mit meinem Selbst zu verbinden. Es hatte etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun.
»Manche Menschen verabscheuen diese Erfahrung, andere genießen sie als eine Art spirituelles Abenteuer. Man kann sie als einen Tod betrachten, allerdings ist es ein Tod, von dem man auferweckt wird – manchmal mit einem neuen Verständnis von sich selbst.« Das sagte sie mir wieder und wieder. Im Grunde sagte sie damit, dass die meisten Menschen den Kälteschlaf als neue Erfahrung akzeptierten. Schon die Reise zum Mars und die Ankunft auf dem Mars waren ganz neue Erfahrungen.
Nun ja, ich war inzwischen so weit, dass ich bereits beim Namen EUPACUS zusammenzuckte. Der Gedanke, mich auf der Heimreise zurück zur Erde noch einmal dieser Prozedur unterziehen zu müssen, die mein Ich auslöschte, machte mich starr vor Angst. Es musste doch einen besseren Weg geben, Abermillionen von Raummeilen zu durchqueren – die Matrix zu durchqueren, wie es jetzt hieß. Die interstellare Matrix wimmelte nur so von Strahlungen und Teilchen, deshalb hatte inzwischen schon aufgrund bloßer Erfahrung der Ausdruck ›Raum‹ einen altmodisch-viktorianischen Beigeschmack.