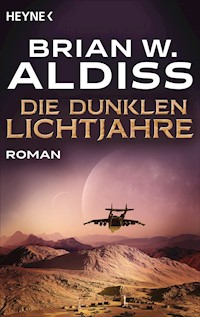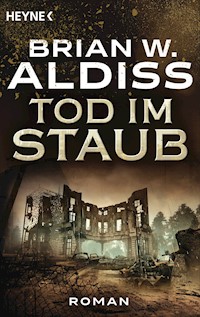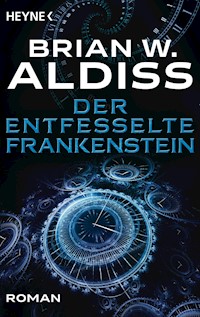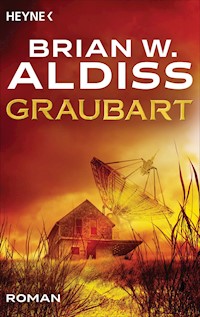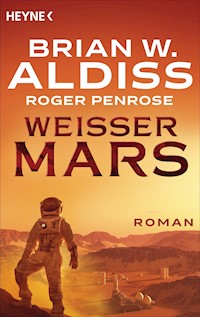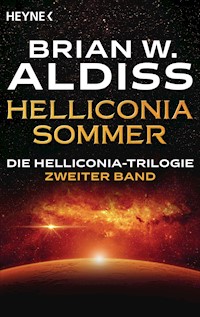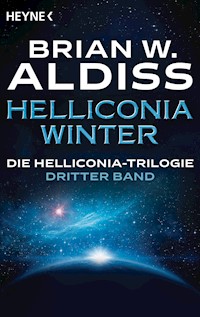
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Helliconia ist eine Welt in einem Doppelsternsystem, auf dem ein Jahr über zweitausend irdische Jahre dauert. Nun, nach einem langen Frühling und einem zweihundert Jahre währenden Sommer, verblasst das Licht der lebensspendenden Sonne Freyr wieder. Die stierköpfigen Phagoren, die im Winter über Helliconia herrschen, werden immer aggressiver und greifen die Städte der Menschen an. Zudem grassiert unter den Nachfahren jener Forscher von der Erde, die Helliconia einst entdeckt haben, eine Seuche – eine Folge der sinnlosen Kriege des Sommers. Der Winter hält Einzug. Er dauert 16 Jahrhunderte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BRIAN W. ALDISS
HELLICONIA:
WINTER
Die Helliconia-Trilogie
Band 3
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Helliconia ist eine Welt in einem Doppelsternsystem, auf dem ein Jahr über zweitausend irdische Jahre dauert. Nun, nach einem langen Frühling und einem zweihundert Jahre währenden Sommer, verblasst das Licht der lebensspendenden Sonne Freyr wieder. Die stierköpfigen Phagoren, die im Winter über Helliconia herrschen, werden immer aggressiver und greifen die Städte der Menschen an. Zudem grassiert unter den Nachfahren jener Forscher von der Erde, die Helliconia einst entdeckt haben, eine Seuche – eine Folge der sinnlosen Kriege des Sommers. Der Winter hält Einzug. Er dauert 16 Jahrhunderte …
Die Helliconia-Trilogie von Brian W. Aldiss:
Helliconia: Frühling
Helliconia: Sommer
Helliconia: Winter
Der Autor
Brian Wilson Aldiss, OBE, wurde am 18. August 1925 in East Dereham, England, geboren. Nach seiner Ausbildung leistete er ab 1943 seinen Wehrdienst in Indien und Burma, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb er bis 1947 auf Sumatra, ehe er nach England zurückkehrte, wo er zunächst als Buchhändler arbeitete. Dort begann er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, anfangs noch unter Pseudonym. Seinen Durchbruch hatte er mit Fahrt ohne Ende, einem Roman über ein Generationenraumschiff. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der lange Nachmittag der Erde, für das er 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, und die Helliconia-Saga, mit der er den BSFA, den John W. Campbell Memorial Award und den Kurd Laßwitz Preis gewann. Brian Aldiss starb am 19. August 2017 im Alter von 92 Jahren in Oxford.
Erfahren Sie mehr über Brian W. Aldiss und seine Werke auf
www.diezukunft.de
www.diezukunft.de
Titel der Originalausgabe
HELLICONIA WINTER
Aus dem Englischen von Walter Brumm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1985 by Brian W. Aldiss
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Nele Schütz, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-25670-8V001
Überhaupt müssen wir, da die Elemente, aus denen wir die Welt zusammengesetzt sehen – feste Erde und Wasser, den leichten Atem der Luft und das brennende Feuer – allesamt aus vergänglicher Materie bestehen, das gleiche von der Erde als einem Ganzen und von ihrer Bevölkerung glauben … Und was die Erde auch beiträgt, das Wachstum der anderen zu nähren, es wird ihr zurückgegeben. Es ist eine beobachtete Tatsache, dass die alles umfassende Mutter auch das allgemeine Grab ist. So wird die Erde abgetragen und durch frischen Zuwachs erneuert.
Lukrez, De rerum natura,
55 v. Chr.
INHALT
Das Buch
Der Autor
Zitat
Inhalt
Einleitung
I – Die letzte Schlacht
II – Stumme Gegenwart
III – Die Einschränkungen des Gesetzes über den Wohnsitz
IV – Eine Militärlaufbahn
V – Weitere Bestimmungen
VI – G4PBX/4582-4-3
VII – Die gelbgestreifte Fliege
VIII – Die Schändung der Mutter
IX – Ein ruhiger Tag zu Lande
X – Tote politisieren nicht
XI – Strenge Disziplin für Reisende
XII – Kakul auf der Strecke
XIII – Alte Feindschaft
XIV – Das schwerste Verbrechen
XV – Im Rad
XVI – Verderbliche Einfalt
XVII – Sonnenuntergang
Zitat
Anhang mit Karten und Erläuterungen von Erhard Ringer
Karte Helliconia politisch
Karte Helliconia geographisch
1. Das Doppelsternsystem Freyr/Batalix
2. Helliconia
3. Der Einfluss der Sonnen auf Helliconia
4. Das Helico-Virus
5. Die Bevölkerung Helliconias
6. Helliconische Zeitrechnung
7. Geographie
8. Das Große Rad von Kharnabhar
Helliconia: Wie und Warum
Einleitung
Luterin hatte sich erholt. Er war befreit von der geheimnisvollen Krankheit. Er durfte wieder hinaus. Das Krankenbett am Fenster, die Unbeweglichkeit, der ergraute Schulmeister, der jeden Tag kam: damit hatte es ein Ende. Er lebte und konnte die frische Luft im Freien atmen.
Der frische Wind weckte seinen Trotz. Er trieb ihm das Blut in die Wangen und drängte ihn, die Gliedmaßen im Gleichklang mit denen des Tieres zu bewegen, das ihn über die väterlichen Ländereien trug. Mit einem Schrei trieb er den Hoxner zum Galopp, fort vom einkerkernden Herrenhaus mit seiner ewig läutenden Glocke und die Allee entlang zwischen den Feldern und Weiden, die immer noch ›der Weingarten‹ genannt wurden, berauscht von der Bewegung, der Luft und dem Aufruhr des eigenen Blutes in den Arterien.
Ringsum lag seines Vaters Besitz, eine weithin sich erstreckende Herrschaft, eine kleine Welt aus Mooren, Bergen, Tälern, rauschenden Flüssen, Wolken, Schneefeldern, Wäldern und Wasserfällen – doch hinderte er sich daran, an die Wasserfälle zu denken. Der Wildreichtum der Gegend war legendär, und nicht einmal die ausgedehnten Jagdzüge seines Vaters vermochten ihm Abbruch zu tun. Phagoren durchstreiften die Hochregionen, und die moorigen Seen menschenferner Täler waren Brutgebiete von Vögeln, deren Wanderzüge den Himmel verdunkelten.
Bald wollte er wieder auf die Jagd gehen, dem Beispiel des Vaters folgend. Das Leben war stehengeblieben und nun irgendwie wieder in Gang gekommen, erneuert. Er sollte frohlocken und die Düsternis verjagen, welche die Ränder seines Bewusstseins überschattete.
Er flog vorüber an halbnackten Sklaven, die, an die Trensen von Yelken geklammert, Gespanne bei der Feldarbeit führten. Die breiten gespaltenen Hufe der Tiere stießen Maulwurfshaufen auseinander.
Luterin Shokerandit erübrigte einen teilnahmsvollen Gedanken für die Maulwürfe. Sie konnten die Launen der beiden Sonnen missachten; Maulwürfe konnten zu allen Jahreszeiten jagen und sich fortpflanzen. Starben sie, wurden ihre Körper von anderen Maulwürfen gefressen. Für sie war das Leben ein endloser Gang, den man auf der Suche nach Nahrung und Partnerschaft durchstreifte. Über seiner langen Bettlägerigkeit hatte er sie vergessen.
»Maulwurfsreich!«, rief er, im Sattel auf und nieder hüpfend, die Füße in die Steigbügel gestellt. Unter der dicken Jacke aus Arangfell machte das schlaffe Muskelfleisch seine eigenen Bewegungen.
Übung war vonnöten, um wieder in Form zu kommen. Schon dieser erste Ausritt seit mehr als einem kleinen Jahr versprach dazu beizutragen. Seinen zwölften Geburtstag hatte er vertan, flach auf dem Rücken liegend; länger als vierhundert Tage hatte er so dagelegen, und einen guten Teil dieser Zeit war er unfähig gewesen, zu sprechen oder sich zu bewegen. In seinem Bett, seinem Zimmer, im elterlichen Herrenhaus, diesem großen, feierlichen Haus des Bewahrers, war er lebendig begraben gewesen. Jetzt war diese Episode abgetan.
Stärke strömte zurück in seine Muskeln, ausgehend von dem Tier unter ihm, von der Luft, von den vorübersausenden Baumstämmen, von seinem eigenen inneren Leben. Irgendeine zerstörerische Kraft, deren Natur er nicht verstand, hatte ihn aus der Welt gerissen; nun war er wieder da und entschlossen, es auf dieser prachtvollen Bühne zu etwas zu bringen.
Ein Flügel des äußeren Tores wurde ihm von einem Sklaven geöffnet, ehe er es erreichte. Ohne einen Seitenblick galoppierte er durch. Der Wind pfiff und heulte in seinen entwöhnten Ohren. Hinter ihm verlor sich der vertraute Klang der Hausglocke. Munter klingelten dafür die kleinen Schellen am Zaumzeug zum Rhythmus der Hufschläge.
Batalix und Freyr standen beide tief am Südhimmel. Wie Bronzescheiben glitten sie hinter den Stämmen des Waldes dahin, die große Sonne und die kleine. Als er in die Dorfstraße einbog, kehrte Luterin ihnen den Rücken. Mit jedem Jahr sank Freyr am Himmel von Sibornal tiefer zum Horizont. Sein Sinken weckte Beklommenheit im menschlichen Herzen. Die vertraute Welt war im Begriff, sich zu verwandeln.
Der Schweiß, den die Anstrengung des Reitens seinem geschwächten Körper aus den Poren trieb, kühlte sofort auf seiner Haut. Aber er war wieder ganz und entschlossen, es den unermüdlichen Maulwürfen gleichzutun und die verlorene Zeit durch verdoppelten Eifer auf der Jagd und beim Lebensgenuss wettzumachen. Der Hoxner konnte ihn zum Rand der weglosen Bergwälder tragen, die sich bis in die entferntesten Täler und Winkel des Gebirges erstreckten. Eines baldigen Tages wollte er sich der Umarmung dieser Wälder überlassen, in ihnen untertauchen und sich verlieren, seine Gefährdung und seine Gefährlichkeit wie ein Tier unter Tieren genießen. Zuerst aber verlangte ihn nach der Umarmung Insil Esikananzis.
Luterin lachte auf. »Ja, du hast eine wilde Seite, Junge«, hatte sein Vater nach der einen oder anderen Missetat einmal zu ihm gesagt und seinen freudlosen Blick auf ihm ruhen lassen. Dabei hatte er ihm eine schwere Hand auf die Schulter gelegt, als wollte er den Grad seiner Wildheit nach dem Befühlen des Knochens ermessen.
Und Luterin hatte den Blick zu Boden gesenkt, unfähig, seinem Vater in die Augen zu sehen. Wie konnte sein Vater ihn lieben, wie er seinen Vater liebte, wenn er in der Gegenwart des mächtigen Mannes so stumm war?
Durch nackte Bäume zeigten sich in der Ferne die grauen Dächer der Klöster. Vor ihm lagen die Tore des Anwesens der Esikananzi. Er spürte, dass sein Reittier ermüdete, und ließ den braunen Hoxner im Trab gehen. Die Art bereitete sich auf die Überwinterung vor. Bald würden alle Hoxner als Reittiere ungeeignet sein. Dies war die Jahreszeit zur Ausbildung der widerspenstigen, aber kräftigeren Yelke. Als ein Sklave ihm das Tor öffnete, fiel der Hoxner in einen gemächlichen Schritt. Voraus ertönte der charakteristische Glockenklang vom Dach des Hauses, verweht von den Windstößen, die mit der Wetterfahne spielten.
Er sandte ein Stoßgebet hinauf zum azoiaxischen Gott, dass dem Vater nichts von seinen Aktivitäten mit Nondadenfrauen zu Ohren gekommen sein möge, diesen heimlichen Unanständigkeiten, denen er sich zugewandt hatte, kurz bevor die Lähmung über ihn gekommen war. Die Nondaden gaben, was Insil ihm bislang verweigerte.
Er musste sich in Zukunft von diesen nichtmenschlichen Frauen fernhalten. Schließlich war er ein Mensch. Am Waldrand gab es armselige Hütten, wo er und seine Schulfreunde – unter ihnen Umat Esikananzi – diese schamlosen achtfingrigen Weiber getroffen hatten. Hexen, die aus den Wäldern kamen, unter den Baumwurzeln hervor … (Und es hieß, dass sie sich auch mit männlichen Phagoren einließen.) Nun, das sollte nicht wieder geschehen. Es war vergangen und abgetan. Wie der Tod seines Bruders. Und wie dieser am besten vergessen.
Das Herrenhaus der Esikananzi war nicht schön. Brutalität war das vorherrschende Merkmal seiner Architektur; es war gebaut, dem erbarmungslosen Ansturm eines nördlichen Klimas zu widerstehen. Eine Reihe von Blendarkaden gliederte das Erdgeschoss. Erst im Obergeschoss gab es schmale, mit schweren Läden versehene Fenster. Da das Obergeschoss zurückgesetzt war, glich das ganze Bauwerk einer enthaupteten Pyramide. Die Glocke auf dem Turm hatte einen schieferigen Klang, als käme ihr Geläut aus dem felsenfesten Herzen des Gebäudes.
Luterin saß ab, erstieg die Stufen und zog am Draht der Türglocke. Er war ein breitschultriger junger Mann, schon geprägt von der stolzen, bisweilen hochfahrenden Art der Sibornalier, aber mit einem offenen, von Natur aus gutartigem und heiterem Gesicht. In diesem Augenblick jedoch, da er Insil gegenüberzutreten erwartete, war seine Stirn gefurcht, die Lippen zusammengepresst. Die Spannung seines Ausdrucks verschaffte ihm Ähnlichkeit mit seinem Vater, doch waren seine Augen von einem klaren Grau, sehr verschieden, vom dunklen, in sich gekehrten Blick seines Vaters.
Hellbraunes Haar ringelte sich in ungebärdigen Locken um seinen Kopf und Nacken und bildete einen Gegensatz zu dem streng frisierten dunklen Kopf des Mädchens, zu dem er von einem Bediensteten geführt wurde.
Insil Esikananzi hatte die Haltung und das Benehmen eines Menschen, der in eine mächtige Familie hineingeboren wird. Sie konnte scharf und verletzend sein, es gefiel ihr, andere zum Besten zu haben, und wo es ihr notwendig erschien, schreckte sie auch vor Lügen nicht zurück. Sie konnte sich ebenso gut hilflos wie gebieterisch geben. Ihr Lächeln war kalt, mehr ein Zugeständnis an die gebotene Höflichkeit als ein Ausdruck ihrer Gemütslage. Ihre blauvioletten Augen blickten aus einem Gesicht, das sie so undurchdringlich wie möglich hielt.
Sie trug einen Krug Wasser in beiden Händen durch die Halle, und als Luterin in Begleitung des Bediensteten auf sie zukam, hob sie mit einem Ausdruck gelangweilten Überdrusses das Kinn und sah ihn fragend an. Für Luterin war Insil außerordentlich begehrenswert, und die Unberechenbarkeit ihrer Launen konnte ihren Reiz in seinen Augen nur erhöhen.
Dies war das Mädchen, das nach einer Vereinbarung, die bei Insils Geburt zwischen ihrem und seinem Vater geschlossen worden war, seine Frau werden sollte, um die Eintracht zwischen den beiden mächtigsten Männern des Bezirks zu festigen.
Kaum war er bei ihr, da sah er sich wieder in ihre alte Verschwörung hineingezogen, verstrickt in dieses verworrene Geflecht aus Neckerei und Klage, das sie um sich knüpfte.
»Ich sehe, Luterin, du bist wieder auf den Beinen. Wie großartig. Und wie es sich für einen pflichtbewussten zukünftigen Ehemann gehört, hast du dich mit Stallgeruch und Schweiß parfümiert, bevor du dich zu diesem Antrittsritt erdreistetest. Ich sehe, dass du in der Zeit deiner Bettlägerigkeit gewachsen bist – jedenfalls um die Mitte herum.«
Sie wehrte eine Umarmung mit dem Wasserkrug ab. Er legte ihr den Arm um die schmale Taille, während sie ihn den breiten Treppenaufgang hinaufführte, dessen Düsternis verstärkt wurde von großen dunklen Ölgemälden, aus denen längst dahingegangene Esikananzis, wie in der Entstofflichung langer Zeit geschrumpft, auf sie herabstarrten.
»Sei nicht so unausstehlich, Sil. Bald werde ich wieder schlank sein. Es ist ein herrliches Gefühl, wieder gesund zu sein.«
Ihre persönliche kleine Glocke klang leise bei jedem Schritt, den sie tat.
»Meine Mutter ist so kränklich. Immer blass. Und meine Schlankheit ist krampfhaft, kein Anzeichen von Gesundheit. Du kannst von Glück sagen, dass du gekommen bist, während meine lästigen Eltern und meine ebenso lästigen Brüder, einschließlich deines Freundes Umat, alle fortgegangen sind, um irgendwo an einer langweiligen Zeremonie teilzunehmen. Also kannst du erwarten, die günstige Gelegenheit auszunutzen, nicht wahr? Natürlich argwöhnst du, dass ich es mit Stalljungen getrieben habe, während du deinen einjährigen Winterschlaf hieltest. Dass ich mich im Heu den Söhnen von Sklaven hingegeben habe.«
Sie führte ihn einen Korridor entlang, wo die Dielenbretter unter den abgenutzten Maditeppichen knarrten. Sie war nahe bei ihm, unwirklich im Halbdunkel hinter den geschlossenen Fensterläden.
»Warum quälst du mein Herz, Insil, wenn es doch dir gehört?«
»Ich will nicht dein Herz, sondern deine Seele.« Sie lachte.
»Mehr Lebhaftigkeit, Luterin. Schlag mich, wie mein Vater es tut! Warum nicht? Ist Bestrafung nicht das Wesen der Dinge?«
»Bestrafung?«, sagte er hitzig. »Hör zu, wir werden heiraten, und ich werde dich glücklich machen. Du kannst mit mir auf die Jagd gehen. Wir werden niemals getrennt sein. Wir werden die Wälder durchstreifen …«
»Weißt du, ich interessiere mich mehr für Zimmer als für Wälder.« An einer Tür machte sie halt, eine Hand auf der Klinke. Sie lächelte herausfordernd und reckte ihm die flachen Brüste unter ihrem Leinen und ihren Spitzen entgegen.
»Draußen sind die Menschen besser, Sil. Lach nicht! Warum musst du so tun, als ob ich ein Dummkopf und ein Tölpel wäre? Ich weiß über Leiden soviel wie du. Das ganze kleine Jahr bewegungslos auf dem Krankenlager – war das nicht die schlimmste Strafe, die man sich vorstellen kann?«
Insil legte die Fingerspitze an sein Kinn und ließ sie zu seiner Lippe aufwärtsgleiten. »Diese schlaue Lähmung half dir, einer schwereren Strafe zu entgehen – dem Leben unter unseren unterdrückerischen Eltern in dieser unterdrückerischen Gemeinde, wo du zum Beispiel genötigt warst, mit Nondaden zu schlafen, um Linderung zu finden …«
Sie lächelte, als er feuerrot wurde, fuhr aber im freundlichsten Ton fort: »Hast du keine Einsicht in dein eigenes Leiden? Du hast mich oft beschuldigt, dich nicht zu lieben, und das mag so sein, aber schenke ich dir nicht mehr Aufmerksamkeit als du dir selbst?«
»Was willst du damit sagen, Insil?« Wie ihre Konversation ihn peinigte!
»Ist dein Vater zu Hause oder auf der Jagd?«
»Er ist zu Hause.«
»Wenn ich mich recht entsinne, war er nicht mehr als zwei Tage vor dem Selbstmord deines Bruders von der Jagd heimgekehrt. Warum beging Favin Selbstmord? Ich habe den Verdacht, dass er etwas wusste, wovor du die Augen und Ohren verschließt.«
Ohne den dunklen Blick von seinen Augen zu wenden, öffnete sie die Tür hinter sich und stieß sie auf, so dass beide plötzlich in Sonnenschein gebadet waren, wo sie, verschwörerisch und doch entgegengesetzt, auf der Schwelle standen. Er fasste sie bei den Oberarmen, bedrückt von der Entdeckung, dass er sie mehr denn je brauchte, und dass sie ihm so rätselhaft wie immer blieb.
»Was wusste Favin? Was sollte ich wissen?« Das Kennzeichen ihrer Macht über ihn war, dass er ihr immerfort Fragen stellen musste.
»Was immer dein Bruder wusste, es war dasselbe, was dich in deine Lähmung flüchten ließ – nicht sein eigentlicher Tod, wie alle vorgeben.« Sie war zwölf Jahre und einen Zehner alt, nicht viel mehr als ein Kind; doch eine Spannung in ihren Gesten ließ sie viel älter erscheinen. Sie quittierte seine Verwirrung mit hochgezogener Augenbraue.
Er folgte ihr in den kleinen Raum, wollte sie mehr fragen, wusste aber nicht, wie er es anfangen sollte. »Woher weißt du dies alles, Insil? Du erfindest es, um dich geheimnisvoll zu machen. Immer eingesperrt in diesen Räumen …«
Sie stellte den Wasserkrug auf einem Tisch neben einem Strauß weißer Blumen ab, die sie vorher gepflückt hatte. Die Blumen lagen in einer weit gefächerten Garbe auf der polierten Oberfläche, wo ihre zarten Gesichter wie in einem beschlagenen Spiegel reflektiert wurden.
Als spräche sie zu sich selbst, sagte sie: »Ich versuche dich zu erziehen, dass du nicht wie die übrigen Männer hier aufwächst …«
Sie ging zum Fenster, das gerahmt war von schweren braunen Vorhängen, die von der Decke bis zum Boden hingen. Obwohl sie ihm den Rücken zugekehrt hatte, spürte er, dass sie nicht hinausschaute. Das zwiefache Sonnenlicht, einfallend aus zwei verschiedenen Richtungen, löste sie auf, als wäre es flüssig, so dass ihr Schatten auf den Bodenfliesen fassbarer schien als sie selbst. Insil demonstrierte wieder einmal ihre täuschende Natur.
Es war ein Raum, den er bis dahin nicht betreten hatte, ein nach dem Geschmack der Esikananzi mit schwerem Mobiliar überladenes Zimmer. Ein unangenehmer, fast widerwärtiger Geruch lag in der Luft. Vielleicht diente das Zimmer nur als Aufbewahrungsort der schweren hölzernen Möbelstücke für die Zeit des Weyr-Winters, wenn keine Möbel mehr hergestellt würden. Unter anderem sah er eine grün bezogene Couch mit geschnitzter Schnörkelarbeit, und einen mächtigen Kleiderschrank, der den Raum beherrschte. Alle Möbelstücke waren importiert; er erkannte es am Stil.
Er schloss die Tür hinter seinem Rücken, blieb stehen und betrachtete sie. Sie war vom Fenster zum Tisch getreten und ordnete ihre Blumen in einer Vase, als existiere er nicht. Dann füllte sie die Vase mit Wasser aus dem Krug und fuhr mit ihren langen Fingern gebieterisch zwischen die Blütenstängel, wo deren Anordnung noch nicht ihren Vorstellungen entsprach.
Er seufzte. »Meine Mutter ist auch immer kränklich. Die arme Alte. Jeden Tag, den Gott werden lässt, begibt sie sich in Pauk und kommuniziert mit ihren toten Eltern.«
Insil blickte schnell zu ihm auf. »Und du? Ich nehme an, auch du bist der Gewohnheit des Pauk verfallen, als du monatelang flach auf dem Rücken lagst?«
»Nein, du irrst dich. Mein Vater verbot es mir … Außerdem ist es nicht nur das …«
Insil legte die Fingerspitzen an ihre Schläfen. »Pauk ist etwas für das gewöhnliche Volk. Es ist so abergläubisch, sich in Trance zu versetzen und in die schreckliche Unterwelt hinabzusteigen, wo die Körper zerfallen und diese grässlichen Leichen immer noch den Bodensatz des Lebens ausspeien … Ah, es ist abscheulich. Hast du es wirklich nicht getan?«
»Niemals. Ich glaube, die Krankheit meiner Mutter rührt vom Pauk her.«
»Na, du Dummer, ich tue es jeden Tag. Ich küsse meiner Großmutter die Leichenlippen und schmecke Maden …« Darauf brach sie in Gelächter aus. »Mach nicht so ein Eselsgesicht! Es war nur ein Scherz. Ich hasse die Vorstellung von diesen Toten in der Unterwelt und bin froh, dass du nicht zu ihnen gehst.«
Sie senkte den Blick auf die Blumen in der Vase.
»Diese Schneeblumen sind Anzeichen des Welttodes, findest du nicht? Es gibt nur noch weiße Blumen, die zum Schnee passen. Früher einmal, sagen die alten Geschichten, blühten in Kharnabhar bunte Blumen in allen Farben …«
Sie schob die Vase resigniert von sich. Tief in den Kelchen der blassen Blüten blieb ein Hauch von Goldgelb, der sich um die Fruchtknoten zu einem tiefroten Flecken verdichtete, wie ein Wahrzeichen der schwindenden Sonne.
Er schlenderte über das Fliesenmuster zu ihr. »Komm und setz dich mit mir auf die Couch und rede von erfreulicheren Dingen!«
»Du meinst vom Klima? Das verschlechtert sich so rasch, dass unsere Enkelkinder, sofern uns welche beschieden sein sollten, ihr Leben nahezu in Dunkelheit verbringen werden, eingehüllt in Tierfelle. Und wahrscheinlich werden sie auch Tiergeräusche machen … Das klingt nach einem vielversprechenden Thema.«
»Welchen Unsinn du redest!« Lachend sprang er auf sie zu und umfing sie mit den Armen. Sie ließ sich auf die Couch niederziehen, während er fiebrige Zärtlichkeiten murmelte.
»Was fällt dir ein, Luterin? Natürlich darfst du nicht mit mir schlafen. Du darfst mich in die Arme nehmen und küssen, aber nicht mit mir schlafen. Ich glaube nicht, dass es mir je gefallen wird – aber jedenfalls, sollte ich es erlauben, so würdest du das Interesse an mir verlieren, sobald deine Lust befriedigt wäre.«
»Das ist nicht wahr!«
»Es muss als die Wahrheit gelten, wenn wir überhaupt jemals etwas wie eheähnliches Glück haben wollen. Ich heirate keinen übersättigten Mann.«
»Von dir würde ich nie genug bekommen.« Während er sprach, stahl sich seine Hand unter ihre Kleider.
Insil seufzte. »Die vordringenden Armeen …« Aber dann küsste sie ihn und steckte ihm die Zungenspitze in den Mund.
Im gleichen Augenblick sprang die Tür des Kleiderschranks auf. Heraus stürzte ein junger Mann von Insils dunkler Haarfarbe, aber so aufgeregt wie seine Schwester passiv war. Es war Umat, der mit einem Schwert fuchtelte und aus Leibeskräften brüllte.
»Schwester, Schwester! Hilfe ist zur Stelle! Hier ist dein tapferer Bruder, um dich und die Familie vor Entehrung zu schützen! Wer ist dieses Vieh? Reicht ihm ein Jahr im Bett noch nicht, dass er sofort die nächste Couch aufsuchen muss? Halunke! Mädchenschänder!«
»Du Ratte vom Kehrichthaufen!«, schrie Luterin und stürzte sich auf Umat. Es entspann sich ein wütender Ringkampf. Die lange Krankheit hatte Luterin Kräfte gekostet. Sein Freund warf ihn zu Boden. Als er sich aufrappelte, sah er, dass Insil hinausgeschlüpft war.
Er rannte zur Tür, aber Insil war irgendwo im Halbdunkel des Hauses verschwunden, im Handgemenge waren ihre Blumen hingeworfen worden, und der Wasserkrug lag zerbrochen auf den Fliesen.
Erst als er missmutig im Sattel saß und sich von seinem Hoxner im Schritt zur Dorfstraße zurücktragen ließ, kam ihm der Gedanke, dass Insil die Störung durch ihren Bruder möglicherweise inszeniert hatte. Statt heimzureiten, bog er am Tor der Esikananzi nach rechts und ritt ins Dorf, um in der Schenke zu trinken.
Batalix stand tief am Westhimmel, als er dem trauervollen Klang der väterlichen Hausglocke heimwärts folgte. Es schneite. Niemand war in der grauen Welt unterwegs. Derbe Scherze und Äußerungen des Missfallens über neue Bestimmungen wie das nächtliche Ausgehverbot hatten das Wirtshausgespräch ausgemacht. Diese Bestimmungen waren vom Oligarchen mit der Absicht erlassen worden, die Gemeinden Sibornals für künftige schwierige Zeiten zu stärken.
Die meisten Wirtshausgespräche waren banal und vulgär. Sein Vater würde sich niemals so gehen lassen – jedenfalls nicht in Hörweite seines Sohnes.
In der langen Eingangshalle des väterlichen Hauses brannten die Gaslampen. Als Luterin seine Glocke abschnallte, kam ein Sklave auf ihn zu, verbeugte sich und sagte, seines Vaters Sekretär wünsche ihn zu sprechen.
»Wo ist mein Vater?«, fragte Luterin.
»Bewahrer Shokerandit ist abgereist, junger Herr.«
Zornig lief Luterin die Treppe hinauf und stieß die Tür zum Arbeitszimmer des Sekretärs auf. Dieser war ein ständiges Mitglied des Haushalts. Mit seiner vorspringenden Hakennase, den geraden Augenbrauen, der fliehenden Stirn und der Haarlocke, die in diese Stirn hing, glich der Sekretär einer Krähe. Dieser enge holzgetäfelte Raum, dessen Ablagefächer mit geheimen Papieren vollgestopft waren, war das Krähennest. Von hier überblickte der Sekretär viele geheime Bereiche, die außerhalb von Luterins Gesichtskreis lagen.
»Euer Vater ist zu einem Jagdausflug aufgebrochen, junger Herr«, sagte der schlaue Vogel in einem Ton, darin sich Ehrerbietung mit Vorwurf mischten. »Da Ihr nirgendwo zu finden wart, musste er abreisen, ohne Abschied zu nehmen.«
»Warum ließ er mich nicht mitreisen. Er weiß, wie gern ich auf der Jagd bin. Vielleicht kann ich ihn einholen. Welche Richtung hat sein Gefolge genommen?«
»Er hat mir diesen Brief für Euch anvertraut. Ihr würdet gut beraten sein, ihn zu lesen, bevor Ihr davonstürzt.«
Der Sekretär übergab ihm einen großen Umschlag. Luterin entriss ihn seinen Krallen. Er riss den Umschlag auf und las, was sein Vater mit seiner großen und sauberen Schrift auf das einliegende Blatt geschrieben hatte:
Sohn Luterin,
es besteht die Aussicht, dass Du in kommenden Zeiten an meiner Stelle zum Bewahrer des Rades ernannt werden wirst. Wie Du weißt, vereinigt dieses Amt weltliche und religiöse Pflichten.
Nach Deiner Geburt wurdest Du nach Rivenjk gebracht, um vom Oberpriester der Kirche des furchtbaren Friedens gesegnet zu werden. Ich glaube, dass dies die gottesfürchtige Seite Deines Wesens gestärkt hat. Du hast Dich als ein gehorsamer Sohn erwiesen, mit dem ich zufrieden bin.
Nun ist es Zeit, die weltliche Seite Deines Wesens zu stärken. Dein verstorbener Bruder sollte als Offizier in die Armee eintreten, wie es bei älteren Söhnen die Tradition verlangt. Es ist passend, dass Du ein ähnliches Amt antrittst, um so mehr als Sibornals Geschäfte in der größeren Welt (von der Du bisher nichts weißt) in eine entscheidende Phase treten.
Demgemäß habe ich bei meinem Sekretär eine Summe Geldes hinterlegt. Er wird sie Dir aushändigen, und Du wirst nach Askitosch reisen, der Hauptstadt unseres stolzen Kontinents. Dort wirst Du im Rang eines Fähnrichleutnants in die Armee eintreten. Melde Dich beim Erzkriegerpriester Asperamanka, der mit Deiner Situation vertraut sein wird.
Ich habe angeordnet, dass zur Feier Deiner Abreise und Dir zu Ehren ein Maskenspiel veranstaltet werden soll.
Du wirst unverzüglich abreisen und dem Familiennamen Ehre machen.
Dein Vater
Eine leichte Röte überhauchte Luterins Gesicht, als er die seltenen Lobesworte seines Vaters las. Dass der Vater trotz all seiner Schwächen mit ihm zufrieden sein sollte! So zufrieden, dass er ihm zu Ehren ein Maskenspiel aufführen ließ!
Die Glut seines Glücksgefühls schwand, als ihm klar wurde, dass sein Vater selbst beim Maskenball nicht zugegen sein würde. Aber das machte nichts. Er würde Soldat werden und alles tun, was man von ihm verlangte. Er würde alles tun, damit sein Vater stolz auf ihn sein konnte.
Vielleicht würde sogar Insil sich für den Träger des Ruhmes erwärmen …
Das Maskenspiel wurde am Vorabend von Luterins Abreise nach Süden im Bankettsaal des Herrenhauses aufgeführt. Begleitet von feierlicher Musik spielten würdevolle Charaktere in prächtigen Kostümen vorherbestimmte Rollen. Aufgeführt wurde ein allen vertrautes Stück von Unschuld und Schurkerei, von Besitzgier und der verschlungenen Rolle des Glaubens im Leben der Menschen. Einigen Charakteren war Leid zugemessen, anderen Glück. Alle standen unter einem Gesetz, das mächtiger war als ihre eigene Rechtsprechung. Die Musiker, über ihre Streichinstrumente gebeugt, betonten die Mathematik, die alle Beziehungen beherrschte. Die von den Musikern beschworenen Harmonien umspielten einen Grundton strengen Mitleids und luden zu einer Betrachtungsweise menschlicher Angelegenheiten ein, die weit jenseits der normalen Akzeptanzen von Optimismus oder Pessimismus lagen. In den Leitmotiven der Frau, die gezwungen war, sich einem verhassten Herrscher auszuliefern, und des Mannes, der unfähig war, seine niedrigen Leidenschaften zu beherrschen, konnten musikalische Zuhörer eine Schicksalhaftigkeit ausmachen, ein Gefühl, dass selbst die stärksten individuellen Charaktere unauflöslich Funktionen ihrer Umgebung waren, geradeso wie die einzelnen Noten Teil der größeren Harmonie waren. Das stilisierte Spiel der Darsteller verstärkte diese Interpretation.
Einzelne Auftritte wurden vom Publikum mit höflichem Applaus bedacht, andere ohne besonderes Vergnügen betrachtet. Die Schauspieler hatten ihre Rollen gut einstudiert; aber keineswegs alle verfügten über die Ausstrahlung der Hauptdarsteller.
Persönlichkeiten des Staates, Vertreter edler Familien, Würdenträger der Kirche, allegorische Figuren, die Phagoren und Ungeheuer verkörperten, spielten zusammen mit den verschiedenen Temperamenten von Liebe und Hass, Edelmut und Niedertracht, Leidenschaft und Reinheit, Furcht und Kühnheit ihre Rollen auf den Brettern und traten ab.
Die Bühne leerte sich. Es wurde dunkel. Die Musik verklang.
Aber Luterin Shokerandits Drama nahm gerade erst seinen Anfang.
I
Die letzte Schlacht
Von solcher Art war das Gras, dass es trotz des Windes weiterwuchs. Es beugte sich vor dem Wind. Seine Wurzeln verästelten sich im Erdboden zu einem dichten Geflecht, das es fest verankerte und keinen Raum zur Ansiedlung anderer Pflanzen ließ. Das Gras war immer dagewesen. Der Wind war es, der in dieser Schärfe bisher unbekannt gewesen war – und die Kälte, die er mitbrachte.
Die gewaltigen Ausatmungen des hohen Nordens führten einen veränderlichen, rasch fliehenden Wolkenhimmel mit sich, ein gelegentlich aufreißendes Flickwerk von schwarzen und grauen Wolkenmassen. An den Randgebirgen entfernter Hochländer entluden sie sich in Regen und Schnee, doch hier über den niedrigen Steppenländern von Chalce sorgten sie lediglich für ein unbestimmtes, farbloses Zwielicht, das die Einförmigkeit des Geländes unterstrich.
Serien flacher, von Bodenwellen und wenig ausgeprägten Höhenrücken voneinander getrennter Täler mündeten in breitere Talmulden und gingen endlich in die Küstenebene über. Es war eine Landschaft ohne weithin sichtbare Merkmale, in scheinbarer Leblosigkeit erstarrt. Abgesehen vom niedrigen Wolkenhimmel, war nur in den Gräsern Bewegung zu sehen. Ihre feinen Rispen und Halme schwankten und beugten sich im Wind, der sie in breit über das Grasland ziehende Wellenfronten kämmte, als wären sie das Haarkleid eines riesigen schlafenden Tieres. Manche Grasbüschel trugen unbedeutende gelbe Blumen. Die einzigen Landmarken waren einige wenige verwitterte Steinsäulen, die aus alter Zeit überdauert hatten und Landoktaven kennzeichneten. Die Südseiten dieser Steine waren bisweilen mit gelben und grauen Flechten bedeckt.
Nur ein scharfes Auge konnte am Boden zwischen den Grasbüscheln winzige Fährten ausmachen, benutzt von Kleinlebewesen, die bei Nacht hervorkamen, oder in Zeiten der hellen Nächte, wenn nur eine der beiden Sonnen über dem Horizont war. Einsame Falken, die auf bewegungslosen Schwingen den Himmel patrouillierten, erklärten die Abwesenheit von Tagesaktivität. Die breiteste Fährte hatte ein Fluss in das Grasland eingeschnitten, der in trägen Windungen südwärts zur entfernten See floss. Tief und still dahinströmend, nahm er seine Farbe vom graufleckigen Himmel, dessen Wolkenmassen sich in den ruhigen Wassern spiegelten.
Aus dem Norden dieses unwirtlichen Landes kam eine Herde Arang. Diese langbeinigen Mitglieder der Ziegenfamilie zogen gemächlich weidend durch die Flussaue, zusammengehalten von krummhörnigen Hunden. Diese fleißigen Asokins wurden ihrerseits von sechs Berittenen beaufsichtigt. Alle waren in Felle gekleidet, die sie mit Riemen um ihre Körper gebunden hatten.
Die Männer blickten immer wieder über die Schultern und erhoben sich dabei in den Steigbügeln, als befürchteten sie Verfolgung. Doch bewegten sie ihre Hoxner ohne Eile in gleichmäßigem, der wandernden Herde angepasstem Schritt. Mit ihren Asokins verständigten sie sich durch Pfiffe und Zurufe. Diese aufmunternden Signale flogen hin und her durch die Talaue und übertönten das Blöken der Arang. So oft die Hirten auch zurückblickten, der öde Nordhorizont blieb leer.
In einer Flussschleife voraus kamen die Ruinen von Wohnstätten in Sicht. Die verwitterten Mauern dachloser steinerner Hütten standen verstreut. Von einem größeren Gebäude hielten sich nur noch zwei Außenmauern aufrecht. Im Windschutz der Ruinen hatten sich allerlei Gestrüpp und dürftige Sträucher angesiedelt, überwucherten die Trümmer und lugten aus leeren Fensterhöhlen.
Die Herde machte einen weiten Bogen um den Ort, als fürchte sie versteckte Raubtiere oder die Seuche. Ein paar Meilen weiter bildete der Fluss, der hier einen gemächlichen Bogen beschrieb, eine seit Jahrhunderten, vielleicht seit Menschengedenken umstrittene Grenze. Hier begann die Gegend, die einst als Hassiz bekannt gewesen war, das nördlichste Land des Kontinents von Campannlat. Die Hunde kanalisierten die Herde am Flussufer, wo eine ausgetretene Wegspur verlief. Die Herde zog sich zu einer langen Kolonne auseinander, die unter den Augen der wachsam hin und her laufenden Hunde und den Anfeuerungsrufen der Hirten rasch dahintrottete.
Sie kamen zu einer breiten und massiven Brücke, die in zwei dauerhaft gemauerten Bogen die von Windriffeln getrübte Wasseroberfläche überspannte. Die Männer stießen schrille Pfiffe aus, die Asokins trieben die Herde zusammen und hinderten sie am Überqueren der Brücke. Eine Viertelstunde Fußmarsch entfernt, lag eine Siedlung am Nordufer des Flusses. Sie war in der Form eines Rades angelegt und trug den Namen Isturiacha.
Die verwehten Töne eines Trompetensignals drangen von dort herüber und sagten den Hirten, dass man sie gesichtet habe. Bewaffnete Männer und schwarze sibornalische Kanonen bewachten den äußeren Siedlungsrand.
Die Herde setzte sich wieder in Bewegung und hielt auf die Siedlung zu.
»Willkommen!«, riefen die Wachen. »Was habt ihr im Norden gesehen? Ist die Armee im Anmarsch?«
Die Hirten trieben ihre Tiere durch den äußeren Siedlungsring zu den bereitstehenden eingezäunten Gehegen.
Die aus Bruchstein gemauerten Gehöfte der Siedlung waren zur Befestigung entlang ihrem Umkreis errichtet. Die Felder und Weiden, wo Getreide angebaut und Vieh gehalten wurde, lagen innerhalb des Kreises. In seinem Mittelpunkt umgab ein Ring barackenartiger Bauten eine hohe Kirche. In Isturiacha herrschte ein beständiges Kommen und Gehen, und so erregte die Ankunft der Herde kein übermäßiges Aufsehen. Die Hirten wurden zu einem der zentralen Gebäude geleitet, damit sie sich nach ihrer Wanderung durch die Steppe erfrischten.
Südlich der steinernen Brücke zeigte die kaum merklich ansteigende, leicht wellige Ebene ein stärker ausgeprägtes Relief, und vereinzelte Bäume, äußerste Vorposten südlicher Wälder, verrieten eine allmähliche Zunahme der Niederschlagsmengen. Der Boden war hier übersät mit spröden Bruchstücken eines weißen Materials, das auf den ersten Blick verwittertem Kalkstein ähnelte. Bei genauerer Untersuchung zeigte sich, dass es Bruchstücke von Knochen waren. Nur wenige der vom Wetter gebleichten Stücke maßen mehr als eine Spanne. Ein gelegentlicher Zahn oder der Keil eines Unterkiefers enthüllten, dass es sich bei den Knochen um die Überreste von Menschen und Phagoren handelte. Diese Zeugnisse vergangener Schlachten erstreckten sich meilenweit über die Ebene.
Durch die leblose Stille dieses traurigen Ortes ritt ein Mann auf einem Yelk und näherte sich von Süden her der Brücke. Ein gutes Stück zurück folgten zwei weitere Reiter. Alle drei trugen Uniform und waren bewaffnet.
Der Spitzenreiter, ein kleinwüchsiger Mann mit scharfgeschnittenen Zügen, hielt ein gutes Stück vor der Brücke an und saß ab. Er führte sein Tier in eine Senke und band es an den Stamm eines breitästigen Dornbaumes, erstieg wieder die Anhöhe und beobachtete die feindliche Siedlung voraus durch ein Fernrohr.
Die beiden anderen Männer kamen heran, saßen gleichfalls ab und banden ihre Yelke an die Wurzeln eines toten Rajabarals. Da sie von höherem Rang waren als der Kundschafter, hielten sie sich abseits.
»Isturiacha«, sagte der Kundschafter und zeigte zur Siedlung. Aber die Offiziere sprachen nur miteinander. Auch sie beobachteten die Siedlung abwechselnd durch ein Fernrohr.
Nach flüchtiger Aufklärung blieb ein Offizier – ein Artilleriefachmann – auf Beobachtungsposten, während sein Offizierskollege mit dem Kundschafter zurückgaloppierte, um die von Süden heranrückende Armee zu benachrichtigen.
Als der Tag verging, kamen von Süden her Kolonnen über die Ebene gezogen – berittene Abteilungen, Fußsoldaten, dazwischen Fuhrwerke, bespannte Kanonen und Trossfahrzeuge. Die Fuhrwerke wurden von Yelken oder den weniger ausdauernden Hoxnern gezogen. Im Gegenteil zu den militärischen Einheiten, die in guter Disziplin und Ordnung marschierten, wälzte sich der Tross, begleitet von Händlern, Frauen, Kindern, Hunden und Vieh, in regellosem Strom dahin. Über einigen Marschkolonnen wehten die Banner Pannovals, der Stadt unter den Bergen, und andere Flaggen von religiöser Bedeutung.
Weiter zurück folgten Ambulanzen und weitere Fuhrwerke, von denen einige Feldküchen und Proviant beförderten, die Mehrzahl aber mit Futter für die an dieser Strafexpedition beteiligten Tiere beladen war.
Obgleich diese vielen tausend Menschen wie Zahnräder in der Kriegsmaschine funktionierten, blieb jeder einzelne seinen oder ihren persönlichen Vorfällen und Umständen unterworfen, und jeder erfuhr das Abenteuer durch seine oder ihre begrenzte Wahrnehmung.
Einen solchen Vorfall erlebte der Artillerieoffizier, der mit seinem Reittier bei dem zerspellten Stamm des toten Rajabarals wartete. Er lag still und beobachtete sein Vorfeld, als er das ängstliche Schnauben seines Yelks hörte und den Kopf wandte. Vier kleine Männer, nicht größer als halbwüchsige Jungen, bewegten sich auf das angebundene Tier zu, offenbar mit der Absicht, es einzukreisen und abzustechen. Als sie aus einem Erdloch zwischen den Wurzeln des toten Baumes gekrochen waren, hatten sie den Offizier augenscheinlich nicht bemerkt.
Die äußere Erscheinung der vier war insgesamt humanoid, mit dünnen Beinen und langen Armen. Die Körper waren bedeckt von lohfarbenen Pelzen, die um ihre Handgelenke besonders langhaarig waren und die achtfingrigen Hände halb verbargen. Die schnauzenartig vorspringende untere Gesichtspartie verschaffte ihnen eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Hunden oder Affen.
Nondaden! Der Offizier erkannte sie sofort, obwohl er sie bis dahin nur in Gefangenschaft gesehen hatte. Der Yelk rollte die Augen, warf ängstlich den Kopf hoch und zerrte an der Leine, schlug aus und versuchte in Panik seitwärts auszubrechen. Als die zwei ersten Nondaden sich auf ihn stürzten, stieß der Offizier einen Warnruf aus und brachte seine doppelläufige Pistole in Anschlag.
Er hielt inne. Ein weiterer Kopf schob sich zwischen den alten Baumwurzeln hervor, gefolgt von zottigen Schultern, die sich durch die enge Öffnung zwängten. Dann kam der ganze Körper zum Vorschein, richtete sich auf, schüttelte Erde aus dem dicken Fell und schnaubte.
Der Phagor beherrschte die Nondaden. Zwei schlanke, rückwärts gebogene Hörner krönten den mächtigen, eckigen Schädel. Sobald er sich aufgerichtet und geschüttelt hatte, schwang das grämlich blickende Stiergesicht herum, und sein Blick fiel auf den Offizier. Einen Augenblick verharrte er bewegungslos. Ein Ohr zuckte. Dann stürmte er mit gesenktem Kopf auf den Mann los.
Der Artillerieoffizier ging auf ein Knie nieder, hielt die Pistole mit beiden Händen, zielte und feuerte erst die eine, dann die andere Kugel in den Leib des Unholds. Ein unregelmäßiger Fleck aus gelber Nässe breitete sich durch das weißliche Fell aus, aber der Phagor brach nicht zusammen. Er sperrte das hässliche Maul auf und entblößte spatenförmige gelbe Zähne, die in bräunlichem Zahnfleisch steckten. Der Offizier hatte gerade noch Zeit aufzuspringen, da prallte der Phagor mit der vollen Wucht seines Ansturms auf ihn. Derbe dreifingrige Hände schlossen sich um ihn.
Der Mann riss einen Arm hoch, seine Kehle zu schützen, während er mit der freien Hand den Pistolenknauf immer wieder gegen den dicken Schädel des Angreifers schlug.
Plötzlich erschlafften die Arme, die ihn umklammert hielten. Der walzenförmige Körper fiel seitwärts, das Gesicht schlug auf den Boden. Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung gelang es dem Phagoren noch einmal, sich halb aufzurichten. Er brüllte. Dann fiel er schwerfällig zurück und regte sich nicht mehr.
Keuchend, gewürgt vom Ekel vor dem durchdringenden Gestank des Ancipitalen, der etwas von verdorbener Sauermilch an sich hatte, rappelte sich der Offizier auf. Er musste sich mit einer Hand auf die Schulter des Phagoren stützen. Im dichten Haarkleid des Körpers, dessen Blutkreislauf zum Stillstand gekommen war, krabbelten Zecken und Läuse unruhig umher, betroffen von einer eigenen Existenzkrise. Einige kletterten auf den Ärmel des Offiziers.
Er erhob sich wankend. Er zitterte. Sein Reittier stand bebend in der Nähe, den Kopf gesenkt; es blutete aus Fleischwunden am Hals. Von den Nondaden war nichts zu sehen; sie hatten sich in ihren unterirdischen Bau zurückgezogen, in die verzweigten Höhlen, die sie die Achtzig Dunkelheiten nannten. Nach einer Weile hatte der Artillerieoffizier sich hinreichend erholt, dass er aufsitzen konnte. Er hatte von der Verbindung zwischen Phagoren und Nondaden gehört, aber niemals erwartet, mit einem Beispiel konfrontiert zu werden. Womöglich waren noch mehr von den zottigen Teufeln unter seinen Füßen …
Noch immer vom Ekel geschüttelt, ritt er zurück zu seiner Einheit.
Die von Pannoval ausgerüstete Expeditionsstreitmacht, welcher der Offizier angehörte, stand bereits seit geraumer Zeit im Feld. Sie hatte den Auftrag, sibornalische Siedlungen zu zerstören, die in der Vergangenheit in Gegenden angelegt worden waren, welche von Pannoval als eigenes Reichsgebiet beansprucht wurden. Mit der Einnahme und Zerstörung von Roonsmoor hatte der Feldzug begonnen, und eine Serie erfolgreicher Unternehmungen hatte sich angeschlossen. In einem sorgfältig geplanten und systematisch durchgeführten Feldzug war die Expeditionsstreitmacht allmählich nordwärts vorgedrungen und hatte auf ihrem Weg eine feindliche Siedlung nach der anderen erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Die Besetzung und Niederlegung Isturiachas war das letzte Operationsziel. Alles war nun eine Frage der Zeit, denn der kleine Sommer neigte sich dem Ende zu.
Die Siedlungen, weit voneinander entfernt und beherrscht von einer Mentalität der Selbstgenügsamkeit, leisteten einander selten Hilfe. Einzelne wurden von der einen oder anderen sibornalischen Nation unterstützt. So fielen sie ihren Zerstörern nacheinander zum Opfer.
Die über das Land verteilten pannovalischen Einheiten hatten wenig mehr zu fürchten als gelegentliche Trupps von Phagoren, die in immer größerer Zahl auftraten, seit die Temperatur auf den Ebenen sank. Das Erlebnis des Artillerieoffiziers war nicht untypisch.
Als der von seinem Spähtruppunternehmen zurückgekehrte Offizier seine Einheit erreichte, gaben die am Himmel dahineilenden Wolkenfetzen eine wässrige Sonne frei, die sich im Westen inmitten eines dramatischen Farbenspiels zur Ruhe begab. Als der Horizont sie verschluckt hatte, versank die Welt dennoch nicht in Dunkelheit. Eine zweite Sonne, Freyr, brannte tief am Südhimmel. Als die Wolken um sie aufrissen, warf sie von den Menschen Schatten, die gleich hinweisenden Fingern nach Norden zeigten.
Allmählich bereitete sich eine weitere Auseinandersetzung zwischen zwei traditionellen Feinden vor. Weit hinter den Marschkolonnen, die über die Ebene zogen, lag im Südwesten die große und ruhmvolle Stadt Pannoval, von welcher der Wille zum Kampf ausging. Pannoval lag verborgen im Inneren des Kalkgebirges der Quzints. Die Quzints bildeten mit ihren langgestreckten Ketten das Rückgrat des tropischen Kontinents Campannlat.
Von den zahlreichen Völkern und Nationen dieses Kontinents waren mehrere Pannoval lehnspflichtig und überdies durch dynastische oder religiöse Bande mit der Vormacht verbunden. Der Zusammenhalt war jedoch immer nur zeitweilig, der Friede stets gefährdet; die Nationen lagen oft untereinander im Krieg. Daher der Name, mit dem Campannlat bei seinen äußeren Feinden bekannt war: Der Wilde Kontinent.
Gefährlichster äußerer Feind der zerstrittenen Völker Campannlats war der Nordkontinent Sibornal. Unter dem Druck seines extremen Klimas bewahrten die Völker Sibornals eine enge Einheit. Die unter der Oberfläche dieser Einheit schwelenden Rivalitäten wurden im allgemeinen mit Erfolg unterdrückt. Seit Menschengedenken hatten die Völker Sibornals nie aufgehört, südwärts über die Landbrücke von Chalce in die wärmeren und fruchtbareren Gefilde des Wilden Kontinents vorzudringen.
Es gab eine dritte Landmasse, den Südkontinent Hespagorat. Die Kontinente waren voneinander durch Ozeane getrennt oder fast getrennt, welche die gemäßigten Breiten einnahmen. Diese Ozeane und Kontinente machten zusammen den Planeten Helliconia aus, oder Hr-Ichor Yhar, um den Namen zu gebrauchen, der ihm von seiner Urrasse, den Ancipitalen, verliehen worden war.
Zu dieser Zeit, als die Streitkräfte aus Campannlat und Sibornal gegeneinander zogen und sich auf eine letzte Entscheidungsschlacht vorbereiteten, deren Schauplatz Isturiacha aus geographischen und strategischen Gründen gleichsam vorbestimmt war, näherte Helliconia sich dem Nadir seines Jahres.
Als Planet eines binären Systems umkreiste Helliconia seine Sonne Batalix einmal in 480 Tagen. Batalix aber kreiste mit einer viel größeren Sonne, Freyr, dem Hauptstern des Doppelsternsystems, um einen gemeinsamen Brennpunkt. Gegenwärtig entfernte sich Batalix mit seinen Planeten auf seiner elliptischen Bahn vom Hauptstern. Im Laufe der letzten drei Jahrhunderte hatten sich die klimatischen Auswirkungen des Herbstes – jener allmählichen Übergangszeit vom Sommer zum Winter – immer mehr verstärkt. Jetzt stand dieser Welt der Winter eines weiteren Großen Jahres bevor. Dunkelheit, Kälte, Stille warteten in der kommenden Jahrhunderten.
Selbst dem unwissendsten Handlanger war bewusst, dass das Klima sich stetig verschlechterte. Dies ergab sich nicht nur aus der Beobachtung der Wetterabläufe; es gab noch andere Anzeichen. Wieder breitete sich die Seuche aus, die im Volksmund als der Fette Tod bekannt war. Die Ancipitalen, gemeinhin als Phagoren bezeichnet, spürten die Wiederkehr der Klimaverhältnisse, die ihnen am zuträglichsten waren, eines Zeitabschnitts, da die allgemeinen Lebensbedingungen sich wieder jenen annäherten, die einst in ferner Vergangenheit geherrscht hatten. Während des Frühjahrs und Sommers hatten diese unglücklichen Geschöpfe unter der Vorherrschaft des Menschen zu leiden gehabt: nun, da das Große Jahr sich seinem frostigen Ende zuneigte und die Zahl der Menschen abzunehmen begann, war es an den Phagoren, die Herrschaft zurückzugewinnen und das alte Recht wiederherzustellen – es sei denn, die Menschheit schlösse sich zu ihrer Abwehr zusammen.
Es fehlte nicht an einem politischen Willen, der imstande sein mochte, die Massen aufzurütteln und zu gemeinsamem Handeln zu bewegen. Einen solchen Willen gab es in Pannoval, einen anderen, noch unbeugsameren, in der sibornalischen Hauptstadt Askitosch. Gegenwärtig aber trachteten beide nur danach, einander zu vernichten.
So bereiteten die sibornalischen Siedler in Isturiacha sich auf eine Belagerung vor und hielten in Sorge Ausschau nach den Verstärkungen, die aus dem Norden kommen sollten. Schon wurden die Kanonen Pannovals und seiner Verbündeten gegenüber der Siedlung in Stellung gebracht.
Ein gewisses Durcheinander herrschte sowohl an der Front wie im rückwärtigen Gebiet der gemischten pannovalischen Streitmacht. Der ältere Hauptmarschall, der den Feldzug befehligte, konnte nicht verhindern, dass Einheiten, die andere sibornalische Siedlungen erobert und geplündert hatten, mit ihrer Beute heimwärts zogen. Sie zu ersetzen, wurden andere Einheiten nach vorn beordert. Unterdessen begann die hinter den Wällen der Siedlung stationierte Artillerie die vorgeschobenen Stellungen der Belagerer zu beschießen. Die Explosionen der Einschläge führten zu Ausfällen in den Reihen des Kontingents von Randonan, das aus dem Süden des Wilden Kontinents gekommen war.
Viele Völker waren in der pannovalischen Expeditionsstreitmacht vertreten. Da gab es Abteilungen halbwilder Schützen aus Kace, die mit ihren enthornten Phagoren marschierten, schliefen und kämpften; hochgewachsene Männer mit steinernen Gesichtern, die aus Brasterl am Rand der westlichen Grenzgebiete kamen und Röcke trugen; Stammeskrieger aus Mordriat, die gezähmte Raubtiere als Maskottchen mitführten; und ein starkes Bataillon aus Borldoran, der Doppelmonarchie von Oldorando-Borlien, Pannovals stärkstem Verbündeten. Manche von ihnen hatten die gedrungene Statur derjenigen, die den Fetten Tod erlitten und überlebt hatten.
Die Borldoraner hatten die hohen und windigen Pässe der Quzint-Berge überschritten, um an der Seite ihrer Bundesgenossen zu kämpfen. Manche waren erkrankt und umgekehrt. Der Rest der Truppe, ermüdet vom langen Marsch, entdeckte nun, dass der Zugang zum Fluss von anderen, früher eingetroffenen Einheiten versperrt war. Es war nicht einmal möglich, die Reit- und Zugtiere zur Tränke zu führen.
Erhitzte Debatten zwischen den Kommandeuren der beteiligten Einheiten waren begleitet vom Pfeifen und Krachen in der Nähe einschlagender Granaten aus Isturiacha und führten zu keinem Ergebnis. Schließlich ging der Kommandeur des borldoranischen Bataillons zum Feldlager des Marschalls, um seine Beschwerde vorzubringen. Der Kommandeur war ein schneidiger, jugendlich wirkender Offizier namens Bandal Eith Lahl, ein Mann von aufrechter Haltung, mit einem militärischen Schnurrbart und einem Hohlkreuz. Mit ihm ging seine hübsche junge Frau, Toress Lahl. Sie war Ärztin in der Sanitätseinheit und hatte gleichfalls eine Beschwerde, die sie dem alten Hauptmarschall vortragen wollte; sie betraf die schlechten hygienischen Verhältnisse. Sie ging bescheiden hinter dem steifen Rücken ihres Ehemannes. Ihre Rocksäume raschelten durch das trockene Gras.
Am Zelt des Marschalls angelangt, machten sie sich bekannt und trugen ihr Begehren vor. Ein Adjutant verschwand im Zelt, kam mit bedauernder Miene wieder heraus.
»Der Marschall ist indisponiert, Herr Oberstleutnant. Er bedauert sehr, dass er außerstande ist, Sie zu empfangen, und hofft, dass er sich Ihrer Beschwerden ein andermal annehmen kann.«
»›Ein andermal‹!«, rief Toress Lahl. »Ist das ein Ausdruck, den ein Soldat im Feld gebrauchen sollte?«
»Sagen Sie dem Marschall«, erwiderte Bandal Eith Lahl, »dass meine Leute darauf nicht warten können. Wenn der Marschall so denkt, werden wir uns selbst zu unserem Recht verhelfen müssen.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und schritt, zornig an seinem Schnurrbart zupfend, zurück zum Fluss. Seine Frau folgte ihm, beunruhigt über die Ergebnislosigkeit ihres Bemühens und das anhaltende Artilleriefeuer aus Isturiacha, das auch das Kontingent aus Borldoran in Mitleidenschaft zog. Toress Lahl bemerkte nicht als einzige, dass über der Ebene bereits die ersten unheilverkündenden Vögel kreisten.
Auf gründliche Planung und effiziente Organisation verstanden sich die Völker von Campannlat nicht so gut wie jene aus Sibornal. Auch waren sie sehr viel undisziplinierter. Nichtsdestoweniger war ihr Feldzug gut vorbereitet gewesen. Die Moral von Offizieren und Mannschaften hatte nichts zu wünschen übrig gelassen; sie waren freudig ausgezogen, im Bewusstsein ihrer gerechten Sache. Der Feind aus dem Norden musste vom Kontinent vertrieben werden.
Inzwischen war die Begeisterung der ersten Wochen verflogen. Der Feldzug war bisher erfolgreich verlaufen, aber er war lang und anstrengend gewesen, und nun stand der Winter vor der Tür. Manche Soldaten, die Frauen bei sich hatten, verbrachten ihre Zeit mit ihnen in Zelten oder im Heu der Fouragewagen, als spürten sie, dass dies ihre letzte Gelegenheit zum Genuss von Liebesfreuden sei. Andere tranken schwer. Auch die Offiziere hatten den Geschmack an der gerechten Sache verloren. Isturiacha war nicht mit einer Stadt zu vergleichen, deren Einnahme sich lohnte; die Siedlung konnte außer Sklaven, dickleibigen Frauen und landwirtschaftlichen Geräten nicht viel enthalten.
Auch in den höheren Kommandostellen war die Stimmung nicht besser. Der Hauptmarschall hatte Nachricht erhalten, dass organisierte Abteilungen wilder Phagoren aus den unzugänglichen Hochländern des großen Nktryhk durch die angrenzenden Vorberge und Täler vordrangen, zweifellos mit dem Ziel, die fruchtbaren Ebenen zu gewinnen; der Marschall erlitt einen Hustenanfall.
Die allgemeine Stimmung ging dahin, dass Isturiacha so rasch und so risikolos wie möglich zerstört werden sollte. Dann könnte das Heer ohne weiteren Verzug in die Sicherheit der Heimat zurückkehren.
Soweit die allgemeine Stimmung. Als Batalix, die schwächere der beiden Sonnen, wieder aufging, enthüllte ihr Licht ein unheilvolles neues Element.
Von Norden her rückte eine sibornalische Armee an.
Bandal Eith Lahl sprang auf einen Karren, um durch ein Fernrohr den aus der Ferne heranziehenden Feind zu beobachten, dessen Kolonnen im dunstigen Licht des Morgens noch nicht klar zu erkennen waren.
Er rief einen Melder zu sich.
»Eine dringende Meldung für den Hauptmarschall. Er muss sie sofort erfahren, selbst wenn es notwendig sein sollte, ihn zu wecken. Eine feindliche Entsatzarmee ist im Anmarsch. Nach meiner Meinung müssen wir unverzüglich mit allen Streitkräften Isturiacha angreifen, noch ehe die Ersatzarmee eintrifft.«
Die Siedlung Isturiacha lag am Südende des großen Isthmus von Chalce, der eine Landverbindung zwischen dem äquatorialen Kontinent Campannlat und dem nördlichen Kontinent Sibornal bildete. Chalces gebirgiges Rückgrat erstreckte sich entlang dem östlichen Rand der Landenge. Um von einem Kontinent zum anderen zu gelangen, war ein tagelanger Marsch durch unfruchtbare Trockensteppen nötig, die im Regenschatten der östlichen Bergketten von Koriantura im sibornalischen Norden bis hinab zum gefährdeten Isturiacha reichten.
Die von den Bewohnern Campannlats bevorzugte gemischte Landbewirtschaftung hatte in den trockenen Grasländern keine Existenzgrundlage. Darum war es eine vernachlässigte Region, die folgerichtig auch bei den Göttern der bäuerlichen Bevölkerungen des Südens in Verruf war. Was immer aus jener kalten und unwirtlichen Gegend kam, war schlecht für Campannlat und seine Bewohner.
Eine frische Morgenbrise kam auf und trieb den Dunst auseinander. Nach und nach wurde der Blick auf die anrückenden Truppen frei, und man konnte die Kolonnen zählen. Nördlich der Siedlung zogen sie über die wellige Ebene und durch die Flussaue, wo am Tag vorher die Arangherde ihren Weg genommen hatte. Die über dem pannovalischen Lager kreisenden Vögel konnten mit der geringsten Anpassung ihrer Flügelspitzen innerhalb weniger Minuten über den Neuankömmlingen schweben.
Auf einen Adjutanten gestützt, trat der kranke Marschall von Pannoval aus seinem Zelt und richtete den Blick nach Norden. Der kalte Wind machte seine Augen tränen; er wischte sie abwesend, während er den vorrückenden Gegner beobachtete. Dann erteilte er den wartenden Stabsoffizieren und Truppenführern in heiserem Flüsterton seine Befehle.
Auffallendstes Kennzeichen der feindlichen Marschkolonnen war eine Ordnung, die unter den Armeen des Wilden Kontinents nicht zu finden war. Sibornalische Kavallerieabteilungen flankierten in angepasstem Schritt die disziplinierten Marschkolonnen der Infanterie. Sechsergespanne zogen die von Schützenabteilungen bewachte schwere Artillerie. Ihr folgten Munitionskolonnen, Bagagewagen und Feldküchen. Und immer weitere Kolonnen kamen in Sicht, wanden sich schwärzlichen Würmern gleich durch die öde Landschaft südwärts, als wollten sie es dem trägen Fluss gleichtun. Niemand in den alarmierten Streitkräften Campannlats konnte noch daran zweifeln, woher die Kolonnen kamen oder was sie bezweckten.
Der alte Marschall beendete die Befehlsausgabe mit der Weisung, dass alle Truppenabteilungen und Hilfsverbände ungeachtet ihres Glaubens für den Sieg Campannlats in der bevorstehenden Schlacht beten sollten. Vier Minuten sollten dafür aufgewendet werden.
Pannoval war in früherer Zeit nicht nur ein mächtiger Staat gewesen, sondern auch ein bedeutendes religiöses Zentrum, dessen geistliches und weltliches Oberhaupt, der C'Sarr, seinem Wort in weiten Teilen des Kontinents Geltung zu verschaffen wusste, und dessen Nachbarstaaten bisweilen zu reinen Satrapien unter der Herrschaft der pannovalischen Ideologie abgesunken waren. Vierhundertachtundsiebzig Jahre vor der Konfrontation bei Isturiacha war der Große Gott Akhanaba jedoch in einem inzwischen legendären Duell vernichtet worden. Der Gott hatte die Welt in einer Flammensäule verlassen und den damaligen König von Oldorando sowie den letzten C'Sarr, Kilander IX., mit sich genommen.
Die Staatsreligion hatte sich seitdem in zahlreiche Richtungen und Glaubensgemeinschaften aufgespalten, und im gegenwärtigen Jahr 1308 nach dem sibornalischen Kalender war Pannoval als das Land der tausend Kulte bekannt. Ein Ergebnis dieser Glaubenszersplitterung war, dass das Leben der Bewohner ungewisser und schwieriger geworden war. In dieser Stunde der Krise wurden alle großen und kleinen Gottheiten angerufen, und jeder betete um sein Überleben.
Um den Männern Mut zu machen, wurde Schnaps ausgegeben. Die Offiziere führten ihre Abteilungen gegen den Feind. Überall auf der südlichen Ebene ertönten Trompetensignale. Meldereiter preschten zu den entfernteren Einheiten und überbrachten den Befehl, unverzüglich die Siedlung Isturiacha anzugreifen und einzunehmen, bevor die Entsatzarmee in die Kämpfe eingreifen könne. Ohne des weit gestreuten Artilleriefeuers von der Siedlung zu achten, ging eine erste Schützenbrigade über die Brücke vor.
Bei den Zwangsausgehobenen von Campannlat drängten sich ganze Familien zusammen. Männer mit Gewehren wurden begleitet von Frauen mit Wasserkesseln und Kindern, die noch ihre Milchzähne hatten. Das Klappern von Pfannen und Töpfen vermischte sich mit dem militärischen Waffengeklirr – wie sich später das Gewinsel von Kleinkindern mit den Schreien der Verwundeten vermischen sollte. Gras und Knochenreste wurden zertrampelt.
Fromme Männer, die mit einem Gebet auf den Lippen in den Kampf zogen, gingen Seite an Seite mit anderen, die das Gebet verachteten. Der Augenblick war gekommen. Sie waren angespannt. Nun ging es ums Ganze. Keiner, der nicht fürchtete, dass dieser Tag sein letzter sein werde – aber der Zufall hatte ihnen das Leben geschenkt, und etwas Glück mochte dieses Leben noch retten. Glück und Geistesgegenwart.
Unterdessen beschleunigte die Armee aus dem Norden ihren Vormarsch. Reiterei und Schützenabteilungen wurden vorgezogen und fächerten zur Flankensicherung aus. Es war eine strikt disziplinierte Armee, mit gut bezahlten Offizieren und sorgfältig ausgebildeten Soldaten. Trompetensignale schmetterten, die Trommel gab den Marschrhythmus an. Über den einzelnen Abteilungen entfalteten sich die Banner der verschiedenen Länder Sibornals.
Hier kamen Truppen aus Loraj und Bribhar; Hinterwäldler aus Carcampan und den zivilisationsfernen oberen Hassiz, welche ihre Körperöffnungen während des Marsches verstopft hielten, damit die bösen Geister der Steppen nicht eindrängen; eine heilige Brigade aus Shivenink; zottige Hochländer aus Kuj-Juvec; und natürlich zahlreiche Einheiten aus Uskutoschk. Alle standen unter dem Oberfehl des finster blickenden, dunkelgesichtigen Erzkriegerpriesters, des berühmten Devit Asperamanka, der in seinem Amt Kirche und Staat vereinte.
Zwischen diesen Einheiten trotteten Phagorenabteilungen, zäh, wortkarg, mürrisch, eingeteilt in Züge, gehörnt, bewaffnet.
Insgesamt zählte die sibornalische Streitmacht mehr als elftausend Soldaten. Sie war von Sibornal durch die Steppenländer marschiert, die wie ein faltiger Fußabstreifer vor der Schwelle Campannlats lagen. Sie war mit dem Befehl aus Askitosch entsandt worden, die Reste der sibornalischen Siedlungen auf dem Südkontinent zu unterstützen und dem alten Feind einen schweren Schlag zu versetzen; zu diesem Zweck hatte man knappe Vorräte und Materialien und die neueste Artillerie bereitgestellt.
Die Aufstellung und Ausrüstung der Strafexpedition hatte ein kleines Jahr in Anspruch genommen. Obwohl Sibornal der Welt ein Bild der Einigkeit vorführte, gab es innerhalb des Systems Meinungsverschiedenheiten, Rivalitäten zwischen Völkern und Heimlichkeiten auf höchster Ebene. Selbst in der Auswahl des Feldherrn hatte Unschlüssigkeit zu spürbaren Verzögerungen geführt. Mehrere Offiziere waren gekommen und gegangen, bevor Asperamanka ernannt worden war – von keinem Geringeren als dem Oligarchen selbst, wie manche sagten. Während dieser Zeit waren Siedlungen, welche durch den geplanten Feldzug hatten geschützt werde sollen, dem pannovalischen Ansturm erlegen.
Die Vorhut der sibornalischen Armee war noch ungefähr eine Meile von den kreisförmigen Wällen Isturiachas entfernt, als die erste Welle pannovalischer Infanterie angriff. Die Siedlung war zu arm, um eine ständige Garnison zu unterhalten; ihre in einer Miliz organisierten Bewohner mussten sich selbst verteidigen, so gut sie konnten. Ein rascher Sieg der Angreifer schien gewiss. Zu ihrem Unglück aber kam es an der Brücke zu Schwierigkeiten, die bei besserer Organisation gar nicht erst entstanden wären.
Zwei rivalisierende Schützenabteilungen und eine Kavallerieschwadron aus Randonan versuchten gleichzeitig die Brücke zu überqueren. Offiziere erhitzten sich über die Frage der Reihenfolge. Die Ungeduld der kampfbereiten Truppen führte zu Rempeleien. Flüche flogen hin und her, dann flogen die Fäuste. Ein Yelk wurde über die Böschung gedrängt und fiel mit seinem Reiter ins Wasser. Breitschwerter aus Kace schlugen auf Säbel aus Randonan. Schüsse wurden abgefeuert.
Andere Truppen versuchten den Fluss mit Hilfe von Halteseilen zu überwinden, scheiterten aber an der Tiefe des Wassers und seiner unnachgiebigen Strömung. Alle, die in die Verwirrung an der Brücke hineingezogen wurden, gerieten durch den unerwarteten Aufenthalt und die Streitigkeiten in einen inneren Konflikt, der sich nachteilig auf ihre Einsatzbereitschaft und Kampfkraft auswirkte – ausgenommen vielleicht die Männer aus Kace, die Kämpfe als Gelegenheit ansahen, große Mengen ihres tückischen Nationalgetränks Pabowr zu konsumieren. Diese allgemeine Verunsicherung gab Anlass zu mancherlei Missgeschick. Eine Kanone explodierte und tötete zwei Kanoniere. Ein Yelk wurde verwundet und stürmte in Panik davon, wobei er einen Leutnant aus Matrassyl niederstieß und verletzte. Ein Artillerieoffizier stürzte von seinem Reittier in den Fluss und zeigte, als man ihn herauszog, unverkennbare Krankheitssymptome.
»Die Seuche!«, ging es wie ein Lauffeuer durch die Reihen. »Der Fette Tod!«
Jeder, der an den Kämpfen teilnahm, sah in den Schrecken der Schlacht und ihren wechselhaften Situationen eine Realität von neuartiger und einmaliger Qualität, doch war dies alles in der Vergangenheit schon viele Male inszeniert worden, sogar auf diesem selben Schauplatz auf der Ebene im nördlichen Campannlat.
Wie bei früheren Anlässen, verlief nichts genau so, wie es geplant worden war. Isturiacha leistete den Angreifern hartnäckigeren Widerstand als diese erwartet hatten. Die Verbündeten der Armee des Südens stritten untereinander und stimmten ihr Vorgehen nicht oder nur unvollkommen miteinander ab. Sturmabteilungen, die gegen die Siedlung angesetzt waren, sahen sich selbst angegriffen; es entwickelte sich ein desorganisiertes Rückzugsgefecht mit kreuz und quer fliegenden Kugeln und blitzenden Bajonetten.
Aber auch die anrückenden Sibornalier vermochten die militärische Disziplin, für die sie berühmt waren, nicht aufrechtzuerhalten. Die jungen Heißsporne der Vorausabteilungen warteten keine Befehle ab, sondern stürmten aus eigenem Entschluss vorwärts, Isturiacha um jeden Preis zu entsetzen. Die Artillerie, mehr als zweihundert Meilen herangeführt, um den pannovalischen Aufmarsch zu zerschlagen, war bereits in Stellung gegangen und musste nun untätig bleiben, weil Gefahr bestand, dass die angreifende Truppe ins eigene Feuer laufen würde.
Um aus dieser Lage das Beste zu machen, erteilte Erzkriegerpriester Asperamanka den nachfolgenden drei nationalen Verbänden den Angriffsbefehl. Diese waren ein starkes Regiment Uskuti, eine Abteilung aus Shivenink und eine kampferprobte Infanterieeinheit aus Bribhar. Alle drei Verbände waren durch Phagoren verstärkt.
Asperamanka ritt mit dem Uskuti-Regiment. Der Oberkommandierende bot einen eindrucksvollen Anblick. Er trug eine Uniform aus blauem Leder mit hohem Kragen und breitem Gürtel, dazu halblange schwarze Stulpenstiefel. Asperamanka war ein hochgewachsener, ziemlich ungelenker Mann, von dem es hieß, er sei sanft und sogar schelmisch im Umgang, wenn er nicht kommandiere. Er war sehr gefürchtet.
Manche sagten von Asperamanka, dass er ein hässlicher Mann sei. Gewiss, er hatte einen großen, eckigen Kopf mit einem bemerkenswert kantigen, dabei schmalen Gesicht, als ob seine Eltern sich nicht über die Geometrie hätten einigen können. Was ihn aber auszeichnete, war eine immerwährende düstere Wolke, die über Brauen und Nasenrücken zu schweben schien. Schwere Lider beschirmten ein dunkles Augenpaar, das stets auf der Hut war. Dieser düstere Zorn würzte noch Asperamankas geringste Bemerkung. Es gab Leute, die ihn fälschlich für den Zorn Gottes hielten.
Als Kopfbedeckung trug Asperamanka einen breiten schwarzen Hut, dessen Stirnseite die Fahne der Kirche und des azoiaxischen Gottes zeigte.
Die Verbände aus Shivenink und Bribhar gingen bereits in Gefechtsordnung gegen den Feind vor, als der von einem Sieg seiner Truppen überzeugte Erzkriegerpriester den Kommandeur des Uskuti-Regiments beiseite nahm.
»Ihr Regiment geht als zweite Welle in zehn Minuten vor!«, ordnete er an.
Der Kommandeur entgegnete, dass nur ein massiver Angriff starker Kräfte Aussicht auf Erfolg habe, wurde jedoch überstimmt.
»Sie halten Ihr Regiment zurück!«, sagte Asperamanka und wies mit schwarz behandschuhtem Finger auf die feuernd vorgehende Infanterie aus Bribhar. »Lassen wir sie ein wenig bluten.«
Bribhar machte Uskutoschk gegenwärtig die Vorherrschaft unter den nördlichen Staaten streitig. Seine unerschrocken vorgehende Infanterieabteilung stieß auf zähen Widerstand. Es kam verschiedentlich zu Nahkämpfen, in deren Verlauf nicht wenige fielen. Das Uskuti-Regiment wartete weiter auf den Angriffsbefehl.
Auch die Abteilung aus Shivenink war im Angriff. Dieses dünn besiedelte Land galt als das friedfertigste der nördlichen Staatsgebilde. In seinen Grenzen lag die heilige Stätte des Großen Rades von Kharnabhar; sein Kriegsruhm war hingegen gering.
Eine gemischte Schwadron von Kavallerie und Phagoren aus Shivenink wurde von Luterin Shokerandit befehligt. Er war ein Mann von edler Haltung, eine auffallende Erscheinung selbst unter seinesgleichen.