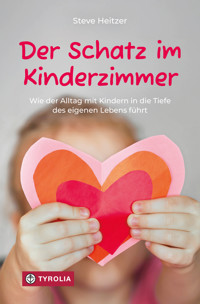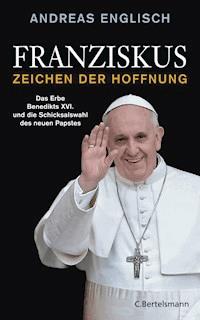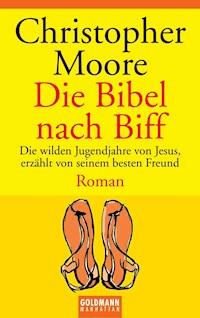Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Vom Dazwischen und der Kunst des Lassens Achtsamkeit, Weisheit und spirituelle Sehnsucht Moderne Achtsamkeitspraxis, die Lehren von Jesus von Nazareth, fernöstliche Weisheit – Achtsamkeitslehrer und Theologe Steve Heitzer schöpft aus verschiedenen spirituellen Quellen, um Kraft und Inspiration für das moderne Leben zu finden. Sein Buch ermutigt dazu, die Schätze des Lebens im Jetzt zu suchen und mitunter die "enge Pforte" anstelle des breiten Mainstreams zu wählen. Es spornt an, das "Dazwischen" mit Sinn und Freude zu füllen und sich in der hohen Kunst des Lassens zu üben. Jedes Kapitel mündet in einer Deutung eines Gleichnisses oder Wortes Jesu. Darin eröffnet der Autor behutsam Wege zur inneren Kraft sowie zu notwendigen Veränderungen für eine heilsame und verantwortungsvolle Lebenskunst. Das Buch ist geprägt von Heitzers persönlicher Suche nach einer ganzheitlichen Spiritualität –tiefsinnig und authentisch. Mit einem Vorwort von Exerzitien-Begleiterin Sr. Huberta Rohrmoser, Marienschwester vom Karmel in St. Valentin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steve Heitzer
Hellwach am Leben
Steve Heitzer
HELLWACH AM LEBEN
Auf dem Weg zu einer tragfähigen Spiritualität
Und wir haben im Grunde nur dazusein
aber schlicht,
aber inständig,
wie die Erde da ist,
den Jahreszeiten zustimmend,
hell und dunkel
und ganz im Raum,
nicht verlangend, in anderem aufzuruhen
als in dem Netz von Einflüssen und Kräften,
in dem die Sterne sich sicher fühlen.
R. M. Rilke
Inhalt
Zum Geleit
Ein
Vom Glück, heimzukommen
Achtsamkeit und Spiritualität – wovon reden wir?
Erster Teil
Einlassen. Von der Kunst, anzukommen
Warum wir Achtsamkeit brauchen
Einen Schritt näher
Der Schatz
Zweiter Teil
Dazwischen. Alltag und Augenblick
Heilkräuter der Achtsamkeit
Komposteimer und Superzeitlupe
Im Gefängnis der Zeit
Die Kinder
Dritter Teil
Nein. Ja. Widerstand und Hingabe
Unser Ja und unser Nein erforschen
Kleine Sorgen, großes Leid
Zuflucht und Hingabe
Die Vögel
Vierter Teil
Krise. Tore und Wege
Wie geht Freiheit?
Wie geht (Un)Sicherheit?
Die Pforte
Fünfter Teil
Auslassen. Kunst der Endlichkeit
Atem – Software des Lebens
Anhaften – Selbstversuch Achtsamkeit
Die Saat
Sechster Teil
Wer bist du? Leben und Gegenwart
Was ist Leben?
Gegenwart und Heiligtum
Das Boot
Aus
Eine neue Überfahrt
Übungen
Dank
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Zum Geleit
„Steve liegt mit Herzinfarkt auf der Intensivstation“ – am 7. Februar 2023 erhielt ich diese schockierende Botschaft. Und jetzt, kaum ein halbes Jahr später, halte ich das Manuskript seines neuen Buches in Händen. Fast nicht zu glauben! Doch ausgerechnet diese existenzielle Erfahrung, nämlich buchstäblich im letzten Augenblick dem Tod entrissen worden zu sein, wurde zum Anstoß für Steves erfrischend lebenszugewandtes Buch.
Unsere Zeit, unsere Welt ist voller Verunsicherung, voller Probleme. Speziell junge Menschen sehen kaum eine Perspektive für eine gute, sinnvolle Zukunft. Noch so viel Ablenkung, Vergnügen, Wohlstand, auch Leistung können diese innere Not nicht verhindern. Auch Menschen mittleren und höheren Alters reagieren auf die Verunsicherung mit Negativität, Frustration und bisweilen aggressiv gegen alles und jeden. Hier braucht es ein Gegengewicht, kein oberflächlich positives Denken, aber neue Kraft aus alten Quellen.
Steve Heitzer ist Achtsamkeitslehrer und Theologe, er schöpft bei seinen Recherchen aus bewährten Quellen: Überlieferung erprobter Weisheit, moderne Achtsamkeitspraxis, Spiritualität im umfassenden Sinn des Wortes, Jesus von Nazareth, dessen Leben und Lehre – und nicht zuletzt aus seinem ehrlichen Bemühen, das Erkannte selbst zu leben. Steve versteht es, sich auf Jesu Botschaft inhaltlich und sprachlich verständlich einzulassen und darin Inspiration für unser Leben heute zu finden. Immer wird dabei Vertrauen auf den tragenden Grund spürbar – wie immer man ihn benennen mag. Es ist ein Grund, der über das irdische Leben hinausführt: Es zeigt sich eine Spur, die nicht nur für diese Welt taugt, sondern Hoffnung auf ein vollendetes Leben, ein Leben in Fülle weckt. Und all dies schaut er nun zusammen mit den Lebensbedingungen des modernen Menschen.
Ich kenne Steve seit fünfzehn Jahren und habe ihn durch ein Jahr Auszeit und spirituelle Vertiefung geistlich begleitet und ihn im Rahmen einer Ausbildung zur Einführung und Begleitung kontemplativ meditierender Gruppen im Alltag befähigt. Seit einigen Jahren leiten wir darüber hinaus gemeinsam im „Haus der Achtsamkeit Grünau“ Seminare und Retreats zum Thema Achtsamkeit und christliche Kontemplation. Ziel dieses Hauses ist ein weltoffenes Christentum, das aus den eigenen Wurzeln lebt und gleichzeitig in großer Wertschätzung bereit ist für den Dialog mit anderen Religionen und vielfältigen Formen der Spiritualität. Und wie gerade das Zusammen von christlicher Kontemplation und moderner Achtsamkeitspraxis gehen kann, stellt Steve in seinem Werk meisterhaft dar.
Dieses Buch kann helfen, Sinn und Freude für das eigene Leben zu schöpfen – auch und gerade für unsere chaotische Welt heute. Eines der größten Probleme des Menschen ist sein Ausgeliefertsein an sein Gedankenkreisen um Vergangenes, Zukünftiges, um Probleme aller Art, darin sind sich Mystiker und Achtsamkeitslehrer aller Zeiten und aller Weltanschauungen einig. Hellwach den gegenwärtigen Augenblick zu leben, ist dagegen das, was uns dem Leben näher bringt, was Resilienz unterstützt und Freude erweckt, was sinnvolles, erfülltes Leben und einen guten Umgang mit Mitmensch, Schöpfung und sich selbst hervorbringen kann.
Zurück zum Anfang: Die persönliche Erfahrung, wie plötzlich Leben zu Ende sein kann, zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk und macht es lebensnah, konkret, auf eine Weise dringlich und zutiefst inspirierend. Lassen Sie sich überraschen!
Sr. Huberta Rohrmoser,
Marienschwester vom Karmel, Meditations- und
Exerzitienleiterin, Diplompädagogin, Supervisorin.
„Haus der Achtsamkeit Grünau“ im Almtal, im September 2023
EIN
We’re all just walking each other home.
Wir begleiten uns nur alle gegenseitig nach Hause.
Ram Dass
Vom Glück, heimzukommen
Ich sitze im Zug über den Arlberg auf dem Heimweg von einer Fortbildung. Oben auf den Bergen leuchtet noch die Abendsonne. Ein wunderbarer Herbsttag verneigt sich vor mir und ich mich vor ihm. Eine stille Gegenwart.
Auch in unserem Seminar war diese wunderbare Stille immer wieder spürbar, wenn wir innehielten und nachspürten. Nichts tun, nichts erreichen, nichts sagen müssen – einfach sein. Bei einer Übung dann die Einladung, sich mit einem Moment der Freude und des Glücks zu verbinden. Eine Situation, in der wir uns geborgen fühlten, eine kleine Erfahrung irgendwo draußen oder mit einem Menschen oder auch mit einem Tier. Bei mir tauchte recht schnell ein kleiner Fußmarsch auf, gerade zwei Tage vorher; und eine weitere Erinnerung an eine Reise, die schon länger zurücklag. Erstaunlicherweise war ich in beiden Situationen eigentlich allein unterwegs. Zufrieden. Geborgen in mir selbst. Vor ein paar Jahren hatte ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, mich eins mit mir allein zu fühlen und darin auch Halt zu finden. Das ist für jemanden, der wie ich schon im Mutterleib mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen und grundsätzlich gerne mit Menschen zusammen ist, doch eine wichtige Erfahrung; mit fünfzig Jahren – spät, aber immerhin.
Der Fußmarsch: Das letzte Stück Weg zum Bildungshaus St. Arbogast, ein guter Ort für eine solche innere Arbeit. Ich hatte Andreas Bouranis Lied „Wieder am Leben“ in meinen Ohren und sang mit einem Male aus vollem Hals und tiefster Seele mit ihm diese Zeilen. Jetzt wusste ich, warum ich nicht den Bus vom Bahnhof nehmen wollte. Ich wollte mit mir allein sein; und ich wollte gehen; und ich wollte dieses Lied hören und singen: „Es vibriert in allen Sinnen, ich saug das ganze Universum in mich auf, […] Zeit neue Wege zu gehen.“
AM LEBEN
In diesem Song vibriert eine Lebensenergie, wie wir sie von Aufbrüchen kennen, bei großen Verschiebungen im Leben, wo wir vielleicht schwierige Entscheidungen getroffen haben. Und nun eine Art Durchbruch erleben. Oder von damals, „als wir noch jung waren“. Das Gefühl, wir könnten Bäume ausreißen. Oder überhaupt die Energie von den Kindern, die tatkräftig an die Umsetzung einer Idee gehen. Eine Höhle, ein Baumhaus bauen, einen Staudamm. Oder von Menschen, die Kind geblieben sind. Kennst du das auch noch? Dieses Gefühl, die Welt gehöre gerade dir? Mir ging es so auf diesem Fußmarsch, gerade für diese paar Minuten, ohne dass ich eigentlich hätte sagen können, warum. Hier schmeckte das Leben nach Fülle. Aufwachen aus dem Dunst von ewig gleichen Problemchen und Gedanken. Aufstehen. Aufbrechen. Mit einer „Kraft für zehn“, wie Bourani singt. Eine Energie, die gerade quer steht zu der Erschöpfung im Alltag. Früher sagte ich manchmal zu meiner Frau, wenn wir müde vom Tagwerk unseres Kindergartens noch zu einer späten Tasse Kaffee fanden und unsere Jüngste (damals 7 oder 8 Jahre alt) schier unerschöpfliche Kraft hatte für Geräusche und Spiele, die uns eigentlich um diese Zeit zu viel waren: „Wenn sie uns ein bisschen von ihrer unbändigen Energie abgeben könnte … Wir ein bisschen mehr, sie ein bisschen weniger …“
Heute, schon bald 10 Jahre später, spüre ich körperliche Wehwehchen und Einschränkungen, die Zeit blieb nicht stehen; und zugleich zum Glück auch immer wieder diese unbändige Lust auf Leben. Zumal es mir nach recht dramatischen Stunden vor ein paar Monaten wie neu geschenkt wurde. „Ich bin wieder am Leben“, trifft für mich heute noch viel konkreter zu als damals bei meinem Fußmarsch.
ALLEIN
Bei einem zehntägigen Retreat (kontemplative Exerzitien) hatte ich zum ersten Mal das Alleinsein als intensives Glück erlebt. Natürlich gab es die Gruppe, die mich mittrug, und die Retreatleiterin, die uns begleitete. Und doch war ich im durchgängigen Schweigen für mich allein, im Zimmer, bei den Spaziergängen. Keine Ablenkungen, keine Bücher, keine Musik, keine Infos, keine Unterhaltung durch digitale Begleiter. Allein mit mir. Und gleichzeitig eins. So sehr ich meine Familie liebe und mich freue an Gemeinschaft und Freundschaft – ich kann auch glücklich mit mir alleine sein – eine überraschende und wichtige Erfahrung für mich.
Die Reise: Ein anderes Mal war ich alleine auf einer weiten Zugreise von Warschau nach Innsbruck. Am Vortag hatte ich eine berührende Begegnung mit einem polnischen Waisenkind und die ganze Nacht über arbeitete diese Geschichte in einem intensiven Traum in mir: Eine Katze war mit mir im Zug und ich sollte mich um sie kümmern. Sie hatte Durst. Ich versuchte zu helfen … An diesem Tag hätte ich dringend eine Schulter gebraucht, an der ich hätte weinen können. Und ich fürchtete mich schon vor der Migräne, die manchmal der Tränenstau auslöst, wenn ich eigentlich weinen möchte und nicht kann. Da erinnerte ich mich an die Einladung zum Selbstmitgefühl: sich innerlich selbst in die Arme zu schließen. Es war tatsächlich möglich, ich legte meine Arme gekreuzt an meine Schultern und spürte, wie gut es tat, mich selbst zu berühren. Die Migräne blieb aus, auch wenn ich nicht wirklich weinen konnte. Ich konnte für einen Moment für mich selbst sorgen. Manchmal ist das Leben so, dass wir andere bräuchten, aber niemand da ist, und wir uns wie gelähmt fühlen, weil wir nichts tun können. Und dann ist da doch eine kleine Berührung möglich oder wir können einfach da sein – einmal nicht für andere, sondern für uns selbst. Vielleicht ist das genauso wichtig, wie etwas für andere zu tun und für andere da zu sein. Achtsamkeit braucht Güte, auch und beginnend mit der Güte zu uns selbst. Immer ist da dieses kostbare Leben: Es umgibt uns, wir atmen es ein, es liegt in der Luft, um uns herum, in uns selbst – kostbares Leben, an dem wir Teil haben, von dem wir Teil sind.
Gleichzeitig staunte ich über die Erfahrung, dass sogar schwierige Momente, Traurigkeit und Schwere, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit dazu führen können, zu sich selbst heimzukommen und gleichzeitig verbunden zu sein. Nicht verbunden zu sein mit dem ganzen großen Netz des Lebens, ist ohnehin eine Illusion, der wir im Alltag aufsitzen, wenn wir uns getrennt und einsam vorkommen. Darauf wies schon Albert Einstein hin, der das Gefühl der Trennung als eine „optische Täuschung unseres Bewusstseins“ bezeichnete. In den vergangenen Jahren musste ich mich immer wieder auch mit körperlichen Schmerzen auseinandersetzen – und zusammensetzen. So schmerzhaft und dramatisch die Dinge manchmal auch werden, ich konnte darin auch erleben, dass das Leben nicht entweder schön oder schmerzhaft ist, kostbar oder herausfordernd, sondern beides zugleich sein kann. Solange wir am Leben sind, nah am Leben dran, vibriert Leben auch immer um uns herum. Sobald wir unser Herz ein kleines Stück weit öffnen können, lassen wir Energie herein, „Schwingung“, könnten wir sagen. Und dann ist es nicht mehr weit, um Resonanz zu spüren, Mit-Schwingen.
Dieses Buch handelt von Erfahrungen eines Mitschwingens, einer Resonanz, von einem Ankommen für Momente – bei mir selbst, mitten im Leben, in der Welt, im Kampf und im Spiel mit dem, was ist; im Aufbruch und im Einbruch, im Einlassen und im Loslassen, im inneren Lärm und in der Stille des Großen Ganzen. Wir klammern die Schwierigkeiten und Herausforderungen bewusst nicht aus. Leben ist alles, was uns widerfährt. Nicht nur das, was wir uns wünschen oder worüber wir uns freuen. Entscheidend ist es, gleichzeitig zu werden mit dem Leben, wo wir doch so oft gedanklich vorauseilen oder grübelnd hinterherhinken. Resonanz, Verbundenheit und dieses Gleichzeitig-Werden mit dem Leben, Gegenwärtigkeit, Präsenz – ist diese Art von Heimkommen auch „spirituell“?
SPIRITUELL
Spiritualität ist ein äußerst schillernder Begriff, wie wir gleich noch sehen werden. Ich möchte in diesem Buch nicht den Versuch unternehmen, den Begriff zu (er)klären, sondern seine Fährte für unsere Lebenskunst immer wieder aufzunehmen. Das Spirituelle ist eine wesentliche Kraft in uns – egal, wie wir es nennen und in welcher Form wir es in unser Leben integrieren.
Mein eigener spiritueller Weg ist verschlungen, aber keineswegs spektakulär; er führte von einer traditionellen Erfahrung von Religion und Kirche in den 1970er Jahren im katholischen Bayern zu einer völlig neuen Erfahrung christlicher Spiritualität in den USA und schließlich – wieder anders – in Argentinien Ende der 1980er Jahre. Nach Theologiestudium und intensiven Jahren in der Gemeindepastoral folgte eine nachhaltige kirchliche Entfremdung, doch es war eher so, dass mir der stille Auszug aus einer kirchlichen Heimat vor Ort passierte. Als ich Vater wurde und im Jahr 2000 auch noch anfing, mit Kindern zu arbeiten, hatte jedenfalls mein ganzes Lebensumfeld plötzlich nichts mehr mit Kirche und Religion zu tun. Erst „dort draußen“, wo die kirchliche Sprache weder gesprochen noch verstanden wurde, war es auch mir möglich, andere „Sprachen“ zu hören und mich auch für andere spirituelle Wege zu öffnen. Dabei bin ich nicht wie viele Sinnsucher seit den 1970er Jahren nach Indien, Thailand oder in andere Länder Asiens gegangen, sondern mitten hinein in mein kleines konkretes Leben, voller Kinder und Eltern, die unseren privaten Kindergarten wählten. Anstatt in den buddhistischen Klöstern fand ich zu Meditation und Achtsamkeitspraxis über wunderbare Lehrer und Wegbereiter für achtsame Elternschaft und Pädagogik. Dabei halfen mir die Kontemplation und Mystik, die ich während meines Studiums schon bei einem Kapuzinerpater entdeckt hatte. Überhaupt hatte ich nie das Gefühl, mich dadurch von Gott, von Jesus, seiner Botschaft und Person entfernt zu haben oder entfernen zu müssen, um wichtige andere Botschaften zu hören. Die Beschäftigung mit der Achtsamkeitspraxis und westlichbuddhistischer Literatur sowie mit modernen Weisheitslehrern wie Eckhart Tolle half mir enorm, das Reden von Gott hinter mir zu lassen und mich auf mein konkretes Leben jenseits religiöser Kategorien ganz einzulassen; die kleinen Momente des Glücks im unscheinbaren Alltag zu finden, die Kraft des Augenblicks zu entdecken und die Schönheit eines Sonnenunterganges in den Bergen sowie in meinen Körper zurückzufinden – als Ausgangspunkt und Brennpunkt dieses meines Lebens. Ich fand in Atem- und Körperwahrnehmung eine ganz konkret erfahrbare Brücke zum Spirituellen – jenseits religiöser Rituale und gesprochener Gebete.
Rückblickend musste ich meine religiöse Heimat wieder verlieren, um spirituell langsam, aber sicher ganz zu mir heimzukommen. Gleichzeitig hatte ich nie das Gefühl, dieser „Heimat“ samt ihren Quellen und Schriften den Rücken zuzukehren (auch der Kirche nicht). Im Gegenteil: Immer wieder fand ich Parallelen zwischen der Meditation und dem kontemplativen, stillen Gebet, das ich schon kannte. Je länger ich mich mit beidem befasse, desto klarer wird mir, dass die „Stille“ quasi interspirituell ist und dass es um eine gemeinsame Erfahrung der Resonanz und Verbundenheit mit dem Großen Ganzen geht – mit welchem Namen oder in welcher Sprache wir sie auch beschreiben.
Wenn ich in diesem Buch auf biografische Fäden meiner Spiritualität zu sprechen komme, dann ohne diese herauszuheben oder für andere als wichtig zu erachten. Es geht nur darum, transparent zu machen, woher ich komme. Dabei folgte dieser Weg keinem Plan; eher ist es mit dem „Spirit“ wie mit dem geheimnisvollen Weg des Atems durch den Körper oder wie mit einem Bach, der sich seinen Weg bahnt, manchmal über die Ufer geht, manchmal wie vertrocknet unterirdisch dennoch weiter fließt und auch mal Steine ins Rollen bringt und schließlich münden wird. Ich bin dankbar, dass ich aufbrechen konnte, heraus aus einer Spiritualität, die oft vorformuliert war; die immer wieder schon Antworten parat hatte, wofür ich noch gar keine Fragen in mir fand. Ich bin dankbar für die Tiefe, die ich auch in einer sehr religiösen Frömmigkeit spüren durfte; zugleich bin ich froh, eine Weite kennengelernt zu haben, Lehrer:innen und Persönlichkeiten, die ganz ohne den Begriff „Gott“ auskommen und doch zutiefst spirituell sind. Sie alle lassen mich erst mehr und mehr heimkommen zu mir und zu dem, den ich erst langsam wieder zaghaft „Gott“ nenne.
Achtsamkeit und Spiritualität – wovon reden wir?
Spiritualität ist wieder in Mode – auch wenn sie sich manchmal hinter anderen Begriffen versteckt; im persönlichen Gespräch ist Spiritualität allerdings auch vielerorts ein Tabuthema. Spiritualität kann alles meinen – auf oberflächliche Weise genauso wie mit Tiefgang. Wenn ich ein Buch über Spiritualität lese, möchte ich zuerst wissen, wer der Autor ist, was er mit Spiritualität meint, woher seine Erfahrungen kommen. Ich möchte den Hintergrund des Autors unter die Lupe nehmen. Ist ihm über den Weg zu trauen? Prüfe selbst.
WELCHE SPIRITUALITÄT?
Was ist eigentlich Achtsamkeit? Was meine ich, wenn ich von Spiritualität, bisweilen auch von Mystik spreche? Unsere Sprache wird immer dann schon wackelig, sobald wir die Begriffe des Alltags verlassen. Vollends zum Seiltanz wird sie, wenn es um so bedeutungsschwere Begriffe wie Mystik, Gott oder Spiritualität geht. Gerade mit so großen Worten müssen wir vorsichtig umgehen und wir brauchen ihrer Ambivalenz gar nicht auszuweichen. Der bekannte Religionspädagoge Fulbert Steffensky schrieb einmal einen Aufsatz mit dem Titel „Warum ich das Wort Spiritualität nicht mehr hören kann“1 und bezeichnete es als „Irrlicht“2. Auch das mit der „Achtsamkeit“ ist so eine Sache, zumal sie in den letzten Jahren förmlich boomt. Viele verstehen den Begriff zu schnell, weil er wie eine gute Idee klingt und wir irgendwie doch eh alle achtsam sind oder sein wollen … Mittlerweile finden sich so vorwurfsvolle Beschreibungen wie „McMindfulness“ oder gleich „McDonalds-Spiritualität“3. Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Wer den Begriff und sein spirituelles Potenzial recht verstehen möchte, dem kann ich nur die Bücher des vietnamesischen Mönches und Dichters Thich Nhat Hanh empfehlen sowie die von Jon Kabat-Zinn, der das Herzstück buddhistischer Meditation zunächst für schwer bzw. chronisch kranke Patienten und Patientinnen seiner Stress Reduction Clinic in den USA fruchtbar gemacht hat. Für sie hat er schon vor über 40 Jahren ein 8-Wochen-Programm mit Yoga, Sitzmeditation und Körperwahrnehmung („Body-Scan“) entwickelt, das sich mittlerweile weltweit verbreitet und in viele therapeutische Richtungen verzweigt hat. Bei aller Vorsicht und Unterscheidung der Geister lohnt es sich, auch neugierig zu sein und wohlwollend interessiert. Es gibt auch hier sehr integre und authentische Menschen mit einer großen spirituellen Kraft; und natürlich gibt es auch geschäftstüchtige Vertreter:innen und Menschen, die noch mehr an ihrem Ego arbeiten dürfen. Die moderne Achtsamkeitspraxis hütet sich jedenfalls, „spirituell“ daherzukommen – wohl in der Sorge um die Ambivalenz des Spirituellen und im Versuch, inmitten des unübersichtlichen spirituellen oder esoterischen Marktes nicht unterzugehen. Dennoch braucht es die Zugänge des Herzens, und es ist nicht überraschend, dass gerade in so genannten „MBSR-Kursen“ zur Stressbewältigung auf der Basis der Achtsamkeitspraxis gern auch auf tief spirituelle Texte zurückgegriffen wird, etwa auf persische Dichter, auf Sufi-Mystiker wie Rumi oder Hafis.
SPIRITUALITÄT UND ERFAHRUNG
Ich persönlich mag den Begriff Spiritualität trotz seiner Ambivalenz. Spiritualität ist aus meiner Sicht ein sehr dynamischer Begriff und Prozess. Das Spirituelle kann uns in die unterschiedlichsten Richtungen führen und damit auch auf Abwege, Irrwege und in Sackgassen. Im besten Fall aber führt sie uns nach außen und nach innen, in die Weite und in die Tiefe, in eine Erfahrung der Verbundenheit – mit dem Äußersten und dem Innersten –, ohne uns einzuengen oder gar zu vereinnahmen. Spiritualität und Mystik führen in die Tiefe unseres Herzens, wo es auch emotional sein darf, aber nicht sein muss. Spiritualität und Mystik öffnen den Raum für Erfahrungen, aber sie können nachhaltige Erfahrungen nicht „machen“, herbeibeten oder zaubern, auch wenn sowohl religiös fromme als auch „sehr spirituelle“ Menschen manchmal den Eindruck erwecken, sie wollten das. Wenn wir in erster Linie auf außerordentliche religiöse oder spirituelle Erfahrungen aus sind, bleiben diese oft oberflächlich, sie tragen letztlich nicht und tragen auch nicht bei zum Wachsen und Reifen unserer Lebenskunst. Aus christlich mystischer Sicht schreibt Steffensky nüchtern: „Wo der Glaube erwachsen wird, da hält er es ohne Erfahrungen aus. […] Wer Gott sucht, der sucht eben Gott und nicht die Erfahrung. Er liebt Gott und nicht seine Erfahrung. Es ist wie in der Liebe: Liebe ich jemanden oder liebe ich die Erfahrung der Liebe?“4 Der Jesuit Franz Jalics, der eine zeitgemäße Form christlicher Meditation – ein stilles, kontemplatives Gebet, inspiriert von der mittelalterlichen Mystik – entwickelt hat, warnte in ähnlicher Weise vor einer Ichbezogenheit in der Meditation, wodurch viele Menschen „die Gaben Gottes“ suchen würden anstatt Gott selbst.5 Christliche Mystiker:innen sprechen – wie auch die islamischen Sufi-Mystiker – gern und unbefangen von Gott. Doch selbst wenn wir der Rede von Gott schon längst überdrüssig sind, wenn schmerzliche oder verstörende Erfahrungen mit Kirche und Christentum dazu geführt haben, dass sogar „die Rollladen heruntergehen“, sobald von Gott, Jesus oder Spiritualität die Rede ist, schließt das eine tiefere spirituelle Offenheit, Suche, ja Sehnsucht nicht aus.
LEIB UND SEELE
Auf unserer Suche nach authentischer und persönlicher spiritueller Erfahrung, die sozusagen näher an unserem Leben dran ist, stoßen wir auf Yoga, Meditation, eine „Praxis“ oder eine bestimmte Technik. Wir brauchen Erfahrungen und wieso nicht auch Wege nützen, die auf eine lange Tradition zurückblicken oder auf neue Weise alte Traditionen wiederbeleben!? Mit dem Körper eine neue spirituelle Suche zu beginnen, ist eine wunderbare Möglichkeit. Der Körper ist unser Ausgangspunkt, alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir mit unserem Körper wahr. Ohne Körper keine Wahrnehmung. Ohne Wahrnehmung keine Erfahrung, keine Gegenwart, keine Möglichkeit, hellwach am Leben zu sein. Und der Leib geht in die Tiefe, mittels des Atems, und ins Zentrum, zum Herzen. Körper, Geist und Seele – dem Denken wird wieder sein Platz neben Körper und Seele eingeräumt. Dem Wort wird nicht mehr Bedeutung gegeben als der körperlichen Wahrnehmung, dem körperlichen Ausdruck und der Erfahrung von Resonanz, Verbundenheit und – nicht zu vergessen – von Stille! Gerade wenn wir Religion in ihrer Äußerlichkeit lang genug erlebt haben, ohne von Herzen berührt zu werden, braucht es den Zugang des eigenen Herzens und die Erfahrung von Stille, um nicht ständig schon von Sprache, Sätzen und Antworten umgeben zu sein, für die wir noch gar keine Fragen haben, keine ur-eigenen Worte und schon gar nicht ein Erkennen und Gewahrsein jenseits von Worten. Im Laufe unserer Übung, unserer Praxis werden wir es dabei auch mit Erfahrungsarmut zu tun haben. Auch diese ist heilsam. Mystik und Achtsamkeit erinnern uns beständig daran, überhaupt keinen speziellen Zustand erreichen zu wollen. Am Ende und am Anfang tieferer Übung in Stille, Meditation und kontemplativem Gebet steht die Erfahrung, dass wir immer „schon dort“ sind, schon angekommen. Wir finden, statt zu suchen. Und was wir vorfinden, betrachten wir hellwach und „mit lebendigem Interesse“ – wie Franz Jalics es nennt.
HEIMAT IN UNS SELBST
Wenn wir also weder durch religiöse Formen und Formeln noch durch die Suche nach dem Besonderen und Spektakulären von uns weggezerrt werden, können wir (endlich!) damit anfangen, alles Äußerliche auch loslassen zu lernen, einfach zu werden (auch in der Spiritualität) und uns auf ganz praktische Weise auf uns selbst zu besinnen, bei uns selbst anzufangen; etwa, indem wir unterstützt durch eine Meditationspraxis üben, im gegenwärtigen Moment zuhause zu sein. Das hat auf längere Sicht enorme Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Leben, denn wir lernen, Heimat in uns selbst zu finden. Nicht schnell, meist nicht spektakulär, eher unscheinbar, stetig und nachhaltig. Der westlich-buddhistische Lehrer Ezra Bayda schreibt: „Eine der stärksten positiven Wirkungen der Meditationspraxis erfahren wir, wenn wir lernen, in uns zuhause zu sein.“6 Dabei führt uns der Weg zu uns selbst, in unsere Mitte durchaus nicht weg von der Suche nach dem Großen Ganzen, nach Gott. Religiös gesprochen erfahren wir hier eine Geborgenheit in Gott. Aber ob wir uns – selbst unter widrigsten Lebensumständen – in den Armen Gottes oder in den „Armen des Lebens“7 gehalten und geborgen fühlen, wie es die Jüdin Etty Hillesum inmitten des Holocaust beschreibt, ist vielleicht viel mehr eine Frage der Worte, als dass es sich um völlig unterschiedliche spirituelle Erfahrungen handeln würde.
DER FROMME VON HEUTE
Wenn ich hier von Mystik spreche, greife ich nicht direkt auf die großen christlichen Heiligen und Mystiker:innen des Mittelalters zurück, sondern auf Menschen und Lehrer:innen unserer Zeit, auch außerhalb des Christentums. Ich fasse den Begriff also sehr weit. Der berühmte Theologe Karl Rahner prophezeit schon vor über fünfzig Jahren: „Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein.“8 An anderer Stelle spricht Rahner vom „Frommen von morgen“, und er schreibt zu dieser Frömmigkeit, dass „die bisher übliche religiöse Erziehung also nur noch eine sehr sekundäre Dressur für das religiöse Institutionelle sein kann“9. Der schwindende Einfluss religiöser Erziehung und der religiösen Institutionen ist heute spürbar, und viele erleben es vielleicht als Befreiung. Andere als herben Verlust oder gar als Bedrohung. Tatsache ist, dass die Menschen heute in ihrer spirituellen Suche – ähnlich wie in der Erziehung ihrer Kinder – glücklicherweise nicht mehr einem starken gesellschaftlichen Konsens folgen müssen; und auch nicht mehr können, weil es diesen in der Form nicht mehr gibt. So sind sie frei, aber auch herausgefordert, eigene Werte, Haltungen, Vorbilder und Inspiration aufzuspüren.
ESOTERIK
Religiöse Bekenntnisse, Formen und Formeln verlieren damit zusehends an Bedeutung, und was die einen als „Patchwork-Spiritualität“ ablehnen, ist für andere ein befreiender Aufbruch. Sie öffnen sich für Meditation, Yoga, Achtsamkeitspraxis oder wenden sich esoterischen Praktiken zu. Der Begriff „Esoterik“ ist dabei noch schwerer zu greifen als der Begriff „Spiritualität“. Oft wird der Begriff abwertend verwendet und alles darunter zusammengefasst, was nicht etablierten Formen religiöser Praxis entspricht. Tatsache ist, dass es ein riesiger Markt ist, bei dem Menschen auf der Suche nach Sinn auch viel Geld ausgeben und bisweilen auch ausgenutzt werden; bei dem manchmal schnelle Versprechungen gemacht werden, v. a. wenn Menschen in Not sind oder krank, ohne diese wirklich einlösen zu können. Gleichzeitig zeigt die große Nachfrage nach esoterischen Praktiken auch, dass sie auf neue Weise und auch auf oft sehr alten Pfaden Beziehung aufnehmen wollen zum Göttlichen, zur „spirituellen Welt“, dass sie hungern und dürsten nach Erfahrung und Einsicht jenseits etablierter Religion und auch jenseits eines engen Verständnisses von Wissenschaft. Zugleich gibt es auch im wissenschaftlichen Feld immer wieder Brückenschläge zu dem, was wir Spiritualität nennen.
WACHHEIT
Aus reiner Herkunft oder aus traditionellen Gründen einer bestimmten Religion anzugehören, ist jedenfalls nicht mehr der Normalfall und auch kaum noch über die Jahrzehnte des Lebens tragfähig. Wir brauchen eine tiefere Verbindung zu der Religion und Spiritualität, der wir uns zugehörig fühlen (möchten), und wir brauchen eine persönliche Verbindung zu der Botschaft und den Quellen, die unsere Spiritualität ausmachen. Kurz: Wir brauchen eine Erfahrung von Resonanz und Betroffenheit. Und das zeichnet „Mystik“ aus. Aber nicht nur sie. Auch moderne Weisheitslehrer:innen, Meditation und die moderne Achtsamkeitspraxis, die ihre Wurzeln in der buddhistischen Tradition hat, arbeiten sehr konkret an unseren Erfahrungen bzw. schaffen Übungsräume, um sich dem Leben innerlich neu zuzuwenden und es damit bewusster zu erfahren. Erstaunlicherweise geht es sowohl in der Mystik als auch in der modernen Achtsamkeitspraxis und westlich-buddhistischen Meditation nicht um außerordentliche oder spektakuläre Erfahrungen. Es werden tatsächlich Erfahrungen nicht bewusst gesucht. Was dagegen gesucht oder besser kultiviert wird, ist Wachheit: Fragt der Schüler: „Was muss ich tun, um erleuchtet zu werden?“– „Du kannst ebenso wenig dafür tun, erleuchtet zu werden, wie du dafür sorgen kannst, dass die Sonne aufgeht.“– „Wofür dann die ganzen Übungen, die du uns vorschreibst?“– „Um sicher zu gehen, dass ihr wach seid, wenn die Sonne aufgeht.“
INTERSPIRITUELLER DIALOG
Es gibt schon lange einen interreligiösen Dialog, gerade zwischen Christentum und Buddhismus. Dieser hat dazu geführt, dass über die letzten Jahrzehnte die Zen-Meditation Einzug gefunden hat in die kirchlichen Bildungshäuser. Bekannte christliche bzw. interreligiöse Lehrer:innen wie Hugo Makibi Enomiya Lassalle SJ, Niklaus Brantschen SJ, Pia Gyger, Willigis Jäger oder Anna Gamma haben dem Dialog zwischen östlicher Spiritualität und christlicher Mystik den Weg bereitet. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Wegbereiter für einen interspirituellen Dialog. Beispielhaft ist hier sicher der Benediktiner Bruder David Steindl-Rast, der auch bei Vertretern der Achtsamkeitspraxis sehr geschätzt wird. Es gibt mittlerweile viele große spirituelle Lehrer:innen, die bei aller Unterschiedlichkeit der Traditionen und Zugänge das Gemeinsame sehen und dieses pflegen, anstatt Unterschiede oder gar Konkurrenz und gegenseitige Diskreditierung.
Ich selbst greife gern auch auf moderne spirituelle Autoren und Autorinnen zurück, die aus anderen spirituellen Traditionen kommen oder sich gar nicht religiös oder mit einer bestimmten spirituellen Richtung identifizieren. Für mich persönlich war und ist v. a. die Lektüre buddhistischer Lehrer:innen eine große Inspiration und Unterstützung, auch wenn meine eigene spirituelle Heimat das christlich-kontemplative Gebet ist und damit eine bleibende Verbindung mit Jesus.
Gerade die Achtsamkeitspraxis, aber auch zeitgenössische und viel beachtete Weisheitslehrer wie Eckhart Tolle verwenden eine säkulare Sprache und lassen religiöse Formen und Institutionen hinter sich, auch wenn sich ihre Lehren und praktischen Impulse aus der Botschaft und der spirituellen Tradition großer Religionen speisen. Ist das aus der Sicht religiöser Frömmigkeit abzulehnen? Ist es adäquat oder auch nur hilfreich, solche Lehren in den kaum fassbaren und oft negativ behafteten Begriff „Esoterik“ wie in eine Schublade zu stecken? Meine eigene, immer wieder überraschende Erfahrung ist, gerade in dieser „Schublade“ Begriffe und Inhalte „meiner“ christlich-spirituellen Herkunft in einem völlig neuen Licht zu sehen. Wenn wir uns nicht mit Schubladen und schnellen Vorurteilen oder in religiöser Engstirnigkeit selbst im Weg stehen, können wir darin auch Perlen entdecken und sogar Schätze aus „unserer eigenen Tradition“ – die in einer anderen Sprache oder in einem anderen Kontext plötzlich wieder neue Bedeutung gewinnen. Vielleicht ist der Auszug so vieler Menschen heute aus den etablierten Kirchen auch ein Hinweis darauf, dass religiöse Formen und Sprache dort an Kraft verloren haben. Und vielleicht liegt darin die Chance, sich neu auf die Suche zu machen nach Erfahrungen und Formen, die uns wirklich betreffen, die uns in der Tiefe erreichen. Für mich war es dabei hilfreich, die althergebrachte Sprache zu verlassen, vor allem eine Sprache, die so klingt, als hätte sie ein Monopol auf Gott oder als könnte sie das Religiöse in gewisser Weise verwalten. Wenn ich heute beginne, wieder vorsichtig von Gott zu sprechen, dann mit dem ständigen Bedürfnis und Versuch, diese Rede für Menschen zu übersetzen, die nicht gern von Gott sprechen oder hören; und mit dem Anliegen, selbst nicht den Eindruck zu erwecken, ich wüsste, wovon ich spreche, wenn ich das Wort „Gott“ in den Mund nehme oder in die Tasten tippe.
JENSEITS EINES BESCHEID-WISSENS
Was mir nach wie vor besonders am Herzen liegt, ist „unsere“ Heilige Schrift, insbesondere die Botschaft Jesu, wie sie in den Evangelien zu finden ist und in Geschichten erzählt wird. Mit ihr und mit Jesus fühle ich mich seit fünfunddreißig Jahren von Herzen verbunden. Dabei kenne ich natürlich unterschiedliche Phasen in dieser Beziehung. Als für mich als junger Erwachsener die Bibel zum ersten Mal echte Bedeutung für meinen Alltag bekam, gab es eine Phase, in der ich sehr religiös war und die Bibel wörtlich genommen habe. Heute bin ich dankbar, diese Enge verlassen zu haben. Göttliche Inspiration, Gottes Wort kann immer nur durch menschliche oder irdische Vermittlung zu uns kommen. Mir wurde klar, dass wir uns nicht anmaßen dürfen, religiös, spirituell oder auch nur hinsichtlich der Bedeutung heiliger Schriften „Bescheid zu wissen“! Abgesehen davon verbauen wir uns die Möglichkeit, den großen Reichtum anderer religiöser, spiritueller, heiliger und profaner Schriften als Quelle der Inspiration zu erfahren.
Während meines Studiums der Theologie konnte ich den Beitrag historisch-kritischer Forschung für ein Verständnis heiliger Schriften kennenlernen. Was für ein großartiges Feld, musste doch auch Jesus – wie alle anderen Propheten – in eine Zeit und in ein bestimmtes kulturelles Umfeld hineinsprechen. Doch wissenschaftliche Forschung allein kann die Botschaft Jesu – wie jede spirituelle Botschaft – für uns heute nicht erfahrbar machen. Sie spricht immer auch ganz individuell und persönlich zu uns. Dafür brauchen wir einen Zugang des Herzens und einen Zugang der Stille. Meine hier vorliegenden Interpretationen erheben keinerlei Anspruch auf „Gültigkeit“ – weder grundsätzlich noch für dich als Leserin oder Leser persönlich. Sie entstammen meiner sehr persönlichen Begegnung mit den Texten, nach vielen Jahren Abstand von einer täglichen Bibellektüre, dafür aber vor dem Hintergrund meiner heutigen spirituellen Praxis und der Lektüre unterschiedlicher zeitgenössischer Autoren und Autorinnen.
Theologen und Theologinnen mögen mir dabei verzeihen, wenn ich hier den aktuellen Forschungsstand nicht abbilden kann; Menschen, die gar nicht mit der Bibel vertraut sind, mögen mir nachsehen, wenn ich manchmal Begriffe verwende, die den Theologen in mir erkennen lassen. Kirchlich fromme Menschen muss ich um Nachsicht bitten, wenn manchmal die Konturen verwischen und die Frage auftaucht, ob ich mich eigentlich noch als Christ bezeichnen kann. Kirchlich entfremdete Menschen bitte ich, meine Verbundenheit mit Jesus und meine Begeisterung für seine Botschaft nicht als Versuch zu werten, sie für das Christentum zu missionieren.
BRÜCKEN SCHLAGEN
Ich habe großen Respekt vor tiefgläubigen und frommen Menschen, wenn sie ihre Religion, ihre heiligen Schriften, ihre Traditionen lieben, ohne sie als allen anderen überlegene oder gar als einzige Wahrheit auszubreiten, die für alle gelten muss.
Mit unseren buddhistischen Geschwistern fühle ich mich sehr verbunden, die so viel Erfahrung mit der Stille haben und die, ohne von Gott zu sprechen, wie alle kontemplativen Traditionen zu einem Frieden beitragen, der wie der Frieden Christi höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen öffnet und den wir so dringend brauchen, um die Krisen dieser Zeit zu bewältigen. Zugleich bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass wir von der Fülle spiritueller Traditionen, die uns heute begegnen, schöpfen können, ohne beliebig werden oder unsere Heimat aufgeben zu müssen. Und darüber hinaus ist es für mich immer wieder spannend zu sehen, wie es Menschen gibt, die unter oft schwierigsten Lebensumständen eine Lebenskunst entfalten, die sich keiner bestimmten spirituellen Form oder religiösen Tradition zuordnen lässt. So liegt es nahe, heute Bücher zu finden wie „Gottlos beten“ des Jesuiten Niklaus Brantschen oder „Säkulare Frömmigkeit“ des katholischen Theologen Hubertus Halbfas. Die kirchlich Beheimateten möchte ich ermutigen, sich nicht von Schubladen und Vorurteilen gegenüber modernen spirituellen Wegen einschränken zu lassen. Unterschätzen wir nicht die bleibende große Sehnsucht der Menschen dahinter und die Spuren tiefer Verbundenheit überall! Authentische Erfahrung und solide Orientierung finden sich immer wieder auch in neuen Formen, diese uralte Verbindung zum Großen Ganzen des Lebens zu pflegen, selbst wenn sie nicht oder anders von Gott sprechen. Den kirchlich Entfremdeten und Verletzten, den Heimatlosen, aber auch denen, die noch kaum Berührung mit der Botschaft Jesu hatten, möchte ich eine Brücke schlagen. Seine Worte und Geschichten sind geschichtlich bedingt und zugleich so zeitlos und modern wie vor 2000 Jahren. Jesu Botschaft dürfen wir immer wieder davor bewahren, vereinnahmt, verengt und verwaltet zu werden. Wir müssen nicht Christen und Christinnen sein, um die Botschaft Jesu zu hören, zu verstehen und ihre Kraft zu erfahren. Mit welch breiter Wirkung Jon Kabat-Zinn beispielsweise die Achtsamkeitspraxis aus einem religiös-buddhistischen Kontext gelöst hat und wie vielen Menschen das heute zugutegekommen ist, bestätigt, was auch prominente buddhistische Mönche wie Thich Nhat Hanh oder der Dalai Lama immer wieder betonen und heute fast schon selbstverständlich klingt: Wir müssen nicht Buddhisten und Buddhistinnen werden, um die Kraft der Meditation zu erfahren. Es zeigt sich heute immer mehr, dass wir nicht in eine andere Religion wechseln müssen, um uns Werkzeuge und Inspiration zu holen. Das spirituelle Erbe der Menschheit steht allen offen. Was nicht bedeuten muss, uns nur oberflächlich eine Patchwork-Spiritualität zusammenzubasteln. Gerade der erwähnte Jon Kabat-Zinn hat sich mit der buddhistischen Tradition tief auseinandergesetzt. Ähnlich tiefen Respekt, ja Liebe zu anderen Traditionen empfinde ich als Christ für die buddhistische Tradition und beginne ich langsam auch für die Poesie und das Wunder des Korans zu spüren.
SPIRITUELLE ETIKETTEN UND HEIMAT
Es ist sicher gut zu wissen, wo wir uns religiös oder spirituell heimisch fühlen (irgendwann oder vielleicht immer wieder neu). Doch werden weder traditionelle religiöse Begriffe noch moderne Formen von Meditation oder Achtsamkeitspraxis diese Heimat je zum Ausdruck bringen können. Selbst wenn wir in einer Religion beheimatet sind, müssen wir uns aus meiner Sicht heute nicht (mehr) mit irgendwelchen religiösen Etiketten identifizieren, um richtig oder gar besser als andere zu sein. Das gilt auch für „moderne“ spirituelle Labels! Es kann auch nicht hilfreich sein, spirituell up-to-date zu sein. Entscheidend ist, dass wir hellwach und verbunden bleiben. Dass wir für die großen Fragen und das Geheimnis des Lebens offen sind und Werkzeuge kennen, die uns helfen, wach und verbunden zu bleiben mit dem Großen Ganzen. Dafür bieten uns unterschiedliche spirituelle Traditionen wunderbare Impulse, die wir für uns prüfen und integrieren können. Achtsamkeit, Weisheit, Mystik und Spiritualität bieten uns Wege, diese Verbindung wieder bewusst aufzunehmen und zu pflegen und uns für all die Angebote zu öffnen, die uns das Leben macht: wunderbare, traurige, freudige, unverhoffte Momente, schwere und leichte.
ERSTER TEIL
EINLASSEN. VON DER KUNST, ANZUKOMMEN
Steig ein, die Fahrt beginnt,
das Karussell dreht sich geschwind,
die Jahre zieh’n vorbei
und trag’n dich fort, mein Kind.
Steig ein, mein Kind, steig ein,
in neue Schläuche neuer Wein.
Lass uns jetzt das Leben feiern,
viel zu schnell sind wir allein.
Lied für meine Tochter Anna-Sumaya
Wenn wir ein Buch lesen, wie gehen wir es an? Wo fangen wir an? Vorne, in der Mitte oder vom Ende her? Wollen wir es schon gelesen haben, bevor wir überhaupt angefangen haben? Wenn auch noch andere Bücher am Schreibtisch oder am Nachttisch liegen, geschenkt, selbst gekauft oder gerade als Paket gekommen, wenn wir die Zeit für die Bücher nicht dazukaufen können, kann sogar das Lesevergnügen noch zum Stress werden.
In diesem ersten Teil wollen wir ankommen in diesem Buch, dort, wo wir gerade sind, auch während wir lesen. Wir lesen und wir wollen nicht nur den Kopf füttern, wir wollen uns spüren.