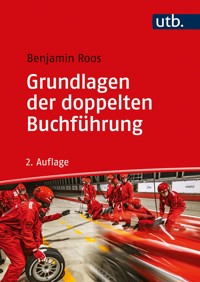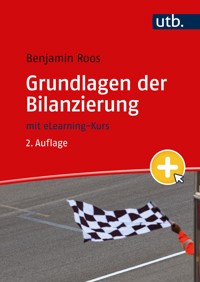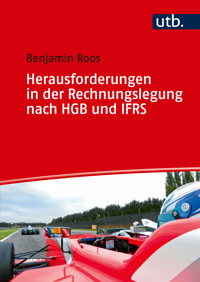
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gegenstand des Lehrbuchs ist die Behandlung komplexer Bilanzierungssachverhalte in der Rechnungslegung nach IFRS und HGB. Hierzu gehören u. a. die Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten, die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften, die anteilsbasierte Vergütung, das Immaterielle Vermögen, Fragestellungen im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben sowie das Thema Eigenkapital. Im Fokus steht dabei das eigentliche Zahlenwerk und nicht die verbalen Erläuterungen hierzu. Die Theorie zu den einzelnen Themengebieten wird um Wiederholungsfragen und Fallstudien (mit Lösungen) ergänzt. Das Buch richtet sich insofern an die Leser:innen, die sich auf dem Gebiet der internationalen Rechnungslegung Spezialwissen aneignen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 6403
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Dipl.-Kfm. Dr. Benjamin Roos ist als Vice President Global Finance bei einem internationalen Konzern tätig. Er besitzt als Fach- und Führungskraft langjährige praktische Erfahrung im externen Rechnungswesen. Daneben publiziert er regelmäßig zu aktuellen Themen der nationalen und internationalen Rechnungslegung.
Benjamin Roos
Herausforderungen in der Rechnungslegung nach IFRS und HGB
Umschlagabbildung: © simonkr · iStockphoto
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564036
© UVK Verlag 2025
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6403
ISBN 978-3-8252-6403-1 (Print)
ISBN 978-3-8463-6403-1 (ePUB)
Für Andrea, Julian, Niklas und Luisa
Vorwort
Das vorliegende Buch befasst sich mit einigen der vielen „Spezialfragen“ im Rahmen der Rechnungslegung sowohl nach IFRS als auch nach HGB. Es erhebt dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, was vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit der Themen auch nicht sachgerecht wäre. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, diese z.T. sehr komplexen Regelungen verständlich aufzubereiten und systematisch darzustellen. Hierzu werden beim Leser fortgeschrittene Buchführungs- und Bilanzierungskenntnisse sowohl nach IFRS als auch nach HGB vorausgesetzt.
Die einzelnen Themengebiete werden in loser Folge aufgegriffen, wobei für viele Themengebiete mehrere Spezialfragen dargestellt werden. Ausgangspunkt ist dabei stets einer der internationalen Rechnungslegungsstandard, der dann in einige seiner Verästelungen heruntergebrochen wird. Im Anschluss an die Darstellung der internationalen Regelungen wird die handelsrechtliche Vorgehensweise skizziert.
Zu diesen Spezialfragen enthält das Buch eine Vielzahl von Beispielen. Die Multiple-Choice-Fragen im Anschluss an die Ausführungen des jeweiligen Kapitels sollen der Überprüfung des Erlernten dienen und für ein besseres Verständnis beim Leser sorgen.
Das vorliegende Buch richtet sich in erster Linie an Studierende von Universitäten, (Dualen) Hochschulen, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien und vergleichbaren Bildungseinrichtungen, aber auch an alle anderen Personen, die ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der internationalen und handelsrechtlichen Rechnungslegung vertiefen möchten.
Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Andrea Roos, die mich während der Erstellungsphase stets unterstützt hat. Zudem möchte ich mich beim UVK-Verlag und speziell bei Herrn Dr. Jürgen Schechler für die wiederholt äußerst gute Zusammenarbeit und die Aufnahme des Lehrbuchs in das Verlagsprogramm bedanken.
Nürnberg, September 2025
Benjamin Roos
Inhaltsübersicht
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten
2Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften
3Anteilsbasierte Vergütung
4Immaterielles Vermögen
5Fragestellungen im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben
6Eigenkapital
Lösungen der Testfragen
Literaturverzeichnis
Index
Inhalt
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten
1.1Finanzinstrumente in der internationalen Rechnungslegung
1.1.1Allgemeines
1.1.1.1Relevante Standards und Anwendungsbereich
1.1.1.2Definition
1.1.2Ansatz und Ausbuchung
1.1.2.1Erstmaliger Ansatz
1.1.2.2Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte
1.1.2.2.1Konzeptionelle Grundlagen
1.1.2.2.2Component approach
1.1.2.2.3Risks and rewards approach
1.1.2.2.4Control approach
1.1.2.2.5Continuing involvement
1.1.2.2.6Gewinne und Verluste aus dem Abgang
1.1.2.2.7Anwendungsfall ‒ Factoring
1.1.2.2.8Abschließendes Beispiel
1.1.2.3Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten
1.1.3Bewertung finanzieller Vermögenswerte
1.1.3.1Überblick
1.1.3.2Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte
1.1.3.3Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet (AC)
1.1.3.3.1Klassifizierung
1.1.3.3.2Zugangsbewertung
1.1.3.3.3Folgebewertung
1.1.3.4Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL)
1.1.3.4.1Klassifizierung
1.1.3.4.2Zugangsbewertung
1.1.3.4.3Folgebewertung
1.1.3.5Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVOCI)
1.1.3.5.1Klassifizierung
1.1.3.5.2Zugangsbewertung
1.1.3.5.3Folgebewertung
1.1.3.6Finanzinstrumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden ohne Recycling in der GuV (FVOCINR)
1.1.3.6.1Klassifizierung
1.1.3.6.2Zugangsbewertung
1.1.3.6.3Folgebewertung
1.1.3.7Fair value option
1.1.4Reklassifizierung finanzieller Vermögenswerte
1.1.5Erfassung von Wertminderungen
1.2Finanzinstrumente in der handelsrechtlichen Rechnungslegung
1.2.1Arten von finanziellen Vermögensgegenständen
1.2.2Finanzanlagen
1.2.2.1Arten von Finanzanlagen
1.2.2.2Ansatz von Finanzanlagen
1.2.2.3Bewertung von Finanzanlagen
1.2.2.3.1Zugangsbewertung
1.2.2.3.2Folgebewertung
1.2.3Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.2.3.1Begriff, Arten und Ausweis der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände
1.2.3.2Zeitpunkt des Ansatzes von Dividendenforderungen
1.2.3.3Bewertung der Forderungen
1.2.3.3.1Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Forderungen
1.2.3.3.2Wertberichtigung von Forderungen
1.2.3.4Sonderfragen
1.2.3.4.1Bewertung von Fremdwährungsforderungen
1.2.3.4.2Bewertung von unverzinslichen und niedrigverzinslichen Forderungen
1.2.4Bilanzierung der Wertpapiere des Umlaufvermögens
1.2.4.1Ausweis der Wertpapiere des Umlaufvermögens
1.2.4.2Ansatz und Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens
2Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften
2.1Sicherungsbeziehungen in der internationalen Rechnungslegung
2.1.1Allgemeines
2.1.2Elemente einer bilanziellen Sicherungsbeziehung
2.1.2.1Gesichertes Grundgeschäft
2.1.2.2Sicherungsinstrument
2.1.2.3Bestimmung von Sicherungsbeziehungen
2.1.2.3.1Kriterien für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
2.1.2.3.2Klassifizierung
2.1.2.3.3Kategorien
2.1.2.3.4Bewertung
2.1.2.3.4.1Fair value hedge
2.1.2.3.4.2Cashflow hedge
2.2Derivative Finanzinstrumente in der handelsrechtlichen Rechnungslegung
2.2.1Begriffsbestimmung
2.2.2Arten von derivativen Finanzinstrumenten
2.2.3Bilanzielle Behandlung von derivativen Finanzinstrumenten
2.2.3.1Ausweis
2.2.3.2Ansatz
2.2.3.3Zugangs- und Folgebewertung
3Anteilsbasierte Vergütung
3.1Hintergrund der Standardregelung
3.2Zielsetzung und Anwendungsbereich von IFRS 2
3.3Bilanzansatz
3.4Bewertung anteilsbasierter Vergütungstransaktionen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (Echte Eigenkapitalinstrumente)
3.5Bilanzierung anteilsbasierter Vergütungen mit Barausgleich (virtuelle Eigenkapitalinstrumente)
3.6Kombinationsmodelle
3.7Steuerabgrenzung
3.8Anteilsbasierte Vergütung in der handelsrechtlichen Rechnungslegung
3.8.1Allgemeines
3.8.2Bilanzielle Behandlung von realen Aktienoptionsplänen
3.8.2.1Ansatz
3.8.2.2Bewertung
3.8.3Bilanzielle Behandlung virtueller Aktienoptionspläne
3.8.3.1Ansatz
3.8.3.2Bewertung
3.8.4Bilanzielle Behandlung von Aktienoptionsplänen auf Basis von Aktienrückkäufen
3.8.5Bilanzielle Behandlung von Aktienoptionsplänen mit Wahlrecht
4Immaterielles Vermögen
4.1Selbst geschaffene Software
4.1.1Bilanzierung nach IFRS
4.1.1.1Allgemeines
4.1.1.2Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase
4.1.1.2.1Ansatzkonzeption für selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte
4.1.1.2.2Forschung
4.1.1.2.2.1Begriff
4.1.1.2.2.2Forschungsphase
4.1.1.2.2.3Forschungsausgaben
4.1.1.2.3Entwicklung
4.1.1.2.3.1Begriff
4.1.1.2.3.2Entwicklungsphase
4.1.1.2.3.3Ausgaben der Entwicklungsphase
4.1.1.2.4Keine Trennung von Forschung und Entwicklung
4.1.1.3Besonderheiten bei eigengenutzter selbst geschaffener Software
4.1.1.4Besonderheiten bei selbst geschaffener Software für Vermarktungszwecke
4.1.2Bilanzierung nach HGB
4.1.2.1Ansatz
4.1.2.2Bewertung
4.1.2.3Besonderheiten bei entgeltlich erworbener Software
4.2Einführung erworbener Software (Rollout-Projekte)
4.2.1Bilanzierung nach IFRS
4.2.1.1Ansatz
4.2.1.2Bewertung
4.2.1.3Behandlung von Rollout-Kosten im Konzernverbund
4.2.2Bilanzierung nach HGB
4.2.2.1Ansatz
4.2.2.2Bewertung
4.2.2.3Behandlung von Rollout-Kosten im Konzernverbund
4.3Bilanzierung von Cloud Computing-Vereinbarungen
4.3.1Bilanzierung nach IFRS
4.3.1.1Grundgedanke des Cloud Computing
4.3.1.2Bilanzielle Einordnung
4.3.1.2.1Allgemeines
4.3.1.2.2IFRS 16 – Leasingverhältnisse
4.3.1.2.3IAS 38 – Immaterielle Vermögenswerte
4.3.1.2.3.1Abgrenzung des Anwendungsbereichs
4.3.1.2.3.2Ansatzvoraussetzung
4.3.1.2.4Konsequenzen für die bilanzielle Abbildung von Cloud-Lösungen zur Nutzungsüberlassung von Softwareprodukten
4.3.1.2.5Bewertung
4.3.2Bilanzierung nach HGB
4.3.2.1Ansatz
4.3.2.2Bewertung
5Fragestellungen im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben
5.1Formen von Unternehmenserwerben
5.1.1Allgemeines
5.1.2Asset Deal
5.1.3Share Deal
5.2Identifizierung des Erwerbszeitpunkts
5.2.1Allgemeines
5.2.2Bestimmung des Erwerbszeitpunkts nach IFRS 3
5.2.2.1Grundvoraussetzungen zur Anwendung von IFRS 3
5.2.2.1.1Unternehmenszusammenschlüsse i.S. des IFRS 3
5.2.2.1.2Beherrschung
5.2.2.2Bestimmung des Erwerbszeitpunkts
5.2.2.3Darstellung möglicher Erwerbszeitpunkte
5.2.2.4Erwerb unter aufschiebender Bedingung
5.2.2.4.1Kartellrechtliche Genehmigungsvorbehalte
5.2.2.4.2Gesellschaftsrechtliche Genehmigungsvorbehalte
5.2.2.5Vordatierung des wirtschaftlichen Übertragungsstichtags
5.2.3Bestimmung des Erwerbszeitpunkts nach HGB
5.2.3.1Maßgebliches Ereignis
5.2.3.2Beherrschender Einfluss i.S. des § 290 HGB
5.2.3.2.1.1Begriff
5.2.3.2.1.2Dauerhafte Bestimmung der Finanz- und Geschäftspolitik
5.2.3.2.1.3Verhältnis von § 290 Abs. 1 zu § 290 Abs.2 HGB
5.2.3.2.1.4Unwiderlegbare Beherrschungstatbestände
5.2.3.3Bestimmung des Erwerbszeitpunkts
5.2.3.4Darstellung möglicher Erwerbszeitpunkte
5.2.3.5Erwerb unter aufschiebender Bedingung
5.2.3.5.1.1Kartellrechtliche Genehmigungsvorbehalte
5.2.3.5.1.2Gesellschaftsrechtliche Vorbehalte
5.2.3.6Vordatierung des wirtschaftlichen Übertragungsstichtags
5.3Umstellung des Geschäftsjahres im Zuge eines Unternehmenserwerbs
5.3.1Abschlussstichtag und Geschäftsjahr nach IFRS
5.3.1.1Allgemeines
5.3.1.2Häufigkeit der Berichterstattung nach IFRS
5.3.2Abschlussstichtag und Geschäftsjahr nach HGB
5.3.2.1Dauer des handelsrechtlichen Geschäftsjahres
5.3.2.2Wechsel des Geschäftsjahres bzw. Abschlussstichtags
5.3.2.3Rumpfgeschäftsjahr
5.3.2.4Konzernabschluss
5.3.2.4.1Stichtag des Konzernabschlusses
5.3.2.4.2Geschäftsjahr der einbezogenen Unternehmen
5.4Gegenleistung eines Unternehmenszusammenschlusses
5.4.1Gegenleistung des Erwerbs nach IFRS
5.4.1.1Übertragene Gegenleistung
5.4.1.2Bedingte Gegenleistung
5.4.1.3Andere Formen von Kaufpreisanpassungen
5.4.1.4Erwerb ohne Übertragung einer Gegenleistung
5.4.2Gegenleistung des Erwerbs nach HGB
5.4.2.1Übertragene Gegenleistung
5.4.2.2Bedingte Gegenleistung
5.5Bewertungszeitraum
5.5.1Allgemeines
5.5.2Bewertungszeitraum nach IFRS
5.5.2.1Änderungen während des Bewertungszeitraums
5.5.2.1.1Retrospektive Anpassung
5.5.2.1.2Anpassungskriterien
5.5.2.1.3Erfolgsneutralität der Anpassungen
5.5.2.2Änderungen nach dem Bewertungszeitraums
5.5.3Bewertungszeitraum nach HGB
5.6Sukzessiver Anteilserwerb
5.6.1Grundlagen
5.6.2Bilanzielle Behandlung nach IFRS
5.6.3Bilanzielle Behandlung nach HGB
5.7Sukzessive Anteilsveräußerung
5.7.1Begriffsabgrenzung
5.7.2Statusändernde Veräußerung
5.7.2.1Behandlung nach IFRS
5.7.2.2Behandlung nach HGB
5.7.3Statuswahrende Veräußerung
5.7.3.1Behandlung nach IFRS
5.7.3.2Behandlung nach HGB
6Eigenkapital
6.1Eigenkapital nach IFRS
6.1.1Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital
6.1.1.1Grundsatz
6.1.1.2Kündbare Instrumente und Genossenschaftsanteile
6.1.1.3Hybride Finanzierungsformen
6.1.1.4Ausweis eigener Anteile
6.1.2Ausstehende Einlagen
6.1.3Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
6.1.3.1Voraussetzungen für die Erfassung von Aktivposten
6.1.3.2Vermögenswerte im Sinne des Conceptual Frameworks
6.1.3.3Ausweis des Eigenkapitals
6.1.3.4Ausweis eines negativen Eigenkapitals
6.2Eigenkapital nach HGB
6.2.1Begriffsdefinition und bilanzieller Charakter
6.2.2Eigene Anteile
6.2.3Ausstehende Einlagen
6.2.4Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Lösungen der Testfragen
Literaturverzeichnis
Index
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1Ausbuchungsablaufschema
Abb. 2Ablaufschema zur Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte nach IFRS 9
Abb. 3Grundstruktur der Wertminderungsvorschriften für finanzielle Vermögenswerte
Abb. 4Identifikation anteilsbasierter Vergütungen
Abb. 5Klassifizierung von Änderungen an bereits installierter Software
Abb. 6Aktivierung selbst geschaffener Software
Abb. 7Behandlung von Installations- und customizing-Ausgaben
Abb. 8Arten von Kaufpreisanpassungen
Abb. 9Bestimmung des Bewertungszeitraums nach IFRS 3
Abb. 10 Prüfungsschema zur Abgrenzung von Eigenkapital und Schulden
Tabellenverzeichnis
Tab. 1Reklassifizierungsvarianten
Tab. 2Zusammenhang zwischen Ansatzkriterium und Entstehungsphase
Tab. 3Bilanzausweis des negativen Eigenkapitals nach IFRS
Tab. 4Bilanzausweis des negativen Eigenkapitals nach HGB – Variante 1
Tab. 5Bilanzausweis des negativen Eigenkapitals nach HGB – Variante 2
Tab. 6Bilanzausweis des negativen Eigenkapitals nach HGB – Variante 3
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
anderer Ansicht
Abs.
Absatz
Afa
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AHK
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
AktG
Aktiengesetz
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
BAnz
Bundesanzeiger
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG
Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz
bspw.
beispielsweise
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CF
Conceptual Framework
c.p.
ceteris paribus
d.h.
das heißt
DRS
Deutsche Rechnungslegungs Standards
DRSC
Deutsches Rechnungslegungs Standard Commitee
DVFA
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V.
EBIT
Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EGHGB
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EStG
Einkommensteuergesetz
etc.
et cetera
EUR
Euro
evtl.
eventuell
f.
folgende
ff.
fortfolgende
Fifo
First in first out
ggf.
gegebenenfalls
GE
Geldeinheiten
GKV
Gesamtkostenverfahren
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH&Co.KG
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
GWG
geringwertige Wirtschaftsgüter
h.M.
herrschende Meinung
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg.
Herausgeber
IAS
International Accounting Standard(s)
IASB
International Accounting Standards Board
IASC
International Accounting Standards Committee
i.d.R.
in der Regel
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.
IFRS
International Financial Reporting Standard(s)
i.H.
in Höhe
inkl.
inklusive
i.R.
im Rahmen
i.S.
im Sinne
i.V.m.
in Verbindung mit
insbes.
insbesondere
kg
Kilogramm
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KoR
Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung
Lifo
Last in first out
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
Nr.
Nummer
o.Ä.
oder Ähnliches
o.g.
oben genannten
OHG
Offene Handelsgesellschaft
p.a.
per anno bzw. per annum
PiR
Praxis der internationalen Rechnungslegung (Zeitschrift)
PublG
Publizitätsgesetz
RBW
Restbuchwert
Rn.
Randnummer
ROI
Return on Investment
S.
Seite
SE
Societas Europaea
sog.
sogenannte/-n/-r/-s
TEUR
Tausend Euro
Tz.
Textziffer
u.a.
unter anderem
u.Ä.
und Ähnliches
UG
Unternehmergesellschaft
UKV
Umsatzkostenverfahren
u.U.
unter Umständen
usw.
und so weiter
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
z.B.
zum Beispiel
ZGE
Zahlungsmittelgenerierende Einheit
z.T.
zum Teil
zzgl.
zuzüglich
1Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten
1.1Finanzinstrumente in der internationalen Rechnungslegung
1.1.1Allgemeines
1.1.1.1Relevante Standards und Anwendungsbereich
IAS 32 und IFRS 9 IFRS 9 beinhaltet grundlegende Bilanzierungs- und Bewertungsregeln für Finanzinstrumente. Der Standard ist allerdings in engem Kontext mit IAS 32 anzuwenden, der komplementär Darstellung und Angaben zu Finanzinstrumenten regelt.
Beide Standards sind grundsätzlich auf alle Finanzinstrumente anzuwenden, allerdings bestehen umfangreiche Kataloge mit Ausnahmen aus dem Anwendungsbereich von IAS 32 und IFRS 9, die nicht deckungsgleich sind. Ziel der Ausnahmen ist es, die Grundregeln der beiden Standards für Bilanzierung und Bewertung sowie Angabe und Darstellung von den Fällen abzugrenzen, in denen abweichende Regeln anderer Standards gelten sollen.1
Weder IAS 32 noch IFRS 9 finden Anwendung auf:2
Anteile an Tochterunternehmen, assoziierte Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen, die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bilanziert werden.3
Finanzinstrumente, die aus Altersversorgungsplänen resultieren und nach IAS 19 bilanziert werden.
Finanzinstrumente, die aus Versicherungsverträgen stammen (ohne darin eingebettete Derivate) und in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen.
Finanzinstrumente, die aus einer ermessensabhängigen Überschussbeteiligung in Versicherungsverträgen resultieren.
Finanzinstrumente oder sonstige Verträge oder Verpflichtungen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 24 fallen.
Die folgenden weiteren Ausschlüsse gelten nur für IFRS 9:
Finanzinstrumente, die aus Leasingverhältnissen stammen und die nach IFRS 16 zu bilanzieren sind.5
Eigenkapitalinstrumente des bilanzierenden Unternehmens (eigene Anteile), einschließlich Options- und Bezugsrechte hierauf.
Termingeschäfte mit Aktionären, welche dazu führen, dass eine Unternehmensakquisition gemäß IFRS 3 stattfinden wird.6
Kreditzusagen, soweit das Unternehmen sie nicht GuV-wirksam zum beizulegenden Zeitwert folgebewerten möchte, sie nicht durch andere Finanzinstrumente erfüllt werden können oder sie keine Zusagen für Kredite mit einem Zins unterhalb des Marktzinssatzes darstellen.7
Erstattungsansprüche und Forderungen, die in Verbindung mit nach IAS 37 bilanzierten Rückstellungssachverhalten stehen.
Finanzielle Rechte und Verpflichtungen aus Verträgen mit Kunden, die in den Anwendungsbereich von IFRS 15 fallen und für dort nicht explizit eine Bilanzierung nach IFRS 9 gefordert wird.
Warenkontrakte Verträge über nichtfinanzielle Posten fallen grundsätzlich nicht in den Regelungsbereich von IFRS 9. Wenn allerdings die Vertragsbedingungen so ausgestaltet sind, dass diese eine Annäherung an Finanzinstrumente erfahren haben, können diese Verträge nach IFRS 9 zu bilanzieren sein. Allerdings ergibt sich nach IFRS 9.2.4 eine Anwendung auf Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nichtfinanziellen Postens, die durch einen Nettoausgleich in bar oder andere Finanzinstrumente oder durch den Tausch von Finanzinstrumente, so als handle es sich bei den Verträgen um Finanzinstrumente, erfüllt werden können. Als Beispiel hierfür können Warenkontrakte in Form klassischer Warenterminkontrakte8 angeführt werden.9
1.1.1.2Definition
Finanzinstrument Nach IAS 32.11 ist ein Finanzinstrument ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt. „Als Finanzinstrument gelten somit alle auf rechtsgeschäftlicher Grundlage stehenden Ansprüche und Verpflichtungen, die unmittelbar oder mittelbar auf den Austausch von Zahlungsströmen gerichtet sind (IAS 32.AG3-IAS32.AG10).“10
Vertrag Gemäß IAS 32.13 bezeichnen die Begriffe „Vertrag“ und „vertraglich“ beziehen sich auf eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien, die normalerweise aufgrund ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit klare, für die einzelnen Vertragsparteien kaum oder gar nicht vermeidbare wirtschaftliche Folgen hat. Verträge und damit Finanzinstrumente können die verschiedensten Formen annehmen und müssen nicht in Schriftform abgefasst sein.
Hinweis
Entscheidend für das Vorliegen eines Finanzinstruments ist, dass die vertragliche Vereinbarung unmittelbar oder mittelbar auf den Erhalt und die Gewährung von Zahlungsmitteln oder Eigenkapitalinstrumenten gerichtet ist. Sofern sich Vermögenswerte oder Schulden aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z.B. Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Steuern, Abgaben oder Sozialleistungen oder gesetzlicher Schadensersatzansprüche) – und damit gerade nicht aus einer vertraglichen Vereinbarung – ergeben, liegen nach IAS 32.AG12 keine Finanzinstrumente vor.11
Finanzieller Vermögenswert Finanzielle Vermögenswerte umfassen nach IAS 32.11
Zahlungsmittel,
ein Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens,
ein vertragliches Rechte darauf, (i) Zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte von einem anderen Unternehmen zu erhalten oder (ii) finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten mit einem anderen Unternehmen zu für das Unternehmen potenziell vorteilhaften Bedingungen zu tauschen, oder
einen Vertrag, der in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wird oder werden kann und bei dem es sich um Folgendes handelt: (i) ein nicht derivatives Finanzinstrument, durch das das Unternehmen verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, eine variable Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens zu erhalten, oder (ii) ein derivatives Finanzinstrument, das nicht durch Austausch eines festen Betrags an Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine feste Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens erfüllt wird oder werden kann.12
Finanzielle Verbindlichkeit Eine finanzielle Verbindlichkeit ist nach IAS 32.11 eine Schuld, und umfasst:
eine vertragliche Verpflichtung, (i) einem anderen Unternehmen Zahlungsmittel oder finanzielle Vermögenswerte zu liefern oder (ii) mit einem anderen Unternehmen finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten zu für das Unternehmen potenziell nachteiligen Bedingungen zu tauschen, oder
einen Vertrag, der in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wird oder werden kann und bei dem es sich um Folgendes handelt: (i) ein nicht derivatives Finanzinstrument, durch das das Unternehmen verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, eine variable Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens zu liefern, oder (ii) ein derivatives Finanzinstrument, das nicht durch Austausch eines festen Betrags an Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine feste Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens erfüllt wird oder werden kann. Rechte, Optionen oder Optionsscheine, die zum Erwerb einer festen Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen, stellen zu diesem Zweck Eigenkapitalinstrumente dar, wenn das Unternehmen sie anteilsgemäß allen gegenwärtigen Inhabern derselben Klasse seiner eigenen nicht derivativen Eigenkapitalinstrumente anbietet. Nicht als Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens gelten zu diesem Zweck hingegen kündbare Finanzinstrumente, die gemäß den Paragraphen 16A und 16B als Eigenkapitalinstrumente eingestuft sind, Instrumente, die das Unternehmen dazu verpflichten, einer anderen Partei im Falle der Liquidation einen proportionalen Anteil an seinem Nettovermögen zu überlassen und die gemäß den Paragraphen 16C und 16D als Eigenkapitalinstrumente eingestuft sind, oder Instrumente, bei denen es sich um Verträge über den künftigen Empfang oder die künftige Lieferung eigener Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens handelt.13
Hinweis
Eine finanzielle Verbindlichkeit entsteht also aus einer Verpflichtung des bilanzierenden Unternehmens, entweder flüssige Mittel an einen externen Vertragspartner zu liefern oder Finanzinstrumente mit diesem zu ungünstigen Bedingungen zu tauschen.14
Eigenkapitalinstrumente Nach IAS 32.11 ist ein Eigenkapitalinstrument ein Vertrag, der einen Residualanspruch an den Vermögenswerten eines Unternehmens nach Abzug aller dazugehörigen Schulden begründet.
Hinweis
Ein Finanzinstrument ist letztlich jede Vertragsform, die ohne Produktions- oder Absatzprozess direkt oder indirekt zum Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln (oder Zahlungsmitteläquivalenten) oder Eigenkapitaltiteln führt. Hierunter fallen sowohl derivative15 als auch originäre bzw. nichtderivative Finanzinstrumente.16
Aufgrund des hohen Abstraktionsgrades der angeführten Definitionen bietet sich eher eine Negativabgrenzung eines Finanzinstruments an. Danach gelten
aktivisch alle Posten, die nicht immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen, Vorratsvermögen, Steueransprüche, Sachleistungsforderungen oder Abgrenzungsposten sind, oder
passivisch alle Posten, die nicht Eigenkapital, Sachleistungsverpflichtungen, Abgrenzungsposten oder Rückstellungen sind, als Finanzinstrument.
Zusammenfassend lassen sich folgende Positiv- sowie Negativbeispiele anführen:17
Positivbeispiele
Kundenforderungen
Anleihen beim Inhaber (aktivisch) bzw. Emittenten (passivisch)
Darlehen beim Darlehensgeber (aktivisch) bzw. beim Darlehensnehmer (passivisch)
Finanzielle Garantien (Bürgschaften usw.) beim Garantiegeber bzw. Garantienehmer
Verbindlichkeiten aus finance leases
Eigenkapitalinstrumente
Negativbeispiele
(Im)materielle Vermögenswerte (IAS 32.AG10)
Abgegrenzte, im Voraus erhaltene bzw. bezahlte Einnahmen bzw. Ausgaben (Auszahlungen), deren Gegenleistung in zukünftigen Güterlieferungen, Dienstleistungen usw. besteht, sowie nicht finanzielle Garantieverpflichtungen (IAS 32.AG11)
Steuern und faktische Verpflichtungen (IAS 32.AG12)
Testfragen zu 1.1.1
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag,
der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt.
der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit und einem Eigenkapitalinstrument führt.
der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen ebenfalls zu einem finanziellen Vermögenswert führt.
Als Finanzinstrument gelten somit alle auf rechtsgeschäftlicher Grundlage stehenden Ansprüche und Verpflichtungen,
die nur mittelbar auf den Austausch von Zahlungsströmen gerichtet sind.
die unmittelbar oder mittelbar auf den Austausch von Vermögenswerten gerichtet sind.
die unmittelbar oder mittelbar auf den Austausch von Zahlungsströmen gerichtet sind.
Grundsätzlich gelten als Finanzinstrument
passivisch alle Posten, die nicht immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen, Vorratsvermögen, Steueransprüche, Sachleistungsforderungen oder Abgrenzungsposten sind, oder aktivisch alle Posten, die nicht Eigenkapital, Sachleistungsverpflichtungen, Abgrenzungsposten oder Rückstellungen sind.
aktivisch alle Posten, die nicht immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen, Vorratsvermögen, Steueransprüche, Sachleistungsforderungen oder Abgrenzungsposten sind, oder passivisch alle Posten, die nicht Eigenkapital, Sachleistungsverpflichtungen, Abgrenzungsposten oder Rückstellungen sind.
aktivisch alle Posten, die immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen, Vorratsvermögen, Steueransprüche, Sachleistungsforderungen oder Abgrenzungsposten sind, oder passivisch alle Posten, die Eigenkapital, Sachleistungsverpflichtungen, Abgrenzungsposten oder Rückstellungen sind.
1.1.2Ansatz und Ausbuchung
1.1.2.1Erstmaliger Ansatz
Vertragsabschluss Nach IFRS 9.3.1.1 hat ein Unternehmen einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Schuld dann anzusetzen, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird, d.h. bei Vertragsabschluss.18 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind bei erstmaligem Ansatz nach den Vorschriften des IFRS 9 zu klassifizieren und zu bewerten. Nach IFRS 9 sind Finanzinstrumente in Abhängigkeit von ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwendungszweck in verschiedene Kategorien zusammenzufassen.
Marktübliche Transaktionen Nach IFRS 9.3.1.2 kann das bilanzierende Unternehmen einen marktüblichen Kauf oder Verkauf finanzieller Vermögenswerte19 entweder zum Handels- oder zum Erfüllungstag20 ansetzen (oder ausbuchen). IFRS 9.A definiert den marktüblichen Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten als Vertrag, der die Lieferung des Vermögenswerts innerhalb eines Zeitraums vorsieht, der üblicherweise durch Vorschriften oder Konventionen des jeweiligen Marktes festgelegt wird. Bei der Divergenz zwischen Handels- und Erfüllungstag stellt sich die Frage, ob dieser Schwebezustand als Finanzderivat zu erfassen ist. Für die marktüblichen Verträge wird dies in IFRS 9.BA4 verneint: die zwischen Handels- und Erfüllungstag entstehende Festpreisverpflichtung erfüllt zwar die Definition eines Derivats, aufgrund der kurzen Dauer der Verpflichtung wird ein solcher Vertrag jedoch nicht als Derivat erfasst.21
Nach IFRS 9.B3.1.3 hat das Unternehmen die gewählte Methode auf alle Käufe oder Verkäufe finanzieller Vermögenswerte anzuwenden, die in gleicher Weise nach IFRS 9 eingestuft sind, d.h. die Entscheidung kann für jede Kategorie separat getroffen werden.
Hinweis
Typisches Beispiel ist der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren an deutschen Wertpapierbörsen, der regelmäßig erst zwei Arbeitstage nach Vertragsabschluss erfüllt wird. Weicht der vereinbarte Zeitraum zwischen Handels- und Erfüllungstag von diesen Marktgewohnheiten ab, liegt kein marktüblicher Kauf oder Verkauf vor, und der Vertrag ist unter den übrigen Voraussetzungen als des IFRS 9 als Derivat zu bilanzieren.22 Allerdings ist nach dem Standard für die Qualifizierung eines Vertrags als marktüblicher Vertrag ein formal eingerichteter Handelsplatz nicht zwingend erforderlich. Als marktüblicher Vorgang ist auch ein Vertrag über den Verkauf von GmbH-Anteilen anzusehen, der innerhalb eines Zeitrahmens abgewickelt wird, der üblicherweise notwendig ist, um dem Erwerber das Eigentum an den Anteilen zu verschaffen.23
Erwerber und Veräußerer des finanziellen Vermögenswerts entscheiden unabhängig voneinander, ob sie entweder zum Handels- oder zum Erfüllungsbetrag bilanzieren. Dieses zeitliche Buchungswahlrecht gilt entsprechend auch für die Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten. Wählt der Veräußerer den Erfüllungstag und der Erwerber den Handelstag, kann die Situation eintreten, dass ein Vermögenswert am Bilanzstichtag noch in der Bilanz des Veräußerers und ebenfalls schon in der Bilanz des Erwerbers erfasst ist.24
Stetigkeitsgebot Die gewählte Methode ist allerdings stetig anzuwenden auf sämtliche Käufe und Verkäufe finanzieller Vermögenswerte, die nach den Vorschriften der IFRS 9.4.1.1 bis IFRS 9.4.1.5 jeweils gleich klassifiziert werden.
Nach IFRS 9.B3.1.4 stellt ein Vertrag, der einen Nettoausgleich für eine Änderung der Vertragswerts – d.h. der Marktwertänderung – vorschreibt oder gestattet, keinen marktüblichen Vertrag dar. Ein solcher Vertrag ist im Zeitraum zwischen Handels- und Erfüllungstag wie ein Derivat zu bilanzieren. Grundsätzlich können somit nur solche Verträge einen marktüblichen Kauf oder Verkauf darstellen, die zwingend zu erfüllen sind, d.h. bei denen die vertraglich vereinbarte Menge an Wertpapieren zu liefern ist und auch tatsächlich geliefert wird.25
Die Unterschiede bei der Bilanzierung eines marktüblichen Kaufs zum Handels- und zum Erfüllungstag werden anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht:26
Beispiel
Die XY AG erstellt seine Jahres- und Quartalszwischenberichte nach IFRS. Am 30.03.X0 schließt die XYAG einen Vertrag zum Kauf von 200 Aktien zum beizulegenden Zeitwert (Börsenkurs) von je 42,50 EUR, also insgesamt 8.500 EUR. Während der Börsenkurs am 31.03.X0 bei 50 EUR pro Aktie notiert, liegt er im Zeitpunkt der Depotgutschrift – d.h. bei der „Lieferung“ der Aktien – am 01.04.X0 bei 48 EUR. Annahmegemäß wird die XY AG die Aktien gemäß IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert bilanzieren und die Wertänderungen erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfassen.
Alternative 1 – Bilanzierung zum Handelstag
Am 30.03.X0 werden die Aktien und die Kaufpreisverbindlichkeit mit einem Buchwert von je 8.500 EUR eingebucht. Da der Börsenkurs am 31.03.X0 um 7,50 EUR je Aktie gestiegen ist, wird an diesem Tag ein Gewinn i.H. von 1.500 EUR erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst. Der Buchwert der Aktien erhöht sich entsprechend auf 10.000 EUR.
Am 01.04.X3 werden die Aktien auf dem Depot gutgeschrieben, was jedoch keine Buchung auslöst. Die Kaufpreisverbindlichkeit wird beglichen. Des weiteren ändert sich an diesem Tag der Buchwert der Aktien erneut, da der Börsenkurs um 2 EUR je Aktie, d.h. insgesamt um 400 EUR gesunken ist. Der neue Buchwert der Aktien beträgt folglich 9.600 EUR, der hieraus resultierende Verlust wird erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst.
Unter Vernachlässigung latenter Steuern ergeben sich folgende Buchungssätze:
Alternative 2 – Bilanzierung zum Erfüllungstag
Am 30.03.X0 erfolgt keine Buchung. Am 31.03.X0 wird für den erfolgten Anstieg des Börsenkurses ein finanzieller Vermögenswert – z.B. eine Forderung – i.H. von 1.500 EUR ausgewiesen, die Gegenbuchung erfolgt ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis. Am 01.04.X0 kommt es zur Erfüllung des schwebenden Geschäfts und die Aktien und die Kaufpreisverbindlichkeit werden erstmalig bilanziert. Die Aktien werden zum beizulegenden Zeitwert von 9.600 EUR eingebucht, die Kaufpreisverbindlichkeit i.H. von 8.500 EUR wird beglichen. Der finanzielle Vermögenswert i.H. von 1.500 EUR wird ausgebucht. Die Differenz von 400 EUR resultiert aus dem am 01.04.X0 eingetretenen Rückgang des Börsenkurses auf 9.600 EUR und wird ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis erfasst.
Unter Vernachlässigung latenter Steuern ergeben sich folgende Buchungssätze:
Hinweis
Die Relevanz des Wahlrechts liegt auf der Ansatzebene. Bei der Bilanzierung zum Handelstag wird der Vermögenswert schon früher erfasst als bei der Bilanzierung zum Erfüllungstag.27
Testfragen zu 1.1.2.1
Wie definiert IFRS 9.4 den marktüblichen Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten?
IFRS 9.A definiert den marktüblichen Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten als Vertrag, der die Lieferung des Vermögenswerts innerhalb eines Zeitraums vorsieht, der üblicherweise durch Vorschriften oder Konventionen des jeweiligen Marktes festgelegt wird.
IFRS 9.A definiert den marktüblichen Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten als schwebendes Geschäft, welches die Lieferung des Vermögenswerts innerhalb eines Zeitraums vorsieht, der üblicherweise durch Vorschriften oder Konventionen des jeweiligen Marktes festgelegt wird.
IFRS 9.A definiert den marktüblichen Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten als Vertrag, der die Lieferung des Vermögenswerts innerhalb eines Zeitraums vorsieht, für den üblicherweise die Vorschriften oder Konventionen des jeweiligen Marktes nicht relevant sind.
Welche Aussage ist bzw. welche Aussagen sind zutreffend?
Erwerber und Veräußerer des finanziellen Vermögenswerts entscheiden unabhängig voneinander, ob sie entweder zum Handels- oder zum Erfüllungsbetrag bilanzieren.
Erwerber und Veräußerer des finanziellen Vermögenswerts entscheiden nur abhängig voneinander, ob sie entweder zum Handels- oder zum Erfüllungsbetrag bilanzieren.
Wählt der Veräußerer den Erfüllungstag und der Erwerber den Handelstag, kann die Situation eintreten, dass ein Vermögenswert am Bilanzstichtag noch in der Bilanz des Veräußerers und ebenfalls schon in der Bilanz des Erwerbers erfasst ist.
Welche Aussage ist bzw. welche Aussagen sind zutreffend?
Ein Vertrag, der einen Nettoausgleich für eine Änderung der Vertragswerts – d.h. der Marktwertänderung – vorschreibt oder gestattet, stellt keinen marktüblichen Vertrag dar.
Ein Vertrag, der keinen Nettoausgleich gestattet, ist im Zeitraum zwischen Handels- und Erfüllungstag wie ein Derivat zu bilanzieren.
Grundsätzlich können nur solche Verträge einen marktüblichen Kauf oder Verkauf darstellen, die zwingend zu erfüllen sind, d.h. bei denen die vertraglich vereinbarte Menge an Wertpapieren zu liefern ist und auch tatsächlich geliefert wird.
1.1.2.2Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte
1.1.2.2.1Konzeptionelle Grundlagen
Ausbuchungskriterien Den Ausbuchungs- bzw. Abgangskriterien für einen finanziellen Vermögenswert liegen die Regelungen des IFRS 9.3.2.1ff. zugrunde. Die Kriterien müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern ergeben sich aus einem in IFRS 9.B3.2.1 enthaltenen Entscheidungsbaum. Dieser veranschaulicht, ob und in welchem Umfang ein finanzieller Vermögenswert ausgebucht wird:
Abb. 1: Ausbuchungsablaufschema
Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten:28
Die Höhe des Abgangs hat sich daran zu orientieren, ob der gesamte Vermögenswert oder nur ein Teil die Kriterien erfüllt (component approach).
Finanzielle Vermögenswerte sind nur dann auszubuchen, wenn das Unternehmen nahezu keine Risiken und Chancen aus diesem Vermögenswert zurückbehält (risks and rewards approach).
Ist nicht eindeutig feststellbar, ob das Unternehmen im Wesentlichen alle Risiken und Chancen zurückbehalten hat, ist darauf abzustellen, ob es noch die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert innehat (control approach).
Sofern ein anhaltendes Engagement besteht, hat eine Bilanzierung in Höhe des verbleibenden Risikopotenzials zu erfolgen (continuing involvement).
1.1.2.2.2Component approach
Umfang einer Ausbuchung Die Prüfung der Ausbuchungs- bzw. Abgangskriterien beginnt mit der Beantwortung der Frage, ob die Ausbuchung für den gesamten Vermögenswert bzw. eine Gruppe ähnlicher Vermögenswerte vorgenommen werden soll oder nur für einen Teil davon. Die anteilige Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts setzt zunächst voraus, dass sich der abgegangene Teil eindeutig bestimmen lässt. Bei der vollständigen Begleichung einer Forderung durch einen Schuldner oder dem Verkauf eines Finanzinstruments ist der Tatbestand der Ausbuchung klar gegeben.29
Ausbuchungsvoraussetzungen IFRS 9.3.2.2(a) nennt drei verschiedene Voraussetzungen, von denen eine erfüllt sein muss, wenn die Ausbuchung nur für einen Teil eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte vorliegen soll:30
(i)Der Teil enthält nur speziell abgegrenzte Zahlungsströme aus einem finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).31
(ii)Der Teil umfasst lediglich einen exakt proportionalen (pro rata) Anteil an den Zahlungsströmen aus einen finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).32
(iii)Der Teil umfasst lediglich einen exakt proportionalen (pro rata) Anteil an speziell abgegrenzten Zahlungsströmen aus einem finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).33
In den drei beschriebenen Fällen lassen sich die Ansprüche auf die Zahlungsströme, die veräußert bzw. behalten wurden, klar voneinander abgrenzen.34 In allen anderen Fällen sind nach IFRS 9.3.2.2(b) die Ausbuchungsregelung des IFRS 9.3.2.3-3.2.9 auf den finanziellen Vermögenswert (oder auf die Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte) insgesamt anzuwenden.35
Testfragen zu 1.1.2.2
Welche Aussage ist bzw. welche Aussagen im Zusammenhang mit der Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte sind zutreffend?
Die Höhe des Abgangs muss sich nicht daran zu orientieren, ob der gesamte Vermögenswert oder nur ein Teil die Kriterien erfüllt.
Finanzielle Vermögenswerte sind nur dann auszubuchen, wenn das Unternehmen nahezu keine Risiken und Chancen aus diesem Vermögenswert zurückbehält.
Sofern ein anhaltendes Engagement besteht, hat eine Bilanzierung in Höhe des verbleibenden Risikopotenzials zu erfolgen.
Was ist Grundvoraussetzung für die anteilige Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts?
Die anteilige Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts setzt zunächst voraus, dass sich der abgegangene Teil eindeutig bestimmen lässt, was bei der vollständigen Begleichung einer Forderung durch einen Schuldner oder dem Verkauf eines Finanzinstruments nicht erfüllt ist.
Die anteilige Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts setzt zunächst voraus, dass sich der abgegangene Teil eindeutig bestimmen lässt, was bei der vollständigen Begleichung einer Forderung durch einen Schuldner oder dem Verkauf eines Finanzinstruments erfüllt ist.
Die anteilige Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts setzt zunächst voraus, dass sich der verbleibende Teil eindeutig bestimmen lässt, was bei der teilweisen Begleichung einer Forderung durch einen Schuldner oder dem Verkauf eines Finanzinstruments nicht erfüllt ist.
Welche ist keine Voraussetzungen nach IFRS 9.3.2.2(a) für die Ausbuchung nur für einen Teil eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte?
Der Teil umfasst lediglich einen exakt proportionalen (pro rata) Anteil an den Zahlungsströmen aus einem finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).
Der Teil enthält nur speziell abgegrenzte Zahlungsströme aus einem finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).
Der Teil umfasst lediglich einen exakt proportionalen (pro rata) Anteil an nicht speziell abgegrenzten Zahlungsströmen aus einem finanziellen Vermögenswert (oder einer Gruppe ähnlicher finanzieller Vermögenswerte).
1.1.2.2.3Risks and rewards approach
Übergang von Risiken und Chancen Entscheidend für eine Ausbuchung ist gemäß dem risks and rewards approach, dass mit der Übertragung des finanziellen Vermögenswerts alle wirtschaftlichen Risiken und Chancen auf den Erwerber übergegangen sind. Unter den Chancen sind die Möglichkeiten einer Realisierung von Wertsteigerungen, aber auch Zahlungsansprüche (z.B. Dividenden) zu verstehen. Risiken resultieren aus einem finanziellen Vermögenswert hauptsächlich aus möglichen Wertminderungen oder Zahlungsausfällen.36
Nach IFRS 9.3.2.4 überträgt ein Unternehmen einen finanziellen Vermögenswert nur dann, wenn es entweder
sein vertragliches Anrecht auf den Bezug von Zahlungsströmen aus dem finanziellen Vermögenswert überträgt oder
sein vertragliches Anrecht auf den Bezug von Zahlungsströmen aus dem finanziellen Vermögenswert zwar behält, sich im Rahmen einer Vereinbarung, die die Bedingung von IFRS 9.3.2.5 erfüllt, aber vertraglich zur Zahlung der entsprechenden Beträge an einen oder mehrere Empfänger verpflichtet.
Hinweis
Eine Übertragung der vertraglichen Rechte auf den cash flow ist hiernach Grundvoraussetzung für die Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts. Fehlt es an ihr, führt auch die Übertragung aller Risiken und Chancen nicht zur Ausbuchung.37
Barwerte prognostizierter Zahlungsströme Für die Beurteilung, inwieweit Risiken und Chancen übertragen wurden, besteht eine sachgerechte Methode z.B. darin, für verschiedene Umweltzustände die Barwerte der prognostizierten Zahlungsströme aus Forderungen zu bestimmen und mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zu belegen. Da die Verhältnisse am Tag des Vertragsabschlusses relevant sind, müssen auf historischen Daten basierende Eintrittswahrscheinlichkeiten ggf. an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst werden. Die Abweichung der Barwerte der Zahlungsströme der einzelnen Umweltzustände vom Erwartungswert könnte ein Maß für die Risiken und Chancen der Forderungen sein. Für die gleichen Umweltzustände sind anschließend die Barwerte der beim Übertragenden verbliebenen Zahlungsströme aus den Forderungen nach erfolgter Übertragung zu prognostizieren und deren Abweichung vom Erwartungswert zu ermitteln. Wenn sich die Abweichungen der Zahlungsströme vom jeweiligen Erwartungswert vor und nach der Übertragung nicht nur unwesentlich verringert haben, sind nicht im Wesentlichen alle Risiken und Chancen beim Übertragenden verblieben.38
Rechtsgeschäft Wie bereits dargestellt, erfolgt die Übertragung nach IFRS 9.3.2.4(a) durch ein Rechtsgeschäft, durch das die vertraglichen Rechte auf die Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auf den Erwerber übergehen. In der Praxis gibt es häufig Zweifelsfragen, ob mit der Übertragung des finanziellen Vermögenswerts auch tatsächlich alle wirtschaftlichen Risiken und Chancen auf den Erwerber übergegangen sind. IFRS 9.3.2.6 bis IFRS 9.3.2.8 konkretisiert für den risks and rewards approach Kriterien für die Beurteilung des Übergangs von Risiken und Chancen.
Überträgt ein Unternehmen einen finanziellen Vermögenswert nach IFRS 9.3.2.4, so hat es nach IFRS 9.3.2.6 zu beurteilen, in welchem Umfang die mit dem Eigentum dieses Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen bei ihm verbleiben.
Vergleich der Nettoposition Hierfür ist nach IFRS 9.3.2.7 die Risikoposition des Unternehmens vor und nach der Übertragung mit Veränderungen bei Höhe und Eintrittszeitpunkt der Netto-Zahlungsströme aus dem übertragenen Vermögenswert zu vergleichen.
Hinweis
Bei der Übertragung von Risiken und Chancen ist die Variabilität von Höhe und zeitlichem Anfall der Netto-Zahlungsströme aus dem übertragenen Vermögenswert zu beachten. Für die Beurteilung, ob eine Übertragung von Risiken und Chancen erfolgt ist, sind nur solche Risiken und Chancen relevant, die sich auf die Variabilität der Zahlungsströme aus dem übertragenen Vermögenswert auswirken.39
Schwankungen des Barwerts Ein Unternehmen hat danach im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines finanziellen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen behalten, wenn sich seine Anfälligkeit für Schwankungen des Barwerts der zukünftigen Netto-Zahlungsströme durch die Übertragung nicht wesentlich verändert hat.40 Im Umkehrschluss daraus folgt, dass ein Unternehmen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines finanziellen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat, wenn seine Anfälligkeit für derartigen Schwankungen im Vergleich zur gesamten Schwankungsbreite des Barwerts der mit dem finanziellen Vermögenswert verbundenen künftigen Netto-Zahlungsströme nicht mehr signifikant ist.41
Grundsätzlich gilt also es zu beurteilen, ob sich die Schwankungsrisiken des Barwerts der erwarteten Einnahmen vor und nach dem Transfer wesentlich unterscheiden:42
Bei Wertpapieren (Eigenkapitalinstrumenten) besteht das relevante Risiko in der Kursschwankung. Eine Risikoübertragung hat daher nicht stattgefunden, wenn i.R.e. echten Pensionsgeschäfts ein Rückkauf zu einem bei der Veräußerung bereits festgelegten Preis vereinbart ist. Der Erwerber trägt dann kein Kursschwankungsrisiko. Dieses verbleibt vielmehr beim Veräußerer, der seine Position am Rückerwerbstag nicht durch sofortige Weiterveräußerung glattstellen kann.43
Bei Forderungen (Fremdkapitalinstrumenten) besteht das relevante Risiko im Zahlungsverzug bzw. Ausfall. Folglich hat eine Risikoübertragung regelmäßig nicht stattgefunden, wenn dieses Risiko beim Veräußerer verbleibt.44
In die Beurteilung sind nur Risiken und Chancen einzubeziehen, die unmittelbar mit dem finanziellen Vermögenswert verbunden sind. Erfolgt eine Übertragung an eine (nicht konsolidierungspflichtige) strukturierte Einheit, bleibt die der strukturierten Einheit zuzurechnende Variabilität, die nur für die Beurteilung der Konsolidierungspflicht Relevanz hat, unbeachtlich.
Ausbuchung von Forderungen Werden Forderungen übertragen, ist nicht ausschließlich auf das Risiko des Ausfalls abzustellen. In den anzustellenden Vorher-Nachher-Vergleich sind sämtliche Einflüsse einzubeziehen, die zu einer Variabilität der erwarteten Zahlungsströme führen können. Neben dem Risiko eines Ausfalls sind daher noch beachtlich das Risiko
einer verspäteten Zahlung, wenn kein marktgerechter Zinsausgleich oder eine Fälligkeitsentschädigung vereinbart ist, und
einer Zinsänderung, wenn variable Zinsen oder Zinskonversionszeitpunkte vereinbart sind.
Besondere Relevanz hat das Spätzahlerrisiko (late-payment-risk), also die Begleichung einer Forderung erst nach deren Fälligkeit.
Beispiel45
Ein Forderungsportfolio wird unter Berücksichtigung eines festen Kaufpreisabschlags für zu erwartende Ausfälle verkauft. Der Verkäufer behält kein Ausfallrisiko zurück. Auf den Kaufpreis zahlt der Verkäufer aber Zinsen i.H. des variablen Basiswerts zuzüglich einer Marge ausgehend vom Fälligkeitszeitpunkt der übertragenen Forderungen bis zur Weiterleitung der Zahlungseingänge aus den Forderungen, max. bis zum Eintritt des Delkrederefalls46 (im Vertrag definiert als 90 Tage nach Fälligkeit). Nach bisherigen Erfahrungen fallen alle Forderungen, die nicht innerhalb von 90 Tagen nach Fälligkeit beglichen sind, auch aus.
Lösung
Das Ausfallrisiko wurde vorliegend zwar übertragen, der Verkäufer behält aber aufgrund der vereinbarten Zinszahlungen das Spätzahlerrisiko zurück. Das zurückbehaltene Risiko bestimmt sich (maximal) in Höhe der garantierten Zinszahlungen.
Veritätsrisiko Der Rückbehalt des Veritätsrisikos47 zeitigt für die Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte keine Relevanz. Entsprechendes gilt für einen vereinbarten Ausgleich, den das übertragende Unternehmen für mögliche Rabatte/Nachlässe auf einen übertragenen finanziellen Vermögenswert leisten muss.
Beispiel48
Ein Unternehmen will ein Portfolio von Forderungen aus Kundenverträgen übertragen. Zur Intensivierung der bestehenden Kundenbeziehungen gewährt das Unternehmen auf ausstehende Forderungen nachträgliche Rabatte, wenn bestimmte (Mindest-)Mengen an Produkten/Dienstleistungen seitens eines Kunden bezogen wurden. Der Kunde hat das Recht, den nachträglichen Rabatt mit bestehenden Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen aufzurechnen. Für die geplante Übertragung des Forderungsportfolios will das Unternehmen das Risiko eines nachträglichen Rabatts nicht übertragen, also vom Käufer des Portfolios die bestehenden Forderungen zum Nominalwert vergütet haben. Im Gegenzug steht das Unternehmen für die Reduzierung der Zahlungen auf die übertragenen Vermögenswerte ein.
Lösung
Das Risiko einer evtl. durch das Unternehmen zu leistenden Ausgleichszahlung bleibt bei der Beurteilung der Ausbuchung in der ökonomischen Beurteilung unbeachtlich.
Aktueller Marktzinssatz Sofern es nicht offensichtlich ist, inwiefern ein Unternehmen im Wesentlichen alle Risiken und Chancen übertragen oder behalten hat, wird es nach IFRS 9.3.2.8 notwendig, die Anfälligkeit des Unternehmens für Schwankungen des Barwerts der künftigen Netto-Zahlungsströme vor und nach der Übertragung zu berechnen und zu vergleichen. Zur Berechnung und zum Vergleich wird ein angemessener aktueller Marktzinssatz als Abzinsungssatz benutzt. Jede angemessenerweise für möglich gehaltene Schwankung der Netto-Zahlungsströme wird berücksichtigt, wobei den Ergebnissen mit einer größeren Eintrittswahrscheinlichkeit größeres Gewicht beigemessen wird.
Änderung der Risikoposition Hat sich die Risikoposition nicht signifikant geändert, liegt nach IFRS 9.3.2.6(b) kein Abgang vor, da das übertragende Unternehmen weiterhin die wesentlichen Risiken und Chancen trägt. Ergibt sich aus der Überprüfung allerdings, dass die mit dem finanziellen Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übergegangen sind, ist dieser gemäß IFRS 9.3.2.6(a) auszubuchen und alle bei dieser Übertragung entstandenen oder behaltenen Rechte und Verpflichtungen gesondert als Vermögenswert oder Verbindlichkeit anzusetzen.
IFRS 9.3.2.7 enthält allerdings keine konkreten Vorgaben, wann die Risiken und Chancen im Wesentlichen übergegangen sind.49
Qualitative Beurteilung Grundsätzlich hat die Beurteilung der Risiken und Chancen vorrangig qualitativ zu erfolgen.50 Kann auf dieser Basis eine eindeutige Entscheidung getroffen werden, ist eine Berechnung der Verteilung der Risiken und Chancen nicht vorzunehmen.51 In den folgenden Fällen verbleiben die Risiken und Chancen gemäß IFRS 9.B3.2.5 bereits qualitativ beim Veräußerer:
ein Verkauf, kombiniert mit einem Rückkauf, bei dem der Rückkaufpreis festgelegt ist oder dem Verkaufspreis zuzüglich einer Verzinsung entspricht,
eine Wertpapierleihe,
ein Verkauf eines finanziellen Vermögenswerts, gekoppelt mit einem total return swap, bei dem das Marktrisiko auf das Unternehmen zurückübertragen wird,
ein Verkauf eines finanziellen Vermögenswerts in Kombination mit einer Verkaufs- oder Kaufoption, die weit im Geld ist (d.h. einer Option, die so weit im Geld ist, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie vor Fälligkeit aus dem Geld sein wird), und
ein Verkauf kurzfristiger Forderungen, bei dem das Unternehmen eine Garantie auf Entschädigung des Empfängers für wahrscheinlich eintretende Kreditverluste übernimmt.
Quantitative Beurteilung In komplexeren Fällen ist eine quantitative Analyse (Risikorechnung) zwingend erforderlich. Wird eine quantitative Beurteilung angestellt, sind für verschiedene denkbare, zukünftige (Umwelt-)Zustände die Zahlungsströme eines finanziellen Vermögenswerts zu schätzen und die einzelnen Zustände mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zu belegen.
Beispiel52
Unternehmen A überträgt ein Forderungsportfolio mit einem Nominalbetrag von 1.000.000 EUR an eine nicht zu konsolidierende Gesellschaft B. Die erwarteten Zahlungseingänge, Eintrittswahrscheinlichkeit und der sich daraus ergebende Erwartungswert stellen sich wie folgt dar:
Es ergibt sich demnach für die Standardabweichung als Risikomaß ein Wert von 7.782. Für die Ausbuchung ist relevant, in welchem Umfang Risiken und Chancen nach der Übertragung bei A verbleiben. Verlangt B eine Ausfallgarantie (variabler Kaufpreisabschlag, credit enhancement) von 40.000 EUR, stellt sich die Situation bei A wie folgt dar:
Lösung
Hinweis
Das Beispiel zeigt den Fall, dass im Wesentlichen alle Risiken und Chancen aus den übertragenen Vermögenswerten weder vom Übertragenden zurückbehalten noch auf den Erwerber übertragen wurden, d.h. es erfolgte eine Risikoaufteilung53. Für die Bilanzierung beim Übertragenden ist dann entscheidend, ob die Verfügungsmacht auf den Erwerber überging. Schon kleine Variationen in der Vereinbarung, Schätzungsänderungen bei den Eintrittswahrscheinlichkeiten oder die Verwendung eines anderen Risikomaßes können allerdings dazu führen, dass sich die Situation anders darstellt.54
Monte-Carlo-Simulation Aus Konsistenzgründen sind bei der quantitativen Beurteilung die gleichen Erwartungen heranzuziehen, die auch für die Bestimmung eines expected credit loss verwendet werden. U.U. kann es erforderlich sein, die denkbaren künftigen Szenarien durch eine Simulationsrechnung – etwa durch eine Monte-Carlo-Simulation – zu bestimmen. Die Erwartungen sind zu jedem Stichtag zu aktualisieren.55
90%-Kriterium Wie bereits erwähnt, fehlt es innerhalb Standards an einer spezifischen Vorgaben des Schwellenwerts für die Beurteilung der oder des Rückbehalts der wesentlichen Risiken und Chancen. Für die quantitative Beurteilung ist der Begriff substantially all nach h.M. mit einem Schwellenwert von 90% oder mehr auszulegen.56
Hinweis
Im Umkehrschluss werden im Wesentlichen alle Risiken und Chancen zurückbehalten, wenn nicht mehr als 10% übertragen wurden. Zwischen 10% und 90% liegt folglich eine Risikoaufteilung vor, d.h. im Wesentlichen alle Risiken und Chancen werden dann weder übertragen noch zurückbehalten. In Fällen mangelnder Trennschärfe wird teilweise auch eine Grenze von 85% für zulässig erachtet.57
Für den erforderlichen Vorher-Nachher-Vergleich kann als Risikomaß einer quantitativen Beurteilung z.B. die Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten positiven und negativen Abweichungen vom Erwartungswert oder die Standardabweichung gewählt werden.58
Beispiel59
Ein Forderungsportfolio von nominal TEUR 1.000 wird verkauft. Der Verkäufer trägt nur die ersten 3,5% möglicher Ausfälle. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit sind Geldeingänge von 1.000 und 950 TEUR mit je 5% wahrscheinlich und ein Geldeingang von 970 TEUR mit 90%.
Lösung
Der Vorher-Nachher-Vergleich im Wege der wahrscheinlichkeitsgewichteten Abweichung fällt wie folgt aus (in TEUR):
Damit verbleiben so gut wie alle realistischen Risiken beim Forderungsverkäufer. Eine (Teil-)Ausbuchung der Forderungen kommt nicht infrage.
Mangels der Vorgabe einer konkreten Methode für die quantitative Beurteilung der Verteilung von Risiken und Chancen besteht eine Wahlmöglichkeit (faktisches Wahlrecht). Eine als accounting policy festgelegte Methode ist stetig anzuwenden. Der Vorrang der qualitativen Beurteilung schränkt die Möglichkeit einer „hingerechneten“ Übertragung der wesentlichen Risiken und Chancen ein.60
Versicherte Forderungen Besondere Probleme bereitet der Vorher-Nachher-Vergleich bei versicherten Forderungen:
Beispiel61
U hat Forderungen aus Exportgeschäften, die zu 80% durch eine Ausfallgarantie von H gedeckt sind. U verkauft die so gesicherten Forderungen an eine Bank. H erteilt die Zustimmung zum Verkauf. Ein Forderungsausfall geht nach der Abtretung zu 80% zulasten der Bank, die sich aber insoweit an H wenden kann, und zu 20% zulasten des U.
Lösung
Durch den Forderungsverkauf hat sich an der Risikosituation von U (vorher und nachher max. 20% des Forderungsausfallsrisikos) nichts geändert. Fraglich ist, ob bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen trotzdem ein Forderungsabgang vorliegt.
Zusammenfassend bleibt folgendes festzuhalten: Geht ein Vermögenswert unter Übertragung so gut wie aller relevanten Risiken und Chancen auf ein anderes Unternehmen über, so führt dies gemäß IFRS 9.3.2.6(a) zu dessen Ausbuchung, wobei „so gut wie alle“ nach h.M. quantitativ als 90% oder mehr interpretiert werden kann. Eine Übertragung unter Rückbehalt so gut wie aller relevanten Risiken und Chancen verhindert hiernach folglich den Abgang des Vermögenswerts. Ein ggf. bereits erhaltener Kaufpreis ist nach IFRS 9.3.2.18 als finanzielle Verbindlichkeit zu passivieren, der Vorgang wie eine besicherte Darlehensaufnahme zu behandeln.
Geteilte Risiken und Chancen Wenn ein Unternehmen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum des finanziellen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen weder überträgt noch zurückbehält, hat es nach IFRS 9.3.2.6(c) zu bestimmen, ob es die Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert behalten hat. In diesem Fall gilt:
(i)Wenn es die Verfügungsmacht nicht behalten hat, ist der finanzielle Vermögenswert auszubuchen und es sind alle bei dieser Übertragung entstandenen oder behaltenen Rechte und Verpflichtung gesondert als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten anzusetzen.
(ii)Wenn es die Verfügungsmacht behalten hat, ist der finanzielle Vermögenswert nach Maßgabe seines anhaltenden Engagements (continuing involvement) weiter zu erfassen.
Eine derartige Risikoteilung – es werden also mehr 10%, aber weniger als 90% der Risiken und Chancen übertragen – macht eine weitere Differenzierung erforderlich. Primär ist letztlich zu prüfen, ob das weiterhin in einen Teil des Risikos involvierte Unternehmen die Kontrolle über den Vermögenswert aufgegeben hat.62
Testfragen zu 1.1.2.2.3
Was ist für eine Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswertes gemäß dem risks and rewards approach entscheidend?
Danach ist entscheidend, dass mit der Übertragung des finanziellen Vermögenswerts alle wirtschaftlichen Risiken und Chancen beim Veräußerer verbleiben.
Danach ist entscheidend, dass mit der Übertragung des finanziellen Vermögenswerts alle wirtschaftlichen Risiken und Chancen auf den Erwerber übergegangen sind.
Danach ist entscheidend, dass mit der Übertragung des finanziellen Vermögenswerts mindestens die Hälfte der wirtschaftlichen Risiken und Chancen auf den Erwerber übergegangen sind.
Welche Aussage(n) im Zusammenhang mit der Ausbuchung von Forderungen ist (sind) zutreffend?
Werden Forderungen übertragen, ist ausschließlich auf das Risiko des Ausfalls abzustellen.
Neben dem Risiko eines Ausfalls ist u.a. noch beachtlich das Risiko einer verspäteten Zahlung.
Werden Forderungen übertragen, ist nicht ausschließlich auf das Risiko des Ausfalls abzustellen.
Welche Aussage(n) im Zusammenhang mit der Ausbuchung von Forderungen ist (sind) zutreffend?
Kann auf qualitativer Basis eine eindeutige Entscheidung getroffen werden, ist eine Berechnung der Verteilung der Risiken und Chancen nicht vorzunehmen.
Grundsätzlich hat die Beurteilung der Risiken und Chancen vorrangig quantitativ zu erfolgen.
Grundsätzlich hat die Beurteilung der Risiken und Chancen vorrangig quantitativ zu erfolgen.
1.1.2.2.4Control approach
Übertragung der Verfügungsmacht Gemäß dem control approach hat ein Unternehmen zu prüfen, ob das übertragende Unternehmen die Kontrolle bzw. die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert verloren hat. Nach IFRS 9.3.2.9 ist hiervon grundsätzlich auszugehen, wenn der Empfänger in der Lage ist, den Vermögenswert zu verkaufen, ohne dass das übertragende Unternehmen dies verhindern kann. Dabei kommt es nach IFRS 9.B3.2.7 nicht nur auf die vertraglichen Rechte oder Pflichten an, sondern auch auf die praktische Fähigkeit zur Ausübung.
Aktiver Markt Der Empfänger hat nach IFRS 9.B3.2.7 dann die praktische Möglichkeit, den finanziellen Vermögenswert zu veräußern, wenn dieser auf einem aktiven Markt gehandelt wird.63 Dies ist bei börsengehandelten Wertpapieren der Fall.
Liegt kein aktiver Markt vor oder sind dem Empfänger Beschränkungen auferlegt, die ihn von einer freien Verfügung über den Vermögenswert abhalten könnten, hat das übertragende Unternehmen gemäß IFRS 9.B3.2.8 die Verfügungsmacht noch nicht verloren, was zur Folge hat, dass er den Vermögenswert nicht ausbuchen darf.
Durch den Verbleib des Vermögenswerts beim übertragenden Unternehmen muss dieses ggf. Wertminderungen auf den Vermögenswert berücksichtigen. Damit wird auf die tatsächlichen Rechte des übertragenden Unternehmens und nicht allein auf die ihm vertraglich eingeräumten Rechte abgestellt.
Neu begründete Rechte und Pflichten Kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Unternehmen die wirtschaftliche Verfügungsmacht verloren hat, ist der finanzielle Vermögenswert auszubuchen. Wenn ein finanzieller Vermögenswert infolge einer Übertragung vollständig ausgebucht wird, die Übertragung jedoch dazu führt, dass das Unternehmen einen neuen finanziellen Vermögenswert erhält bzw. eine neue finanzielle Verbindlichkeit oder eine Verbindlichkeit aus der Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung übernimmt, hat das Unternehmen nach IFRS 9.3.2.11 den neuen finanziellen Vermögenswert, die neue finanzielle Verbindlichkeit oder die Verbindlichkeit aus Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung zum beizulegenden Zeitwert zu erfassen hat.64
Anhaltendes Engagement Lässt sich nicht genau bestimmen, ob das Unternehmen sämtliche Risiken und Chancen aus dem finanziellen Vermögenswert übertragen oder behalten hat (Risikoaufteilung), steht aber fest, dass es weiterhin die wirtschaftliche Verfügungsmacht darüber ausübt, hat es den Vermögenswert gemäß IFRS 9.3.2.6(c)(ii) nach den Regelungen zum sog. anhaltenden Engagement (continuing involvement) zu behandeln.
Testfragen zu 1.1.2.2.4
Gemäß dem control approach hat ein Unternehmen zu prüfen,
ob das übertragende Unternehmen die Kontrolle bzw. die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert erlangt hat.
ob das übernehmende Unternehmen die Kontrolle bzw. die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert verloren hat.
ob das übertragende Unternehmen die Kontrolle bzw. die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert verloren hat.
Wenn ein finanzieller Vermögenswert infolge einer Übertragung vollständig ausgebucht wird, die Übertragung jedoch dazu führt, dass das Unternehmen einen neuen finanziellen Vermögenswert erhält bzw. eine neue finanzielle Verbindlichkeit oder eine Verbindlichkeit aus der Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung übernimmt,
hat das Unternehmen den neuen finanziellen Vermögenswert, die neue finanzielle Verbindlichkeit oder die Verbindlichkeit aus Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung zum Buchwert zu erfassen.
hat das Unternehmen den neuen finanziellen Vermögenswert, die neue finanzielle Verbindlichkeit oder die Verbindlichkeit aus Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung zum beizulegenden Zeitwert zu erfassen.
hat das Unternehmen den neuen finanziellen Vermögenswert, die neue finanzielle Verbindlichkeit oder die Verbindlichkeit aus Verwaltungs- bzw. Abwicklungsverpflichtung zu fortgeführten Anschaffungskosten zu erfassen.
Durch den Verbleib des Vermögenswerts beim übertragenden Unternehmen muss dieses …
ggf. Wertminderungen auf den Vermögenswert berücksichtigen.
ggf. eine Ausbuchung vornehmen.
ggf. eine korrespondierende finanzielle Verbindlichkeit passivieren.
1.1.2.2.5Continuing involvement
Partizipation an Wertänderungen Wenn ein Unternehmen also im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines übertragenen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen weder überträgt noch behält und auch die Verfügungsmacht über den übertragenen Vermögenswert behält, so hat es den übertragenen Vermögenswert gemäß IFRS 9.3.2.16 nach Maßgabe seines anhaltenden Engagements (continuing involvement) zu erfassen. Ein anhaltendes Engagement des Unternehmens an dem übertragenen Vermögenswert ist danach in dem Maße gegeben, in dem es Wertänderungen bei dem übertragenen Vermögenswert ausgesetzt ist.
Hinweis
Der übertragene Vermögenswert darf in dem Umfang nicht ausgebucht werden, in dem er beim Übertragenden – im Extremfall, d.h. im worst case – künftig noch einen bilanziellen Verlust verursachen kann.66
IFRS 9.3.2.16 führt als Beispiele hierfür an:
(a)Wenn das anhaltende Engagement eines Unternehmens der Form nach den übertragenen Vermögenswert garantiert, ist der Umfang dieses anhaltenden Engagements entweder der Betrag des Vermögenswerts oder der Höchstbetrag des vereinnahmten Entgelts, den das Unternehmen evtl. zurückzahlen müsste („der garantierte Betrag“), je nachdem, welcher von beiden der niedrigere ist.
(b)Wenn das anhaltende Engagement des Unternehmens der Form nach eine geschriebene oder eine erworbene Option (oder beides) auf den übertragenen Vermögenswert ist, so ist der Umfang des anhaltenden Engagements des Unternehmens der Betrag des übertragenen Vermögenswerts, den das Unternehmen zurückkaufen kann. Im Fall einer geschriebenen Verkaufsoption auf einen Vermögenswert, der zum beizulegenden Zeitwert bewertet wird, ist der Umfang des anhaltenden Engagements des Unternehmens allerdings auf den beizulegenden Zeitwert des übertragenen Vermögenswerts oder den Ausübungspreis der Option – je nachdem, welcher von beiden der niedrigere ist – begrenzt.
(c)Wenn das anhaltende Engagement des Unternehmens der Form nach eine Option auf den übertragenen Vermögenswert ist, die durch Barausgleich oder vergleichbare Art erfüllt wird, wird der Umfang des anhaltenden Engagements des Unternehmens in der gleichen Weise ermittelt wie bei Optionen, die nicht durch Barausgleich erfüllt werden.
So kann z.B. vereinbart sein, dass beim Überträger ein festgelegtes Ausfallrisiko aus den übertragenen Forderungen verbleibt. Es wird dann nur der Teil der Forderungen als Abgang erfasst, aus dem das Unternehmen keine Zahlungsmittelzu- oder -abflüsse und somit auch keine Risiken und Chancen mehr zu erwarten hat.67
Hinweis
Bei Abgabe einer unbegrenzten Garantie oder einer Verpflichtung zum Rückkauf in bestimmten Fällen scheidet eine Ausbuchung komplett aus (allerdings scheitert dann ohnehin der Nachweis einer Übertragung wesentlicher Risiken und Chancen).68
Korrespondierende Verbindlichkeit Wenn ein Unternehmen einen Vermögenswert weiterhin nach Maßgabe seines anhaltenden Engagements erfasst, hat es nach IFRS 9.3.2.17 auch eine zugehörige bzw. korrespondierende Verbindlichkeit (associated liability) zu erfassen.
Hinweis
Der zurückbehaltene Vermögenswert und die korrespondierende Verbindlichkeit sind bei erstmaliger Erfassung unter Berücksichtigung der verbliebenen Rechte und Verpflichtungen zu bewerten.
Zugangsbewertung Die Zugangsbewertung der korrespondierenden Verbindlichkeit hängt von dem zugrunde gelegten Bewertungsmaßstab des finanziellen Vermögenswerts, für den nur ein Teilabgang zulässig ist, ab. Der Höhe nach bestimmt sich die Bewertung dieser Verbindlichkeit gemäß IFRS 9.3.2.17 in Abhängigkeit des Nettowerts aus dem übertragenen Vermögenswert und korrespondierender Verbindlichkeit. Der Zugangswert der korrespondierenden Verbindlichkeit muss
(a)den fortgeführten Anschaffungskosten der zurückbehaltenen Rechte und Verpflichtungen entsprechen, falls der übertragene Vermögenswert zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wird, oder
(b)gleich dem beizulegenden Zeitwert der von dem Unternehmen zurückbehaltenen Rechte und Verpflichtungen sein, wenn diese eigenständig bewertet würden, falls der übertragene Vermögenswert zum beizulegenden Zeitwert bewertet wird.
An dieser Stelle bleib folgendes festzuhalten: Die im Zusammenhang mit der Übertragung spezifischen (zurückbehaltenen) Aktivposten und (zusätzlich passivierten) Passivposten sind Konsequenz der Anwendung der besonderen Vorgaben zum anhaltenden Engagement. Für den Vermögenswert ist keine neue Klassifizierung zulässig, da der bisherige Vermögenswert nach einem Teilabgang fortgeführt wird. Die Klassifizierung der Verbindlichkeit richtet sich nach bestehenden Bewertungsregeln für den anteilig zurückbehaltenen Vermögenswert. Eine Ausübung der fair-value-Option für die korrespondierende Verbindlichkeit im Zugangszeitpunkt scheidet nach IFRS 9.3.2.21 aus, wenn der übertragene Vermögenswert zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wird. Zudem ist eine bilanzielle Aufrechnung des Vermögenswerts und der zugehörigen Verbindlichkeit nicht zulässig.
Beispiel69
U verkauft ein bislang zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziertes Portfolio homogener Forderungen mit einem Nominalbetrag von 1.000 EUR, welches nach Berücksichtigung einer Risikovorsorge einen Buchwert von 920 EUR aufweist. Als fester Kaufpreis wird ein Betrag von 1.000 EUR vereinbart. Im Gegenzug verpflichtet sich U zur Abgabe einer Garantie für Forderungsausfälle mit einem maximalen Betrag von 100 EUR. Der beizulegende Zeitwert der Garantie wird mit einem Betrag von 80 EUR bestimmt (und entspricht vereinfachend der bisherigen Risikovorsorge).
Lösung
Da nicht im Wesentlichen alle Risiken und Chancen übertragen bzw. zurückbehalten wurden, bilanziert U den Abgang unter Berücksichtigung seines continuing involvement. Es ergeben sich (in einer Nettobetrachtung) die folgenden Buchungssätze:
Konto
Soll
Haben
Kasse
1.000
Forderungen
820
Korrespondierende Verbindlichkeit
100 + 80
Unmittelbar nach der Transaktion verbleibt ein Restbetrag der Forderung von 100 EUR (920 EUR - 820 EUR). Der Wertansatz des finanziellen Vermögenswerts ergibt sich als der niedrigere Betrag aus dem bisherigen Buchwert der verkauften Forderungen und dem maximalen Garantiebetrag (100 EUR). Der Zugangswert der korrespondierenden Verbindlichkeit ergibt sich durch Addition des maximalen Garantiebetrags (100 EUR) und der zum beizulegenden Zeitwert im Zugangszeitpunkt bewerteten Garantie (80 EUR).
Der finanzielle Vermögenswert ist bislang ohne eine Risikovorsorge erfasst. Da der beizulegende Zeitwert der Garantie betragsmäßig der bisherigen Risikovorsorge entspricht, stellt sich bei erstmaliger Erfassung des anhaltenden Engagements zunächst kein Ergebniseffekt ein.
Folgebewertung Bei der Folgebewertung ist der übertragene Vermögenswert weiterhin im Umfang des anhaltenden Engagements zu erfassen. Dieser ist in dem Umfang, in dem von einer Pflicht zur Rückzahlung/Rückerstattung der empfangenen Gegenleistung auszugehen ist, durch eine Abwertung erfolgswirksam anzupassen. Die korrespondierende Verbindlichkeit ist gemäß IFRS 9.B3.2.13(a) unabhängig vom übertragenen Vermögenswert zu bewerten:
In Höhe des Betrags der empfangenen Gegenleistung, für den weiterhin eine Verpflichtung zur Rückzahlung/Rückerstattung besteht, ist die Verbindlichkeit fortzuführen.
Eine im Rahmen der Zugangsbewertung zum beizulegenden Zeitwert passivierte Garantieverbindlichkeit ist nach den Grundsätzen von IFRS 15 über die Laufzeit aufzulösen.
Der Nettobetrag aus dem übertragenen Vermögenswert und der korrespondierenden Verbindlichkeit entspricht – in Abhängigkeit des zugrunde gelegten Wertmaßstabs für den übertragenen Vermögenswert – entweder den fortgeführten Anschaffungskosten oder dem beizulegenden Zeitwert der beim Übertragenden verbliebenen Rechte und Verpflichtungen.
Risikovorsorge Die besonderen Vorgaben zur Wertberichtigung nach IFRS 9.5.5.1ff. bleiben trotz der spezifischen Regeln des anhaltenden Engagements dennoch beachtlich. Für den anteilig zurückbehaltenen finanziellen Vermögenswert ist im Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung nach IFRS 9.B3.2.13(a) daher eine Risikovorsorge (loss allowance) zu bestimmen, die der Höhe nach dem expected credit loss entspricht. Aus Konsistenzgründen ist für die Bestimmung der Höhe nach von der Einschätzung, die (unmittelbar) vor der Vereinbarung der Übertragung bestand, auszugehen.
Beispiel70- Fortsetzung
Bei erstmaliger Erfassung ist für den zurückbehaltenen finanziellen Vermögenswert eine Risikovorsorge zu bilden. Erwartungsgemäß fallen bezogen auf das gesamte Portfolio Zahlungen mit einem Betrag von 80 EUR aus. Diese gehen vorrangig zulasten von U.
Lösung
In der Konsequenz ist eine Wertberichtigung von 80 EUR zu erfassen:
Konto
Soll
Haben
Wertberichtigung
80
Forderungen
80
Die zurückbehaltene Forderung steht danach nur noch mit einem Betrag von 20 EUR in den Büchern des U. Änderungen der Erwartung in den Folgeperioden führen zu einer weiteren Anpassung des noch verbleibenden Buchwerts der übertragenen Forderung.
Für die korrespondierende Verbindlichkeit ist eine Folgebewertung in Abhängigkeit der einzelnen Bestandteile erforderlich. Der maximale Garantiebetrag von 100 EUR ist in unveränderter Höhe fortzuführen und verringert sich nur durch Inanspruchnahme. Fallen tatsächlich weniger als die von U zu tragenden Zahlungen (100 EUR) aus, sind mit Fälligkeit der Forderungen der Restbuchwert von Forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander auszubuchen. Der auf die Garantie entfallende Anteil der Verbindlichkeit (80 EUR) ist über die Laufzeit ergebniserhöhend aufzulösen. Die Erfassung der Risikovorsorge führt zu einer vorweggenommenen Aufwandsverrechnung.
Kaufpreisabschlag Wird im Rahmen der Übertragung eines finanziellen Vermögenswerts, der im Umfang des anhaltenden Engagements weiter bilanziert wird, durch den Übernehmenden ein variabler Kaufpreisabschlag in Höhe eines (anteiligen) Garantiebetrags einbehalten, ist beim übertragenden Unternehmen ein zusätzlicher finanzieller Vermögenswert71 zu erfassen. Die Zugangsbewertung für den zusätzlichen Vermögenswert, der einen Anspruch gegenüber dem übernehmenden Unternehmen begründet und nicht mit dem zur Übertragung vorgesehenen Vermögenswert vermengt werden darf, erfolgt nach den allgemeinen Vorgaben von IFRS 9.5.1.1ff.
Für die Folgebewertung der Forderung auf den Kaufpreisabschlag gilt Folgendes:
Der übertragene Vermögenswert ist unabhängig von dem zusätzlich zu erfassenden finanziellen Vermögenswert fortzuführen. Reduziert sich der Wert des erwarteten Anspruchs aus dem zurückbehaltenen Aktivposten, ist der übertragene Vermögenswert erfolgswirksam anzupassen.
Der zusätzliche finanzielle Vermögenswert ist in korrespondierender Höhe anzupassen. Insoweit der maximale Garantiebetrag durch den Übernehmenden (anteilig) einbehalten wurde, besteht keine Verpflichtung zur Rückzahlung/Rückerstattung. Die erfasste korrespondierende Verbindlichkeit ist daher in entsprechender Höhe anzupassen.
Im Saldo stellt sich somit zunächst der gleiche Ergebniseffekt ein, der ohne Einbehalt eines Kaufpreisabschlags zu erfassen ist.
Testfragen zu 1.1.2.2.5
Wie lässt sich ein sog. anhaltendes Engagement beschreiben?
Ein solches liegt dann vor, wenn ein Unternehmen zwar im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines übertragenen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen überträgt, aber die Verfügungsmacht über den übertragenen Vermögenswert weiterhin innehat.
Ein solches liegt dann vor, wenn ein Unternehmen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines übertragenen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen weder überträgt noch behält und auch die Verfügungsmacht über den übertragenen Vermögenswert behält.
Ein solches liegt dann vor, wenn ein Unternehmen zwar im Wesentlichen alle mit dem Eigentum eines übertragenen Vermögenswerts verbundenen Risiken und Chancen weder überträgt noch behält, aber letztlich die Verfügungsmacht über den übertragenen Vermögenswert überträgt.
Welche Aussage im Zusammenhang mit einem anhaltenden Engagement ist zutreffend?
Ein anhaltendes Engagement des Unternehmens an dem übertragenen Vermögenswert ist in dem Maße gegeben, in dem es ausschließlich Wertminderungen bei dem übertragenen Vermögenswert ausgesetzt ist.
Ein anhaltendes Engagement des Unternehmens an dem übertragenen Vermögenswert ist in dem Maße gegeben, in dem es ausschließlich Werterhöhung bei dem übertragenen Vermögenswert ausgesetzt ist.
Ein anhaltendes Engagement des Unternehmens an dem übertragenen Vermögenswert ist in dem Maße gegeben, in dem es Wertänderungen bei dem übertragenen Vermögenswert ausgesetzt ist.
Welche Aussage im Zusammenhang mit einem anhaltenden Engagement ist zutreffend?
Der übertragene Vermögenswert darf in dem Umfang nicht ausgebucht werden, in dem er beim Übertragenden künftig noch einen bilanziellen Verlust verursachen kann.
Der übertragene Vermögenswert darf in dem Umfang nicht ausgebucht werden, in dem er beim Übertragenden künftig noch einen bilanziellen Gewinn verursachen kann.
Der übertragene Vermögenswert darf in dem Umfang nicht ausgebucht werden, in dem er beim übernehmenden Unternehmen künftig einen bilanziellen Verlust verursachen wird.